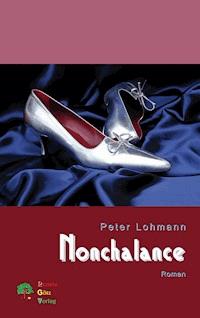Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
In Zeiten der Brüche ist eine fesselnde Vater-Sohn-Geschichte, die das Schicksal zweier Generationen erzählt. Der Vater Friedrich, geboren 1915, wächst in den Wirren der Weimarer Republik auf. Auf der Suche nach Zugehörigkeit und Identität wird Friedrich Anhänger des Nationalsozialismus. Nach der Beendigung des Arbeitsdienstes 1936 wird er im Oktober desselben Jahres als Berufssoldat vereidigt. Aus Briefen und Dokumenten entsteht ein eindrucksvolles Bild des heranwachsenden Friedrich im Nationalsozialismus und während des Zweiten Weltkriegs. Sein Sohn Kurt, geboren 1950, ist als Heranwachsender in den siebziger Jahren des letzten Jahrhunderts von der politischen und kulturellen Rebellion der Jugend geprägt. Er wächst in der noch jungen bundesdeutschen Demokratie auf und rebelliert gegen die Elterngeneration, deren Einstellungen nach wie vor vom Nationalsozialismus beeinflusst sind. Die Konflikte spiegeln sich in Kultur, Musik und politischen Ansichten wider. Diese Erzählung beleuchtet den Konflikt zwischen Vergangenheit und Gegenwart, Generationen und Idealen und lädt die Leser ein, die komplexen Verstrickungen von Krieg, Verlust und persönlicher Freiheit zu erkunden.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 407
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Meinen lieben Freunden Rainer und Ümit gewidmet,die so früh und schmerzhaft aus meinem Leben geschieden sind.
»Die Geschichte ist keine ununterbrochene Bewegung, sie ist eine Ansammlung von Brüchen, die uns daran erinnern, dass unsere Handlungen Konsequenzen haben.«
Peter Weiss, Die Ästhetik des Widerstands
Inhaltsverzeichnis
1930
1965
1930
1965
1932
1965
1933
1966
1934
1966
1934
1967
1935
1968
1936
1968
1936
1969
1937
1969
1937
1969
1970
1938
1970
1939
1970
1970
1940
1971
1971
1940
1971
1940
1972
1940
1972
1940
1973
1974
1940
1975
1976
1940
1976
1940
1976
1940/41
1977
1977
1940/41
1942
1977
1943
1978
1943
1978
1944
1979
1945
1980
1990
ANMERKUNGEN
LITERATURLISTE
AUTORENVITA
DANKE
1930
Es ist nasskalt am Abend des 15. Januar 1930, als Friedrich den Damen- und Herrenfriseursalon Ernst Pakebusch im Kleinen Burstah 12 in Hamburg pünktlich zum Feierabend verlässt. Der Laden liegt in der Innenstadt, nicht weit von Rathaus und Hafen entfernt, wo viele Kontorhäuser stehen. Pakebusch hat gut zu tun, und sein Lehrling ist fleißig.
Es ist dunkel. Schneeflocken fliegen Friedrich ins Gesicht. Er macht sich auf den Weg nach Hause, in den Ausschläger Weg im Stadtteil Hammerbrook. Zu Fuß hat er jetzt gut eine Stunde vor sich. Im Sommer, bei schönerem Wetter, ist er oft an der Großbaustelle gegenüber der Musikhalle vorbeigeschlendert. Dort entsteht das erste Hochhaus in Hamburg, ein Bürohaus mit zwölf Stockwerken, acht Fahrstühlen, Rohrpost, lichtdurchfluteten Großraumbüros für tausend Angestellte. Friedrich könnte stundenlang dabei zusehen, wie der gigantische Neubau entsteht. Im nächsten Jahr soll er eröffnet werden. Einige Hamburger fühlen sich bei dem Gebäude voller Stolz an New York erinnert. Eigentümer des Gebäudes ist der Deutschnationale Handlungsgehilfenverband, eine völkisch-antisemitische Angestelltengewerkschaft mit 30 000 Mitgliedern, die weder Juden noch Frauen aufnimmt.
Oft spaziert Friedrich eine Weile am Nikolaifleet und am Hafen entlang, vorbei am Rathaus, zum Kontorhaus der Reederei Woermann, dem Afrikahaus. Dort am Toreingang treffen die Besucher auf einen afrikanischen Krieger aus Bronze, bekleidet nur mit einem Lendenschurz und bewaffnet mit Speer und Schild. Wenn Friedrich dann durch das Tor in den Innenhof schleicht, sieht er an dessen Ende den Eingang des Kontorhauses mit lebensgroßen Skulpturen. Zwei Elefantenköpfe mit riesigen Stoßzähnen. Er träumt davon, als Abenteurer in fremde Länder zu reisen. Von Hamburg hinaus in die Welt. Einerder Kunden von Pakebusch war damals in Südwestafrika dabei, als Deutschland noch seine Kolonien hatte. Gespannt lauscht Friedrich seinen Erzählungen, während er die Haare vom Boden fegt. Er hört von der Überlegenheit der weißen Rasse, von der Überlegenheit des deutschen Volkes. Dass die Deutschen die Kolonie gegründet und missioniert haben, hatte, so meint der Kunde, auch etwas Gutes für die unterentwickelten Menschen dort.
Die Kneipen und Wirtshäuser, an denen er auf solchen Spaziergängen vorbeikommt, lässt er links liegen. Für Alkohol, Über-die-Stränge-Schlagen und Swing-Musik ist der junge Friedrich nicht zu haben.
An diesem Januarabend jedoch will er so schnell wie möglich nach Hause, auch weil er noch etwas vorhat. Neben ihm hetzen die Menschen durch die Dunkelheit. Er könnte auch zur Haltestelle der 17 laufen, um mit der Straßenbahn zu fahren, aber das sieht der Vater Johann Heinrich nicht gern. Er hat seine Kinder zur Sparsamkeit erzogen. Er selbst dreht jeden Groschen zweimal um, bevor er ihn ausgibt. Nur so sind sie durch die Zeit gekommen. Der Vater hat noch nie die Straßenbahn genommen, wenn er in die Innenstadt musste. Er geht lieber zu Fuß. „Wer den Pfennig nicht ehrt, ist des Talers nicht wert.“
Der Vater ist Schuhmacher und hat ein eigenes Ladenlokal im Ausschläger Weg 115. Auch als Schuster ist er in dieser Wirtschaftskrise bedroht, und das Leben ist ein Überlebenskampf. Ein paar Häuser weiter, in der Nr .85, wohnt die Familie. Die älteren Geschwister, Gerhard und Erika, haben das Elternhaus bereits verlassen. Friedrich wird am 28. Februar 1930 fünfzehn Jahre alt.
Geboren 1915, im Ersten Weltkrieg, 1923 die Inflation. Da war er gerade acht Jahre alt, ging zur Schule und war alt genug, um zu sehen, wie sich die Eltern täglich sorgten, überhaupt noch etwas Essbares auf den Tisch zu bekommen. Wenn Friedrich losgeschickt wurde, um Brot zu kaufen, wusste er am Ende der Schlange, in der er anstand, nicht, ob das Geld in seiner Hand dieses Mal reichen würde oder ob er mit leeren Händen zurückkehren würde.
Friedrich hat die Schule 1929 nach der achten Klasse abgeschlossen, und es war klar, dass er einen Handwerksberuf erlernen würde. Der Vater hatte gehofft, sein Jüngster würde die Schuhmacherei übernehmen, doch Friedrich wollte keine Lehre beim Vater machen. Er wollte doch in die weite Welt hinaus! Friseurlehrling ist er schließlich geworden, weil sich sein Lehrherr, der Pakebusch, und sein Vater sehr gut kannten. Beide sind Kaisertreue, und die Zeiten sind, wie sie sind. Man hilft einander. Welches Glück für Friedrich, so hat er überhaupt eine Lehrstelle gefunden!
Es ist nicht die Zeit für Träumereien, noch immer bestimmt die Weltwirtschaftskrise den Alltag. Viele Mitschüler aus der Volksschule haben keine Lehrstelle bekommen. Friedrichs Bruder Gerd ist Schlosser und war bei Blohm&Voss. Jetzt ist er arbeitslos, wie Millionen andere mit ihm. Im Laufe der Krise stehen sechs Millionen Arbeitslose zwölf Millionen arbeitenden Menschen gegenüber. Die Sozialsysteme brechen zusammen, Not und Elend sind nicht aufzuhalten.
Die politischen Parteien, statt die Probleme gemeinsam zu lösen, bekämpfen einander. Straßenkämpfe werden mit Waffengewalt ausgetragen, hauptsächlich zwischen den Linken und den Rechten, aber auch innerhalb der jeweiligen politischen Lager ist man sich nicht einig. Die Demokratie steht am Abgrund, eine stabile Regierung ist nicht in Sicht. Und eine Partei weiß das Chaos für die eigenen politische Ziele zu nutzen. Die Nationalsozialisten.
1965
Mit viel Geschrei hatten sich Kurt und seine drei Freunde Hoddel, Jan und Olli ihre Plätze in der Sylter Inselbahn erobert, die sie nach Puan Klent, ins Hamburger Schullandheim an der Südspitze der Insel bringen sollte.
„Blumen pflücken während der Fahrt verboten“, rief Kurt ausgelassen aus dem Fenster, das er gleich nach der Abfahrt in Westerland heruntergezogen hatte. Seine Freunde hatten ebenfalls den Kopf rausgestreckt, und ein heftiger Wind, der dunkle, tief hängende Wolken am Himmel entlang trieb, blies ihnen ins Gesicht. Sie kannten sich seit der Grundschule und gingen nun gemeinsam auf die Hansa-Schule, das Jungengymnasium in Bergedorf. Jetzt hatten sie Herbstferien.
Kurt liebte dieses Wetter. Er war fünfzehn Jahre alt und zum ersten Mal an der Nordsee, dem großen Meer, das über die Elbe bis nach Hamburg reichte und das man dort an manchen Tagen riechen konnte.
Die Lohmanns, also Kurt, seine Schwester Svenja und die Eltern Friedrich und Ilse, wohnten in einem Mietshaus direkt an der Holtenklinker Straße, der B5, die von Hamburg nach Berlin führte. Nur noch zwanzig Kilometer bis zum „Eisernen Vorhang“, betonte der Vater immer wieder. Auf beiden Seiten Mietshäuser gleichen Typs in rotem Backstein, die gleich nach dem Krieg gebaut worden waren. Sieben Familien wohnten in einem solchen Haus.
Die Lohmanns hatten in der dritten Etage eine Zweizimmerwohnung mit Küche und einer Toilette. Nachts wurde die Küche mit einem Vorhang unterteilt, hinter dem die Schwester schlief. Das wöchentliche Bad nahm Kurt immer samstags in der Allgemeinen Badeanstalt von Bergedorf. Bis vor zwei Jahren hatte er sich noch mit der Mutter eine Wanne geteilt.
Kurt hatte ein Klappbett im Schlafzimmer der Eltern. Auf dem Gehäusedeckel des Bettes hatte der Vater aus Pappmaschee eine kleine hügelige Landschaft gebaut, mit einer Straße mit Wiking-Autos, einem VW Käfer, einem Lastwagen und einem Bus und links und rechts FALLER-Häuschen. Inzwischen stand diese Landschaft, die Kurt sehr geliebt hatte, verlassen da, und die Autos wurden nicht mehr bewegt. Ebenso erging es der Trix-Eisenbahnanlage, die der Vater mit viel Liebe zum Detail mit einem Bahnhof, Häusern und Straßen auf eine Sperrholzplatte gebastelt und seinem Sohn vor Jahren zu Weihnachten geschenkt hatte. Sie verstaubte unter dem Ehebett der Eltern.
Kurts privater Ort in der kleinen Wohnung war die Toilette, „sein Zimmer“. Hier spielte er Tipp-Kick, richtete Deutsche- und Weltmeisterschaften aus. Kniend, das Spielfeld vor sich, war er Spieler und Rundfunkreporter in einem. Stunden konnte er hier verbringen, bis ihm die Knie schmerzten und die harte und kratzige Auslegware sich als Muster auf seinen Schienbeinen abzeichnete. Hier las er auch die Bücher, die er wöchentlich in der Bücherhalle auslieh und nach Hause schleppte. Der Aufenthalt in seinem „Zimmer“ wurde nur unterbrochen, wenn jemand aus der Familie es zu anderen Zwecken aufsuchen musste. Wenn sein Vater dagewesen war, roch es immer speziell nach kaltem Rauch und Toilette, sodass Kurt das kleine Fenster zur Straße hin öffnen musste. Dann drang der Straßenlärm herein, und im Winter wurde es bitterkalt, denn es gab in der ganzen Wohnung nur einen Ofen in der Küche und einen im Wohnzimmer.
Im Keller war die Waschküche mit Waschzuber und Mangel. Alle vierzehn Tage war Waschtag, dann stand die Mutter mit Plastikschürze und Gummistiefeln im Wasser. Kurt musste nach der Schule bei der Mangel mithelfen. Er hasste diese Tage, auch weil es dann nur „Reste“ zu essen gab. Von der Waschküche aus ging es hinaus auf einen schmalen Hof, der parallel zu den Häusern verlief, ein Streifen von zehn Meter Breite, begrenzt von der kaum noch befahrenen Eisenbahnlinie Bergedorf–Geesthacht. Auf diesem schmalen Hof wurde die Wäsche aufgehängt, wurden die Teppiche über den Teppichstangen ausgeklopft und Schweine geschlachtet. Das Quieken der Schweine kurz vor der Schlachtung ging Kurt tagelang nicht aus den Ohren.
Hinter dem Bahndamm das kleine Flüsschen, die Brookwetter, und dahinter das Marschland. Nicht weit entfernt die Eschenhofsiedlung.
Der Krieg war lange vorbei, die Eltern hatten das Heim gefunden, von dem der Vater Friedrich in seinen Briefen aus dem Krieg geschwärmt und geträumt hatte. Er war im Krieg Sanitätsoffizier gewesen, dadurch hatte er bald eine Stelle als Krankenpfleger im Bethesda-Krankenhaus gefunden, und an den Wochenenden kellnerte er nebenbei. Die Mutter war Hausfrau. Wie viele andere auch waren sie eine Familie, die sich im Wirtschaftswunder Deutschlands nicht viel, aber immer mehr leisten konnte. Es wurde alles besser, sie machten jedes Jahr eine Reise an die Ostsee, nach Gut Brodau und schauten, wie viele Landsleute, optimistisch in die Zukunft.
Der Unfall der Hamburger S-Bahn 1961 mit achtundzwanzig Toten am Berliner Tor, die verheerende Sturmflut in Hamburg 1962, als der Wind an der Balkontür rüttelte, während die Eltern mit Freunden Rommé spielten und die Onkel und Tanten in Billwerder und Finkenwerder vom Elbwasser umschlossen waren, der Grubenunfall in Lengede 1963, all das hatte die Menschen aufgewühlt, ihre Zuversicht aber nicht trüben können.
Als störend, den gesellschaftlichen Frieden und die Harmonie des erfolgreichen Wiederaufbaus Deutschlands hemmend, hatten Kurts Eltern den Eichmann-Prozess in Israel 1961 und den Ausschwitz-Prozess 1963 empfunden. Alte Sachen sollte man nicht mehr aufwärmen, hörte Kurt die Erwachsenen sagen, obwohl er nicht so recht wusste, wovon sie eigentlich sprachen.
Der Mauerbau am 13. August 1961, die Bilder von flüchtenden Menschen, die im Stacheldraht hängenblieben – daran erinnert Kurt sich gut. Zu Weihnachten stellten sie immer Kerzen für die Brüder und Schwestern in der sowjetischen Besatzungszone in die Fenster.
Gleich nach der Ankunft in Puan Klent wurden ihnen die Betten zugewiesen, sie waren alle vier in einem großen Schlafraum mit noch vielen anderen Jungen untergebracht. Jan und Kurt lagen, nur durch einen kleinen Gang getrennt, nebeneinander.
Kurt hatte es geschafft. Er war mit seinen Freunden an der Nordsee. Ohne die Eltern und die Schwester. Dabei hätte er beinahe nicht mitfahren dürfen. Der Vater hatte erklärt, für einen Extraurlaub sei kein Geld da, die Urlaubskasse sei nach den großen Ferien leer. Als Kurt maulte, hatte der Vater streng erwidert: “In deinem Alter hab ich schon gearbeitet, war Friseurlehrling in Hamburg. Da konnten wir uns überhaupt nichts leisten. Zu Fuß bin ich jeden Tag von zu Hause, dem Ausschlägerweg, bis in den kleinen Burstah zur Arbeit und zurück. Das kannst du dir gar nicht vorstellen. So wie ihr verwöhnt seid, auch von Mutter, die alles für dich macht! An die Nordsee mit Freunden, der Herr will sich das gutgehen lassen. Das kommt überhaupt nicht infrage!“
Kurt hatte sich daraufhin gekränkt in seinem „Zimmer“ eingeschlossen. Mehr als eine Stunde lang. Die Mutter hatte wohl ein gutes Wort für ihn eingelegt, am Ende hatte erfahren dürfen, mit dem Hinweis, wenn er irgendwas extra wolle, solle er zukünftig neben der Schule arbeiten gehen und sein eigenes Geld verdienen.
„In dem Alter kann man schon für sich selber sorgen. Das ist eine gute Schule!“, hatte der Vater immer noch erbost gerufen, aber Kurt hatte gar nicht mehr richtig zugehört, so sehr freute er sich auf die Reise.
Egal, jetzt war er hier, und es drängte ihn, mit seinen Freunden die Gegend zu erkunden. Sie machten sich auf und rannten durch die Dünen, die so hoch waren, dass sie den Blick auf die Nordsee verdeckten, aber sie schmeckten die salzige Luft auf den Lippen und hörten das Meer rauschen. Jan war schon einmal in Puan Klent gewesen und übernahm die Führung.
Jan war ein Jahr älter als die anderen Freunde, schon sechzehn. Er lebte mit seiner Mutter und seiner Großmutter auch an der Holtenklinker, in einem älteren Mietshaus, das noch vor dem Krieg gebaut worden war. Kurt holte ihn immer ab, weil das Haus näher am Stadtzentrum lag. Jan hatte keinen Vater mehr, der war einige Jahre nach dem Krieg an einer Kriegsverletzung gestorben. Für Sport hatte Jan überhaupt nichts übrig. Er ging gern ins Kino und liebte es, mit Freunden im Bergedorfer Schlosspark rumzuhängen und die Mädchen zu veralbern.
Hoddel wohnte in der Eschenhofsiedlung. Die Häuschen waren Anfang der dreißiger Jahre als Einzel- oder Reihenhäuser gebaut worden. Mit kleinen Gärten, in denen viele der Bewohner Kartoffeln und Gemüse anbauten. Auf der Wiese zwischen der Brookwetter und der Siedlung bolzten Hoddel und Kurt in jeder freien Minute. Beide hatten so schnell wie möglich beim ASV Bergedorf 85 spielen wollen, der wegen der schwarz-weißen Vereinsfarben die „Elstern“ genannt wurde. Hoddel war als Erster bei den „Elstern“ gelandet. Kurt, ganz neidisch, hatte seine Eltern bearbeitet, ihm auch Trikot, Hose und Stutzen der „Elstern“ sowie Bolzer zu kaufen. Kurz nach Hoddel war er dann ebenfalls zur 8.Mannschaft der Knaben dazugestoßen. Zwar gab es den großen HSV in Hamburg, aber die „Elstern“ waren 1958 auch in die Oberliga Nord aufgestiegen, und Kurt und Hoddel waren mit ihren Vätern im Billtalstadion dabei gewesen, als auf rotem Grand gegen den HSV mit Uwe Seeler, den Brüdern Dörfel und Micky Neissner 1:4 verloren wurde. Was die Liebe zu ihren "Elstern" nicht gemindert hatte.
Olli, der Vierte im Bunde, war der direkte Nachbar in der Holtenklinker, nur ein paar Hauseingänge weiter. Er war dünn und immer blass und hatte abstehende Ohren. Sein Vater war Kellner bei Muelzer&Voelkel in Bergedorf. Seine Mutter war gleich nach seiner Geburt gestorben, und die Schwester der Mutter, hatte Witwer und Sohn übernommen. Olli kannte seine Mutter nur von Fotos, doch er meinte, die Tante sähe ähnlich aus. Er war zurückhaltender als die anderen, ein „stilles Wasser“, wie Kurts Mutter oft Menschen bezeichnete, die es faustdick hinter den Ohren hatten, ohne dass man es ihnen ansah. Olli liebte die Musik, spielte Gitarre und konnte nicht singen. Dem Sport war er nicht zugetan, und dem Turnunterricht blieb er ständig mit Entschuldigungen fern.
Er war der Erste von ihnen, der angefangen hatte zu rauchen, und ebenso wie Jan fand er Mädchen deutlich interessanter als das Gekicke von Kurt und Hoddel.
Erschöpft kehrten sie vom Meer zurück. In den mächtigen Dünen, am endlosen Strand, im Wind und der Gischt, die sie in Nebel einhüllte, hatten sie wie verrückt getobt. Sie hatten die Flugkünste der Möwen verfolgt, sich in den Wind gelegt, ohne umzufallen und Neptun hochleben lassen. Es war ein großes Glück, hier zu sein!
1930
Friedrich geht schnellen Schrittes, um Nässe und Kälte zu vertreiben. Als er endlich in die Süderstraße einbiegt, hat er es nicht mehr weit. Er mag dieses Viertel, so nahe an der Elbe und am Hafen. Es ist sein Zuhause.
Die „Unterstadt“ von Hamm, so nennt sich ihre Gegend im Volksmund, wurde im 19. Jahrhundert auf dem Sand der Boberger Dünen erbaut. Die „Oberstadt“ entstand schon im 18.Jahrhundert, als reiche Kaufleute sich dort auf dem Geestrücken des Elbtals mit ihren Villen ansiedelten. In der „Unterstadt“, wo Friedrich mit seinen Eltern lebt, prägen große, urbane Straßenzüge mit Mietskasernen das Straßenbild. Hier wohnen vor allem Arbeiter. Auch kleine Gewerbetreibende haben sich hier angesiedelt, wie auch Friedrichs Vater mit seiner Schuhmacherei.
Friedrich mag die Arbeit im Friseursalon. Vor allem hört er dort viel. Er lauscht den Gesprächen der Kunden mit seinem Lehrherrn und spürt die Unruhe und Zerrissenheit der Menschen. Die einen wollen den Kaiser zurück, der jetzt im Exil in den Niederlanden lebt, die anderen schimpfen über die Erpressung von Versailles nach dem Ersten Weltkrieg, an dem auch Friedrichs Vater teilgenommen hat. Für Kaiser und Vaterland. Wieder andere pfeifen auf das Parlament und die unfähigen Politiker. Einige votieren für Hitler, dessen Partei immer stärker wird, andere warnen vor dem Anstreicher. Und manche sehen das Übel vor allem bei den Kommunisten und der chaotischen Demokratie, die die Probleme des Landes nicht lösen kann.
In den großen Mietshäusern sind viele Nachbarn für die Sozialdemokraten oder die Kommunisten, aber die Anhänger der Nationalsozialisten werden mehr. Auch in Hamm.
Immer häufiger kommt es in den Versammlungssälen und Straßen zu Schlägereien zwischen Kommunisten oder Sozialdemokraten auf der einen und Nationalsozialisten auf der anderen Seite. Es ist nicht ungefährlich, zu bestimmten Zeiten auf der Straße zu sein.
Friedrichs Vater schimpft auch auf die Demokratie. So ein Chaos habe es unter dem Kaiser nicht gegeben, erklärt er. Zucht, Ordnung, Disziplin, Fleiß, Sparsamkeit und Unterordnung sind die Grundtugenden, die er aus dem Preußischen Kaiserreich mitgenommen und seinen Kindern weitergegeben hat. Friedrichs Bruder Gerhard dagegen ist Gewerkschaftler und sympathisiert mit den Sozialdemokraten.
Friedrich will am Abend zum Treffpunkt der christlichen Pfadfinderschaft Deutschlands, der er seit seinem zwölften Lebensjahr angehört. In seiner Tracht aus grauem Hemd und blauen Halstuch.
Dort trifft er auf gleichaltrige Kameraden, die das gemeinsame Bekenntnis vereint: „… die Liebe zu Heimat und Volkstum pflegen, von allem volksverhetzenden Treiben uns fernhalten und danach trachten, treue tatbereite Bürger unseres Landes (zu) werden“.
Was Friedrich mag, sind die gemeinsamen Unternehmungen. Besonders beeindruckend war der Besuch im Planetarium im Hamburger Stadtpark. Der Winterhuder Wasserturm ist umgebaut und im vergangenen Frühjahr als Planetarium eröffnet worden. Auch die Wanderungen in den Harburger Bergen oder am Elbestrand, die Zeltlager in der freien Natur begeistern Friedrich. Heute wollen sie über ein neues Abenteuer sprechen. Es soll in die Lüneburger Heide gehen.
Dem lustbetonten Leben, den lustbetonten Zeiten, sagen sie in ihren Richtlinien den Kampf an: „Wir wollen mitstreiten im Jugendkampf gegen Schmutz und Schund, gegen Volkslaster und Unzucht und unermüdlich aufklären helfen über die verwüstenden Gefahren von Alkohol und Nikotin, mit dem Ziel, möglichst viele zum bewussten Kampf gegen diese Volksverbrecher zu führen.“
Aber auch die Anerkennung von Führerschaft und Unterordnung ist in ihren Richtlinien zu finden. „Wir wollen in frei gewählter Zucht uns verbinden, unseren Führern gehorchen, treu zueinander halten, und überall denken, dass wir christliche Pfadfinder sind.“
Die Erziehung in seinem Elternhaus und die Richtlinien der Pfadfinder sind für den jungen Friedrich die Leitplanken seines Lebens.
1965
Die erste Nacht im Landschulheim. Es war stockdunkel im Schlafsaal. Kurt konnte nicht einschlafen, er war zu aufgekratzt. Stattdessen lauschte er den Geräuschen im Saal. Seine Augen hatten sich an die Dunkelheit gewöhnt, und er konnte das Bett von Jan sehen. Nur der schmale Gang trennte ihre Betten voneinander.
„Jan“, flüsterte Kurt. „Kannst du auch nicht pennen?"
„Geht so!“
„Kann ich zu dir kommen?“
„Komm schon!“
Lautlos überquerte Kurt den Gang und kroch unter Jans Bettdecke.
„Was ist denn?“, fragte Jan.
„Bei mir passiert mit meinem Schniepel nichts“, flüsterte Kurt, „obwohl ich es immer wieder versucht habe.“
„Das ist ganz einfach, ich zeig es dir! Warte.“
Ohne ein weiteres Wort zu verlieren, fummelte Jan Kurts Pimmel aus der Pyjamahose und begann die Vorhaut hin und her zu rubbeln.
Kurt versuchte, an gar nichts zu denken, er kniff die Augen zu und konzentrierte sich darauf, das Gefühl, vom dem Jan gesprochen hatte, möglichst nicht zu verpassen. Vielleicht spürte er was, merkte es nur nicht, weil er sich nicht genügend konzentrieren konnte.
Sein Vater hatte ihm an einem Sonntagmorgen vor nicht allzu langer Zeit erklärt, wie das ist mit den Männern und Frauen. Natürlich wusste Kurt schon einiges, aber wie es mit seinem Schniepel funktionierte, dazu hatte der Vater nichts gesagt. Kurt hatte auch nichts gefragt, weil das Gespräch unangenehm war, so als würden sie über was Schlechtes reden, über das man eigentlich nicht sprach. Der Vater hatte auch ständig geflüstert, so als sollte niemand etwas von dem Gespräch mitkriegen. Mit erhobenem Zeigefinger und ernster Miene hatte er leise warnend gesagt: „Lass dich nicht mit Männern ein!“
Nun lag er hier mit Jan im Bett. Aber der war ja noch kein Mann.
„Du musst an Frauen mit dicken Titten denken!“ Jan legte sich ins Zeug.
Kurt fiel so schnell keine ein. Doch, Sophia Loren, die hatte er in einer Illustrierten gesehen, die im Wohnzimmer auf dem Rauchtischchen lag.
Die Angst, dass die anderen etwas merken könnten, kam seiner Konzentration schnell in die Quere, zumal Jan wie eine Lokomotive schnaufte. Kurt drehte sich enttäuscht zur Seite.
„Was ist?“, fragte Jan. „Dein Schniepel wird auch gar nicht hart. Da kann ich mich noch so abmühen.“
„Nö, lass!“, raunzte Kurt ihn an. Verdammt, war ihm das peinlich. Wieso spürte er nichts? Was war los mit ihm?
„Ist doch ganz einfach“, flüsterte Jan ihm ins Ohr, und Kurt ahnte den leicht spöttischen Gesichtsausdruck. Verlegen verließ er das Bett auf leisen Sohlen und schlüpfte wieder unter die eigene Bettdecke.
Er war eben anders, das stand schon mal fest, aber wenn er ehrlich war, als Verlust empfand er es nicht. Auch, wenn es ihn wurmte.
Leider vergingen die Tage auf der Insel wie im Fluge. Sie hatten die Südspitze bei Hörnum umwandert, in den Dünen wilde Verfolgungsjagden veranstaltet, waren mit nackten Füßen im Watt gewandert und hatten, mit einem Eifer, als wollten sie dem blanken Hans neues Land abtrotzen, Dämme ins tosende Meer gebaut. Abends hatten sie todmüde im Schlafsaal noch so manche Kissenschlacht veranstaltet, was ihnen Extraschichten in der Küche eingebracht hatte. Doch in Puan Klent vergaß Kurt die verhasste Schule, die Holtenklinker, überhaupt die ganze Welt. Selten hatte er sich so wohl gefühlt. Der letzte Tag. Er hätte, wenn er gekonnt hätte, jetzt auf „Stopp“ gedrückt. Er genoss diese Freiheit ohne die häusliche Enge so sehr.
Allein ging er zum Strand, noch einmal das Meer hören und schmecken. Barfuß über den Sand latschen. Er hatte sich, von den drei Freunden unbemerkt, einfach davongemacht. Plötzlich hörte er hinter sich eine Stimme.
„Na, so allein, ohne den Begleitschutz?“ Während er sich umdrehte, ahnte er schon, wem die Stimme gehörte. Dem Mädchen, das er vom Tanzabend kannte. Irgendwie hatte sie es immer geschafft, beim „Ringelpiez mit Anfassen“, wie Jan die Abende nannte, mit ihm zu tanzen. Er hatte diesen Abend, gleich zu Beginn der Ferien, völlig albern gefunden. Die Heimleiterin, eine ältere Frau mit strengem Gesicht und Dutt, den sie wie seine Oma Marie als Knödel auf dem Kopf zusammengebunden hatte, spielte auf dem Klavier den Radetzky-Marsch. Dabei mussten die Jungs im Außenkreis und die Mädchen im Innenkreis in entgegengesetzte Richtung aneinander vorbeimarschieren, und wenn die Musik abrupt endete, musste man mit der gegenüberstehenden Partnerin tanzen. Jedesmal entstand ein idiotisches Geschiebe in beiden Reihen, und oft genug lief Kurt jemand auf die Hacken, oder ihm wurde in den Rücken gestoßen, sodass er nach vorn stolperte. Scheinbar hatten etliche Jungs es darauf abgesehen, mit nur einer Bestimmten zu tanzen. Und bei den Mädels war es genauso. Ausgerechnet dieses Mädchen hatte dann immer vor ihm gestanden. Wie sie das geschafft hatte, war ihm unerklärlich. Kurt fand Tanzen dämlich. Ja, rumhotten, nach den Beatles oder den Rattles, das ging schon, aber mit einem Mädchen zusammen tanzen, so eng beieinander, dass man ins Straucheln geriet, das hasste er. Eigentlich konnte er mit Mädchen überhaupt noch nicht so viel anfangen. Sie waren meistens albern, was ihn irritierte, und außerdem rochen sie nach Ziege, bildete er sich ein, obwohl er noch nie eine Ziege gerochen hatte. Mädchen verunsicherten ihn einfach.
Jetzt stellte sie sich nahe vor ihn und lächelte. „Na? Wohin des Weges?“
Sie roch überhaupt nicht nach Ziege, sondern duftete anziehend, nach Vanille, Zimt und Honig. Das bezauberte ihn. Machte ihn schwindelig. Was war das? Er atmete hörbar tief durch.
„Is was?“, fragte sie
„Nö, nö nichts!“, sagte er.
„Wohin des Wegs?“
„Ach ich“, stotterte er, „ich bin halt hier!“
„Das sehe ich, aber wohin?“
„Zum Strand, Abschied nehmen!“, sagte er ehrlich und war zugleich darüber erstaunt.
„Das ist gut, da komm ich mit. Wir müssen auch wieder gehen!“ Sie lächelte.
„Wie ich heiße, müsstest du eigentlich wissen. Aber nur zu deiner Erinnerung: Ich bin Miriam!“ Dabei zeigte sie mit dem Finger auf sich. „Und du?“ Nun bohrte sie ihm ihren Zeigefinger in den Bauch. „Du bist der Kurt, das weiß ich mittlerweile.“
Er wusste nichts mit der Situation anzufangen. Die Berührung mit dem Finger und dieser Duft, der ihn betörte, machten ihn unfähig zu reagieren. Er dachte an Flucht und marschierte los, als ginge es darum, den Rekord im olympischen Strandgehen einzustellen. Doch Miriam hielt mit und fragte ihm ein Loch in den Bauch. Woher aus Hamburg er komme, auf welche Schule er gehe, ob er Geschwister habe und so weiter und so fort. Kurt fand zwar, dass sie das nichts anging, aber er war froh, dass er dadurch nicht so sprachlos neben ihr herlaufen musste, und beantwortete ihre Fragen ohne Ausschmückungen, sagte einfach, wie es war.
„Und du?“, fragte er schließlich, nachdem sie eine Zeitlang schweigend neben ihm hergegangen war.
Sie war schon sechzehn und ging in Blankenese aufs Gymnasium. Ihr Vater war Journalist und ihre Mutter Ärztin. „Außerdem, das hast du wohl schon bemerkt, habe ich ein zu kurzes Bein. Kommt von der Kinderlähmung. Ich weiß, dass Jungen immer über mich spotten. Das tut weh!“
Kurt schwieg, auch seine Freunde und er hatten darüber gelästert. Hoddel hatte ihn nach dem Tanzabend gefragt, ob das jetzt seine Freundin sei, und er hatte entrüstet geantwortet: „Mit der?“ Dazu hatte er den Hinkefuß gemacht, und sie hatten alle gelacht. Am Strand zog sie sich ihre Schuhe aus.
Kurt schaute sie erstaunt an. „Das wollte ich auch gerade machen“, log er. „Ich spüre so gern den Sand unter den Füßen.“ Sie lachte und lief zum Wasser. Kurt hinterher. Sie spritzten sich gegenseitig nass und schrien den Möwen Abschiedsgrüße zu.
Dann wanderten sie schweigsam am Meer entlang. Es wurde langsam dunkel. Sie mussten zurück.
Miriam hielt sich, während sie sich den Sand von den Füßen streifte, um ihre Schuhe anzuziehen, an ihm fest. Als sie fertig war, lehnte sie sich an seine Schulter: „Danke!“
Ein ihm unbekanntes, flatterndes Bauchgefühl durchströmte ihn bis in die Lenden. Es war passiert. Das spürte er deutlich, und er hatte Angst, dass sie es bemerken könnte. Aber sie lächelte ihn an, und er war glücklich. Er war doch nicht so anders.
Am Haupthaus trennten sich ihre Wege. Kurt stand unsicher vor ihr und wusste nicht, wie er sich verabschieden sollte. Die Hände hatte er tief in den Hosentaschen vergraben. Miriam hatte die Arme selbstbewusst in die Hüften gestemmt. So standen sie sich schweigend gegenüber.
Er wusste nicht, warum und wieso, aber plötzlich wollte er sie küssen. Doch ungeschickt, wie er war, traf er das Ohr von Miriam.
„Uff, das hat aber geknallt!“ Sie lachte.
„Tschüss!", rief er und lief seinen Freunden in die Arme.
„Na, doch ‘ne Freundin, was?“, fragte Jan.
„Ach Quatsch!“, schimpfte Kurt.
1932
Mit siebzehn Jahren beendet Friedrich im Mai des Jahres 1932 als Geselle seine Lehrzeit. Mit gutem Ergebnis. Darauf ist er stolz. Er ist ehrgeizig und will die Ziele der Innung erfüllen. Die Motti im Lehrbrief des Bundes Deutscher Friseure entsprechen seinen Idealen: „Ohne Fleiß keinen Preis“, und: „Nur Erfahrung bildet.“ Er hat Glück, gleich am 21. Mai kann er als Geselle in Pakebuschens Salon in der Süderstraße in Hamm anfangen. Der Laden befindet sich im Souterrain und ist etwas kleiner als der im Kleinen Burstah. Auch wenn einige Damen aus der Oberstadt Hamms kommen, hat Friedrich vor allem männliche Kundschaft. Allerdings andere als in der merkantilen Innenstadt. „Weniger gediegen“, wie Meister Pakebusch sagt. Wenn Friedrich aus den Fenstern des Ladenlokals schaut, sieht er viele Männerbeine vorbeischlendern. Die Männer haben Zeit, weil sie keine Arbeit haben. Und die Damenbeine, die vorbeispazieren, interessieren Friedrich auch. Er ist siebzehn, und die Damenwelt hat ihre Reize. Er will die Richtige finden und Geld für eine schöne Wohnung sparen. Das Wichtigste aber ist, er hat Arbeit und die auch noch ganz in der Nähe der elterlichen Wohnung. Noch immer hängen die dunklen Wolken der Weltwirtschaftskrise über den Menschen. In der Stadt herrscht Armut. Doch das ist es nicht allein. Die vergangenen Jahre waren ein einziges Chaos. In Pakebuschs Kundschaft werden die Stimmen, die den Parlamentarismus für den Wirrwarr verantwortlich machen, immer lauter. Die handgreiflichen Auseinandersetzungen zwischen der SA und dem Rotfrontkämpferbund werden immer unerträglicher. Jeden Tag sind in der Zeitung, wie Wasserstandsmeldungen, die Berichte über Schlägereien, Tote und Verletzte zu lesen.
Auch bei den Kameraden der Christlichen Pfadfinder ist die politische Spannung zu spüren. Zu sehr bestimmen die Gegensätze in den Überzeugungen das gesellschaftliche und politische Leben. Die Hitlerjugend scheint einigen immer attraktiver. Arbeitslose Männer, die nicht wissen, wohin mit sich und ihrer Energie, schließen sich kriminellen Banden an oder sehen ihre Zukunft in den militanten Organisationen der Parteien. Die Christlichen Pfadfinder sind für die Mehrzahl der jungen Männer keine Alternative mehr. Sie werden belächelt, wenn sie an den Wochenenden mit grauem Hemd und blauem Halstuch öffentlich für ihre Vereinigung werben.
Dann, im Juli, der schockierende Höhepunkt. Auf einem Demonstrationszug der wieder zugelassenen SA durch Altona sterben sechzehn Demonstranten, die gegen den Aufmarsch der Faschisten protestieren, durch Schüsse der Polizei. Die Opfer sind alle Kommunisten, Friedrich und die Freunde aus der Christlichen Pfadfinderschaft fragen sich: Wer wird diesem Chaos endlich ein Ende setzen? Wann werden die Straßen wieder für die Menschen sicher sein?
Friedrich hat einen engeren Freund bei den Pfadfindern. Achim, er wohnt auch noch bei den Eltern und studiert Musik. Sie verstehen sich gut. Doch zunehmend sind sie nicht mehr einer Meinung. Achim hält nicht viel von Hitlers Partei. „Ich mag diese Deutschtümelei nicht! Vor Gott sind alle Menschen gleich! Die Politik Hitlers ist mit unserem christlichen Glauben nicht vereinbar.“ Achim hat zwar auch die Nase voll vom Chaos der letzten Jahre, aber er ist zurückhaltender.
Friedrich dagegen möchte, dass auf den Straßen Disziplin, Vaterlandsliebe und Ordnung herrschen. Er widerspricht Achim, so wie er es bei Pakebusch gehört hat: „Hitler ist der Einzige, der Ordnung schaffen kann. Sonst versinkt Deutschland im Chaos!“
Auch in der Musik sind sie unterschiedlicher Meinung. Achim mag den Jazz. Er tanzt gern Charleston. Dafür hat Friedrich nichts übrig. „Jazz ist Musik von den Hottentotten. Das ist Urwaldmusik“, sagt er verächtlich. „Nicht für unsere Ohren bestimmt!“ Friedrich liebt den Schlager. Außerdem war er mit seiner Schwester Erika in der Schiller-Oper und hat den „Freischütz“ gesehen. Das hat ihm gefallen. Das war was für deutsche Ohren!
Trotzdem, noch ist Achim sein bester Freund aus der Pfadfinderschaft. Außerhalb derer hat Friedrich nicht viele Freunde.
1965
„Ich geh noch in den Kirchenkreis!“, rief Kurt, als er die Wohnung verließ. Er sprang fast alle Stufen der Treppe auf einmal hinunter. Aber er hörte noch die Mutter ins Treppenhaus rufen: „Komm nicht so spät zurück, Vater will dir noch die Haare schneiden!“ Kurt verdrehte die Augen. „Der kann mich mal!“, murmelte er.
Nach den Konfirmationen im Frühjahr hatten sie ihren Club gegründet. Hoddel hatte gemeint, sie sollten den Treff „Beat-Club“ nennen, wie den, den es seit Neuestem im Fernsehen gab. Mit Uschi Nerke, die Jungs fanden sie alle Klasse. Aber „Beat-Club“ war zu lang, und so blieb es einfach bei „Club“. Der Diakon Hans hatte ihnen im Keller des Gemeindehauses einen Raum angeboten, wo sie bleiben konnten. In der Stadt gab es keine Orte für sie, und sie hatten zunehmend Schwierigkeiten gehabt, sich nach der Schule irgendwo zu treffen. Bei „Penndorf “, dem Kaufhaus, gab es zwar eine Cafeteria, aber auch dort hatten sie ständig Ärger gekriegt, weil sie sich den ganzen Nachmittag an einer Cola festhielten. Der Geschäftsführer war regelmäßig ausgeflippt und hatte mit der Polizei gedroht. Seitdem waren sie auf Konfrontation aus gewesen und hatten immer ihre Pommes rot-weiß mit in die Cafeteria gebracht. Es hatte sie schon gefreut, wenn sie den roten Kopf des Typen um die Ecke kommen sahen. Aber irgendwann war Schluss. Sie hatten Hausverbot, und es machte auch auf Dauer keinen Spaß, sich mit dem Spießer anzulegen, auch wenn Jan ihn unheimlich gut nachahmen konnte.
„Jan, mach mal den Spießer!“, riefen sie, und er verschwand kurz und kam dann mit rotem Kopf um die Ecke der Cafeteria! Er brauchte gar nichts mehr zu sagen, sie kannten seinen Text auswendig und brachen schon so in Gelächter aus, so laut, dass tatsächlich der Geschäftsführer um die Ecke kam. „Macht, dass ihr hier rauskommt, sonst hole ich Polizei!“, rief er. “Die Cafeteria ist für die Kunden! Raus!“ Und Jan stand neben ihm und hatte den Text mitgesprochen. Es war einfach nur knorke.
Jetzt trafen sie sich zweimal die Woche im Club. Mittlerweile kamen oft über zehn Jungen und Mädchen zu ihrem Treff. Meistens brachte Olli sein Uher-Tonbandgerät mit, das er sich vom Konfirmationsgeld angeschafft hatte. Olli war der Musikspezialist mit immer den neuesten Scheiben aus England und den USA, die er mit seinem Sennheiser-Mikrofon vom Radio aufgenommen hatte. Um auf der Höhe der Zeit zu sein, musste man die englischen Sender oder Radio Luxemburg hören, im langweiligen deutschen Radio wurde kein einziges englisches Lied gespielt. Irgendwann war „Sie liebt dich“ von den Beatles auf Deutsch im Radio zu hören.
Jan, Olli und Hoddel saßen auf einem ausgedienten Sofa, während Inge, Krischi und Trixi sich in einen alten Sessel quetschten. „Get Off OF My Cloud“ drang aus den Boxen, die Olli an sein Gerät angeschlossen hatte.
„Hi, hier sieht man ja nichts vor lauter Qualm!“, rief Kurt, als er den Raum betrat.
„Willst du auch ‘ne Fluppe?“, fragte Jan und reichte ihm eine Schachtel Overstolz rüber.
„Deine neue Marke?“
„Nee, ich bleib bei Rothändle, aber die hatten sie bei mir am Kiosk nicht.“
„Am besten sind Gauloises!“, sagte Olli und lachte.
„Danach kotzt du Teer!“
Kurt nahm sich eine Zigarette und schaute in die Runde. Die Mädchen im Sessel winkten ihm zu, tuschelten und lachten. Es verunsicherte ihn immer noch, wenn Mädchen rumalberten und sich über die Jungen lustig machten.
Trixi mit ihren blonden Haaren sah super aus. Sie hatte ein kurzes Pepita-Kleid an und dazu weiße Stiefel. Hoddel hatte es auf sie abgesehen. Trixi war die Tochter der ersten Drogerie am Platz. Obwohl sie das Wort Drogerie nicht mochte. Sie nannte das Geschäft eine Parfümerie. Kurt steckte sich die Overstolz an und blies den Rauch aus.
Die einzige Abmachung mit Hans war, dass im Club kein Alkohol getrunken werden durfte, aber Jan hatte trotzdem eine kleine Flasche Jägermeister dabei.
„Das ist Medizin, wenn einem Mal schlecht ist.“ Er stieß Kurt an: „Dir ist nicht gut. Oder?“
„Kann man wohl sagen! Kann ich gut gebrauchen!“
„Is was passiert?“, fragte Olli.
„Nö, nur meine Eltern nerven! Wegen der Haare!“ Kurt nahm einen kleinen Schluck. „Ich geh nicht mehr zu meinem Alten auf den Stuhl! Lass mir jetzt auch die Haare wachsen, egal, was mein Vater sagt!“ Dabei schaute er bewundernd Hoddel an, der bereits den Pilzkopf in Vollendung trug.
„Das ist mal ’ne Ansage!“, murmelte Jan und versuchte, Rauchkringel in die Luft zu pusten, aber sie verliefen sich im Nebel des Raumes.
Kurt fand den Haarschnitt, den der Vater ihm immer verabreichte, entsetzlich. Jan hatte ihn mal gefragt, wann er denn das Modell „Hitlerjunge“ ablegen wolle. „So haben bei den Nazis die Jungs ausgesehen! Blonde Haare, alles Fasson bis zur Platte und dann der gescheitelte ordentliche Haarschnitt obendrauf. Genau wie bei dir!“
Seitdem war Kurt noch fester entschlossen, dem Friseurtermin mit seinem Vater aus dem Weg zu gehen. Sein geheimer Wunsch war: Er wollte so aussehen, wie John von den Beatles. Hoddel hatte sich schon für Paul entschieden, und dem sah er auch ein wenig ähnlich. Sehr zu Kurts Leidwesen. Einmal hatte er dem Vater gesagt, er wolle seine Haare wachsen lassen, aber der war natürlich überhaupt nicht einverstanden. Er behauptete sogar, Männer könnten gar keine langen Haare bekommen, das wären alles Perücken. Vor allem sei es unmännlich, mit so langen Haaren rumzulaufen. „Die machen nur Weichlinge aus euch!“, hatte er ausgerufen. Wer „die“ waren, hatte Kurt nicht fragen mögen, und er hätte auch keine Erklärung bekommen. „Diese Hottentottenmusik!“ Inwieweit sich sein Vater mit der Musik der Hottentotten auskannte, blieb Kurt ebenso im Verborgenen. Auch hier fragte er nicht nach. Alles, was aus England oder den USA kam, war dem Vater suspekt, Die Musik, Coca-Cola, die Kurt nicht trinken durfte und sogar Donald Duck war bei Lohmanns nicht gerne gesehen.. Mit einer Ausnahme. Wenn Kurt krank im Bett lag, spendierte die Mutter einen Disney Comic, auch wenn der Vater das überhaupt nicht guthieß.
Trotzdem saß Kurt mit seinem Grundig-Tonbandgerät und Mikro vor der Musiktruhe im Wohnzimmer, immer sonntags, während der Mittagsruhe, die sich Vater und Mutter regelmäßig gönnten, und nahm vom englischen Soldatensender BFBS die Hitparade auf.
Was die Haare betraf, hatte der Vater die Wünsche seines Sohnes ignoriert, und Kurt musste weiterhin auf den Küchenstuhl. Die Haare wurden mit Vaters Friseurbesteck bearbeitet, das noch aus der Zeit vor dem Krieg stammte und seitdem keinen Scherenschleifer mehr gesehen hatte.
Kurt war nicht nur die Frisur peinlich, die alten Maschinen rissen die Haare auch mehr aus, als dass sie schnitten, und die kleinen Härchen, die den Rücken runterrieselten, juckten den ganzen Tag fürchterlich.
„Übrigens, nächste Woche läuft der neue Bond an! ‚Feuerball‘. Muss wieder echt dufte sein!“, sagte Jan und steckte sich noch eine Zigarette an.
„Echt?!“ Kurt dachte daran, das Mädchen von Puan Klent zu fragen, ob sie Lust hätte, mitzukommen. Dann verwarf er die Idee wieder. Ich Feigling hab sie ja noch nicht mal angerufen. Er fühlte nach dem Zettel mit der Telefonnummer in seiner Hosentasche.
Als er am Abend nach Hause kam, schaute der Vater ihn vorwurfsvoll an. „Wo kommst du denn jetzt her? Ich habe auf dich gewartet! Deine Haare müssen geschnitten werden!“, sagte er ärgerlich.
„War im Kirchenkreis!“, antwortete Kurt.
„Du stinkst nach Rauch, aber nicht nach Weihrauch!“, sagte der Vater streng. „Rauchst du etwa?“
„Nein, aber die anderen, ich kann mir das nicht leisten. Ich bin doch Fußballer!“, antwortete Kurt knapp.
„Das will ich dir auch geraten haben!“, gab der Vater zurück.
„Wieso? Du rauchst doch selbst!“, hielt Kurt dagegen.
„Nun werde nicht frech!“
„Wieso, stimmt doch.“
„Der Ton macht die Musik, mein Jung!“, sagte der Vater.
„Nun Schluss mit euch beiden!“, rief die Mutter.
„Aber morgen Abend will ich dich hier sehen!“, rief der Vater ihm noch hinterher, doch Kurt war bereits in seinem „Zimmer“ verschwunden, wo es nach kaltem Rauch stank. Was will der eigentlich von mir? dachte er. Soll mich doch in Ruhe lassen.
1933
Am 28. Februar wird Friedrich achtzehn Jahre alt. Der Geburtstag wird von den politischen Ereignissen in Deutschland überschattet.
Am 30. Januar 1933 wird Adolf Hitler von Reichspräsident Hindenburg als Reichskanzler eingesetzt. Die im Parlament vertretenen Parteien waren nicht in der Lage, eine Regierung zu bilden. Am 27./28. Februar, in Friedrichs Geburtstagsnacht, brennt der Reichstag. Ist das der Beginn des kommunistischen Aufstands, wie ihn die Nationalsozialisten prophezeit haben?
Friedrich feiert den Geburtstag mit seinen Eltern. Eingeladen hat er auch Achim, den Kameraden von den Pfadfindern, mit dem er auch die Begeisterung für den Boxsport teilt. Sie sind Anhänger von Max Schmeling. Dessen Kampf um den Weltmeistertitel gegen Jack Sharkey am 12. Juni 1930 haben sie im Hörfunk verfolgt. Der Maxe ist Weltmeister geworden, weil sein Gegner einen unerlaubten Tiefschlag angesetzt hatte. Seitdem ist der Maxe ihr Idol und der Boxkampf ihr Sport. 1931 verteidigt Max Schmeling seinen Titel in den USA, aber 1932 verliert er ihn im Rückkampf gegen Sharkey. Die beiden Freunde bleiben trotzdem ihm und dem Boxsport treu und hoffen auf neue Siege.
Mutter Frieda hat Friedrichs Leibgericht „Snuten und Poten“ gekocht, und Achim singt als Geburtstagsgeschenk das schöne Lied „Snuten un Poten, das ist ein fein Gericht“. Danach singen sie alle „Hoch soll er leben, hoch soll er leben, dreimal hoch!“. Friedrich ist es immer ein wenig peinlich, wenn er so im Mittelpunkt steht.
„Die Kommunisten haben den Reichstag angezündet!“, sagt er, um von sich abzulenken.
„Der Reichspräsident hat deshalb heute eine Notverordnung zum Schutz von Volk und Staat erlassen!“, erwidert der Vater. „Der ist noch von den unsrigen, gut, dass er da ist!“
„Noch ist nicht bewiesen, wer das getan hat“, sagt Achim leise.
„Da gibt es keinen Zweifel!“, fährt Friedrich dazwischen. „Wer soll es denn sonst gewesen sein? Das Gesindel ahnt, dass seine Tage gezählt sind. Hitler wird mit den Feinden des deutschen Volkes kurzen Prozess machen!“
Achim senkt den Blick in sein Bierglas. „Wir Christen sollten da nicht gleich ‚Hurra‘ schreien“, sagt er und schaut in die Runde. „Ich weiß nicht – wir wissen doch noch gar nicht, was da alles hintersteckt.“
„Es wird Zeit, dass der Zirkus hier aufhört. Nur mit Disziplin und Wehrhaftigkeit, mit Ruhe und Ordnung kann Deutschland wieder zur alten Größe kommen!“ Der Vater hebt das Glas „Auf Deutschland!“
„Hitler ist unser Mann!“, ruft Friedrich und erhebt ebenfalls das Glas.
Achim zögert. „Auf den Maxe!“, sagt er schließlich.
Mutter Frieda schaut bedrückt in die Runde. Sie mag nicht, wenn am Tisch von Politik gesprochen wird. Es ist der Geburtstag ihres Jüngsten. Sie war froh, von den bäuerlichen Verwandten aus Elsdorf das Fleisch für das Essen bekommen zu haben.
„Nun lass mal gut sein, Friedrich, iss noch ein bisschen, so schnell kriegst du das schöne Essen nicht wieder“, sagt sie besorgt.
In den Tagen danach werden Kommunisten und Sozialdemokraten verfolgt und eingesperrt. Die NSDAP besetzt mit Massenaufmärschen die Straße. Hitler verspricht Ordnung, Erneuerung und die Lösung der wirtschaftlichen Probleme. Friedrich hofft, dass nun endlich klare Verhältnisse geschaffen werden.
Die März-Wahlen gewinnt die NSDAP. Die möglichen Konkurrenten sind längst ausgeschaltet. Am 23. März erlässt Hitler das Ermächtigungsgesetz, das die Demokratie in Deutschland beendet. Viele Menschen, so auch Friedrich, sind damit einverstanden.
„Das war ja nicht mehr zum Aushalten!“, sagen viele Kunden am nächsten Tag in Pakebuschs Salon. „Wo gehobelt wird, fallen Späne!“, sagt einer, und alle im Laden nicken dazu.
Die Mahner, Schriftsteller, Schauspieler, Regisseure, Komponisten, Maler, Journalisten und viele Demokraten verlassen ungehört das Land. Die das nicht können, werden aus den Betten heraus verhaftet. Am 10. Mai werden auf dem Berliner Opernplatz Bücher in einer großen Demonstration mit dem Motto „Aktion wider den undeutschen Geist“ öffentlich verbrannt. Am 15. Mai geschieht das Gleiche in Hamburg, am Kaiser-Friedrich-Ufer. In einem schauerlichen Schauspiel werden die Bücher deutscher Autoren mit dem Ruf „Gegen Frechheit und Anmaßung, für Achtung und Ehrfurcht vor dem deutschen Volksgeist! Verschlinge, Flamme, auch die Schriften der Tucholsky und Ossietzky“ ins Feuer geworfen.
Friedrich schaut ehrfurchtsvoll in die Flammen. Er war mit Achim verabredet, aber der ist nicht gekommen. Friedrich ist vom Spektakel, von der Kraft, die von dieser Inszenierung ausgeht, begeistert. Für ihn hat es etwas Mystisches, wenn die Bücher ins Feuer fallen und die Funken zum Himmel aufstieben. Er kennt die Werke dieser Schriftsteller nicht.
Das die Meinungsfreiheit, ein Grundrecht der Demokratie, eingeschränkt bzw. eingestampft ist, ist für Friedrich nicht wichtig. Das Verbot der Kommunistischen Partei und der Sozialdemokratie – an all dem nimmt Friedrich keinen Anstoß. Er kennt die Demokratie nur als Chaos und Unordnung. Dagegen sind die Ideale der Nationalsozialisten den seinen sehr nahe. Disziplin, Pflichterfüllung und Unterordnung, Fleiß, Zucht und Treue, wie bei den Pfadfindern.
Die von Hitler versprochene Volksgemeinschaft erscheint Friedrich als eine lebenswerte Idee.
Im November 1933 wird Friedrich als Achtzehnjähriger in der Christlichen Pfadfinderschaft zum „Späher“ ernannt, aber da haben sich längst viele seiner Kameraden der Hitlerjugend anschlossen. Ein Jahr später werden die verbliebenen Mitglieder unter achtzehn Jahren aufgrund einer Vereinbarung zwischen der evangelischen Kirche und der Hitlerjugend aus der Pfadfinderschaft entlassen. Für Friedrich gibt es keinen Grund mehr, bei den Pfadfindern zu bleiben, obwohl die „Bruderschaft der Älteren“, ab achtzehn Jahren, vorerst bestehen bleibt. und Achim ihr weiterhin angehört.
1966
Dann kamen sie auf die Bühne. Zuerst Paul, dann John und George und am Schluss Ringo. Alle in dunklen Anzügen und den Hemden mit großem Kragen, die Kurt so mochte. Sie winkten mit ihren Gitarren ins Publikum. Hinter ihnen verkündete die Musikzeitung „Bravo“ auf einem riesigen Transparent in großen Lettern die „Beatles-Bravo-Blitztournee“. Eine Tournee der beliebten Beat-Band aus Liverpool in nur drei deutschen Städten. München, Köln und Hamburg, der Stadt in der die Fab Four ihre Karriere begonnen hatten.
Die Begeisterung war gigantisch und ohrenbetäubend. Alle in der Halle waren aufgesprungen. Seit Wochen hatten Kurt und seine Freunde diesem Sonntag, dem 26. Juni, entgegengefiebert.
Vergessen waren die Kämpfe mit seinem Vater um die Haarlänge. Am Ende hatte Kurt sich, unterstützt von seiner Schwester, durchgesetzt. Einfach Tatsachen schaffen, hatte sie empfohlen und war mit ihm zum Friseur gegangen. „Einmal Bürste“, hatte sie dort gesagt. Eine „amerikanische Bürste“, wie der Vater sofort erkannt hatte. „Du siehst ja aus wie ein amerikanischer GI!“, hatte er verärgert ausgerufen und noch ein „fürchterlich“ hinterhergeschickt. Die Bürste war zwar nicht das, was Kurt eigentlich wollte, aber ein Anfang war gemacht. Seitdem blieb der Stuhl in der Küche leer, und seine Haare wuchsen.
Nun standen „The Beatles“ vor ihnen auf der Bühne. Schrille, spitze Ausrufe überall im Saal. Mädchen streckten den vieren auf der Bühne die Arme entgegen, als wollten sie ihre Idole mit Händen greifen. Die Gesichter verzerrt, wie von Schmerzen geschüttelt. Einige waren aufgesprungen, andere hüpfen auf den Stühlen, setzen sich wieder, um dann das wilde Ritual zu wiederholen. Vergebens versuchten Ordner immer wieder, sie auf die Stühle zu bugsieren. Gleich hinter Kurt fielen zwei Mädchen in Ohnmacht, und sofort waren Sanitäter zur Stelle. Miriam stupste Kurt an und strahlte.
„Ich kann es nicht fassen!“, schrie sie aus Leibeskräften in sein Ohr. „Die Beatles!“
Kurt sah sie freudenstrahlend an. Auch er war außer sich. Da vorn auf der Bühne standen sie tatsächlich, seine Idole! Und neben ihm seine Miriam. Wie hatte er gezaudert, sie anzurufen. Immer wieder hatte er seinen verborgenen Schatz aus der Hosentasche gefingert, den Zettel mit ihrer Telefonnummer. Miriam hatte ihm den in Puan Klent noch in die Hand gedrückt, ihm dann schnell einen Kuss gegeben, war zurück zu ihren Freundinnen gelaufen, hatte sich noch einmal umgedreht und gerufen: „Melde dich!“
Es hatte lange gedauert, bis er mit zittrigen Händen in einer Telefonzelle den Hörer in der Hand hielt und zu Gott betete, sie möge nicht da sein. Doch sie hatte sich am anderen Ende der Leitung gemeldet, und Jan hatte draußen gestanden und die Tür zugehalten. Kurt hatte nicht fliehen können.
Und jetzt stand sie neben ihm.
Erneut schwoll der Lärmpegel unvorstellbar an, Kurt verstand von Paul, der ins Mikrofon sprach, kaum ein Wort. Die vier stöpselten ihre Gitarren ein und legten los: „Just let me hear some of that rock a roll music …“
Wieder hielt es niemanden auf den Sitzen. Kurt, Miriam und alle im Saal tanzten, kreischten oder sangen mit: „If you wanna dance with me“. Sie kannten die Songs auswendig. Kurt nahm Miriam in den Arm und gab ihr überglücklich einen Kuss.
„Unvorstellbar. Dufte!“, rief Hoddel zu ihnen rüber.
Mit Hoddel hatte alles begonnen, er hatte Kurt auf dem Schulweg plötzlich gefragt: „Kennst du ‚Twist and Shout‘ von ‚The Beatles‘?“
„Nö!“, hatte Kurt damals geantwortet, und seitdem war er Beatles-Fan.
„Zwick mich mal!“, rief er Miriam zu, die ihn lachend in den Hintern kniff.
„I´m in love with her and feel fine“, sang er beim nächsten Song mit, und Miriam zog ihn an sich und küsste ihn.
Kurt liebte diese Musik, sie verkörperte sein Lebensgefühl, die Freiheit, anders, freier zu sein als die Alten. Für seinen Vater waren sie Gammler und hörten Hottentottenmusik, und auch wenn der Vater das nicht sagte, hörten sie doch auf der Straße immer wieder von alten Leuten Bemerkungen wie: „Euch hätte man unter Hitler ins KZ gesteckt!“ Und allmählich begannen sie sich zu fragen, was ihre Eltern denn unter den Nazis gemacht hatten.
Nun ging es Schlag auf Schlag. In den ersten Reihen warfen Mädchen Bonbons und Blumen auf die Bühne. Sechstausend Beatles-Fans waren völlig aus dem Häuschen.
Viel zu bald nach „Paperback Writer“ kündigte Paul das letzte Lied an. „How can you laugh when you know I´m down?“ Nun gab es kein Halten mehr. Sie tanzten auf den Stühlen, die bedenklich wackelten. Regelrecht trunken waren sie. Sie waren die neue Zeit. Sie waren die Zukunft eines freien Lebens.