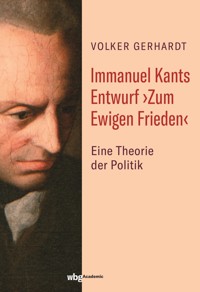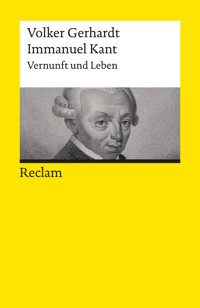27,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: C. H. Beck
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Seit es den Begriff "Demokratie" und die mit ihm verbundenen Erwartungen gibt, ist er umstritten. In einer historisch-philosophischen Tour d’horizon rekonstruiert Volker Gerhardt die zentralen Stationen dieser Diskussion von den Denkern der Antike bis in unsere globalisierte Gegenwart. Zugleich zeigt der renommierte Philosoph, warum die Demokratie unter allen Regierungsformen die Einzige ist, die schon ihrer Idee nach ausnahmslos alle Menschen – die ganze Menschheit – einschließt. Von der ersten Demokratie in Athen bis zu den Vereinten Nationen zieht sich ein weiter Bogen durch die Weltgeschichte. In ihm verbindet sich der Anspruch des Menschen an sich selbst mit seinen Erwartungen an die Politik. Schon Sokrates ging davon aus, dass es eine dem Menschen angemessene Ordnung erst geben kann, wenn freie Menschen über freie Menschen herrschen. Platon benennt die Tugenden und Pflichten im Staat und bietet wie Aristoteles einen Fundus von Einsichten, die bis heute nachwirken. Mit der Humanität, die für alle Menschen gilt (und für die jeder Mensch immer auch in seinem eigenen Handeln zuständig ist), entsteht eine neue und in letzter Konsequenz weltumspannende Dimension des Politischen. Doch Gerhardt nimmt in seinem Durchgang durch die Geschichte der Philosophie auch die Widersacher der Demokratie in den Blick und fragt am Ende nach den Chancen einer demokratisch organisierten Weltgemeinschaft, ohne die eine Bewältigung der immer akuteren Zukunftsfragen kaum möglich sein wird.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Volker Gerhardt
INDIVIDUUM UND MENSCHHEIT
Eine Philosophie der Demokratie
C.H.Beck
Zum Buch
Seit es den Begriff «Demokratie» und die mit ihm verbundenen Erwartungen gibt, ist er umstritten. In einer historisch-philosophischen Tour d’horizon rekonstruiert Volker Gerhardt die zentralen Stationen dieser Diskussion von den Denkern der Antike bis in unsere globalisierte Gegenwart. Zugleich zeigt der renommierte Philosoph, warum die Demokratie unter allen Regierungsformen die einzige ist, die schon ihrer Idee nach ausnahmslos alle Menschen – die ganze Menschheit – einschließt.
Von der ersten Demokratie in Athen bis zu den Vereinten Nationen zieht sich ein weiter Bogen durch die Weltgeschichte. In ihm verbindet sich der Anspruch des Menschen an sich selbst mit seinen Erwartungen an die Politik. Schon Sokrates ging davon aus, dass es eine dem Menschen angemessene Ordnung erst geben kann, wenn freie Menschen über freie Menschen herrschen. Platon benennt die Tugenden und Pflichten im Staat und bietet wie Aristoteles einen Fundus von Einsichten, die bis heute nachwirken. Mit der Humanität, die für alle Menschen gilt (und für die jeder Mensch immer auch in seinem eigenen Handeln zuständig ist), entsteht eine neue und in letzter Konsequenz weltumspannende Dimension des Politischen. Doch Gerhardt nimmt in seinem Durchgang durch die Geschichte der Philosophie auch die Widersacher der Demokratie in den Blick und fragt am Ende nach den Chancen einer demokratisch organisierten Weltgemeinschaft, ohne die eine Bewältigung der immer akuteren Zukunftsfragen kaum möglich sein wird.
Über den Autor
Volker Gerhardt ist einer der wichtigsten Philosophen der Gegenwart. Er lehrte bis 2012 als Professor für Philosophie an der Humboldt-Universität Berlin, wo er auch weiterhin als Seniorprofessor tätig ist. 2022 wurde er mit dem Karl-Jaspers-Preis ausgezeichnet. Er hat zahlreiche Werke vorgelegt, darunter zuletzt bei C.H.Beck Der Sinn des Sinns. Versuch über das Göttliche (42017, C.H.Beck Paperback 2022).
Inhalt
Vorwort
EINLEITUNG: Menschheit als Selbstbegriff
I: Anfänge von Menschheit und Demokratie
1. Das Parallelogramm von Mensch und Politik
2. Menschheit als Verständigungsgemeinschaft
3. Der Anteil der ersten Philosophen
4. Der geschichtliche Vorlauf der Demokratie
5. Die weltpolitische Innovation in Athen
II: Die philosophische Grundlegung der Politik
6. Das Beispiel des Sokrates
7. Platons Idee von einer politisch verfassten Menschheit
8. Partizipation bei Aristoteles
9. Ciceros ideelle Rettung der Republik
III: Der lange Weg in die Moderne
10. Der humane Impuls des Evangeliums
11. Humanismus als politisches Programm
12. Der epochale Schritt zum Menschenrecht
13. Weltoffenheit und Öffentlichkeit
14. Konstitution und Föderation
IV: Kants republikanische Wende zur Demokratie
15. Eine politische Theorie der Menschheit
16. Menschheit als reales und ideales Fundament
17. Frieden als globales Erfordernis
18. Republikanismus auf der Schwelle zur Demokratie
19. Natur und Politik
20. Moral und Politik im Medium der Öffentlichkeit
V: Ein Jahrhundert sucht nach neuen Wegen
21. Friedensidyll im Jahrhundert der Kriege
22. Individualität und Repräsentation
23. Friedenserwartung mit sozialer Verstärkung
24. Die Institutionalisierung der sozialen Frage
25. Der Anschlag auf die Einheit der Menschheit
VI: Demokratie: Politische Chance für die Menschheit
26. Völkerbund und UNO als weltpolitische Innovation
27. Föderation als Prinzip internationaler Ordnung
28. Öffentlichkeit als Lebenssphäre der Demokratie
29. Repräsentation als Raum des Politischen
30. Der innere Zusammenhang von Freiheit und Gleichheit
31. Recht als tragendes Element der Demokratie
32. Opposition als zivilisierende Kraft
33. Moral und Wahrheit als Bedingungen
34. Das dünne Eis des Friedens
35. Homo politicus: Der Anwalt seines Daseins
BESCHLUSS: Vom möglichen Ende der Menschheit
Anmerkungen
Einleitung: Menschheit als Selbstbegriff
I. Anfänge von Menschheit und Demokratie
II. Die philosophische Grundlegung der Politik
III. Der lange Weg in die Moderne
IV. Kants republikanische Wende zur Demokratie
V. Ein Jahrhundert sucht nach neuen Wegen
VI. Demokratie: Politische Chance für die Menschheit
Beschluss: Vom möglichen Ende der Menschheit
Literatur
Quellen
Lektüren
Personenregister
«Die Armut in einer Demokratie ist dem in Diktaturen angeblich zu genießenden Glück um so viel vorzuziehen wie Freiheit der Sklaverei.»
Demokrit
«Regieren besteht aus der Herrschaft über Freiwillige.»
Sokrates
«Politik ist die wahre Tragödie.»
Platon
«Kein Gesetz ist vor Gott und den Menschen lobenswerter als die Ordnung, die eine wahre, einige und heilige Republik begründet, in der man frei beratschlagt, klug diskutiert und das Beschlossene getreulich ausführt.»
Machiavelli
«Es ist so weit gekommen, dass die Rechtsverletzung an einem Platz der Erde an allen anderen gefühlt wird.»
Immanuel Kant
«Die letzte Aufgabe unseres Daseins: dem Begriff der Menschheit in unserer Person […] einen so großen Inhalt als möglich zu verschaffen.»
Wilhelm von Humboldt
«I believe in democracy because it releases the energies of every human being.»
Woodrow Wilson, 1912
«Democracy will win.»
Thomas Mann, 1942
Vorwort
Lange bevor es die erste Demokratie gegeben hat, gab es ihre Definition als politische Ordnung, in der die Freiheit eines jeden mit seiner Gleichheit vor dem Gesetz verbunden ist. Der Einzelne wurde als Individuum anerkannt und galt zugleich als Ursprung eines gemeinschaftlichen Ganzen, das letztlich alle Menschen umfasst und seine Einheit durch nichts Geringeres als das Recht gewinnt.
Diese Definition, die der erste griechische Historiker auf das Jahr 522 datiert, brauchte hundert Jahre, bis man sich an ihr als Modell versuchte, und noch weitere 70 Jahre, bis es in Athen einen Staat gab, der sich diesen Namen zu verdienen suchte. Er hatte, wenn man großzügig rechnet, nur 130 Jahre Bestand, ehe er verlacht und vergessen wurde. Es dauerte mehr als 2000 Jahre, bis man sich ernsthaft wieder an ihn erinnerte, und weitere 200 Jahre, bis es die als Republik gegründeten Vereinigten Staaten von Amerika wagten, sich diesen alten Namen zu eigen zu machen. Tatsächlich enthält er noch heute die treffendste und umfassendste Definition, die man einem menschlichen Gemeinwesen geben kann.
Doch die Demokratie blieb umstritten und gefährdet, und es scheint, als stehe sie auch im Augenblick vor einer weiteren großen, vielleicht sogar vor ihrer ultimativen Bewährungsprobe. Das, so denke ich, ist ein hinreichender Grund, dem Begriff eine philosophische Betrachtung zu widmen, die, ohne den Anspruch, vollständig zu sein, zu zeigen versucht, wie dieses politisch durch nichts überbotene politische Modell der Demokratie mit dem Selbstverständnis des Menschen verbunden ist.
Die vorliegende Betrachtung setzt Überlegungen fort, die in einer 2019 erschienenen Studie über die Humanität entwickelt wurden. Sie bezieht nun auch das Verhältnis der Politik zur Menschheit ein. Während in der Humanität gezeigt werden sollte, wie sich das Selbstverständnis des Menschen wesentlich mit Blick auf die Leistungen beschreiben lässt, die er in der Welt von sich aus erbringt, geht es hier um den Anspruch, den die Menschen an die Politik stellen, sobald sie sich selbst ernst nehmen.
Dieser Anspruch wird nicht erst in der Moderne erhoben. Er kommt historisch bereits mit der Entstehung der Philosophie auf und führt im selben epochalen Zusammenhang zu ersten politischen Konsequenzen. Die Entstehung der Philosophie und die initiale Begründung der Demokratie erfolgen im selben kulturellen Großraum und fallen in dieselbe Zeit. Zwar bleibt diese räumliche und zeitliche Koinzidenz zunächst auf den griechischen Kulturkreis begrenzt, in dem die Demokratie für eine kurze Zeit Bestand hat. Doch unter anderen Namen und mit erweiterten Zielen blieb sie lebendig.
Daran hat die Philosophie einen nicht geringen Anteil. Sie gibt wegweisende Impulse, zunächst durch das eigenständige Denken, dann durch ihr Beharren auf Erziehung, Wissen und Kritik. Dann kommen Ansprüche durch den religiösen Glauben hinzu, sofern er seine Hoffnung auf eine personal verstandene Beziehung des Menschen zu seinem Gott gründet. Die Philosophie sieht sich darin wiederum in ihren Argumenten für die Humanität sowie für die naturrechtliche Gleichheit aller Menschen bestärkt, die sie schließlich mit ihren Gründen für das Menschenrecht verdichtet. Daher lässt sich mit guten Gründen sagen, dass Philosophie und Demokratie historisch und systematisch miteinander verbunden sind. Unter dem Einfluss des Humanismus und der Aufklärung wird daraus eine innere Bindung des individuellen Selbstbegriffs an die Ansprüche und Verfahren der Demokratie. Denn die Demokratie ist die einzige Staatsform, die sich auf das ursprüngliche Recht des Menschen gründet, frei und gleichberechtigt zu sein. Sie vertraut auf das Menschenrecht, das durch ihre Verfassung und ihre Gerichtsbarkeit auch mit legitimer Gewalt gesichert werden kann.
Das soll auf den folgenden Seiten anschaulich werden: Mir ist bewusst, dass ein umfassender historischer Beleg meiner These, verbunden mit einer Darlegung ihrer systematischen Voraussetzungen und Folgen, ein mehrbändiges Werk unter Beteiligung einer Vielzahl von Fachleuten erforderte. Er verlangte Kenntnisse der über Europa hinausreichenden Kulturgeschichte, benötigte Belege aus Anthropologie, Soziologie, Psychologie und Jurisprudenz und bedürfte einer kohärenten systematischen Rechtfertigung. Doch der Versuch, Vertreter derart verschiedener Disziplinen in einem als heikel geltenden Forschungsvorhaben zu verbinden, erwies sich als zu aufwändig.
Also begnüge ich mich jetzt mit einem programmatischen Entwurf, der historische und systematische Einsichten verbindet. Er enthält hoffentlich mehr als bloß die Illustration meiner persönlichen Überzeugung, dass die Philosophie bereits in ihrem individuellen Anspruch auf Allgemeinheit ursprünglich demokratisch ist. Dazu gehört, dass die Politik letztlich sowohl auf rationale Begründung wie auch auf moralische Einsichten gegründet werden muss. Allein die Berufung auf Traditionen oder der Hinweis auf überkommene Machtverhältnisse reichen nicht aus.
Dass diese Publikation möglich ist, verdanke ich dem Cheflektor im Verlag C.H.Beck, Dr. Detlef Felken. Er hat mich seit über zwanzig Jahren kundig beraten und meine in systematischer Absicht verfassten Bücher umsichtig und kenntnisreich betreut. Seine Ermutigung, es nicht bei dem Eindruck zu belassen, dass der Mensch als homo quaerens, als animal sociale sive rationale, als homo sapiens et faber, als homo ludens und homo publicus schon hinreichend beschrieben sei, hat den entscheidenden Impuls gegeben. Denn noch fehlte der homo politicus, der nicht nur von sich sagen kann, dass er ein rationales und zugleich soziales und moralisches Wesen ist. Der politische Mensch hat vielmehr den Anspruch, gleichberechtigt und in seinen individuellen Fähigkeiten so anerkannt zu sein, dass er die reale Chance hat, selbstbestimmt am gesellschaftlichen Ganzen mitzuwirken. Das ist ein zentraler, aber längst nicht alle Fragen einer Demokratietheorie abdeckender Aspekt des vorliegenden Buches.
Auch dafür, dass Detlef Felken es in dieser Einseitigkeit akzeptiert hat, habe ich ihm zu danken. Ihm ist dieses Buch gewidmet.
Volker Gerhardt
Berlin und Hamburg, im September 2022
EINLEITUNG
Menschheit als Selbstbegriff
Die kulturelle Entwicklung beschleunigt sich, je mehr der Mensch seine Naturbeherrschung über die Sphäre seines Körpers hinaus erweitert. Das geschieht zum einen dadurch, dass er mit Hilfe seiner Werkzeuge seinen Wirkungsraum ständig vergrößert und dabei erheblich verändert; zum anderen durch die Nutzung von Naturprozessen, die er seinem Willen unterwirft. So ist er in der Nutzung des Feuers und bei der Optimierung seiner Waffen, bei der Jagd, dem Ackerbau und der Viehzucht verfahren. Im Zeitraum weniger Jahrtausende lernte er, Techniken für den Hausbau, für die Anlage fester Siedlungen und aufwändiger Grabstätten, für den Bau von Dämmen, Brunnen, Bewässerungsanlagen und Schiffen einzusetzen und das Rad zu nutzen.
Die Liste der Entdeckungen und Erfindungen, die menschliche Kulturen möglich gemacht haben, ist lang – auch dort, wo noch keine Schrift zur Verfügung stand. Mit deren Erfindung und Gebrauch aber erweiterten sich die Handels- und die Herrschaftsräume. Recht und Verwaltung wurden effektiviert, das Geschehen am Tages- und Nachthimmel konnte von verschiedenen Standpunkten aus verzeichnet und an zentralem Ort gesammelt, verglichen und bestimmt werden. Auf diese Weise entstand die Astronomie, mit der ihr zugrundeliegenden Mathematik eine der ersten Wissenschaften überhaupt. Auf längere Sicht verlieh die Schrift sowohl dem gesprochenen Wort wie auch der Erinnerung und der Erkenntnis Dauer und wurde zum unerlässlichen Träger des Wissens und der Wissenschaften.
Nach einer produktiven Inkubationszeit unter der Herrschaft orientalischer Könige gelangte die Wissenschaft auch zu den streitbaren Griechen, wo ihr unter Bedingungen politischer und individueller Konkurrenz eine größere Vielfalt, breitere Aufmerksamkeit und gesteigerte praktische Bedeutung zukam. So kam es zu einer ersten Berührung der Wissenschaft mit widerstreitenden politischen Ansprüchen. Auch wenn wir über keine näheren historischen Aufschlüsse verfügen, so kann man doch annehmen, dass es einen Zusammenhang zwischen der Diversifizierung der Wissenschaften und dem Aufkommen pluraler Ansprüche und erster demokratischer Vorstellungen gibt. Die auf gleiche Rechte für alle Bürger dringenden Isonomie-Bemühungen von Solon und Kleisthenes sind die Vorboten dessen, was seit dem Beginn des 5. Jahrhunderts als Vorbereitung auf die Demokratie in Athen zulief.
Die neue Staatsform scheiterte zwar in ihrem Ursprungsland, überdauerte aber in Rom unter dem Titel der Republik. Als Republik gelang es Rom, zu einer Weltmacht zu werden, ehe der Ehrgeiz einzelner Römer daraus wieder eine Königsherrschaft unter dem Namen eines «Imperiums» machte. Die Cäsaren auf dem Thron konnten zwar Weltmacht-Phantasien beflügeln; ihre Herrschaft aber endete in Spaltung und Zersplitterung; das einzig Hoffnungsvolle daran war, dass sie den guten Ruf der Republik nicht zerstören konnten.
So bietet sich 1500 Jahre später, nach fortgesetzten Glaubenskrisen und bei erkennbarer Überforderung der europäischen Monarchien, erneut die Republik als Alternative an. Mit ihr kommt auch – in der Zeit eines ungleich machtvolleren Auftritts der Wissenschaften – die Demokratie wieder als Regierungsform in Betracht. Mehr noch: Die Demokratie wird als die einzige Staatsform erkannt, die dem inzwischen als universell geltenden Menschenrecht, dem bei der Vielzahl der Religionen lebensnotwendig gewordenen Toleranzprinzip und der in ihrer kulturellen Notwendigkeit erkannten Selbstbestimmung der Individuen gerecht werden kann.
Welche kulturellen Energien hier wirksam waren, wird augenblicklich klar, wenn wir erkennen, in welchen Leistungen sie sich entluden: Es sind die wissenschaftlichen Erkenntnisse und die Fortschritte der Technik, die sich in der Welterkundung, in der Entfesselung künstlerischer Potenzen und in der alle Grenzen überschreitenden Entfaltung der ökonomischen Leistungen manifestierten. Die Eroberung und Besiedlung Nordamerikas, der sich binnen dreier Jahrhunderte vollziehende Aufstieg der neuenglischen Kolonien zur politischen Selbstständigkeit, aber auch die Revolution in Frankreich wären ohne den fortgesetzt in sie investierten wissenschaftlichen und technischen Fortschritt nicht möglich gewesen. Auch das von der aufgeklärten Literatur geschaffene kulturelle Klima sollte nicht unterschätzt werden.
Hinter dem 1776 in Amerika und 1789 in Frankreich obsiegenden Modell der Demokratie stand das ganze Pathos der Aufklärung, das weder in den politischen Wirren der nachrevolutionären Kriege noch in der sich nach mehr Gefühl und Glauben sehnenden Romantik verloren ging. Obgleich die Staaten, so als hätte sich an der prärevolutionären Feudalherrschaft nichts geändert, nur auf Sicherung und Mehrung ihrer Macht bedacht waren, setzten Wissenschaft, Technik, Industrie und Kunst mit ihren je eigenen Mitteln den Prozess der Aufklärung fort. Sie ermutigten die Menschen, sich der neuen Erkenntnisse unter Einsatz ihres eigenen Verstandes zu bedienen. Und wo immer sie Erfolge und höhere Erträge versprachen, wurden sie von der staatlichen Politik gefördert.
Den elementaren Bedürfnissen der Menschen wurde weniger Aufmerksamkeit geschenkt. Die sozialen Ansprüche der Menschen, die in ihren Lebensverhältnissen den größten Belastungen unterworfen waren, wurden von den Staaten kaum beachtet. Hier entfalteten jedoch die gewachsenen Rechte der bürgerlichen Gesellschaft ihr politisches Potential. Sie boten historisch neue Freiheiten der Erkenntnis, der Organisation und der Opposition, die aus dem politischen Leben der Gegenwart nicht mehr wegzudenken sind.
Im 19. Jahrhundert wurden Wissenschaft und Technik als Triebkräfte der gesellschaftlichen Organisation bewusst wahrgenommen und zielgerichtet eingesetzt. Als Beispiel seien nur die «Weltausstellungen» genannt, wie sie von 1851 an in so gut wie allen europäischen und amerikanischen Metropolen ausgerichtet wurden. Nach der offiziellen Ausstellungsliste fanden bis zum Ersten Weltkrieg mehr als dreißig solcher Leistungsschauen statt. Sie machen offenkundig, dass es eine die Politik konstituierende aktuelle Weltöffentlichkeit gibt.
Dass sie jedoch nicht nur allgemein zu einer alle Menschen gleichermaßen verbindenden Politik verpflichten, sondern mit existenzieller Dramatik eine Demokratisierung der Weltbevölkerung verlangen, wird mit dem Beginn des 21. Jahrhunderts offenkundig: Die Digitalisierung der Weltöffentlichkeit hat zu einer alles Private und Persönliche gefährdenden Aufdringlichkeit geführt, die längst die Arbeitsfähigkeit der wirtschaftlichen, politischen und rechtlichen Institutionen bedroht. Sie zeigt mit alarmierender Dringlichkeit, dass wir eine Weltordnung brauchen, die nicht nur einzelne Staaten, sondern die Menschheit – und in ihr jeden einzelnen Menschen – vor der permanenten Übergriffigkeit von ihresgleichen schützt.
Demgegenüber hat es beinahe etwas Biedermeierlich-Beschauliches, auf die anderen Fortschritte zu verweisen, die den Prozess der Politisierung der Weltgesellschaft vorantreiben. Gleichwohl seien sie benannt: Die Naturwissenschaften, die noch bis zum Ende des 18. Jahrhunderts im Rahmen der Philosophischen Fakultäten eine eher randständige Aufmerksamkeit gefunden hatten, wurden nach Kräften gefördert. Neue Fächer wie Chemie und Biologie erlangten den Status separater Wissenschaften. Die Medizin entdeckte Krankheiten, die ihre Ursache in deplorablen Lebensbedingungen hatten, und wurde zu einer Triebkraft der Veränderung städtischer Infrastruktur und allgemeiner Versorgung. Im Kampf gegen die Pocken- und Cholera-Epidemien errang sie weltweite Erfolge; nach der Entdeckung der mikrobiologischen Ursachen der Seuchen und mit der Möglichkeit ihrer Eindämmung trug sie wesentlich zum Bestand der Menschheit bei.
Die Ökonomie wurde zum Hoffnungsträger, auf den sich überzeugte Demokraten wie John Stuart Mill und Henry Charles Carey stützen konnten. Auch die rasch wachsende Gewerkschaftsbewegung, alsbald unter Beteiligung der Sozialisten, konnte das gewachsene wirtschaftswissenschaftliche Wissen nutzen. Nur Karl Marx, wiewohl vorrangig an der neuen Wissenschaft interessiert, merkte nicht, dass er deren politische Chance verspielte, indem er nur auf die Ökonomie setzte und alles, was darüber hinausging, sich selbst überließ. Die Folge war eine Geringschätzung von Recht, Staat und Politik – vom Menschenrecht und von der Humanität, für die Marx in seinen Jugendschriften so bewegend Partei ergriffen hatte, ganz zu schweigen. Damit fehlte auch dem programmatisch vorrangigen «Internationalismus» der kommunistischen Bewegung die sozio-kulturelle Einheit, derer es bedurft hätte, um allgemein politisches Vertrauen zu finden.
Bereits im 19. Jahrhundert konnte allenthalben mit der Präsenz einer Weltgesellschaft gerechnet werden, deren Mitglieder in einem zunehmenden Informationsaustausch stehen. Was über Jahrhunderte in der literarischen Überlieferung durch Historiker, Philosophen, Künstler und Kleriker als kulturelle Einheit im Bewusstsein gehalten wurde und dann wesentlich durch den Buchdruck verdichtet werden konnte, wird durch den rapiden Ausbau der Telegrafie (wenig später auch durch die Entwicklung des Telefons und heute durch das World Wide Web) zur permanenten Präsenz eines Publikums, dem alle Menschen angehören.
Das sind lediglich Indizien dafür, dass der Terminus, der über Jahrtausende hinweg nur ein Gattungsbegriff für alle Menschen war, in kurzer Zeit zur Bezeichnung der präsenten Gesamtheit aller Menschen wurde, die im Bewusstsein der Zeitgenossen und der Politik zu einem Gegenstand aktueller Sorgen und konkreter Bemühungen werden konnte. Mehr noch: Der in seiner Abstraktheit lange Zeit schwer zu fassende Begriff der Menschheit wandelte sich mit dem historischen Ertrag der kulturellen, politischen und technischen Aktivität der Menschheit zur Bezeichnung eines weltumspannenden Gesamtsubjekts, zu dessen Aufgaben die eigene Erhaltung und Entwicklung gehört. Mit der Vernunftaufklärung des 18. Jahrhunderts, mit der im Namen der Menschheit betriebenen kritischen Wissenschaft und einer Politik, die sich zum Ziel setzt, dem Menschenrecht weltweit Geltung zu verschaffen, rückt die Menschheit ins Zentrum einer Weltpolitik, die unter dem Anspruch steht, schon im aktualen Vollzug Weltgeschichte zu sein.
Aber es geht nicht nur um die Menschheit als ganze: Die technischen Medien tragen erheblich zur Individualisierung in konkreten Situationen bei, indem sie durch Fotografie, später auch durch den Film und die dadurch mögliche aktuelle Berichterstattung die Anteilnahme des Publikums erhöhen. Inzwischen werden die kommunikativen Techniken durch die Digitalisierung perfektioniert, sind aber zugleich schier unbegrenzt manipulierbar, so dass auch hier Chance und Risiko so nahe beieinander liegen, dass aus ihrer Kontrolle in kürzester Zeit eine vorrangige Aufgabe für die Menschheit geworden ist.
Mit der politischen Profilierung des Begriffs der Menschheit tritt auch die existenzielle Bedeutung des Individuums hervor. Und es ist zu zeigen, dass beide Termini im Begriff der Demokratie von Anfang an miteinander verbunden sind.
Es ist historisch nicht exakt zu bestimmen, wann die bei den meisten Menschen mehr oder weniger stark ausgeprägte Verantwortung für ihresgleichen: für ihre Nächsten, für ihre Familie, für ihre Gefährten in Jagd und Kampf, für ihr Handlungsterrain oder für ihre eigene Kommunität bewusst geworden ist. Die Menschen der Frühzeit haben sich, so darf man annehmen, für das Leben der Mitglieder ihres Stamms, ihres Volkes oder ihrer Kultgemeinschaft eingesetzt. Besitz- und Befehlshierarchien lassen hier eine beachtliche Vielfalt zu.
Aber wann hat sich die Verantwortung für die «Menschheit» geregt? Darüber gibt es nur Mutmaßungen. Vielleicht waren die Religionsstifter und ihre Nachfolger die Ersten, die hier die gegebenen Grenzen eines Stammes, eines Volkes oder einer Kultur überschritten und für alle Menschen gesprochen haben? Hier könnte man im Reden und Wirken der ersten Zeugen der «Achsenzeit» fündig werden, zu denen auch jene Weisen gehören, die als Reformer, wie Solon und Kleisthenes, oder die als erste Philosophen, wie Xenophanes, Heraklit und Anaxagoras, zu den Wegbereitern der Demokratie gerechnet werden können. In der europäischen Tradition ist überdies an christliche Impulse zu denken, die von einem inspirierten Gründer ausgegangen sind, der als «Sohn» Gottes zugleich im Namen aller «Menschen» gesprochen hat.[1]
Ein Problem, das in den beiden Jahren, in denen dieses Buch geschrieben wurde, buchstäblich alle Menschen akut betraf und weiter betrifft, ist die Covid-19-Pandemie. Obgleich es in den ersten Monaten nach Auftritt der Seuche sogar Staatsmänner gab, die weltweite Maßnahmen zur Bekämpfung der Infektion gar nicht für nötig hielten, kann es heute keinem vernünftigen Zweifel mehr unterliegen, dass eine erdumspannende Gefahr gegeben ist.
Auch hier können wir es wörtlich nehmen, dass alle Menschen bedroht sind, alle fachkundig behandelt und mit Impfstoff versorgt werden müssen. Und es kann im Ernst auch nicht in Zweifel stehen, dass jeder Einzelne die Pflicht hat, seinen Beitrag zum Schutz aller zu leisten, erst recht, wenn die in seiner eigenen Freiheit gegründete Pflicht darin besteht, zugleich mit seiner eigenen Gesundheit die Gesundheit anderer zu bewahren. Dazu gehört, wenn es nicht schon die Nächstenliebe oder der gesunde Menschenverstand zur Selbstverständlichkeit machen, ein Nachdenken über den inneren Zusammenhang des Selbstbegriffs der Person, ihrer Zugehörigkeit zur Menschheit und der von allen geforderten Würde des Menschen. Die drei Begriffe: persona, humanitas und dignitas, in deren Zeichen Cicero fünfzig Jahre vor der Zeitenwende die res publica zu retten versuchte, waren es, die fast zweitausend Jahre später Immanuel Kant davon überzeugten, dass eine auf diese Begriffe gegründete Republik den Titel einer Demokratie verdient.
Das soll im IV. Kapitel über Immanuel Kants politisches Denken gezeigt werden. Was danach im V. Kapitel folgt, kann nicht mehr als eine Vergegenwärtigung in Stichworten sein. Sie soll anzeigen, wie die Menschheit vornehmlich durch Hochrüstung und in unablässigen Kriegen ihre Selbstgefährdung vorangetrieben hat. Zugleich hat sie durch Industrialisierung und Kommerzialisierung nahezu der gesamten Erdbevölkerung etwas geschaffen, das man «Zivilisierung» nennen möchte, wobei angesichts der damit zugleich geschaffenen Risiken der Begriff mit einem Fragezeichen versehen werden muss. Denn inzwischen ist offenkundig, dass die Naturbedingungen auf der Erde dem menschlichen Handeln Grenzen setzen, die deutlich machen, dass es unter keinen Umständen wie bisher weitergehen kann. Die Technik hat nicht nur in der Erfindung und Entwicklung von Waffensystemen ihre zerstörerische Potenz offenbart. Auch in ihren pharmazeutischen, medizinischen und kommunikationstechnischen Errungenschaften zeigt sie eine Ambivalenz, die gleichermaßen für den Bestand der Menschheit hoffen und fürchten lässt.
Sicher ist, dass die natürlichen Ressourcen, mit deren Erschließung und Verarbeitung die Menschheit ihr Wachstum und ihren Wohlstand erwirtschaftet hat, in Kürze erschöpft sein werden. Die Rückstände der aufwändigen Lebensweise sind für viele andere Lebewesen tödlich, und sie bedrohen zunehmend auch die Existenz großer Teile der Menschheit. Wissenschaft, Technik und Politik stehen vor den größten Herausforderungen ihrer Geschichte, angesichts dieser Gefahr Lösungen zu finden, die nicht nur einen kleinen Teil der Menschen, sondern die Menschheit als ganze zu retten haben.
Vielleicht ist es in dieser Lage eine Hilfe, sich nicht nur klarmachen zu können, welche historischen Voraussetzungen die Rede von der Menschheit hat, sondern dass sich mit ihr von Anfang auch das politische Mittel anbietet, sachlich, ethisch und politisch mit ihr umzugehen. Tatsächlich ist die Demokratie die einzige angemessene Form politischer Organisation der Menschheit.
Vor aller spekulativen Erweiterung der Problemstellung rekonstruiere ich die Phasen der philosophischen und politischen Geschichte, in denen die Voraussetzung dafür geschaffen wurde, mit den Krisen der Menschheit aktiv und hoffnungsvoll umzugehen. Das gilt bereits für das I. Kapitel mit seinen Beobachtungen zur philosophischen Annäherung an die Fragen von Menschheit und Politik.
Im II. Kapitel suche ich daran zu erinnern, was die Philosophen der Antike, namentlich Sokrates, Platon, Aristoteles und Cicero zur Vertiefung der Beziehung zwischen Menschheit und Demokratie beigetragen haben. Im III. Kapitel wird, zunächst mit Blick auf zwei Stationen demokratietheoretisch bislang wenig beachteter Anregungen im frühen Christentum und im neuzeitlichen Humanismus, dann aber auch unter Würdigung des Kampfes für das Menschenrecht und für unzensierte Öffentlichkeit sowie in Würdigung des Universalismus und Internationalismus der Aufklärung zu zeigen sein, wie sich der Begriff der Menschheit mit neuen geschichtlichen Inhalten füllt.
Schließlich werde ich im IV. Kapitel einen Blick auf Immanuel Kant werfen, dem wir ein wesentlich vertieftes Verständnis des Begriffs der Menschheit verdanken und der zugleich die Grundlagen dafür geschaffen hat, der Menschheit weltweit eine republikanische Verfassung zu geben. Kant hat sich gegen Ende seines Schaffens auch von einem rousseauistischen Vorurteil gegenüber der Demokratie befreit und bereits in seiner Friedensschrift ein Bekenntnis zur Demokratie hinterlassen. Dabei werden Menschheit und Demokratie systematisch verknüpft, und was uns Kant heute besonders nahebringt, ist das ausdrücklich gemachte Bewusstsein davon, dass die Menschheit nicht nur einen (vergleichsweise späten) naturgeschichtlichen Anfang, sondern auch ein (irgendwann mit Gewissheit eintretendes) naturgeschichtliches Ende hat.
Im V. Kapitel folgt ein selektiver Blick auf die Entwicklung im «langen Jahrhundert» von der Französischen Revolution bis zu den beiden Weltkriegen, der deutlich machen soll, wie gut die Chancen für eine sich weltweit ausdehnende Verbindung von Demokratie und Menschheit stehen müssten – wenn nur die Menschen in der Lage wären, ihrer besseren Einsicht zu folgen. Daran schließen sich im VI. Kapitel systematische Schlussfolgerungen zum inzwischen gewonnenen Verständnis der Demokratie und ihrer möglichen Zukunft an. Darauf ist dann auch der allen zu weit reichenden weltpolitischen Erwartungen Einhalt gebietende Beschluss bezogen.
I
Anfänge von Menschheit und Demokratie
1. Das Parallelogramm von Mensch und Politik. So viele Nachteile die Demokratie auch immer haben mag: Sie gilt vielen Menschen, die Erfahrungen mit ihr machen konnten, als die beste Option. Zwar ist sie die Regierungsform, deren Unzulänglichkeiten die Kritik ihrer Bürger unablässig auf sich zieht; aber dadurch, dass sie diese Kritik zulässt und sich schon damit für Innovationen offenhält, ist sie anderen Systemen überlegen, insbesondere solchen, die das Recht nicht achten und damit der Willkür des herrschenden Personals überlassen sind.
Die Demokratie setzt auf die gleiche Freiheit der Individuen, bietet Raum für öffentliche Debatten und kann so dem Gemeinwesen größere Chancen eröffnen. Das macht sie in vielem aufwändig und manchmal auch unbequem; aber im Vergleich mit Diktaturen und Einparteienstaaten bietet sie Rechtssicherheit und größere Meinungsvielfalt. Also eröffnet sie der Mehrheit mehr Entfaltungsraum mit einem höheren Anteil individueller Zufriedenheit – zumindest so lange sie ein auskömmliches, möglichst berechenbares und Zukunftschancen bietendes Leben verspricht.
Solange diese Voraussetzungen gegeben sind, gehört der Demokratie die Zukunft. Und solange sie Erfolg hat, wird sie auch die besten Chancen haben, die Menschen überall auf der Welt für sich zu gewinnen. So könnte die Demokratie bereits in absehbarer Zeit die Verfassung sein, unter der die Mehrheit der Weltbevölkerung lebt und auch in Zukunft leben möchte.
Aber was ist, wenn die Rahmenbedingungen sich ändern? Wenn Naturkatastrophen, wirtschaftliche Krisen, Kriege, Terrorakte, Kriminalität oder Seuchen unerwartete Probleme schaffen, können die politischen Vorzüge der Demokratie rasch an Attraktivität verlieren. Dann schlägt die Stunde der Demagogen und Populisten und mit ihnen sind Rechtssicherheit und Freiheit dahin. Die historischen Beispiele sind zahlreich; die jüngsten Fälle sehen wir gegenwärtig in Hongkong und im Verhältnis zu Taiwan, in Russland, Venezuela, Brasilien, Myanmar oder Haiti. Und in Washington wurde uns vier Jahre lang das aus Dummheit, Bosheit, Nationalegoismus, hartnäckigen Lügen und Anstiftung zu putschistischer Gewalt verfertigte Trauerspiel der Selbstdemontage einer großen Demokratie geboten.
Die erste Demokratie hat es vor zweieinhalbtausend Jahren in Athen gegeben: Doch nach großen militärischen Erfolgen, einer staunenswerten Aufbauleistung und einer glanzvollen ersten Blüte war sie binnen weniger Jahrzehnte nur noch ein Schatten ihrer selbst und ging zugrunde. Unter dem äußeren und inneren Druck demagogisch geschürter Gegensätze scheiterte die attische Demokratie an den Aufgaben, geordnete Machtwechsel zu garantieren, dem Recht Geltung zu verschaffen und dem größeren Teil der Bevölkerung einen durch eigene Tätigkeit erworbenen Lebensunterhalt in Aussicht zu stellen.
Das Scheitern noch vor dem Ende des vierten vorchristlichen Jahrhunderts wirkte so ernüchternd, dass nicht nur in der nachfolgenden Antike, sondern auch im Mittelalter und der frühen Neuzeit die Demokratie als Regierungsform nicht mehr ernsthaft in Erwägung gezogen wurde. Über mehr als zweitausend Jahre blieb sie das Exempel für eine sich selbst den Untergang bereitende Verfassung.
Soll es nach dem hoffnungsvollen Neubeginn in Philadelphia vor nahezu 250 Jahren nicht erneut so weit kommen, gilt es, erneut über die Demokratie, ihre Vorzüge und ihre Schwächen nachzudenken. Das soll in der nachfolgenden philosophischen Betrachtung geschehen. Dabei bietet uns die Zeit, in der die Idee der Demokratie erste Anhänger gefunden hat, Aufschluss über ein basales Merkmal, das sie allen anderen Regierungsformen überlegen macht.
Um diesen Vorzug angemessen zu fassen, sei an zwei der Antike vertraute metaphorische Umschreibungen des Verhältnisses von Mensch und Staat erinnert. Auch wenn sie von ihren ersten Anwälten nicht nur auf demokratische Regierungsformen bezogen wurden, kann ihnen nur in einer Demokratie Genüge getan werden. Die beiden Autoren, denen wir sie verdanken, gehören nicht zu den erklärten Theoretikern der Demokratie; aber einer von ihnen steht ihr, wie sich zeigen wird, so nahe, dass sie einer nachfolgenden grundsätzlichen Zuordnung nicht entgegenstehen. Und der andere ist ein wirkungsmächtiger Anwalt der Republik.
Der Erste ist Platon, der im zweiten Buch der Politeia den Staat mit einem in «Großbuchstaben» geschriebenen Menschen vergleicht: Wenn es nicht gelinge, die Tugenden beim einzelnen Menschen zu erkennen, weil sie gleichsam in «sehr kleinen Buchstaben» geschrieben sind, die wir «von weitem» nicht zu lesen vermögen, könnten wir die Möglichkeit nutzen, dass «dieselben (!) Buchstaben» auch in vergrößerter Fassung zu finden sind (368d–c.).
Mit diesem Vergleich begründet Platon sein Vorgehen, die Tugenden, um die es ihm vorrangig geht, zunächst als die gute Verfassung einer polis zu beschreiben, mit Blick auf welche es möglich ist, auch für den vergleichsweise klein erscheinenden einzelnen Menschen zu erkennen, was unter «Gerechtigkeit», «Besonnenheit», «Tapferkeit» und «Frömmigkeit» zu verstehen ist.
Die Pointe dieses Vergleichs kann man sich auch heute noch anschaulich machen: In der Vielfalt seiner sich vielfach widersprechenden Empfindungen, Bedürfnisse, Einstellungen, Erwartungen und Ansprüche ist der Einzelne darauf angewiesen, sich als Einheit zu verstehen, sobald er als Person wahr- und ernst genommen werden will. Und das Modell für diese Einheit kann ihm in einem gut bestellten Staat vor Augen stehen, dessen Einheit nach Analogie des einzelnen Menschen vorgestellt wird.
Das erscheint aufwändig, dürfte aber im Gebrauch der Begriffe für politische Einheiten wenig Schwierigkeiten bereiten, wenn wir sehen, wie selbstverständlich auch dem Staat ein «Körper» zugerechnet wird, der ein «Haupt» und eine Reihe von «Gliedern» hat. Das Frontispiz von Hobbes’ Leviathan, auf dem ein aus lauter kleinen Menschen bestehender königlicher Riesenmensch mit Krone, Zepter und Schwert ein ganzes Land bewacht und beschützt, zeigt einen «großgeschriebenen Menschen». Auch wenn Hobbes kein Anhänger Platons war, suchte er seine Beispiele aus dem Fundus der Antike. Das Bild verstehen wir augenblicklich, denn bis heute sprechen wir vom «Staatskörper» und seinen «Organen», der Staat ist die «Körperschaft» schlechthin, auch wenn sich die Rede von «Oberhaupt» und «Fußvolk» nur noch selten findet. So ist die Analogie von Mensch und Staat zum Bestandteil unserer politischen Sprache geworden. Doch man hat vergessen, dass in ihr auch ein Maßstab liegt, mit dem die staatliche Ordnung auf den Menschen verpflichtet wird, so dass die Politik als vorrangige Aufgabe einer immer auch als moralisch verstandenen Selbstachtung der zu ihr gehörenden Menschen angesehen werden kann.
Die erste große philosophische Darstellung des griechischen Staatsverständnisses durch Platon stützt sich also auf eine grundlegende Entsprechung zwischen dem Einzelmenschen und dem Staat. Die Tatsache, dass es Menschen sind, die den Staat gründen, ihn bilden und nach ihren Vorstellungen leiten, hat eine offenkundige Konsequenz für den Begriff der polis: Der Mensch schafft den Staat nach seinem Bild und ist dabei von der Erwartung geleitet, dass dieser seinem Urheber in Verfassung und Aufgabe ähnlich bleibt. Die politische Lehre ist von der Erwartung bestimmt, dass ein Staat seiner menschlichen Herkunft dauerhaft verpflichtet bleibt.
Das zweite Beispiel findet sich nahezu vierhundert Jahre später in einem Text, der beansprucht, eine Begebenheit zu berichten, die sich gut 100 Jahre vor Platons Niederschrift der Politeia ereignet haben soll. Titus Livius gibt im zweiten Buch seiner monumentalen Geschichte der römischen Republik die Verhandlung wieder, die um das Jahr 495 v. Chr., 15 Jahre nach der Vertreibung des letzten römischen Königs, stattgefunden haben soll. Die Verhandlung führte zu einer Vereinbarung, die eine rechtlich verankerte Beteiligung auch der besitzlosen Bürger an der Verwaltung Roms ermöglichte. Diese Einigung war eine unerhörte Innovation, die es modernen Historikern erlaubt, die Römische Republik sogar in die Nähe der modernen Demokratie zu rücken.
Die Schilderung der Ereignisse durch Livius gibt der Vermutung Raum, die kluge und beherzte Rede, die der zur ersten Generation der Konsuln gehörende Menenius Agrippa vor der Gesamtheit der aufständischen Truppen gehalten hat, habe überhaupt erst den Fortbestand der jungen Republik gesichert. Tatsächlich war Roms politische Zukunft gefährdet; die Rede des Senators muss als ein so verzweifelter wie mutiger Versuch angesehen werden, mit der Erweiterung der Verfassung auch die Existenz Roms zu retten.
Livius schildert die Lage so: Die Soldaten hatten einen bravourösen Sieg über die Latiner erstritten, sollten aber auf ihren Sold verzichten, weil die Kassen der Stadt leer waren. Die Anführer der Truppen erklärten daraufhin, nicht mehr in die Stadt zurückkehren zu wollen. Alle Soldaten versammelten sich mit ihren Familien auf dem Feld vor den Mauern Roms und drohten mit ihrem vereinten Abzug und der Gründung einer eigenen Siedlung im umliegenden Land. Das hätte das politische Ende der jungen Republik bedeutet, so dass die Stadtväter in ihrer Not der Ansicht waren, der Zusammenhalt der Stadt müsse gerettet werden, «koste es, was es wolle.»[1]
In dieser Lage wagte es Menenius Agrippa, aus dem Schutz der Mauern herauszutreten, um die Anführer der revoltierenden Truppe zur Rückkehr zu bewegen. Die Rede hat Livius wie folgt überliefert:
«Einst, als im Menschen noch nicht wie heute alles einheitlich verbunden war, als jedes der einzelnen Glieder des Körpers seinen [eigenen] Willen, [und] seine eigene Sprache hatte, empörten sich die übrigen Glieder, dass sie ihre Sorge und Mühe und ihre Dienste nur aufwendeten, um alles für den Magen herbeizuschaffen. Der Magen aber liege ruhig mittendrin und tue nichts anderes, als sich an den dargebotenen Genüssen zu sättigen. Sie verabredeten sich also folgendermaßen: Die Hände sollten keine Speise mehr zum Munde führen, der Mund nichts Angebotenes mehr annehmen und die Zähne nichts mehr zerkleinern. Während sie nun in ihrer Erbitterung den Magen durch Aushungern bezwingen wollten, kamen die einzelnen Glieder alle zugleich mit dem ganzen Körper an den Rand völliger Entkräftung. Da sahen sie ein, dass sich die Aufgabe des Magens durchaus nicht in faulem Nichtstun erschöpfte, dass er ebenso andere ernähre, wie er selbst ernährt werde.» (Liv., 2, 32, 11)
Es soll dieser Vergleich des Staates mit dem lebendigen Leib gewesen sein, der dazu geführt hat, «die Gemüter umzustimmen». Dabei dürfte es eine Rolle gespielt haben, dass im anschaulichen Vergleich zwischen der körperlichen Beschaffenheit eines Menschen und der auf Einheit angewiesenen Leistung der verschiedenen Staatsorgane der körperlichen Tätigkeit die fundierende Rolle zugesprochen wurde. Ohne den Leib gibt es nichts von dem, was wir «Mensch» und «menschliche Leistung» nennen können. In Analogie dazu wären es die Kampfkraft der Soldaten und der körperliche Einsatz der Arbeiter und Handwerker, die den Grund für das legen, was dann als Stadt oder Staat seine Funktion erfüllt. Dieses Verständnis wird dadurch unterstrichen, dass der ehemalige Konsul und geachtete Senator zu den vor der Stadt lagernden Soldaten kommt und sie um Hilfe bittet.
Ohne die hier an zwei prominenten Beispielen illustrierte Überzeugung von der Korrelation zwischen dem Menschen und der von ihm getragenen staatsförmigen Organisation ist Politik bis heute weder denkbar noch möglich. Denn mit der Beziehung von individueller Einstellung und allgemeiner Bedeutung werden die beiden Pole des menschlichen Selbstbewusstseins, Individualität und Allgemeinheit, verknüpft. Und in der praktischen Herstellung dieser Verbindung zeigt sich die Entsprechung zwischen dem Menschen, der sein eigenes Selbst- und Weltbewusstsein hat, und dem Staat, in dem er in der von ihm mitgetragenen gesellschaftlichen Einheit lebt und von dem er erwarten kann, dass er auch in seinem Interesse tätig ist.
Damit sind die beiden Pfeiler benannt, auf denen die gesamte Konstruktion des Politischen aufruht. Der hohe Grad der Abstraktion erschwert das Verständnis dieser Verbindung. Doch das wird umso weniger Schwierigkeiten bereiten, je mehr wir sehen, dass sich die Logik der Demokratie auf den hier aufgewiesenen Begriffszusammenhang stützt und daraus organisatorische Konsequenzen zu ziehen sucht.
Die Herausforderung liegt auch darin, dass die angemessene rechtliche Ordnung der Gemeinschaft an der für den ersten Blick so paradox erscheinenden Verbindung zwischen Individualität und Allgemeinheit im Selbstverständnis des Menschen hängt. Dass der Mensch, wie es später bei Kant heißt, die «Menschheit in seiner Person» zu achten hat, ist die größte logische, ethische und schließlich auch politische Provokation, mit der der Mensch sowohl als moralisches wie auch als politisches Wesen umzugehen hat.
Diese begriffliche Herausforderung ist zugleich der Grund, warum wir uns überhaupt veranlasst sehen, so weit in die Vorgeschichte der Demokratie zurückzugehen. Dass in der Antike das Leben ein anderes war als in der Gegenwart, und dass die Menschen in Athen und in Rom durchaus auch andere Probleme hatten als die Menschen im 21. Jahrhundert, ist uns bewusst – auch unabhängig davon, wie spärlich unsere Kenntnisse darüber sind, was die Menschen damals wirklich beschäftigt hat.
Aber im Rückblick auf die vor gut 2500 Jahren in Umlauf kommenden Begriffe der Menschheit und ihres sich zunehmend individuell ausprägenden Selbstbewusstseins, damit auch des Anspruchs auf Freiheit und Gleichheit – verbunden mit der Vorstellung, dass dieser sich so verstehende Mensch auch seine politische Verfassung mitbestimmen will, lässt sich eine Ahnung davon gewinnen, wie alt die Zentralbegriffe unseres politischen Selbstverständnisses sind. Sie bieten eine Chance zu prüfen, wie gut begründet die Innovationen sind, die erst gegen Ende des 18. Jahrhunderts in vollem Umfang verstanden worden sind.
Mag sein, dass die extrem lange Zeit der Entstehung und Entwicklung der Idee der Menschheit und ihrer politischen Form für eine kurze Weile den Eindruck begünstigt hat, so werde es nach der Errichtung der ersten neuzeitlichen Demokratien in Amerika und Europa gleichsam von selbst weitergehen. Doch die Rückschläge des 19., die beiden Weltkriege des 20. Jahrhunderts, der nachfolgende Kalte Krieg, der in ihm fortgesetzte Terror und die damit verbundenen nationalistischen Regressionen großer und kleiner Staaten lassen wenig Raum für eine automatische Erfüllung demokratischer Hoffnungen. Wir erleben sowohl bei den Machthabern der Welt wie auch an der im Namen der Demokratie auftretenden «Basis» eine heillose Verstrickung in Missverständnisse, die wie Vorboten neuen Unheils erscheinen. Gegen sie muss mit einer weit in die Geschichte der Politik zurückgehenden Aufklärung angegangen werden.
2. Menschheit als Verständigungsgemeinschaft. Von einem begrifflich gesicherten Verständnis von Menschheit lässt sich erst mit der schriftlichen Überlieferung in religiösen, literarischen und juridischen Texten sprechen. Überall, wo ein Gott oder die Götter ganz allgemein den Menschen gegenübergestellt werden, schwingt mindestens ein Vorverständnis von Menschheit mit. Und verlässliche Hinweise finden wir erst in den Fragmenten vorsokratischer Philosophen. Der Wert dieser Texte wird nur dadurch geschmälert, dass sie uns lediglich in Form von Zitaten in Schriften von Autoren nachfolgender Generationen vorliegen. Gleichwohl sind die Notate von unschätzbarem Wert, und ihr besonderer Reiz besteht darin, dass sie im zeitlichen Zusammenhang mit dem ersten Vorkommen des Begriffs der Demokratie zu sehen sind. Dabei soll, nach dem Bericht des ersten griechischen Historikers Herodot, der Vorschlag zur Einführung der Demokratie von Anfang an mit den Vorzügen der Freiheit und der rechtlichen Gleichheit aller Bürger verbunden gewesen sein.
Doch ganz gleich, ob wir das Auftreten der Demokratie um 520 v. Chr. (wie Herodot berichtet) oder auf 450 v. Chr. (das Jahr, in dem Herodot sein großes Werk veröffentlicht) datieren: Wir bewegen uns im selben epochalen Zusammenhang, in dem sich auch der Aufstieg der Wissenschaften vollzieht, namentlich der Medizin, des Rechts, der Ökonomie, der Philosophie, der Geschichtsschreibung und der Rhetorik. Dabei darf die zur gleichen Zeit einsetzende Karriere des Theaters, der bildenden Künste, in Sonderheit der Skulptur und Architektur, nicht übersehen werden – in einem Lebensraum, der bereits durch die homerischen Epen, die Kulturkritik Hesiods, die Poesie von Archilochos und Sappho, die tragische Dichtung und die panhellenischen Feste erschlossen worden war. Alles dies erfolgt in derselben Zeit und in eben der Kultur, in der auch die Demokratie erstmals Erwähnung findet. Mit schwindelerregendem Tempo setzt die Antike ein, und es kann nicht verwundern, dass hier die Moderne bereits ihre wichtigsten Impulse bekommt.
Seit uns schriftliche Zeugnisse überliefert sind, die uns präziser als die Reste der hinterlassenen Gräber, Bauten, Bilder, Gerätschaften oder Schmuckstücke einen Eindruck von der Selbst- und Weltwahrnehmung der Menschen vermitteln, können wir sicher sein, dass diese von der Tatsache des Lebens vieler Menschen auf der Erde ausgegangen sind. Keine der Kulturen, von der es eine Überlieferung gibt, scheint von der Überzeugung auszugehen, dass die in ihr lebenden Menschen allein auf der Welt seien. Man weiß, zumindest auf dem eurasischen Kontinent und in Afrika, dass überall, wo sich leben lässt, auch Menschen anzutreffen sind. Nur von dem, was jenseits der Meere ist, gibt es lediglich Vermutungen, die gelegentlich mythischen Ausdruck finden.
Das gilt auch für die Menschen, die in grauer Vorzeit den Weg nach Amerika oder Australien gefunden haben und dauerhaft dort geblieben sind, ohne dass sich bei den dort ansässig gewordenen Menschen eine geographisch bestimmbare Erinnerung an ihre Herkunft bewahrt zu haben scheint. Offenbar haben die frühen Einwanderer in Amerika mit der Zeit vergessen, dass sie einst als Auswanderer von anderswoher ins Land gekommen sind. Auffällig ist allerdings, dass sich elementare Strukturmomente einer Weltsicht erhalten haben, die sich schon in ihren Herkunftsgebieten entwickelt haben dürften und in den «Weltreligionen» mit ihren vielen Filiationen bis heute Bestand haben.
Ein Moment dieser Struktur betrifft die Unterscheidung zwischen Menschen und Göttern. Deren Beziehungen scheinen nach Art einer Herrschaftsordnung vorgestellt zu werden, in der die Menschen durch ihre gemeinsamen Eigenschaften dadurch verbunden sind, dass sie allesamt Geistern oder Göttern unterstehen, denen sie Dienste und Opfer schulden.
Alle Menschen dürften sich angesichts ihrer Endlichkeit und Sterblichkeit den die Zeiten überdauernden Göttern unterworfen sehen. Offenbar lässt sich der rasche Wandel des menschlichen Lebens leichter ertragen, wenn man ihm den bleibenden Bestand einer göttlich gesicherten Daseinsordnung unterlegen kann. Und je mehr dem Menschen bewusst wird, wie wenig er von den Bedingungen seines Lebens weiß, umso größer ist sein Bedürfnis, wenigstens an eine Instanz glauben zu können, die über dieses Wissen verfügt. Bereits dieses Verlangen kennt der Mensch nur von seinesgleichen; ob es auch andere Lebewesen umtreibt, weiß er nicht.
Zu der sich schon früh zeigenden Besonderheit der Menschen gehört es, dass sie sich zu einem Dienst an den Göttern verpflichtet sehen. Verbunden ist damit die Vorstellung, dass es zu ihrem eigenen Wohl ist, wenn sie den himmlischen Mächten ihre Verehrung bekunden und sich um die Befolgung der göttlichen Gebote bemühen.
Darin tritt ein zentrales Kennzeichen zur Beschreibung des Selbst- und Weltverhältnisses der Menschen zutage: Sie bilden eine Verständigungsgemeinschaft, unter deren Bedingungen sie zu eigenen Handlungen genötigt sind. Schon in einer solchen Gemeinschaft ist das wirksam, was später mit den Begriffen des Erkennens und des Wissens bezeichnet wird; es kann überdies an Bejahung und Verneinung gebunden sein. Dazu gehören Absichten, Absprachen und koordiniertes Tun, auf das man sich vorbereiten muss, das man gemeinsam erleben, an das man sich erinnern und aus dem man lernen kann.
Im Raum der Verständigung dürfte vieles mit situativer Selbstverständlichkeit geschehen, aber das, worauf es im Verstehen ankommt, ist ein gemeinsames Bewusstsein von dem, was bedeutsam, vorrangig oder weniger wichtig ist. Darin sind Menschen als Gemeinschaft miteinander verbunden und hier sind sie, so zahlreich die benötigten Dinge, die beteiligten Tiere und vielleicht auch die angerufenen Götter sein mögen, die einzigen Akteure, auf die sie im eigenen Handeln rechnen können.
Auf diese Weise bilden die Menschen, wo immer sie sich auf der Erde befinden, nicht nur eine Verständigungs-, sondern auch eine mögliche Handlungsgemeinschaft. Trotz der in vielen Fällen bestehenden kulturellen Unterschiede, trotz des Argwohns, der ihnen von Anders-Gläubigen entgegengebracht wird, trotz der möglichen Fremdheit und Feindseligkeit, der sie unterworfen sind, haben Menschen die Fähigkeit, voneinander zu lernen. Religionen bieten ein unablässig umworbenes, umstrittenes und umkämpftes Terrain, mit Blick auf das es gleichwohl gerechtfertigt ist, die Menschheit auch eine Lehr- und Lerngemeinschaft zu nennen. Die Menschen lernen in besonderer Weise voneinander, sie sind aufeinander bezogen, bringen eine ausdrückliche Aufmerksamkeit füreinander auf und können sich offenbar auch in ihrer gegenseitigen Gefährdung verstehen. Wäre das nicht so, würden die Menschen gewiss nicht unablässig versuchen, sich gegenseitig zu beeindrucken, miteinander zu konkurrieren oder sich wechselseitig zu bedrohen.
«Verstehen» ist zwar der Akt, der bewusstes Einvernehmen ermöglicht, aber gewiss nicht mit diesem zusammenfällt. Das mitdenkende Urteil mit jemandem, in dessen Lage man sich versetzen kann, führt nicht notwendig zur Eintracht. Es kann auch das schier unbegrenzte Feld eröffnen, auf dem sich die Schwäche, die vermutete Bosheit oder die Gefährlichkeit des Anderen zeigt oder befürchten lässt. Es ist das mit Annahmen, Verdächtigungen, Mutmaßungen und für sicher gehaltenen Eindrücken einhergehende Verstehen, welches das Zusammenleben der Menschen schwierig macht. Denn mit dem Verstehen kommen auch Irrtum, Täuschung und Lüge in die Welt. Erst das Verstehen, von dem wir nur hoffen können, dass es Vertrauen, Freundschaft und Liebe ermöglicht, lässt uns annehmen, dass der andere Mensch sich mit feindseligen Absichten nähert. Und so kann das Verstehen auch dazu führen, im Anderen den Widersacher zu vermuten.
Gesetzt, die Annahmen sind nicht völlig verfehlt, kann man die Auffassung vertreten, dass nichts so unwahrscheinlich ist wie das Bewusstsein von einer ursprünglichen Gemeinsamkeit und Verbundenheit der Menschen. Tatsächlich herrschen Fremdheit, Streit und gewaltsamer Gegensatz vor. Aber in ihrer gemeinsamen Abhängigkeit von den überlegenen Göttern sowie in der sie verbindenden Macht über Tiere und in der vereinten Verfügung über die Kräfte der Natur kann dennoch das Bewusstsein einer verbindenden Gemeinsamkeit der Menschen entstanden sein.
Vielleicht ist es nicht möglich, empirische Argumente für die Einheit der Menschen beizubringen. Gleichwohl finden wir in der prähistorischen Forschung eine Bestätigung für das, wofür die Griechen den Mythos bemühen mussten: Wir können sicher sein, dass über einen Zeitraum von vermutlich mehr als einer Million Jahre die Verständigungsgemeinschaft der Menschheit in der Lage war, den Gebrauch des Feuers in allen Erdteilen zu verstetigen und so die menschliche Kultur zu gründen. Auch die globale Verbreitung der Steinwerkzeuge lässt an der ursprünglichen Gemeinsamkeit in Verstehen, Lernen und Handeln keinen Zweifel. Die schon lange vor der Sesshaftigkeit ausgebildeten Fähigkeiten sind durch die Funde von Faustkeilen, Speeren und Pfeilen, alsbald auch von Werkzeugen und Gebrauchsgegenständen, von Schmuck und Musikinstrumenten dokumentiert.
Heute wissen wir durch die bis in die geschichtliche Vorzeit zurückgreifenden weltweiten Genanalysen, dass alle Menschen aus einer vergleichsweise kleinen Population von Angehörigen des homo sapiens in Afrika stammen. Die Messungen belegen, dass alle Menschen ein und dieselbe genetische Herkunft teilen, und die durch die Wanderungsbewegungen auf dem ganzen Erdball verteilten Populationen sind auf ihrer Suche nach neuen Siedlungsgebieten miteinander in biologischer Verbindung geblieben. In einem sich über Jahrtausende erstreckenden Entwicklungsgang der Generationen veränderten sie sich und bildeten auch die Eigenschaften und Lebensformen aus, die sie von anderen bis heute erkennbar unterscheiden.
Das hinderte die Menschen jedoch nicht, sich gerade auch nach Generationen der Trennung und größter Entfernungen voneinander mit ihresgleichen zu vermischen und ihre ursprüngliche Verwandtschaft zu erneuern. Sogar die sprichwörtlich gewordenen «Neandertaler» mit ihrer größeren genetischen Eigenständigkeit waren in diesen Austausch einbezogen. Bei aller Auffälligkeit äußerer Unterschiede bilden die Menschen als Spezies eine Einheit.
Diese Menschheit, die wir kennen und auf die wir uns in unseren politischen Ansprüchen stützen, hat ihr Spezifikum in einer Bedingung, die in ihrem Selbstverhältnis begründet ist. Ihre Besonderheit liegt im Umgang der Menschen mit sich selbst und ihresgleichen, aus dem das gemeinsame Verständnis für sich selbst und für die Welt entspringt. Die Eigenart des Menschen wird stärker und nachhaltiger durch sein im Umgang mit seinesgleichen reguliertes Selbstverständnis bestimmt als durch Klima, Umweltbeschaffenheit, Arbeit und Ernährung. Es ist nicht per se die anatomische Beschaffenheit, sondern vielmehr der Anspruch der Kultur, der den Zusammenhang und die Einheit der Menschheit stiftet.
Mit hoher Wahrscheinlichkeit ist es ein affektives und intellektuelles, zugleich ein auf die Welt übergreifendes geistiges Klima, in dem sich der Mensch als Mensch entwickelt. Auch in seiner durch ihn selbst stimulierten Genese liegt eine Bestätigung der Tatsache, dass der Mensch einer Verständigungsgemeinschaft angehört, in der er sich durch eigene Aktivitäten offen hält für alles, was sich ihm durch seine Sinne, seinen Verstand und in seinem Anspruch auf Gründe erschließt. Inmitten der erfahrenen Unterschiede sowie in unzähligen Fremd- und Feindseligkeiten kann die in allen Gegensätzen durchgehaltene Praxis der gemeinsamen Weltbewältigung als Indiz für eine Grundbedingung des menschlichen Daseins angesehen werden.
Um nur einige Beispiele zu nennen: In den zahllosen technischen Fertigkeiten, in den Siedlungs- und Bestattungsformen, in der Neigung, alles Bleibende zu kennzeichnen und zu schmücken, oder in den sich schon früh zeigenden Fähigkeiten, instrumentell erzeugte Klänge zu erzeugen und staunenswerte Skulpturen und Bildwerke zu erschaffen, tritt eine Neigung zur Weltaneignung hervor, vermutlich lange bevor es zur begrifflichen Welteroberung durch logische Vergegenständlichung von Weltverhältnissen kommt. Und das Verbindende und Gemeinsame liegt darin, dass diese produktiven Aktivitäten auf eine Weltverfügung im Dienst menschlicher Verständigung zielen. So expressiv und extrovertiert die Leistungen auch allesamt sind: Sie sind sämtlich von Menschen an Menschen adressiert und können als Verstärker einer kollektiven Präsenzerfahrung der Menschheit begriffen werden.
Auch die bereits genauer datierbaren Schöpfungsmythen fügen sich in die Selbstverstärkung menschlicher Daseinserfahrung ein. So werden scharfe Grenzen zwischen Göttern und Menschen und auch zwischen Menschen und Tieren gezogen. Hier also wirkt ein prägnanter Sinn von Menschheit, der noch dadurch verstärkt wird, dass sich, trotz des als grundsätzlich angenommenen Unterschieds zwischen Göttern und Menschen, beide besonders nahestehen. Es gibt sogar Beispiele für die Erhebung einzelner Menschen in den Stand der Götter, die sich ihrerseits in Menschen verwandeln, ja, sich sogar mit ihnen paaren können. Der Rangunterschied bleibt gleichwohl gewahrt und kann, wie zum Beispiel im Gilgamesch-Epos, auch kategorial zum Ausdruck kommen: Im Unterschied zu den Göttern sind die Menschen sterblich, und sie werden davor gewarnt, unsterblich sein zu wollen. Wie wollen sie, so werden sie von einem in den Stand der Götter erhobenen einstigen Menschen gefragt, die Unsterblichkeit aushalten, wenn sie noch nicht einmal ohne Schlaf auskommen können? (XI, 1–200)
Mit der noch die Toten einbeziehenden Individualisierung ist ein entscheidender Schritt in der Menschwerdung vollzogen. Was Menschheit bedeutet, kann erst in vollem Umfang zum Ausdruck gebracht werden, wenn wir die sie ausmachende Gesamtheit von Menschen als miteinander in Verbindung stehende Menge von Individuen verstehen. Das kommt nicht nur in den ersten schriftlichen Erzählungen aus dem vorderasiatischen, ägyptischen und später auch jüdischen, Kulturraum zum Ausdruck; auch die in Keilschrift oder Hieroglyphen verfassten Erinnerungstafeln, Gesetzestexte, Vertragsurkunden sind zu Dokumenten einer offenbar bereits als selbstverständlich angesehenen Individualisierung der menschlichen Gesellschaft geworden.
Wann es erstmals zur Auszeichnung des einzelnen Menschen als Individuum gekommen ist, lässt sich nicht sagen, denn aussagekräftige Skulpturen und Bilder aus der Zeit vor der Erfindung der Schrift scheint es nicht mehr zu geben. Man darf aber annehmen, dass es eine Verehrung von Menschen als gottgleiche, bestaunte und bewunderte Individuen überall gegeben hat, wo es stabile Herrschaftsordnung und Narrative über außerordentliche Leistungen, göttliche Botschaften oder unerhörte Ereignisse gab.
Im spekulativen Rückschluss aber dürfen wir annehmen, dass mit der Aufwertung einzelner Individuen ihre Zurechnung zu einer als bedeutsam angesehenen Gesamtheit der Menschen einhergeht. Gott oder die Götter, so stellen es die Mythen von der Entstehung der Menschen dar, haben einzelne Menschen geschaffen, die einen Namen erhielten oder unter dem Einfluss von Heroen standen, die Außerordentliches vollbrachten und so jedem Einzelnen Ziele vorgaben, die als Tugenden zum individuellen Ansporn werden konnten. Die Götter, so glaubte man, haben den Menschen zu einem herausgehobenen Lebewesen gemacht, das sich durch seine Einsicht und durch seine Tugend zu einer exponierten Stellung qualifiziert. Und solange die Menschen glauben konnten, dass sie durch Einsicht und Tugend an dem teilzuhaben vermögen, was die Götter als vorrangig auszeichnen, war diese Aufwertung wirksam. Und wo immer sie wirkte, konnte sich der Mensch einen Vorzug zurechnen, der ihm als Teil der Menschheit besondere Verpflichtung auferlegte.
Doch so naheliegend der religiöse Hintergrund auch ist, man darf nicht übersehen, dass sich die Auszeichnung der Menschheit und des Menschen in begrifflichen Konstellationen artikuliert. Zum generalisierenden Verständnis von Menschheit und Individuum kommt es nur unter epistemischen Konditionen, von denen wir annehmen, dass sie sich erst in den letzten Jahrtausenden vor der Zeitenwende eingestellt haben. Das ist eine spekulative These, für die durch den gleichzeitigen Auftritt universeller weltanschaulicher Konzeptionen und individueller Leistungen in einem von China über Indien und Persien bis hin nach Palästina und Griechenland reichenden Areal aufschlussreiche Anhaltspunkte sprechen. Eindeutige Belege für die Konjunktion von Individualität und Universalität finden sich in den philosophischen Reflexionen der vorsokratischen Denker aus der Zeit, in der nach Solon und Kleisthenes in Athen über die Demokratie nicht mehr nur nachgedacht wurde. Doch das Nachdenken über die begrifflichen Bedingungen des menschlichen Weltverhältnisses zielt ins Zentrum des menschlichen Daseins und berührt das Wesen der Politik. Denn was immer Menschen gemeinschaftlich in einer verbindlichen Weise zu verstehen und zu unternehmen versuchen, ist auf Abstraktionen gegründet, die von den beteiligten Menschen verstanden und getragen werden können.
Das ist so offensichtlich, dass man sich scheut, es auch nur an Beispielen zu erläutern, zumal schon der Gebrauch der Sprache, erst recht eine verlässliche Verständigung ohne Begrifflichkeit nicht möglich ist. Jeder, der sich mit seinesgleichen eindeutig auf denselben Gegenstand, den gleichen Vorgang oder ein gemeinsames Ziel beziehen möchte, braucht, insbesondere dann, wenn den Beteiligten das Gemeinte nicht unmittelbar sinnlich gegenwärtig ist, Begriffe, um auch nur die Eindeutigkeit eines Sachbezugs herstellen zu können.
In der Politik wird das den menschlichen Lebensvollzug fundierende Begriffsvermögen in besonderer Weise gefordert. Man muss angeben können, wer dazugehört und wer nicht, um bestimmen zu können, wer durch die Grenzen geschützt und was durch die Bürger verteidigt werden soll. Und so steigern sich die Forderungen an die komplementären Vermögen von Abstraktion und Konkretion mit der Menge der gemeinten Menschen, mit der Größe des behaupteten Landes, mit der Vielfalt der Aufgaben und Leistungen und mit dem Umfang der Bestimmungen, die im Frieden und im Krieg zu beachten sind. Mit dem zur Politik gehörenden Begriff des Rechts wird die Unerlässlichkeit abstrakter Unterscheidungen, etwa zwischen Schuld, Urteil, Strafe oder Freispruch manifest. Eine politische Ordnung wird als «Verfassung» verstanden, die nicht weniger als ein in Machtbefugnisse übersetztes Begriffsgefüge ist.
Je komplexer und differenzierter die Lebensverhältnisse werden, umso höher werden die Ansprüche an den Begriff des Politischen selbst: Mit zunehmend entwickelter Arbeitsteilung muss man die Aufgaben der Politik von dem unterscheiden, was für andere Tätigkeitsbereiche wesentlich ist: in der Wirtschaft, dem Handel, den technischen Leistungen und vor allem in der Religion, der Kunst und in der Wissenschaft. Die sich mehrenden Kenntnisse über andere Länder, über die Unterschiede in der Lebensform der Völker, aber auch über die geschichtlichen Veränderungen im eigenen Kulturkreis schärfen das Bewusstsein für alles das, was im politischen Raum schon deshalb von besonderem Belang ist, weil es viele Menschen betrifft.
Das Vertrauen in die Leistung der Begriffe scheint mit dem Übergang ins letzte vorchristliche Jahrtausend trotz der immer bewusster wahrgenommenen kulturellen Unterschiede zu einem Bewusstsein von der Einheit der Menschen geführt zu haben. Für diese Dynamik gibt es eine einfache Erklärung: Der Umfang und die Reichweite des Handels nehmen zu, mit seinem Volumen steigt auch das Interesse an Nachrichten über das Leben in anderen Regionen. Das schließt das Interesse für andere Religionen ein, denn man will weder verpassen, was sich anderswo als günstig erwiesen hat, noch übersehen, wovon Abgrenzung erforderlich scheint. Und so kann gerade das Bewusstsein von den Unterschieden im Sprechen, Denken und Glauben dem Bewusstsein einer Verwandtschaft zwischen den Menschen Vorschub leisten, einem Bewusstsein, das qualifizierte Neugier, differenzierte Begehrlichkeiten und auch das Verlangen nach lohnenden Eroberungen weckt.
Dieses Bewusstsein von menschlichen Gemeinsamkeiten muss keineswegs bereits humanitär oder gar philanthrop gewesen sein. Um auf seinesgleichen mit besonderer Aufmerksamkeit zu achten, genügt das Wissen, sich in einem von gemeinsamen Interessen oder erwarteten Konflikten bestimmten Lebensraum zu bewegen. Je größer der Aktionsraum des menschlichen Handelns wird, umso wichtiger wird es, die anderen Menschen zu verstehen.
3. Der Anteil der ersten Philosophen. Wer den angedeuteten Wandel verstehen will, muss zumindest eine Vorstellung davon haben, wie sich die Selbsteinschätzung des Menschen verschiebt und unversehens das Individuum eine tragende Rolle übernimmt, ohne auf die begriffliche Konzeption der Allgemeinheit (und damit letztlich auch der Universalität) verzichten zu müssen. Auf sichere Anzeichen dafür stößt man im 6. und 5. vorchr. Jh. in Griechenland. Hier findet auch die Demokratie erstmals Erwähnung.
Unter den vorsokratischen Denkern ist Xenophanes von Kolophon der erste, dem die Einsicht in den menschlichen Ursprung der Götter zugeschrieben wird: «Wenn die Pferde Götter hätten, sähen die wie Pferde aus», ist der pointierte Spruch, mit dem Xenophanes in das Gedächtnis der Menschheit eingegangen ist (Xen. 29).[2] In anderen Bemerkungen des Denkers kommen die Menschen als begrifflich aktive Wesen vor, die zwar auch Lebewesen wie die Tiere sind, aber dank einer besonderen Gunst der Götter über die Fähigkeit zum Erkennen und zum Denken verfügen. Da die Götter nur einen kleinen Teil des Wesens der Verhältnisse und Dinge enthüllen, welche die Menschen als Erkennende zu begreifen suchen, bleibt das menschliche Wissen unvollkommen.
In seiner nur in wenigen Bruchstücken überlieferten Naturphilosophie ist Xenophanes sowohl um das Verständnis der Vorgänge am Himmel wie auch der auf der Erde bemüht. Die Besonderheit des Menschen im Vergleich zu den anderen Lebewesen sieht Xenophanes in den Leistungen des Erkennens und des begrifflichen Unterscheidens. In deren Betonung liegt keine Abwertung dessen, was wir heute als die Intelligenz der Tiere bezeichnen, die in ihrer Aufmerksamkeit von ihren Bedürfnissen ausgehen und somit auf Gegenstände gerichtet sind, die für sie sinnlich vorrangig sind. Doch der Mensch geht mit seiner Frage nach der Herkunft und dem Ziel aller Dinge darüber hinaus, kann die Eigenart vieler Gegenstände und Ereignisse erkennen und vermag den Begriff eines höchsten Wesens zu fassen.
Von dem sich nur den Menschen erschließenden Gott heißt es: «Als Ganzer sieht er, als Ganzer versteht er, als Ganzer hört er.» (Xen. 35) Diese lakonische Feststellung ist der Nukleus einer rationalen Theologie. Den hier verwendeten Begriff des Ganzen (houlos) darf man nicht nur auf die gesehene, verstandene und gehörte Welt beziehen. Er bezeichnet vornehmlich die Eigenart Gottes, der in allen seinen Tätigkeiten als ein Ganzes wirksam ist.