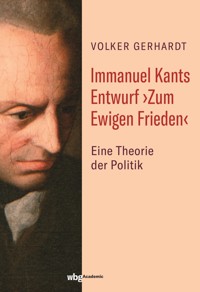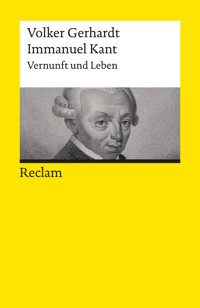11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Reclam Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Reclams Universal-Bibliothek
- Sprache: Deutsch
Gerhardt macht in diesem inzwischen fast klassisch zu nennenden Buch das ›Prinzip der Individualität‹ zum Fundament einer Moraltheorie. In zehn Kapiteln untersucht er verschiedenste Selbstverhältnisse, von der Selbsterkenntnis über das Selbstbewusstsein bis zur Selbstverwirklichung. Es ist ein »Versuch, die Beziehung zwischen Moral und Leben genauer zu bestimmen«, ein Versuch, der »an der Erfahrung des Lebens ansetzt, dort, wo die moralischen Kollisionen sich entzünden«, wie die ZEIT in ihrer sehr positiven Besprechung der Erstauflage schrieb. Für diese zweite Auflage wurde das Buch durchgesehen und um ein neues Nachwort ergänzt. E-Book mit Seitenzählung der gedruckten Ausgabe: Buch und E-Book können parallel benutzt werden.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 697
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Volker Gerhardt
Selbstbestimmung
Das Prinzip der Individualität
Reclam
2., erweiterte Auflage
2018 Philipp Reclam jun. GmbH & Co. KG, Siemensstraße 32, 71254 Ditzingen
Gesamtherstellung: Philipp Reclam jun. Verlag GmbH, Siemensstraße 32, 71254 Ditzingen
Made in Germany 2018
RECLAM ist eine eingetragene Marke der Philipp Reclam jun. GmbH & Co. KG, Stuttgart
ISBN 978-3-15-961366-6
ISBN der Buchausgabe 978-3-15-019526-0
www.reclam.de
Inhalt
[11]»Wir wissen zu sagen: ›Cicero spricht dieses oder jenes; das ist Platons Art;
dies sind die eigenen Worte des Aristoteles.‹
Aber wir, was sagen wir für uns selbst?
Wie urteilen wir? Was tun wir selbst?«
(Montaigne, »Du pedantisme«; Essais I,25)
»Nur aus dem Bewußtsein der Einzigkeit meines Lebens entspringt Religion – Wissenschaft – und Kunst.«
(Ludwig Wittgenstein, Tagebücher 1914–1916, 1. 8. 16)
»An sich selbst hat jeder das Maß.«
(Pindar, Pythische Oden II,34)
[13]Vorwort
Das Von-vorn-Anfangen ist unser Schicksal. Mit jeder eigenen Tat nehmen wir uns etwas heraus, das tatsächlich schon lange angefangen hat. Für jedes Individuum ist alles irgendwann das erste Mal: die ersten Zähne, die erste Reise, der erste Kuss. Irgendwann fängt man auch selbst zu denken an. Doch was man denkt, ist in der Regel schon milliardenfach von anderen gedacht. Und trotzdem kann man es nicht lassen. Denn der größte Reiz liegt im eigenen Anfang. Das ist nicht ohne Tragik, aber so unabänderlich wie das Schicksal.
Auch das philosophische Denken untersteht diesem Gesetz – und zwar von Anfang an. Schon die Vorsokratiker treten – vermutlich nach einer Reihe uns heute unbekannter Vorläufer – als Individuen auf, die für ihre Zeitgenossen so auffällig sind, dass man bis heute die Anekdoten überliefert, die bereits in der AntikeAntike, antik über sie im Umlauf waren. Thales hatte den Gedanken, alles stamme aus dem Wasser. Eine Generation später macht Anaximander aus dem natürlichen Ursprung ein metaphysisches Prinzip. Dessen logischer Gehalt wird schon wenige Jahrzehnte später von Parmenides und seinen Schülern verabsolutiert und scharfsinnig zum unwandelbaren Sein erklärt. Dem setzt Heraklit noch zur selben Zeit seine hoch individualisierte Einsicht in das Werden aller Dinge entgegen. Eine weitere Generation später bietet Anaxagoras eine vermittelnde Lösung an, die nunmehr den in sich beweglichen, aber mit sich einigen Geist zum Prinzip erklärt.
So geht es weiter: Die Sophisten entwerfen aus dem schnell wachsenden Fundus des Wissens eine bedeutende lebenspraktische Lehre, die jedoch einem von ihnen, Sokrates, bedenklich erscheint. Sein Schüler Platon sucht zu zeigen, warum Sokrates eben wegen dieser Bedenken kein Sophist mehr ist, und überbietet ihn durch die größte philosophische [14]Leistung, die wir kennen. Die genügt aber schon seinem Assistenten Aristoteles nicht. Denn er hat andere Gaben und bringt sie in anderen Interessen zum Ausdruck. Also geht er ungerührt über die Subtilität des Ideenbegriffs hinweg, tut so, als gäbe es den Politikos und die Nomoi nicht, und kümmert sich auch nicht um die hoch individualisierte Einheit von literarischer Kunst und philosophischer Einsicht in den Dialogen seines Lehrers. Dafür schafft er mit einzigartig erscheinender Kraft ein nach Disziplinen geordnetes Ganzes, das den bis heute gültigen Rahmen für das philosophische Denken abgibt.
Auf Aristoteles folgt die Reihe der Theorien und Schulen, in der alle Epigonen sind und dennoch, wenn sie denn der Wahrheit näherkommen wollen, originelle Denker sein müssen. In diesem individuellen Übergang von der Epigonalität zur Originalität liegt zwar nicht schon die Logik, wohl aber die Dynamik der Forschung, und einen Großteil der Anregungen zu neuen Ideen ziehen wir aus der historischen Rekonstruktion der Zusammenhänge, in der die Vorgänger stehen. Allein deshalb wäre es unsinnig, einen Gegensatz zwischen historischer und systematischer Arbeit aufzubauen. Gleichwohl hat man sich gelegentlich zu entscheiden, ob man primär historisch oder systematisch vorgehen will.
Mit Ausnahme einiger Skizzen, die nur den Zweck verfolgen, die den Ansatz tragende Überzeugung von der Problemkontinuität zwischen Antike und Moderne anschaulich zu machen, habe ich mich für eine systematische Darstellung entschieden. Anders wäre der Stoff im Rahmen eines Buches nicht zu bewältigen gewesen. Die Entscheidung schloss ein, auch auf die Auseinandersetzung mit den Theorien der jüngeren Vergangenheit zu verzichten. Denn obgleich ich aus den Debatten der letzten dreißig Jahre viel gelernt habe, gibt es keine Position, der ich mich einfach anschließen kann. Jeder Verweis hätte [15]somit eine Abgrenzung nötig gemacht. Dadurch wäre der Text gewiss um mehr als das Doppelte angeschwollen.
Vor allem aber wäre meine Absicht, eine Grundlegung der Ethik möglichst in der Sprache vorzutragen, in der wir uns alltäglich über ethische Fragen verständigen, gar nicht mehr erkennbar gewesen. Die Schwierigkeiten einer lebensnahen Darstellung sind ohnehin groß genug, weil man trotz der offenkundigen Eigenständigkeit moralischer Ansprüche nicht an der ebenso offenkundigen Tatsache vorbeisehen kann, dass der Mensch – gerade auch in seiner kulturellen Existenz – ein Naturwesen bleibt. Es war also auch der Grund für diffizile methodologische Unterscheidungen zu legen. Um also überhaupt eine lesbare Fassung zustande zu bringen, musste ich mich ganz auf die Darlegung des eigenen Gedankens beschränken. Lediglich die richtunggebenden Impulse einzelner Denker sind vermerkt. Wer meine Neigung zur Kritik, zur polemischen Klarstellung und zur Offenlegung auch der eigenen Hintergründe kennt, wird mir abnehmen, dass dies niemand mehr bedauert als ich selbst.
Einen gewissen Ersatz können die Texte bieten, die ich in den letzten zwanzig Jahren in Vorbereitung auf die vorliegende Grundlegung veröffentlicht habe. Aus meinen Schriften wird nichts wiederholt; aber sie dokumentieren ein Stück des Weges zur Philosophie der Individualität, die hier nun endlich vorliegt. Im Literaturverzeichnis sind einige der über diesen Weg Aufschluss gebenden Texte aufgeführt. Die früher publizierten Arbeiten geben auch zu erkennen, wovon in diesem Buch aus Platzgründen ebenfalls keine Rede sein kann: Das Ganze ist die Vorbereitung auf eine Philosophie der Politik, für die ich jetzt eine tragfähige, unseren gegenwärtigen Einsichten entsprechende Grundlage geschaffen zu haben glaube. Das gilt erst recht für die heute fast ausschließlich interessierenden Probleme der Angewandten Ethik, die ich aus Raumgründen [16]gar nicht erst erwähne, die aber stets im Blick sind, wann immer es um den hier erstmals normativ eingeholten Kontext des Lebens geht. Dabei darf freilich nicht vergessen werden, dass wir ethische Ansprüche nur an Menschen stellen.
Vom eigenen Versuch darf ich nicht sprechen, ohne mich dankbar an meine Lehrer zu erinnern. Das sind in diesem Zusammenhang Friedrich Kaulbach, Helmuth Schelsky und Gerold Prauss. Der eine hat mich in den Perspektivismus eingeübt, der zweite hat mir das Pathos der Wirklichkeitserkenntnis vorgelebt – ein kraftvoll überspieltes Leiden, das nur durch praktische Wirksamkeit erträglich wird; der dritte hat mir die alles tragende Macht des eigenen Impulses (Prauss verwendet den heute üblichen Begriff der »Intentionalität«) vor Augen geführt. Und jeder von ihnen hat mich auf seine Weise gelehrt, dass selbst die äußerste Anstrengung der individuellen Kräfte, ohne die Wissenschaft nun einmal nicht produktiv betrieben werden kann, der Offenheit gegenüber anderen bedarf. Schelsky hat mit guten, auch persönlich bis in die letzten Lebensjahre bestätigten Gründen Wilhelm von Humboldts Formel Einsamkeit und Freiheit populär gemacht. Und dennoch hat er so gelebt, als sei die behutsam gegen Humboldt gesetzte Korrektur Schleiermachers sein eigentlicher Wahlspruch, nämlich: Mitteilung und Tätigsein.
Es ist in jeder Hinsicht ein Glück, wenn man eigene Gedanken mit anderen erörtern kann. Deshalb habe ich allen Grund, meinem Berliner Kolloquium, vor allem aber Dina Emundts, Beatrix Himmelmann, Axel Hutter, Karsten Malowitz, Matthias Schloßberger, und Hector Wittwer zu danken. Mein besonderer Dank für Kritik und Korrektur gilt Karl-Heinz Gerschmann, Franziska Henningsen, Jacqueline Karl, Reinhard Mehring, Udo Tietz, Marcus Willaschek und – nicht zuletzt – Birgit Recki.
Berlin, am 30. Oktober 1998 Volker Gerhardt
[19]Einleitung
1. Das Neue in der Ethik
Dieser Versuch über Ethik enthält hoffentlich etwas grundsätzlich Neues. Robert Spaemanns großes Wort lassen wir für uns nicht gelten. Es besagt, eine moderne Ethik sei schon dadurch widerlegt, dass sie, nach zweitausendfünfhundert Jahren ethisch-philosophischer Tradition, überhaupt etwas Neues in Aussicht stelle.1 Die gezielte Enttäuschung einer moralphilosophischen Fortschrittserwartung hat einen guten Sinn. Es ist immer wieder richtig, dem hektischen Innovationsverlangen der Gegenwart entgegenzutreten. Die PhilosophiePhilosophie, Philosophieren kann es nicht dabei belassen, sich den Moden zu entziehen, sie hat die Pflicht, ihnen zu widersprechen.
Gleichwohl kann es nicht bei Spaemanns Einsicht bleiben. Denn sie gilt nur für die elementaren Ziele des moralischen Handelns. Bei den Zwecken und Zielen, und damit bei den Tugenden selbst, dürfte es in der Tat schwerlich gelingen, etwas Neues zu empfehlen. Zwar gibt es, wie gegenwärtig etwa die Bioethik vor Augen führt, neue Situationen mit neuen Problemen; sie verlangen auch nach neuen Formen der Regulation, Kooperation und Sanktion. Sucht man aber in den hochkomplexen modernen Lagen nach dem Kernbestand des moralischen Handelns, kommt man auf die gleichen Antworten, die wir seit der AntikeAntike, antik kennen. Daran will und wird auch das vorliegende Buch nichts ändern.
[20]Aber man darf nicht übersehen, dass sich die Philosophen schon seit Jahrhunderten gar nicht so sehr um neue Tugenden bemühen, sondern ganz und gar auf deren Begründung konzentriert sind. Und hier haben wir, wenn uns am Fortbestand einer philosophischen Ethik liegt, auf Neues zu hoffen. Denn die überlieferten Modelle der Rechtfertigung tragen schon lange nicht mehr.
Vielleicht muss man auch hier die Einschränkung machen, dass die Aussage nur für das moderne Verständnis jener alten Modelle gilt. Sie scheinen uns und unseren Vorgängern überholt, weil sie den neuzeitlichen Erwartungen an begriffliche Strenge, Allgemeingültigkeit und Wirklichkeitsbezug nicht mehr entsprechen. Zwar muss man bei genauerer Betrachtung zumindest Platon und Aristoteles zugestehen, dass ihre Begründungsverfahren im Ansatz keineswegs so veraltet sind, wie uns manche weismachen wollen. Aber gerade diese größten Bestände der Tradition bedürfen der Interpretation und der Transformation, ehe erkennbar werden kann, dass sie den verschärften Kriterien des gegenwärtigen Denkens durchaus genügen. Doch schon diese Deutung bedarf der Innovation; denn anders können wir die Gemeinsamkeiten zwischen der anscheinend so gründlich verlorenen alten Welt und unserer anscheinend so radikal verwandelten modernen Zeit nicht benennen.
Hinzu kommt, dass die Standards des gegenwärtigen Denkens alles andere als klar sind. Wenn Philosophen, die weltweit als Moraltheoretiker gelten, ziemlich abwegige Unterscheidungen zwischen Moral und Ethik einführen, sodass die Ethik nur auf eine angeblich nicht universalisierbare Frage nach dem guten LebenLeben beschränkt sein, die Moral aber die Standards universaler Gerechtigkeit abgeben soll; oder wenn sich der Utilitarismus, in welcher Spielart auch immer, überhaupt als Ethik präsentieren kann und damit die Verwirrung demonstriert, in [21]der ökonomischen Kalkül und moralischer Anspruch nicht mehr auseinandergehalten werden können; wenn die Ansicht verbreitet wird, in der zum zwischenmenschlichen Verkehr in der Tat unabdingbaren Anerkennung sei selbst schon ein PrinzipPrinzip der Ethik zu entdecken; wenn gar ein solches Prinzip in einer angeblich neu entdeckten Ich-Du-Beziehung enthalten sein soll, aber kein Wort darüber verloren wird, dass schon Sokrates die Selbsterkenntnis nur im Angesicht des anderen für möglich hielt; oder wenn eine ganze Schule der MoralphilosophiePhilosophie, Philosophieren seit zwei Jahrzehnten mit dem Versprechen beschäftigt ist, sie werde nun aber endlich den Übergang von der Ebene der Begründung zur Ebene der Anwendung aufzeigen, so, als seien in der Ethik Theorie und Praxis ähnlich unterschieden wie in den Ingenieurwissenschaften die Phase der Konstruktion von der der Produktion – dann sind das alles deutliche Anzeichen dafür, dass kein klares Urteil darüber herrscht, worin Moral und Ethik eigentlich bestehen. Also haben wir allen Grund, nach neuen Einsichten zu trachten, die wenigstens klären, was eigentlich zum einen wie zum anderen gehört.
Das Neue, auf das ich hoffe, soll sich aus der Erinnerung an etwas sehr Altes ergeben, auch wenn es sich uns immer wieder als neu präsentiert. Gemeint ist das LebenLeben, das wir sind, aus dem wir alles haben und in dem wir völlig aufgehen. Die älteste Ethik wusste von dieser vollständigen Einbindung des Menschen in den Lebenszusammenhang; und ihr gelang es auch, auf ihn bezogen zu bleiben. Denn sie beließ alles, was wir heute in ein Jenseits des LebensLeben verlegen – die Gesellschaft, die Geschichte, den Geist oder die Götter –, in der Sphäre des lebendigen Daseins.
Wie nahe liegend dieser antikeAntike, antik Ansatz des Denkens ist, wird auch heute augenblicklich sichtbar, wenn wir uns nur einmal versuchsweise vorstellen, Gesellschaft und Geschichte seien ohne jede Basis in der Natur, genauer: sie seien nicht in einem [22]fundamentalen Sinne immer auch Natur. Wären sie nicht in allem immer auch Natur, gäbe es kein einziges Ereignis und damit auch keine Struktur. Auch der Geist mit seinen Einsichten, Begriffen und Schlussfolgerungen wäre null und nichtig ohne die spontane Lebendigkeit leibhaftiger Individuen. Und was bliebe von einem Gott, an den wir glauben, wenn er, wie der verzweifelte Nietzsche seinen Narren sagen ließ, wirklich »tot« wäre? Ein toter Gott kann eben kein Gott mehr sein.
Ganz ähnlich ist es beim Menschen: Solange er noch nicht geboren und noch nicht zu eigenem Handeln fähig ist, kann er kein moralisch zurechenbares Subjekt sein; und wenn er gestorben ist, erlischt sein Anspruch auf eigene Lebensführung ganz von selbst. Zwar können wir im institutionellen Zusammenhang gesellschaftlicher Organisation auch einem ungeborenen Wesen Rechtsansprüche übertragen; entsprechend können wir den Willen eines Verstorbenen verbindlich machen. Doch auch dies steht unter der Prämisse des LebensLeben. Wenn niemand lebt, der die Rechte und Pflichten ernst nimmt, fehlt der Träger. Und das ist – im Fall der Ethik – stets ein Mensch, der sein Leben selbstbewusst führt. Wo die Kette des Lebens reißt, sind auch rechtliche und moralische Verbindlichkeiten unterbrochen. Für jeden, dem Recht und Moral wichtig sind, ist das ein zusätzlicher Grund, für die Kontinuität des Lebens einzutreten.
Das war den antikenAntike, antik Denkern bewusst. Deshalb kamen sie nicht auf die Idee, das Verhalten der Menschen von den leibhaftigen Bedingungen ihres Daseins zu lösen. Selbst in den Mythen von der Unterwelt bewahrten sie den Toten ihre Schatten. Der TodTod war nicht das Ende des LebensLeben, sondern die Wende in einer Metamorphose, die in der Geburt ihre Entsprechung hat. Alle ethische Überlegung stand somit im Dienste der »Lebensführung«Lebensführung (pros ton bion; vitam agere; regimen vitae). Sie war also auf das gerichtet, was der Einzelne – [23]natürlich im Kontext seiner Gemeinschaft – aus seinem LebenLeben macht. Es ist klar, dass sich dieser Bezug auf das gegebene Leben nur verschärft, wenn der TodTod als das definitive Ende eines Individuums begriffen wird, ein Ende, auf das weder Lohn noch Strafe, noch ein weiteres Leben folgt. Und so haben wir unter den modernen Bedingungen nur noch einen Grund mehr, auf die Basisbedingung unserer Lebendigkeit zu achten.
Dies gilt für die grundlegenden Funktionen des LebensLeben überhaupt, für die Tatsache der Endlichkeit. Verletzlichkeit und Triebhaftigkeit ebenso wie für die Angewiesenheit auf Eigenbewegung und Stoffwechsel; es gilt für den unumgänglichen Verkehr mit unseresgleichen und für das in aller Bindung offenkundige Verlangen nach Eigenständigkeit. Es gilt aber auch für die spezifisch menschlichen Konditionen des langen Wachsens und Reifens, der bewussten Außensteuerung durch Erziehung, Sitte und Recht sowie für die verlangte Binnensteuerung durch eigene Einsicht, die uns die Kenntnis von Stärken und Schwächen, von günstigen Gelegenheiten und möglichen Gefahren, von Glück und Gunst ebenso wie von Krankheiten, Notlagen oder zunehmendem Alter vermittelt und uns – alles in allem – das Bewusstsein der Situativität und der Individualität verschafft.
Alles dies darf der Ethik nicht gleichgültig sein. Sie kann keine Maßstäbe setzen und erst recht keine Gesetze vorschreiben, ohne auf die Konditionen des LebensLeben bezogen zu sein. Sie kann nicht die Anpassung ächten, wenn Anpassung zu den elementaren Bedingungen eines jeden Lebensvollzugs gehört. Sie kann nicht von AutonomieAutonomie, autonom und Freiheit sprechen, ohne zu sagen, welchen Ort diese PrinzipienPrinzip im Leben haben. Und sie kann keine Universalität behaupten, wo ein Handeln unter Bedingungen steht, die nur durch die jeweilige Position auf der Lebenskurve zu erklären sind.
[24]Ich sage nicht, dass die alteuropäische Ethik diese allem Handeln zugrunde liegenden Konditionen nicht beachtet hätte. Das wäre schon deshalb eine höchst problematische Behauptung, weil die Lebensbedingungen so umfassend sind, dass man ihnen noch nicht einmal in ihrer Missachtung oder Leugnung entkommt. Meine These zielt allein auf das Versäumnis, diese elementare Bindung an das Leben nicht genügend ausdrücklich zu machen.
Und so unternehme ich denn den Versuch, die Beziehung zwischen MoralEthik, Moral und LebenLeben genauer zu bestimmen. Dass dies auf so knappem Raum nur in extremer Beschränkung möglich ist, versteht sich hoffentlich von selbst. Mehr als eine Grundlegung ist nicht möglich. Mehr ist aber auch nicht nötig. Denn die PhilosophiePhilosophie, Philosophieren kann ohnehin nur einen Zugang zur Moral eröffnen. Die Moral selbst ist, wie wir sehen werden, ausschließlich Sache des Individuums, und zwar des Individuums, das ein Problem mit sich selber hat. Dass es bei dieser Akzentuierung wie von selbst zu einer Konzentration auf einige wesentliche Elemente des Lebens kommt, spricht für die Kohärenz zwischen beiden Seiten: Das LebenLebenhaben wir nur, sofern wir es führen. Und die Moral besteht in nichts anderem als darin, eben dies – theoretisch wie praktisch – ausdrücklich zu machen. Somit steht die – recht verstandene – Moral ganz und gar im Dienst eines – recht verstandenen – LebensLeben.
2. Die Entdeckung in der Krise
Der vorliegende Versuch einer Grundlegung der Ethik erscheint zum Ende eines Jahrhunderts. Man könnte spöttisch hinzufügen: am Ende eines Jahrtausends. Für manche sagt das schon alles. Zum Beispiel für Niklas Luhmann, der sich mit der Bemerkung hervorgetan hat, die Ethik habe immer nur zu [25]den Jahrhundertwenden Konjunktur. Sie soll also nicht mehr sein als ein Zeitgeistphänomen, vielleicht nur die Folge einer unterschwelligen Angst, die den systemtheoretisch nicht hinreichend aufgeklärten Menschen vor vermeintlichen Epochenwenden ergreift. Luhmann wollte daher auch den Astrologen (!) die Erklärung überlassen, »wieso dieser Komet Ethik regelmäßig gegen Ende des Jahrhunderts und ziemlich genau im 9. Jahrzehnt erscheint«.2
Dass ein Soziologe so leicht vor einer von ihm selbst behaupteten sozialen Tatsache kapituliert, geht uns nichts an. Man darf ihm allerdings nicht durchgehen lassen, dass er anderen Disziplinen einfach ihre Probleme abspricht und sich dabei auf höchst lückenhafte Daten stützt. Zum Beleg seiner These nennt er Kant für den Ausgang des 18. und Nietzsche für den des 19. Jahrhunderts. Dabei bleibt unerwähnt, dass Kant mit seinen Überlegungen zur Grundlegung der Ethik bereits 1762 begonnen hat und Nietzsches Beschäftigung mit moralphilosophischen Fragen spätestens 1875 ansetzt. Die Jahrhunderte waren jeweils noch in vollem Gang. Doch um seine Datenbasis ein wenig zu verbreitern, bezieht Luhmann auch noch die Siebzigerjahre der vorangegangenen Jahrhunderte ein, verweist indirekt auf Montaignes Essais, die erstmals 1580, und die Werke von Lipsius, Pascal, La Rochefoucauld und Gracián, die zwischen 1670 und 1680 erschienen. Er vergisst Spinozas Ethik, die, nach langjähriger Vorbereitung, 1677 veröffentlicht werden konnte.
Doch man braucht die Auswahl nur geringfügig zu erweitern, um zu erkennen, dass hinter der These des Soziologen kaum mehr als eine Bosheit steckt: Descartes’ Les passions de l’âme erschienen 1649, Hutchesons Inquiry into the Original of Our Ideas of Beauty and Virtue kam 1725 heraus, Hume folgte [26]mit seiner Enquiry Concerning the Principles of Morals1751 und Adam Smiths bedeutende Theory of Moral Sentiments1755. Schellings Freiheitsschrift erschien 1808; Hegel trug seine Moralphilosophie in Vorlesungen zwischen 1817 und 1830 vor; Kierkegaard legte seine moralphilosophische Überzeugung in Entweder/Oder dar. Das Buch kam erstmals 1842 auf den Markt. Kurz zuvor, nämlich 1839, hatte Schopenhauer seine (schon vorher verfassten) Studien über Die beiden Grundprobleme der Ethik herausgegeben; seine Aphorismen zur Lebensweisheit, eine der schönsten Reflexionen zur Moralphilosophie überhaupt, erschienen 1851. Das sind nur die bedeutendsten Schriften, von den zahllosen Systemen, Lehr- und Handbüchern zur Ethik, die das Jahrhundert füllen, längst bevor es sich zum Ende neigt, ganz zu schweigen.
Und in unserem Jahrhundert? Da haben wir Moores Principia Ethica gleich 1903. Schelers ingeniöse Studien über Sympathie und Ressentiment erscheinen zwischen 1913 und 1916, Nicolai Hartmanns Materiale Wertethik kommt 1926 heraus, Eduard Sprangers Lebensformen werden 1923 publiziert. In diesem Zeitraum erscheinen John Deweys einflussreiche Arbeiten über Erziehung und menschliches Verhalten, Albert Schweitzers Lebensethik, Martin Bubers dialogische Moral und Karl Löwiths grundlegende Analyse über den Menschen in der Rolle des Mitmenschen. Karl Jaspers’ dreibändige Philosophie, ein Systemversuch aus anspruchsvollster moralischer Gesinnung, ist 1930 abgeschlossen und erscheint 1932, zu einer Zeit, in der, wie Luhmann mit Sicherheit wusste, Edmund Husserl mit moralphilosophischen Untersuchungen beschäftigt war.
Die existenzialistische Ethik wird im Frankreich der Vierziger- und Fünfzigerjahre entworfen, in eben jener Zeit, in der die sprachanalytische Philosophie mit ihren Untersuchungen über intentions und moral propositions einsetzt; die Arbeiten [27]von Elizabeth Anscombe, Kurt Baier, H. Paul Grice oder William Frankena liegen der Mitte des Jahrhunderts näher als dessen Ende. Die in den Fünfzigerjahren ausgelöste Debatte beschäftigt die Philosophie seitdem unablässig und hat ihr zu wichtigen begrifflichen Abklärungen verholfen; doch gegen Ende des Jahrhunderts stehen die rein analytischen Untersuchungen auf einem toten Gleis.
Aber die Ethik hat nicht nur analytische Impulse erhalten: 1950 erscheint Otto Bollnows anschauliche Studie über die TugendenTugend, die vieles von dem enthält, was in der jüngeren Debatte über virtues angeblich erst wieder neu entdeckt werden musste. Es folgen die, wenn auch von der akademischen Philosophie nicht immer ernst genommenen, dafür aber umso stärker gelesenen und höchst beachtlichen Arbeiten von Romano Guardini und Josef Pieper. Émanuel Lévinas schreibt in diesen Jahren an seiner ethisch durchtränkten Theologie des Anderen; Arnold Gehlen deckt 1969 in Moral und Hypermoral auf, dass bereits sein grundlegendes anthropologisches Werk Der Mensch von 1940 und erst recht die Studie über Urmensch und Spätkultur von 1956 als Beitrag zur ethischen Selbsteinschätzung des Menschen gemeint waren. Schließlich tritt Hans Jonas bereits 1962 mit Organismus und Freiheit als bedeutender Moralphilosoph hervor. Seine große öko-moralische Bußpredigt von 1979, Das Prinzip Verantwortung, ist zwar der Jahrhundertwende schon etwas näher, bleibt dafür aber auch unter dem begrifflichen Niveau der früheren Studien.
Es ist also, mit Verlaub, der pure Unsinn, der Ethik nur eine Aufmerksamkeit zuzubilligen, die sich nach Art hysterischer Schübe einstellt. Richtig ist vielmehr die ganz und gar undramatische Auskunft, dass die Ethik eine der Grunddisziplinen der Philosophie darstellt und stets so viel Aufmerksamkeit erhält und verdient wie die Philosophie selbst. Es gibt sogar gute Gründe dafür, die ethische Selbstreflexion für den Ursprung [28]und den stets benötigten Boden des philosophischen Denkens überhaupt anzusehen. Dass dies einem Soziologen nicht behagt, der von der Soziologie nur noch eine dem menschlichen Handeln denkbar fernstehende Systemphilosophie übrig lässt, ist verständlich. Denn die beste Art, den gegen ihn erhobenen Philosophievorwurf abzuwehren, ist, die Philosophie für obsolet zu erklären und ihren wichtigsten Gegenstand an die Astrologie zu verweisen.
Wäre es Luhmann ernsthaft um eine soziologische These über den Zusammenhang zwischen Epochenbewusstsein und Ethik gegangen, hätte er freilich ein ganz anderes Phänomen benennen können, nämlich die Verbindung zwischen der KrisenerfahrungKrise und dem Bedürfnis nach ethischer Selbstversicherung. Denn es gibt in der Tat geschichtlich-gesellschaftliche Einflussfaktoren, die das Aufkommen ethischer Fragen begünstigen. So kann man schon die Entstehung der Ethik bei den Griechen mit der politisch-kulturellen KriseKrise in Verbindung bringen, die insbesondere in Athen des 5. vorchristlichen Jahrhunderts bewusst erfahren worden ist. Wenn ein überliefertes Selbstverständnis fragwürdig wird, hat man sich eben selbst zu fragen, was nun zu tun ist. Das geschieht erstmals durch die Sophistik in demselben Jahrhundert. Im großen Stil und mit breiter Wirkung setzt sie ihre radikale Kritik an der Überlieferung durch und wirbt mit dem Versprechen, für alle Lebenslagen das passende praktikable WissenWissen bereitzustellen.
Epochengeschichtlich kommt der Sophistik größte Bedeutung zu. Mit guten Gründen erkennen wir in ihr die erste europäische Aufklärung und damit die bis heute fortwirkende Bewegung, die sich die Entstehung der eigenständigen Wissenschaften verdankt. Ihr bleibendes Verdienst liegt in der gesellschaftlichen Verselbstständigung des kritischen Intellekts sowie in der Einsicht in die maßgebende KompetenzKompetenz des Menschen. Ihr Defizit aber war (und ist), dass sie den [29]Menschen, den sie, nach einem Wort des Protagoras, für das »Maß aller Dinge« erklärte, als eine bloß empirische Größe begriff. Der Mensch war ihr nur das, was er de facto verlangte und erreichte. Die Erkenntnis, dass sowohl das WissenWissen wie auch das sich in ihm artikulierende Selbst des Menschen nicht einfach von der Art des gegenständlich Gewussten sein können, blieb ihr verschlossen. Angesichts ihres virtuosen Umgangs mit dem WissenWissen kann man diese Unfähigkeit zur selbstkritischen Analyse ihres eigenen Mediums nur als tragisch bezeichnen. Es ist dies eine Tragik, die in der modernen Sophistik Friedrich Nietzsches ins Komische umschlägt; denn er hätte schon aus der Überlieferung wissen können, was Protagoras oder Gorgias allererst von sich aus hätten finden müssen.
Hier liegt das Verdienst des Sokrates. Er entdeckte, dass alles WissenWissen seinen Wert verliert, wenn es ohne Bezug zum selbstbewussten Anspruch des Menschen ist. Wenn man schon nicht weiß, wer man ist, dann muss man zumindest angeben können, als was man sich unter welchen Umständen versteht, um sich seines WissensWissen angemessen bedienen zu können. Sogar die Sachhaltigkeit des WissensWissen ist an die Referenz zum eigenen Können gebunden. Also kann man nichts wirklich wissenWissen, wenn man sich nicht wenigstens um Selbsterkenntnis bemüht und das dabei erworbene WissenWissen von sich selbst von sich selbst zum Ausgangspunkt jeder bewussten Entscheidung macht.
Daraus zog Platon die methodologische Konsequenz. Er machte klar, dass die SeeleSeele, also das sich im WissenWissen zeigende und es zugleich tragende SelbstSelbst, nicht zu den sinnlich vorkommenden Gegenständen des Wissens gehören kann. Vielmehr muss es eine grundsätzlich andere Stellung haben. Das Selbst muss von den sinnlich vorkommenden Fällen des Wissens ebenso geschieden sein, wie das Wissen selbst sich von seinen Inhalten unterscheidet. Denn andernfalls wäre es nicht in jedemWissenWissen gegenwärtig. Das Gleiche gilt für den BegriffBegriff: Er [30]kann nur dann die sich selbst gleiche Form der begriffenen Sachverhalte sein, wenn er einen prinzipiell anderen Status hat als sie. Der Begriff des Tisches ist von allen möglichen Tischen grundsätzlich verschieden. Das gilt nicht nur für alle Begriffe von sinnlich gegenwärtigen Gegenständen, sondern selbst noch für Begriffe von Begriffen.
Damit war die eigenständige Funktion der BegriffeBegriff entdeckt. Platon vermochte sie an immer neuen Beispielen zu erläutern, hatte aber zur Bezeichnung ihrer besonderen Stellung gegenüber der sinnlich wahrnehmbaren Realität nur das zumeist mythisch verklärte Bild einer allem irdischen Wandel entrückten IdeeIdee. Das hat ihm schon sein Schüler Aristoteles als Versagen vorgeworfen. Erst heute beginnt man zu begreifen, dass es an der Natur unseres Wissens liegen könnte, wenn wir diese Differenz tatsächlich nicht anders als in metaphorischen Wendungen ausdrücken können.3
Doch wie dem auch sei: Der Aufweis einer durch ihre innere Form ausgezeichneten Eigenständigkeit des Wissens war zugleich die Geburtsstunde der EthikEthik, Moral. In ihr wurde der allgemeine Rahmen eines Wissens vom richtigen Handeln vorgegeben: eine Lehre von jenen menschlichen Fähigkeiten, die es dem Einzelnen erlauben, ein gutes LebenLeben, gutes (eu zēn) zu führen. Diese Fähigkeit nannten die Griechen aretē. Wir übersetzen das Wort zumeist mit »Tugend«Tugend; treffender ist der Ausdruck »Tüchtigkeit«Tüchtigkeit, denn gemeint ist die Leistungsfähigkeit, in der ein Mensch aus eigener Einsicht sein Bestes gibt. Wer »Tugend«Tugend oder »Tüchtigkeit«Tüchtigkeit für antiquiert oder hausbacken hält, der kann aretē auch ziemlich genau mit »Kompetenz«Kompetenz übersetzen. Nur darf er dabei nicht vergessen, dass sich »Kompetenz« nicht auf eine bloß technische Leistung beschränken lässt und dass [31]jemand mit seiner Kompetenz nur dann überzeugen kann, wenn er ganz dahintersteht.
Mit der Konzeption eines allgemein verbindlichen, gleichwohl von jedem Einzelnen für sich zu erwerbenden Wissens war die Sophistik – als selbstvergessene Aufklärung zu beliebigen Zwecken – überwunden. Aber die tradierten Wertungen gewannen dadurch ihre Selbstverständlichkeit nicht zurück; die alten Tugenden wurden immer wieder neu in Zweifel gezogen. Also verlor sich auch das Bewusstsein der KriseKrise nicht, und mit ihm blieb das von der herrschenden Unsicherheit immer neu geschürte Verlangen, wenigstens aus eigener Einsicht zur Sicherheit der eigenen Lebensführung zu gelangen. So wurde die EthikEthik, Moral eine Lehre in der KriseKrise.
Natürlich wurde und wird eine KriseKrise – kollektiv und individuell – höchst unterschiedlich empfunden. Bei Niederlagen in Kriegen, im Niedergang einer Kultur oder eines Standes, zu dem man gehört, nach Naturkatastrophen oder vor befürchteten oder erhofften Zeitenwenden verstärken sich naturgemäß die Symptome einer allgemeinen Unsicherheit. Doch die stärkste Verunsicherung entsteht in jedem Einzelnen ganz von selbst: vor großen Herausforderungen, nach schweren Schicksalsschlägen oder in einer feindlichen Umgebung.
Unnötig zu sagen, dass es hier große individuelle Unterschiede gibt. Vielleicht gibt es Menschen, deren Selbstsicherheit aus natürlicher Kompetenz, aus Naivität oder aus Dummheit so groß ist, dass sie sich niemals ernstlich fragen, was sie denn tun sollen. Andere sehen sich durch ihre ängstliche, vorsichtige oder allgemein bedenkliche Natur ständig vor diese Frage gestellt. Entsprechend unterschiedlich fällt die individuelle Nachfrage nach EthikEthik, Moral aus. Es ist aber schwer vorstellbar, dass sich eines Tages niemand mehr für ethische Fragen interessiert. Denn es ist nicht zu erwarten, dass es ein menschliches Dasein ohne KrisenKrise gibt. Und nach allem, was wir vom [32]Menschen wissen, wird er sich in diesen Krisen auch immer wieder selbst zum eigenen Handeln nach eigenen Vorstellungen herausgefordert sehen. Also kommt er um das eigene Nachdenken über die Ziele und Mittel seines Handelns nicht herum. Er wird sich daher immer wieder fragen: Was soll ich tun? Mit dieser Frage aber ist er schon mitten in einer ethischen Reflexion.
Natürlich erfolgt eine solche Frage nicht voraussetzungslos. In der Regel braucht man ein gewisses Alter, eine elementare Erziehung, ein Minimum an Intelligenz und vielleicht auch ein Vorbild, an dem man sich orientiert. Doch alle physiologischen, psychischen und sozialen Konditionen werden äußerlich, sobald ein Individuum in Nachdenklichkeit über sein eigenes Handeln verfällt. Dann stellt es sich seine Fragen ganz von selbst. Dann ist es das eigene Problem, von dem es selbst nicht loskommt und auf das es seine eigene Antwort finden muss.
Auch hier könnte es den Einwand geben, dass uns moralische Fragen doch auch von anderen gestellt werden. Ja, vermutlich sind es immer zuerst die anderen, die uns ins GewissenGewissen reden; historisch-biografisch betrachtet sind sie es, die uns das Gewissen machen. Und dennoch bleiben auch diese initialen Fragen der anderen äußerlich, wenn wir sie uns nicht zu eigen machen. Nur wer sich die an ihn herangetragenen Probleme wirklich aneignet, wer sie sich ernsthaft selbst vorlegt, hat darin ein moralisches Problem. Also liegt das entscheidende, das die EthikEthik, Moral allererst schlafende Moment in der individuellen Selbstbezüglichkeit einer ernsthaft an sich selbst gestellten Frage. – Das ist die These des vorliegenden Buches. Es verfolgt eine systematische Absicht und verweist nur insoweit auf den historischen Hintergrund, als es für das Verständnis der These unerlässlich ist.
[33]1 Selbsterkenntnis
Zum Selbstverständnis der Philosophie
1. Selbstdenken
Der Reiz, immer wieder von Neuem sagen zu wollen, was Philosophie eigentlich ist, hängt keineswegs bloß an der Flüchtigkeit ihrer Gegenstände. Wichtig dürfte sein, dass die Philosophie mit jedem Menschen einen neuen Anfang macht. Deshalb kann man, wie Kant gesagt hat, eigentlich auch nicht die Philosophie, sondern nur das Philosophieren lernen.
Die Pointe dieser These ist, dass man etwas zu lernen hat, was sich streng genommen gar nicht lernen lässt, weil man es letztlich nur selber machen kann. Denn es gibt da nichts, was von anderen so und genau so gemacht würde. »Philosophieren lernen« besteht nicht darin, korrekt nachzumachen, was ein Lehrer tut. Das »Philosophieren«, von dem Kant spricht und um das es wohl schon Sokrates ging, wenn er seine Gesprächspartner zum eigenen Denken zu bewegen suchte, ist letztlich nur das, was man selber tut. Also ist das Philosophieren, wie es im Deutsch des 18. Jahrhunderts hieß, nichts anderes als ein SelbstdenkenSelbstdenken. Der Philosoph ist der Selbstdenker par excellence.
Das ist leichter gesagt als verstanden; noch schwerer ist es offenbar, es auch tatsächlich zu tun. Mit Sicherheit kann man die Formel von der Philosophie als SelbstdenkenSelbstdenken nur dann wirklich verstehen, wenn man selber denkt. SelbstdenkenSelbstdenken kann aber nur der, der über dieses SelbstSelbst verfügt, genauer: der es ist und es im Umgang mit sich gebraucht. Also fordert schon das bloße (theoretische) SelbstdenkenSelbstdenken eine elementare Form der (praktischen) Selbstbestimmung. Wenn aber das SelbstSelbst sowohl theoretisch wie auch praktisch zum Subjekt und Objekt eines SelbstverhältnissesSelbstverhältnis werden muss, um der Anforderung des SelbstdenkensSelbstdenken zu genügen, wird erkennbar, wie [34]allgegenwärtig der Einsatz des SelbstSelbst tatsächlich ist. Es hat jeweils dieses konkrete SelbstSelbst zu sein, das da denkt, wenn es wirklich ein SelbstdenkenSelbstdenken sein soll. Folglich ist die Aufgabe wirklich nur individuell zu erfüllen. Ich selbst muss denken, wenn eine Philosophie daraus werden soll. Wie aber denke ich selbst?
Mit dem SelbstdenkenSelbstdenken kann nicht das Strukturmerkmal gemeint sein, dem zufolge es sowieso immer nur »Ich«-sagende Wesen sind, bei denen wir den Vorgang des Denkens feststellen können. Jenes »es denkt«, das Lichtenberg mit Recht als zuweilen adäquate Kennzeichnung des Denkvorgangs benennt, steht (empirisch wie logisch) immer in Verbindung mit einem »Ich«. Auch wenn der Gedanke auftaucht wie ein Blitz, ist er doch – und zwar in Abgrenzung von dem, was andere denken – stets der eigene Gedanke, auch wenn man mitunter ganz »bei der Sache« ist, wird der Zustand als Denken nur durch Zuordnung zu mir selbstSelbst bewusst. So verknüpft sich das Ich mit allem, was uns äußerlich oder innerlich zugehört, mag es uns ursprünglich auch noch so fremd gewesen sein.
Also steht Kants »Ich denke«, das alle Vorstellungen begleiten können muss, auch nicht in Widerspruch zu dem »es denkt« Lichtenbergs – vorausgesetzt, es wird überhaupt etwas SachhaltigesSachhaltigkeit, sachhaltig gedacht. Denn jedes sachhaltigeSachhaltigkeit, sachhaltig Denken ist an ein Ich gebunden, auch wenn das Ich das Gefühl haben kann, selbst gar nicht der Urheber seiner Gedanken zu sein. An der Tatsache, dass jeder Gedanke an ein »Ich«-sagendes IndividuumIndividuum gebunden ist, ändert die Erfahrung, dass uns Gedanken zufliegen oder dass sie sich uns aufdrängen, nichts.
Doch wie gesagt: Diese rein formale Verknüpfung zwischen dem Denken und dem jeweiligen Ich kann nicht gemeint sein, wenn das SelbstdenkenSelbstdenken gefordert wird. Denn sonst erfüllte schon jedes beliebige Denken die Bedingung des SelbstdenkensSelbstdenken, weil über das notwendig mit anwesende Ich jedes beliebige Denken ein selbstbezügliches Denken ist.
[35]Also fordert das SelbstdenkenSelbstdenken ein profiliertes SelbstSelbst, ein Ich, das sich seiner konstitutiven und situativen Eigenart derart bewusst ist, dass sie nur durch unverwechselbar eigenes Denken zum Ausdruck gebracht werden kann. Dabei wird das SelbstSelbst, das jedem Denken anhängt, als selbstverständlich vorausgesetzt. Das allgemeineSelbst Selbstkommt jedem zu. Davon braucht somit beim SelbstdenkenSelbstdenken keine Rede zu sein – es sei denn, das Selbst Selbstist ein Gegenstand unter anderen, der uns sachlich interessiert (4.6; 5.4).4 Die ausdrückliche Aufforderung zum SelbstdenkenSelbstdenken hat vielmehr nur dort einen Sinn, wo sich ein seiner IndividualitätIndividualität, Individualisierung bewusstes SelbstSelbst, bewusstes in seinem eigenen Denken bestimmt. Ich, dieses konkrete Ich, als das ich mich selbst erfahre, muss meine eigenen Gedanken zu meinen eigenen Problemen und Zwecken denken. Das Philosophieren als SelbstdenkenSelbstdenken ist somit eine TätigkeitSelbsttätigkeit der ausdrücklich selbstbewussten IndividualitätIndividualität, Individualisierung.
Das ist keine neue Definition des Philosophierens, auf die man erst in einer hoch individualisierten Zivilgesellschaft am Ende des 20. Jahrhunderts verfällt. Im Anspruch auf das SelbstdenkenSelbstdenken hat bereits das 18. Jahrhundert nur eine Forderung erneuert, die schon dem dialogischen Philosophieren bei Sokrates und Platon zugrunde liegt. Kants didaktische Ersetzung der »Philosophie« durch das »Philosophieren« macht lediglich kenntlich, welchen grundlegenden Anteil das IndividuumIndividuumschon immer hatte und hat: Ob es überhaupt eine Philosophie gibt, die diesen Titel verdient, hängt allein davon ab, dass es eigenständig denkende Individuen gibt. Philosophieren kann immer nur der seiner selbst bewusste einzelne Mensch, auch wenn er es im faktischen oder virtuellen Gespräch mit anderen tut.
[36]Das symphilosophein, der Anspruch, im freundschaftlich-freien Gespräch miteinander zu philosophieren, steht dazu nicht im Widerspruch. Schon die AntikeAntike, antik kannte die individualisierende Sprengkraft des Philosophierens. Deshalb ist im symphilosophein bereits ein soziales Korrektiv zu sehen, das dem individuellen Denken förderlich sein kann. Das freie Gespräch über das eigene Denken zwingt nicht nur zur Verdeutlichung der Ansichten und Gründe, sondern eben dabei auch zur Klarstellung der eigenen Position. Also verstärkt es in der situativen Darlegung des eigenen Überlegens die IndividualisierungIndividualität, Individualisierung des ja stets für sich Nachdenkenden. Auch wenn ich aus Sorge für einen anderen zu denken versuche oder wenn ich mich in hermeneutischer Absicht an die Stelle eines anderen denke, bleibt es stets mein eigenes Denken.
Aus diesem elementaren Tatbestand der unaufhebbaren IndividualitätIndividualität, Individualisierung unseres IntellektsIntellekt macht die Philosophie ihr PathosPathos und ihr Prinzip. Aus dem habitus des Denkens wird das ethosEthos intellektueller Eigenständigkeit.Selbstständigkeit Aus den Vollzugsbedingungen des Geistes wird ein Programm, das eigentlich nur die Konsequenz dessen ist, was sich in jedem einzelnen Denkvorgang zeigt: Wenn es wirklich immer nur der Einzelne ist, der denken kann, dann hat sich der ernsthaftErnst Denkende auch ausdrücklich als IndividuumIndividuum zu präsentieren.
Das ist die gleichermaßen theoretische wie praktische Grundstellung dessen, der philosophiert. Folglich hängt die Philosophie als WissenschaftWissenschaft von der EigentätigkeitSelbsttätigkeit der Individuen ab, die aus den tradierten sowie aus den aktuellen Problemen ihres Fachs ihre eigenen Fragen machen, um ihre eigene Antwort zu suchen.
[37]2. Die eigene Einsicht suchenEinsicht, eigene
Nun könnte man mit guten Gründen einwenden, dass alle menschlichen Einrichtungen letztlich an der Aktivität einzelner Personen hängen. Wenn nicht wenigstens einer da ist, der etwas tut, kommen auch die unendlich vielen Leistungen nicht zustande, denen wir das Gros unserer gesellschaftlichen Tatsachen verdanken. Prinzipien, Institutionen und Strukturen gibt es nur, sofern Individuen tätig werden. Das gilt natürlich auch für die Philosophie; also wäre gar nichts Besonderes daran, das die Philosophie als Selbstdenken die Eigentätigkeit von Individuen fordert.
Doch dieser Einwand übersieht, dass wir im Selbst des Selbstdenkens die bloß formale Zuständigkeit eines einzelnen Wesens bereits überschritten haben und auf den Menschen setzen, der sich ausdrücklich seiner Individualität bewusst ist. Es reicht also nicht, dass hier überhaupt ein Einzelner tätig wird; gefragt ist vielmehr ein seiner selbst bewusstes Individuum, das sich in seiner Eigenart denkend auf sich selbst bezieht.Selbstbezug Andernfalls ergäbe es keinen Sinn, das Selbst des Denkens zu akzentuieren. Suche deine eigene EinsichtEinsicht, eigene und folge ihr – das ist der Wahlspruch der Philosophie. Jeder solle sich, so hat Kant es für die Aufklärung formuliert, seines eigenen Verstandes bedienen. Wäre das Ich nur insoweit gefragt, als es ohnehin bei jedem intellektuellen Akt beteiligt ist, bedürfte es der Betonung des jeweils eigenen Verstandes nicht. Also lebt die Philosophie tatsächlich aus einer selbstbewussten Forcierung der Individualität, eine Besonderheit, die sie, wie Platon bereits wusste, mit den Künsten teilt.5
[38]Die Philosophie also braucht die Individualität der Philosophierenden. Das ist eine durch die Jahrtausende hindurch so selbstverständlich mitgenommene Prämisse, dass sie erst in der Bedrohung durch gesellschaftliche Formierung ausdrücklich gemacht werden musste. Erst als mit der verbreiteten Kenntnis der Schrift die Bildung allgemein wurde, erst als die Wissenschaft ansetzte, zum Großbetrieb zu werden, also im Übergang vom 18. ins 19. Jahrhundert, sahen sich Philosophen genötigt, die Individualität ihres Denkens zu exponieren. Auch hier fällt die Gemeinsamkeit mit den Künstlern auf, die sich zur selben Zeit als Genie oder Dandy kultivierten und aus dem Einzelgängertum eine Lebensform zu machen suchten.
Dass dies den mit ihnen gemeinsam aufkommenden Ideologen verdächtig war, bedarf keiner Erklärung. Alle Partei- und Weltanschauungslehren des 19. und 20. Jahrhunderts haben die Individualität zu verfemen gesucht, am stärksten der Marxismus. Denn er machte den Intellektuellen die größten Versprechungen, weil er in seinem Machtanspruch nahezu ausschließlich auf sie angewiesen war; eben deshalb musste er die Eigendynamik des Denkens vor allem anderen fürchten. Mit dem Wissen, das die Kapitalanalyse den Intellektuellen zur Verfügung stellte, hatten sie den Schlüssel zur Macht. Also bedurften sie auch der schärfsten Kontrolle durch die parteiliche Organisation, der sie sich vorab durch die Abkehr von »Subjektivismus« und »Individualismus« zu unterwerfen hatten. Dazu haben bereits Marx und Engels den Grund gelegt; und so stand ihre Herrschaftslehre von Anfang an im Gegensatz zur Philosophie.
Die Abwehr des Individuellen gehörte auch zum Gemeingut der rassistischen, nationalistischen, kulturalistischen und [39]semireligiösen Ideologien, die in der Reaktion auf die dramatischen Veränderungen der modernen Lebenswelt entstanden sind. Ihre trüben Erfindungen werfen noch heute einen Schatten auf die Individualität. Wie anders ist es zu verstehen, dass sich in einer Kultur, die sich wesentlich den Leistungen ihrer Individuen verdankt, so viel dumpfe Sorge verbreitet, nur weil sich nach dem politischen Ende des Marxismus der Individualismus mit größerem Selbstbewusstsein entfaltet?
Doch wie dem auch sei: Die Philosophie betreibt seit über zweitausendfünfhundert Jahren eine Vertiefung und Steigerung der IndividualitätSteigerung der Individualität. In ihr wird das Selbst des Denkens ausdrücklich. Aus dem unumgänglichen Selbstbewusstsein eines jeden wird die Emphase jedes Einzelnen. Aus den Akten von Erkenntnis und Einsicht, denen sich die menschliche Kultur wohl nicht unwesentlich verdankt, geht eine eigene Praxis hervor, nämlich die Theorie selbst. Und die wendet der Philosoph von der Erkundung und Beschreibung der Sachverhalte auf sich selbst zurück, um sie zur SelbsterkenntnisSelbsterkenntnis zu sublimieren. Aus dem γνῶϑι σαυτόν, dieser Aufforderung des Weisheit spendenden Gottes an alle, die von ihm Aufklärung erhofften, machte Sokrates seine Lebensmaxime. Sie wurde zum ImperativImperativ für alle, die nach seinem Vorbild Aufschluss über das Ganze ihres Weltzusammenhangs suchen und dabei in der Erfahrung, dass sie nur in der Selbsterschließung zu EinsichtenEinsicht, eigene gelangen, die BedeutungBedeutung für sie haben, zu Philosophen geworden sind.
3. Das Individuelle im Allgemeinen
Im Philosophieren gewinnt ein WissenWissen, ganz gleich worauf es sich bezieht, BedeutungBedeutung für einen selbst. Wäre der BegriffBegriff nicht in Verruf geraten, könnte man sagen, dass letztlich jedes Philosophieren in eine Existenzphilosophie mündet. Denn in der [40]Selbsterkenntnis als dem A und O des Philosophierens vertieft sich das Bewusstsein unserer endlichen ExistenzExistenz. »Vertiefung« eines Bewusstseins ist aber nur als Steigerung einer Intensität zu erfahren. Folglich liegt bereits im Ansatz des Philosophierens eine Steigerung der IndividualitätSteigerung der Individualität.
Natürlich schließt die konstitutive Individualisierung im Akt und im Prozess des Selbstdenkens die Allgemeinheit sowohl im Anspruch wie auch im Ertrag des philosophischen Erkennens nicht aus. Wäre es anders, müsste schon der BegriffBegriff des Denkens vermieden werden. Denken ist stets Denken an oder von etwas. Damit hat es ursprünglich den Charakter der Objektivität (5.8). Und bereits das Denken an oder von etwas, obgleich es stets von einem individuellen Ich vollzogen wird und sich vielleicht nur auf dieses spezielle Etwas richtet, bewegt sich im Medium des BegriffsBegriff und ist insofern ursprünglich allgemeinAllgemeines, allgemein.
Daran ändert nichts, dass dieses Etwas auch ein Fantasieprodukt sein kann. Auch der mich vielleicht in diesem Augenblick beschäftigende Versuch, den afrikanischen Pegasus (ein so vermutlich nur von mir vorgestelltes geflügeltes Zebra) zu denken, benötigt den BegriffBegriff und ist insofern allgemeinAllgemeines, allgemein. Denn anders ließe sich der afrikanische Pegasus noch nicht einmal in meiner Vorstellung als dieser gesuchte Pegasus identifizieren. Schon das Minimum des Wissens, welche Sache ich eigentlich meine (ganz gleich, ob sie nur eingebildet ist oder offen vor aller Augen liegt), benötigt einen BegriffBegriff von dieser Sache. Im BegriffBegriff aber ist Allgemeinheit impliziert.
Üblicherweise wird an der Allgemeinheit philosophischer Erkenntnis nicht gezweifelt. In unserem Fall aber könnten Zweifel aufkommen, weil wir die Individualität des Ausgangspunktes als unabdingbar ansehen. Da könnte sich die Frage einstellen, ob denn der extreme Bezug auf das Individuum überhaupt Aussagen von allgemeinerAllgemeines, allgemein Tragweite erlaubt. Oder [41]spricht jedes philosophierende Individuum nur für und von sich selbst?
Die Frage unterstellt eine Unvereinbarkeit von Individualität und Allgemeinheit; sie legt zumindest eine Schwierigkeit in ihrer Vermittlung nahe. Doch von beidem kann keine Rede sein: Das Individuelle steht dem AllgemeinenAllgemeines, allgemein nicht entgegen; es bereitet ihm auch keine nennenswerten Probleme. Denn im Erkennen sind beide nur zwei Seiten ein und desselben Zusammenhangs.
Das ist leicht zu sehen, weil alles Wirkliche individuell verfasst ist, aber schon in dieser Verfassung weder benannt noch erkannt werden könnte, wenn es sich nicht im Medium des AllgemeinenAllgemeines, allgemein präsentierte. Dieser Text, so wie er jetzt vor mir auf dem Papier steht, ist von unbestreitbarer Individualität. Jedes Wort kommt in seinem speziellen Kontext nur einmal vor, obgleich es sich in anderen Kontexten mehrfach wiederholt. Jeder Buchstabe steht an seiner Stelle nur dieses eine Mal, auch wenn er im Text unablässig wiederkehrt. Doch alle diese Einsichten in die Einmaligkeit und Einzigartigkeit einer jeden Sache an ihrer Stelle in Raum und Zeit eröffnen sich mir nur, indem ich diesen Text überhaupt als Text, dieses Wort überhaupt als Wort und diesen Buchstaben überhaupt als Buchstaben identifizieren kann. So findet sich das Individuelle immer als Fall eines AllgemeinenAllgemeines, allgemein, das selbst wieder auf anderes AllgemeinesAllgemeines, allgemein verweist.
Aber es ist nicht nur das Individuum, das ohne AllgemeinesAllgemeines, allgemein nicht erkannt werden kann: Auch das AllgemeineAllgemeines, allgemein ist nichts ohne den Fall, in dem es sich exemplifiziert. Ohne das Individuelle, in dem es sich konkretisiert, bliebe es bedeutungslos. Schließlich weiß ich mich selbst als das individuelle Wesen, das sich jetzt dieses epistemische Wechselspiel vor Augen führt, nur als ein zur Einsicht fähiges Wesen überhaupt. Also gilt für alle Dinge und Beziehungen dieser Welt – [42]einschließlich meiner selbst –, dass sie als individuelle nur generell ansprechbar sind. Das Einzelne ist nur im AllgemeinenAllgemeines, allgemein.
Das gilt selbst für absolute Singularitäten, also für etwas, das nicht nur an dieser Raum-Zeit-Stelle, sondern überhaupt nur einmal vorkommt: Auch das vollkommen Einmalige (gesetzt: es kommt vor) kann nur im Medium des AllgemeinenAllgemeines, allgemein benannt und erkannt werden. Ja, selbst für den äußersten BegriffBegriff der Individualität des Menschen wird ein allgemeinerAllgemeines, allgemein Begriff unterlegt. Denn hier wird der Begriff zur Ausgrenzung des Nicht-Begrifflichen nicht weniger dringend benötigt als in jenen weniger dramatischen Fällen, in denen ein Individuelles restlos zu der Menge gehört, die der BegriffBegriff definiert.
So viel mag genügen, um den Zweifel auszuräumen, ein seiner selbst in seiner unverwechselbaren Eigenart bewusstes Individuum sei nicht zu allgemeinenAllgemeines, allgemein Einsichten disponiert. Ist dies erst einmal anerkannt, kann man das Individuum genauso behandeln, wie es die Philosophie schon immer getan hat, wenn sie den Menschen als erkennendes und handelndes Wesen betrachtet. Nur darin hat sie hinzuzulernen, dass sie die Individualität ihres Ausgangspunktes endlich ernster nimmt.
4. Wirklichkeit und Wirksamkeit des Selbst
Darüber aber darf man nicht vergessen, dass die philosophische ErkenntnisErkenntnis, wie alle Erkenntnis, WelterkenntnisWelterkenntnis ist. Welt nennen wir das Ganze der Wirklichkeit, in der wir sind. Also ist ErkenntnisErkenntnis auf die WirklichkeitWirklichkeit gerichtet, in der wir nicht nur gleichsam wie in einem großen Gehäuse leben, sondern die wir selber sind. Wären wir nicht selber wirklich, ginge uns die Wirklichkeit nichts an.
Wie sehr sie uns aber etwas angeht, zeigt sich vor allem daran, dass sie uns ProblemeProblem macht. Und da sie, die WirklichkeitWirklichkeit, es zugleich ist, in der sich einzig ProblemeProblem lösen lassen, haben [43]wir augenblicklich einen Eindruck von dem uns ganz und gar umfassenden Charakter der RealitätRealität. Ihr entkommen wir nur in der Illusion. Doch schon die Frage, ob die Illusion uns tatsächlich aus der Realität entkommen lässt, holt uns automatisch in die WirklichkeitWirklichkeit zurück. Man müsste die Illusion völlig unabhängig von der RealitätRealität, ganz ohne Differenz zu ihr entdecken können, um die Kraft der Imagination zur vollen Entfaltung zu bringen. Aber ohne den abgrenzenden Bezug zur WirklichkeitWirklichkeit bleibt der Illusion nichts, was sie noch gefährlich oder verführerisch machen könnte. Also bleibt auch sie ganz und gar der RealitätRealität verpflichtet.
Dass angesichts der dichten, durch uns hindurch-, in uns hineingehenden und alle Unterscheidungen vereinnahmenden Gegenwärtigkeit des Wirklichen der IdealismusIdealismus überhaupt eine Chance hatte und hat, liegt daran, dass es allererst die ErkenntnisErkenntnis ist, die uns auf die Wirklichkeit Wirklichkeitals etwas allgemein Verbindliches verweist. Erst im Anspruch auf ErkenntnisErkenntnis kommen wir zur Unterscheidung zwischen dem, was wirklich, und dem, was nur ein Irrtum ist. Die ErkenntnisErkenntnis sondiert die RealitätRealität; erst in ihrem Licht lernen wir, zwischen dem Realen und dem Irrealen zu unterscheiden. Und es ist diese Unterscheidung, von der, im Bewusstsein des erkennenden Wesens, alles abhängt: Kann der Deich dem Druck des Wassers standhalten, oder wird er brechen? Ist dort eine Wasser spendende Oase oder falle ich wieder nur einer Halluzination zum Opfer? Gibt es das Medikament, das mich retten könnte? Liebt sie mich wirklich oder spielt sie mir nur etwas vor?
Diese Fragen sind, wie alle anderen ihrer Art, darauf gerichtet, ob etwas wirklich ist oder nicht. Sie eruieren die RealitätRealität: Im mehr oder weniger expliziten Bewusstsein von Alternativen suchen sie zu erkunden, ob es das tatsächlich gibt, was wir erwarten. Dabei wäre es selbst eine Illusion zu glauben, die WirklichkeitWirklichkeit sei so etwas wie der uns ganz [44]umschließende, vollständig mit Gegenständen ausgefüllte Raum, in dem wir uns mit der Apparatur unserer ErkenntnisErkenntnis bewegen, um sie in die Registratur unseres Wissens aufzunehmen. Denn die WirklichkeitWirklichkeit haben wir zunächst und in allem an uns selbst – und damit auch an unseren Erwartungen und Wünschen. Die RealitätRealität, die wir selber sind, zeigt sich an unserer WirksamkeitWirksamkeit, wirksam, die bereits in unseren BedürfnissenBedürfnis, Bedürftigkeit zum Ausdruck kommt und notwendig auf deren Befriedigung, als auf ErfolgErfolg und Erfüllung angelegt ist.
Mit der Ausrichtung auf ErfolgErfolg aber fügt sich die Gesamtheit unserer eigenen Organisation in den Ablauf des uns nicht nur äußerlich berührenden, sondern leibhaftig durch uns hindurchgehendes Geschehens, das sich ebenfalls als »Erfolg« beschreiben lässt: als der objektive Prozess in dem aus einer Wirkung unablässig die nächste erfolgt. So sind wir mit dem ursprünglichen Streben nach ErfolgErfolg von Anfang bis Ende in die lückenlose Folge von Ursachen und Wirkungen eingebunden. Und auch dies sind wir keineswegs bloß äußerlich. Denn wir setzen in unserer impliziten Erfolgserwartung auf eben diese lückenlose Folge von Ereignissen. Wäre dies anders, wäre jedes Handeln zum Scheitern verurteilt, und ErkenntnisErkenntnis, sofern sie überhaupt möglich wäre, bliebe ohne jeden Effekt.
Um kenntlich zu machen, wie dicht der Stoff der RealitätRealität gewirkt ist, können wir auch sagen: Die ErkenntnisErkenntnis steht im Dienst der WirksamkeitWirksamkeit, wirksam unserer individuellenWirklichkeitWirklichkeit in der Wirklichkeit überhaupt. Sie ist das Organ individueller Aktivität in eben der allgemeinen RealitätRealität, die wir selber immer auch im unmittelbaren Zusammenhang mit allen und allem anderen sind. Als Individuen sind wir durch und durch Teil der physischen Welt. Und nur weil das so ist, können wir in ihr, als Teil eines Ganzen, wirksamWirksamkeit, wirksam sein. Für die soziale Welt, die ebenfalls durch und durch Teil der physischen Welt ist, gilt das entsprechend: Auch ihr gehört das Individuum in seiner [45]WirksamkeitWirksamkeit, wirksam vollständig zu. Die Gleichung von actio und reactio hat keine Ausnahme. Und nur weil das so ist, kann es als Individuum sozial tätig sein. Es muss mit seinesgleichen von außen wie von innenAußen/Innen her verbunden sein, um überhaupt in Gesellschaft handeln zu können.
5. Selbsterkenntnis in der Welt
Die durchgängige Wirksamkeit – gerade auch bei effektiv gezogenen GrenzenGrenze, Grenzbestimmung – ist schließlich auch das Kennzeichen des LebensLeben, dem das IndividuumIndividuum in allen seinen Leistungen vollständig angehört: Es muss, um überhaupt es selbst zu sein, in einer leibhaftig-lebendigen Beziehung zu seinesgleichen und zu seiner Umgebung stehen. Die GrenzenGrenze, Grenzbestimmung, die es dabei zwischen sich und allem anderen vorfindet, GrenzenGrenze, Grenzbestimmung, die es teils selber erweitert, verstärkt und sichert, teils durchlässig macht oder aufhebt, zu einem nicht geringen Teil aber einfach nicht ändern kann, sind FunktionenFunktion, Funktionalität seiner biologischen OrganisationOrganisation, die beim Menschen von den psychischen, sozialen, kulturellen und geistigen Momenten seines Daseins nicht zu trennen sind. Als GrenzenGrenze, Grenzbestimmung wirken sie nur bei durchgängiger Wirksamkeit der zugrunde liegenden Kräfte. Die Schwerkraft muss den Organismus ganz erfassen, wenn er sich – gegen sie und zugleich mit ihrer Hilfe – fortbewegen will; zum Stoffwechsel kommt es nur, weil es die gleichen chemischen Gesetze sind, die innen wie außenAußen/Innen wirken. Entsprechendes gilt für die überkommenen Gewohnheiten, die Lautbildung der Sprache oder auch für die Blicke der anderen, die jeweils durch das hindurchgehen, was ein IndividuumIndividuum als seine GrenzeGrenze, Grenzbestimmung behaupten oder aufheben möchte.
Das Gleiche gilt schließlich auch für die ErkenntnisErkenntnis, die auf der Ebene der bewussten OrganisationOrganisation des individuellen LebensLeben selbst Ausdruck der kontinuierlichen Wirksamkeit [46]zwischen äußeren und inneren Vorgängen ist. Gäbe es die Durchgängigkeit der Wirkungsstränge nicht, fehlte die Gewähr dafür, dass überhaupt etwas Sachhaltiges ermittelt werden kann. ErkenntnisErkenntnis im alltäglichen wie im strikten Sinn des Wortes wäre somit gar nicht möglich. Also haben wir davon auszugehen, dass auch die ErkenntnisErkenntnis eine organische Leistung im Feld der uns durchwirkenden Kräfte ist, ungeachtet der Befürchtung, dass sich die Probleme der biologischen SelbstorganisationSelbstorganisation ins Unabsehbare potenzieren, sobald es um einen adäquaten Begriff der SelbsterkenntnisSelbsterkenntnis geht.
Diese Änderungen stehen hier nur, um erahnen zu lassen, dass wir mit dem Versuch einer ErkenntnisErkenntnis der Erkenntnis vor dem Abgrund der SelbstreflexionSelbstreflexion stehen, der sich mitten im Massiv der RealitätRealität auftut. Die einzige Sicherheit, die sich uns hier theoretisch bietet, ist, dass uns zwar schwindlig werden kann, aber kein Absturz möglich ist. Denn der RealitätRealität entkommen wir nie – weder außen noch innenAußen/Innen. Wirklich scheitern können wir nur mit unserer eigenen AktivitätSelbstständigkeit. Nur sofern wir selbst auf etwas aus sind, können wir die RealitätRealität verfehlen, die wir erwarten. Also ist auch das, was wir als »wirklich« ansehen, auf die Selbstständigkeit gegründet, also auf das individuelle SelbstSelbst, das sich schon im (theoretischen) Selbstdenken (praktisch) selbst bestimmt. Der Zugang zur RealitätRealität bleibt somit unvollständig, nein: Er wird verfehlt, wenn die individuelle Verfassung des SelbstSelbst nicht einbezogen wird. Das IndividuumIndividuum hat sich, so wie es ist, als wirksamer Teil der WirklichkeitWirklichkeit zu denken, wenn es einen adäquaten Begriff der Welt in Anschlag bringen will.
Wer also die Absicht hat, erkennend auf die Wirklichkeit zuzugehen, der hat nicht nur der Vollständigkeit halber auch sich selber einzubeziehen; er hat vielmehr von sich selber auszugehenAusgangspunkt, eigener. Denn nur in ihm liegt der Impuls zur Wirksamkeit und zugleich die Ursache für das Treffen oder Verfehlen der [47]jeweils gemeinten WirklichkeitWirklichkeit. Also zeigt sich auch von hier, dass die SelbsterkenntnisSelbsterkenntnis das Element der PhilosophiePhilosophie, Philosophieren ist, und sie bleibt es auch dann, wenn ein Denker im Ausgriff auf das Ganze der RealitätRealität sich anscheinend unendlich weit vom selbsttätig-selbstdenkenden IndividuumIndividuum, das er selber ist, entfernt. Wann immer Vollständigkeitserwartungen im Spiele sind – und sie sind im Spiel, wann immer konsequentKonsequenz, konsequent gedacht werden soll –, ist die RealitätRealität des selbsttätig-selbstdenkenden IndividuumsIndividuum unabweisbar. Folglich wird man die SelbsterkenntnisSelbsterkenntnis in der PhilosophiePhilosophie, Philosophieren auch dann nicht los, wenn man sich ganz auf die Erschließung der scheinbar rein objektiven Gegenstandsbereiche des Lebens, der Natur oder gar des Seins verlegt.
Es besteht andererseits aber auch keine Gefahr, die Welt zu verlieren, wenn man sich ganz auf die SelbsterkenntnisSelbsterkenntnis zurückzuziehen sucht. Denn auf ein Selbst stoßen wir nur, sofern es wirksam ist. Um nicht dogmatisch zu erscheinen, kann man noch vorsichtiger formulieren: Wir stoßen nur dann auf ein Selbst, sofern etwas an uns selbst wirksam ist, das wir in Abgrenzung zu anderen, uns nicht in der gleichen Weise zugehörigen Momenten der Wirksamkeit als »Selbst«Wirksamkeit des Selbst bezeichnen (4.7). Doch wie immer wir die Zusammenhänge auch benennen: Die Wirksamkeit, in der etwas als Folge unserer eigenen Tätigkeit erscheint, werden wir nicht los. Und da diese Wirksamkeit gleichsam durch uns hindurchgeht, also nur wirklich ist, sofern sie nicht nur auf uns selbst beschränkt ist, sondern wir in etwas anderem auf WiderstandWiderstand stoßen, sind wir niemals bloß bei uns selbst, sondern immer zugleich auch bei der Welt. SelbsterkenntnisSelbsterkenntnis, konsequentKonsequenz, konsequent betrieben, führt zur WelterkenntnisWelterkenntnis – und umgekehrt.
Allein dadurch steht die PhilosophiePhilosophie, Philosophieren, die sich seit Sokrates mit guten Gründen als SelbsterkenntnisSelbsterkenntnis begreift, in engster Verbindung mit den alltäglichen Formen der neugierigen [48]Erschließung der Welt. Zur ErkenntnisErkenntnis als Organ unserer Wirksamkeit gehört alles, was wir als flüchtige Kenntnis, Beobachtung, Entdeckung, Einsicht oder gut gesichertes Wissen ansehen. Zu ihr gehört aber auch der methodisch validierte Bestand der WissenschaftWissenschaft, und es gibt keinen Grund, die Einsichten der PhilosophiePhilosophie, Philosophieren mitsamt der von ihr angestrebten SelbsterkenntnisSelbsterkenntnis des Einzelnen davon auszunehmen. Das PathosPathos, mit dem der Erkenntnisanspruch des PhilosophierensPhilosophie, Philosophieren immer wieder von dem der einzelnen Wissenschaften abgehoben wird, führt letztlich zur Preisgabe der ErkenntnisErkenntnis. Das prominenteste Beispiel ist Heidegger, der die Einzelwissenschaften »transzendieren« will, um zur PhilosophiePhilosophie, Philosophieren zu gelangen.6 Kein Wunder, dass er nirgendwo mehr anlangt und im Andenken des Seins schließlich auch das begriffliche Erkennen fahren lässt.
Gerade wenn man glaubt, PhilosophierenPhilosophie, Philosophieren sei ursprünglicher und umfassender als die WissenschaftWissenschaft, muss man auf die Gemeinsamkeit in Anlass und Anspruch achten. Und die liegt nun einmal in dem Verlangen nach ErkenntnisErkenntnis. Konsequent verfolgt führt jede ErkenntnisErkenntnis