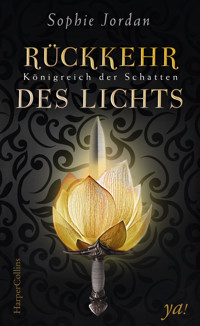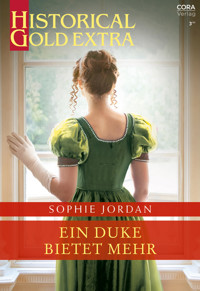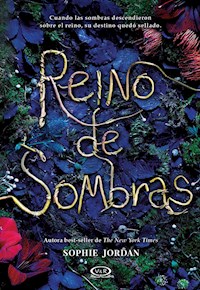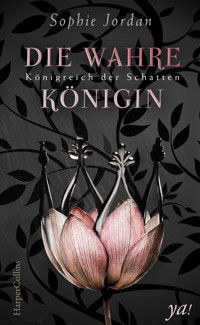Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Loewe
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: Infernale
- Sprache: Deutsch
Der erste Band der neuen Jugendbuch-Reihe von Firelight-Autorin Sophie Jordan konfrontiert Leser mit der Frage, inwiefern unsere DNA unser Schicksal bestimmt. Der Auftakt zu einer spannenden Reihe überzeugt mit packender Action, gefühlvoller Romantik und der schwierigen Suche nach der eigenen Identität. Von klein auf hörte ich Wörter wie begabt. Überdurchschnittlich. Begnadet. Ich hatte all diese Wünsche, wollte etwas werden. Jemand. Niemand sagte: Das geht nicht. Niemand sagte: Mörderin. Als Davy in einem DNA-Test positiv auf das Mördergen Homicidal Tendency Syndrome (HTS) getestet wird, bricht ihre heile Welt zusammen. Sie muss die Schule wechseln, ihre Beziehung scheitert, ihre Freunde fürchten sich vor ihr und ihre Eltern meiden sie. Aber sie kann nicht glauben, dass sie imstande sein soll, einen Menschen zu töten. Doch Verrat und Verstoß zwingen Davy zum Äußersten. Wird sie das werden, für das alle Welt sie hält und vor dem sie sich am meisten fürchtet - eine Mörderin? Sophie Jordan spinnt aus der Frage, wie stark Gene unseren freien Willen beeinflussen, eine actionreiche Jugendbuch-Reihe über den Versuch, sich seiner Vorherbestimmung zu entziehen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 429
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
TEIL 1
TRÄGER
Pressemitteilung
Zur sofortigen Veröffentlichung:
Kontakt: Pressestelle des Ministeriums für Gesundheitspflege, Amt für Sucht- und Gewaltprävention
15.März 2021
Leiter der Gesundheitsbehörde veröffentlicht neues Gutachten zu HTS-Gen
Bereits über 19.000 registrierte Träger
KAPITEL 1
Ich habe schon immer gewusst, dass ich anders bin.
Mit drei Jahren habe ich mich ans Klavier gesetzt und Chopin gespielt. Mom behauptet, ich hätte das Stück ein paar Tage zuvor in einem Aufzug gehört. Ich kann nicht sagen, wo ich es gehört habe. Ich wusste einfach, welchen Finger ich auf welche Taste legen … und wie ich sie weiterbewegen musste. So, wie man seine ersten Schritte macht. Es war eben etwas, das ich konnte. Etwas, das ich einfach tat.
Musik war meine Gabe. Etwas, das ich konnte, ohne mich anstrengen zu müssen. Erst Klavier. Dann Flöte. Dann Geige. Es dauerte nie lange, bis ich ein neues Instrument beherrschte. Von klein auf hörte ich Wörter wie begabt. Überdurchschnittlich. Begnadet. Als sich zeigte, dass ich noch dazu eine Stimme besaß, die sich mit meinen Fähigkeiten an den Instrumenten messen konnte, nannte man mich »Wunderkind«.
Von diesen Talenten abgesehen hatte ich jedoch die ganz normalen Träume. Mit sechs wollte ich Archäologin werden. Im Jahr darauf Rennfahrerin. Natürlich kam zwischendurch die obligatorische Prinzessinnenphase. Da verbrachte ich endlos viele Stunden in meinem Zimmer und baute aufwendige Burgen, bis mein Bruder hereinstürmte und sie kaputt machte. Dann tat ich so, als wäre es der Angriff eines Drachen gewesen, und baute sie wieder auf.
Ich hatte all diese Wünsche, wollte etwas werden. Jemand.
Niemand sagte: Das geht nicht.
Niemand sagte: Mörderin.
Mit geschlossenen Augen genieße ich das Gefühl von Zacs Lippen an meinem Hals. Er küsst sich langsam bis zu dem empfindlichen Punkt direkt unterhalb des Ohrs vor. Ich kichere und zittere am ganzen Leib.
»Zac, wir sind in der Schule«, erinnere ich ihn, rücke ein wenig von ihm ab und knuffe ihn halbherzig gegen die Schulter. Strahlend grüne Augen treffen mich und mir verschlägt es den Atem.
Zwei Mädels aus der Unterstufe gehen an uns vorbei. Sie versuchen, uns nicht anzusehen und sich cool zu geben, aber es ist offensichtlich, wie sehr sie mit sich kämpfen. Einen Kampf, den sie verlieren. Ihre Blicke streifen Zac voller Bewunderung. Er trägt eine Sporthose. Ein hautenges Everton-Rugbytrikot betont seinen schlanken Oberkörper. Als er den Arm hebt, um sich hinter mir am Spind abzustützen, rutscht das Trikot hoch und gibt den Blick auf einen flachen Bauch frei, gestählt von den vielen Stunden in der Sporthalle. Mein Mund wird ganz trocken.
Die Mädchen gehen weiter, flüstern aber gerade laut genug, dass ich sie verstehen kann: »Ist der scharf … hat die ein Glück …«
Zac bemerkt sie nicht mal. »Gefällt dir das etwa nicht?« Er lehnt sich an mich, presst mich gegen den Spind und küsst mich zärtlich auf den Mundwinkel. »Oder das?« Er haucht mir einen Kuss aufs Kinn.
Mein Bauch fährt Achterbahn. Ich bin kurz davor zu vergessen, dass mich MrsMcGary und ein Riesenberg an Mathehausaufgaben erwarten. Kurz davor, weiter mit Zac vor dem Probenraum des Orchesters rumzuknutschen, in dem Anthony Miller sich mäßig erfolgreich am Schlagzeug aufwärmt. Einem der wenigen Instrumente, das ich nicht beherrsche, das ich aber vermutlich trotzdem besser spielen könnte als er.
Zac löst sich mit einem Seufzer von mir und schenkt mir einen dieser verführerischen Blicke, die er für unwiderstehlich hält. Und zu Recht. Schließlich bringt er jedes Mädchen an der Schule damit ins Stolpern.
Aber er hat sich für mich entschieden. Mir geht das Herz auf und ich lasse mich noch einmal küssen, obwohl ich schon zu spät bin und MrsMcGary es absolut nicht leiden kann, wenn ich zu spät zur Probe komme. Sie betont immer wieder, dass ich als gutes Beispiel vorangehen soll.
Tori kommt auf uns zu und verdreht die Augen. »Nehmt euch ein Zimmer.« Sie zieht die Tür zum Probenraum auf und das herausdröhnende Schlagzeugsolo zerfetzt mir das Gehör.
Tori hält mir die Tür auf. »Kommst du, Davy?«
Zac mustert sie schräg. »Davy ist gleich da.«
Tori zögert und schaut mich an wie ein verprügelter Welpe. »Unsere Verabredung für heute Abend steht aber noch, oder? Du wolltest doch, dass ich dir bei den Mathehausaufgaben helfe.«
Ich nicke. »Ja, klar.« Integralrechnung, mein Untergang. Ich habe in den letzten sechs Wochen mehr schlecht als recht meine Eins gehalten, was ich aber hauptsächlich Tori und ihrer Engelsgeduld zu verdanken habe. »Die Verabredung steht.«
Sie lächelt, scheint beruhigt. Ich erwidere ihr Lächeln. »Ich komm gleich nach, hältst du mir einen Platz frei?«
Tori verschwindet im Probenraum und Zac stöhnt.
Ich streichle ihm über die harte Brust. »Sei nett.«
»Immer funkt sie dazwischen.«
Obwohl ich mir große Mühe gebe, die Zeit gerecht zwischen Zac und Tori aufzuteilen, ist es doch immer ein Drahtseilakt. Keiner von ihnen ist je zufrieden. »Habe ich schon mal erwähnt, wie sehr ich mich auf nächstes Jahr freue?«, frage ich. Was anderes fällt mir nicht ein, wenn er sich über Tori beklagt.
Er schaut mich wissend an. Er hat eine ganz besondere Art, mich anzuschauen. So eindringlich. Als könnte er mir direkt in die Seele blicken. Er weiß, dass ich ihn mit dieser Bemerkung über unsere Zukunft ablenken will. Glücklicherweise funktioniert es.
Zac fährt mir mit den Fingern durch die Haare. Denn er mag es, wenn ich sie offen trage, berührt sie so gern. Berührt mich so gern. Ja, ich geb’s zu, ich bin total süchtig nach meinem Freund. Es fällt uns immer schwerer, nicht übereinander herzufallen.
»Ja, und weißt du, was das Allerbeste sein wird?« Er hält meinen Blick. »Unsere Zimmer im Wohnheim.«
Ich lache. Nächstes Jahr. Die Vorstellung ist einfach unglaublich verlockend. Ich an der Juilliard. Zac an der NYU. Eigentlich sollte ich mich nicht so über die Aussicht freuen, dass meine beste Freundin auf ein College Hunderte Kilometer entfernt gehen wird, aber es wird sicher eine Erleichterung, nicht die ganze Zeit Rücksicht auf Tori nehmen zu müssen.
Mein Handy klingelt. Ich schiebe Zac ein Stück weg, um nachzusehen, wer anruft. Ich schaue zu ihm auf und forme mit den Lippen ein Wort: Mom.
Zac hebt eine Augenbraue. Meine Mutter arbeitet normalerweise um diese Zeit.
»Hallo?«, frage ich.
»Davy, komm sofort nach Hause.«
Ich zögere. Nicht wegen der Forderung, sondern weil ihre Stimme so zittert. Sehr untypisch für Mom. Sie spricht sonst immer schnell, die Wörter sprudeln dann nur so aus ihr heraus. Liegt vermutlich daran, dass sie normalerweise stundenlang Leute in ihrer Designfirma herumkommandiert.
»Ich habe Probe –«
»Sofort, Davy«, fällt sie mir ins Wort.
»Ist alles in Ordnung?« Schweigen folgt auf meine Frage und ich weiß, dass nicht alles in Ordnung ist. »Ist was mit Dad?«
»Deinem Vater geht es gut. Er ist hier.«
Dad ist auch zu Hause? Der ist ein schlimmerer Workaholic als meine Mom. »Dann ist was mit Mitchell«, stelle ich fest und mache mir langsam richtig Sorgen. »Ist ihm was passiert?«
»Nein, nein. Ihm geht es gut«, sagt sie schnell, das nervöse Zittern ist noch da. Vielleicht sogar stärker als vorher. Ich höre undeutliche Stimmen im Hintergrund, dann wird es dumpf, so als würde Mom den Hörer mit einer Hand abdecken, damit ich irgendwas nicht mitbekomme. Dann höre ich ihre Stimme wieder deutlicher. »Komm nach Hause. Dann erkläre ich dir alles.«
»Okay.« Ich lege auf und schaue Zac an.
Er blickt verständnisvoll. »Mitchell?«
Ich nicke und Angst um meinen Bruder macht mir das Herz schwer. Was hat er diesmal angestellt? »Ich sage nur schnell MrsMcGary Bescheid.« Ich öffne die Tür und stecke den Kopf in den Probenraum. MrsMcGary steht an ihrem Tisch in der Ecke und telefoniert. Ich winke ihr zu, aber sie schüttelt den Kopf und gibt mir ein Zeichen, dass ich warten soll.
Kaum erblickt Tori mich und Zac in der Tür, kommt sie zu uns. Der Probenraum war bisher Zac-freie Zone, was sie sicher so beibehalten will. »Was ist los?«
»Meine Mom hat angerufen, ich muss nach Hause.«
Mit besorgter Miene legt sie mir eine Hand auf den Arm. »Ist was passiert?«
»Keine Ahnung.« Ich beiße mir auf die Lippe.
Sie hält den Kopf schief, in ihren Augen funkelt Besorgnis. »Mitchell?«
Ich schüttle den Kopf. »Keine Ahnung.«
Sie streichelt mir tröstend über den Arm. »Das wird schon wieder, das ist nur eine Phase. Der fängt sich bestimmt bald.«
Wenn das stimmt, dann hält diese Phase schon an, seit mein Bruder dreizehn ist. Mittlerweile ist er einundzwanzig und ich bezweifle stark, dass ein Ende in Sicht ist.
»Ganz bestimmt.« Tori nickt aus voller Überzeugung. »Er ist ja kein schlechter Mensch.«
»Danke.« Ein schneller Blick zu MrsMcGary verrät, dass sie noch immer telefoniert. »Kannst du ihr vielleicht ausrichten –«
»Klar!« Tori drückt mir aufmunternd die Hand. »Hau schon ab. Ich komm nach der Probe vorbei. Soll ich dir einen Smoothie mitbringen? Wassermelone?«
»Danke, das ist lieb, aber ich passe besser. Ich habe ja keine Ahnung, was zu Hause los ist.«
»Komm.« Zac nimmt meine Hand, ich meinen Rucksack und wir gehen nach oben. Auf der Treppe treffen wir ein paar Freunde. Obwohl uns mehrere in ein Gespräch verwickeln wollen, lässt Zac sich nicht aufhalten.
Zacs bester Freund ist der Einzige, dem es doch gelingt. Carlton ist ein ausgemachter Schmeichler und lässt mich nie ohne eine Umarmung davonkommen. »Hallo, meine Schöne.«
Ich löse mich von ihm. »Hallo.«
Carlton und Zac stoßen die Fäuste gegeneinander. »Gehst du Gewichte stemmen, mein Freund?«
Zac zieht mich wieder an seine Seite. »Nein, ich bring Davy nach Hause.«
Carlton zwinkert mir zu. »Cool, wir sehen uns.«
»Hallo, Bridget«, rufe ich einer aus der Zehnten zu, die im Orchester neben mir sitzt und die zweite Geige spielt. Sie bleibt abrupt stehen, klammert sich am Geländer fest und schaut mich erstaunt an.
Dann nickt sie schnell und verharrt reglos, während wir an ihr vorbeigehen. »Hi, Davy.« Sie schaut zu Zac und läuft sofort knallrot an. »Hi, Zac.«
Er dreht sich mit ausdrucksloser Miene zu ihr um. »Hi.«
Ich lächle in mich hinein.
»Warum lächelst du?«, fragt er, als wir im Erdgeschoss ankommen.
»Du kennst nicht mal ihren Namen.«
Er legt mir einen Arm um die Taille und zieht mich heran. »Ich kenne deinen Namen.«
Ich lache. »Ach ja? Nur meinen Namen?«
Er tastet mich förmlich mit Blicken ab, in denen so viel Verlangen liegt, dass mir ganz warm wird. »Ich weiß schon noch das eine oder andere über dich.«
»Du würdest gern noch das eine oder andere wissen«, stichle ich.
»Werde ich.« Er grinst, seiner Sache so sicher. Unserer Sache so sicher.
Er hält mir die Tür auf und wir verlassen das Hauptgebäude, folgen dem Kiesweg, der zum Parkplatz führt. Die Luft an diesem Spätnachmittag beißt ein bisschen – das letzte Aufbäumen des Winters in Texas. Schon bald wird es so heiß sein, dass einem selbst die dünnsten Klamotten am Leib kleben, und die Luft wird sich wie Wasserdampf anfühlen.
Ich freue mich schon auf New York. In meinem Leben habe ich nämlich erst ein Mal Schnee gesehen und das ist zehn Jahre her. Er ist fast sofort wieder geschmolzen, hat nur ein bisschen an den Hausdächern gehaftet. Mein Bruder und ich haben so viel wie möglich vom Rasen gekratzt und daraus Schneebälle geformt, sie dann in den Tiefkühler gesteckt, in der Hoffnung, sie würden dort ein bisschen länger halten. Es waren unförmige, braune Eisbälle, aus denen Blätter und Zweige ragten. Mom hat sie weggeworfen, bevor wir sie noch einmal herausholen konnten.
Ich lasse meinen Blick über die grünbraunen Hügel streifen, die sich vor einem Himmel abzeichnen, der so blau ist, dass sein Anblick in den Augen schmerzt. Die Villa des Schuldirektors mit den weißen Säulen starrt vom Hügel zu uns hinunter, während wir den Speisesaal passieren. Eine perfekt gepflegte Rasenfläche erstreckt sich zu unserer Linken. Das Flattern von Fahnen, in denen der Wind spielt, mischt sich mit dem leichten Dröhnen des Golfwagens, mit dem der Chef des Sicherheitsdiensts zu den Spielfeldern unterwegs ist. Er wird »Schnippsi« genannt, weil er für gewöhnlich mit den Fingern schnippst, um Aufmerksamkeit auf sich zu lenken. Der Spitzname stammt von meinem Bruder. Mitchell hatte in seiner Schulzeit mehr als einmal mit Schnippsi zu tun.
Wir laufen den letzten Hügel hinunter zum Parkplatz. Die Oberstufenschüler bekommen die besten Plätze. Und das ist nur einer der Vorzüge, die wir in Everton genießen. Außerdem haben wir einen eigenen Aufenthaltsraum mit Sofas, Fernseher und Getränke- und Süßigkeitenautomaten. Zac hat in der ersten Reihe direkt unter einer Kräuselmyrte geparkt. Winzige weiße Blütenblätter verzieren das Autodach.
»Den müsste mal jemand absägen.«
»Aber er ist doch so schön.«
Zac drückt meine Hand. »Nicht so schön wie du.«
Ich verdrehe die Augen, lächle aber trotzdem. Er entriegelt seinen BMW und begleitet mich zur Beifahrerseite. Ich kann gar nicht sagen, wie sehr ich es mag, dass er damit bisher nicht aufgehört hat. Obwohl wir schon sechs Monate zusammen sind, gibt er mir noch immer das Gefühl, etwas Besonderes zu sein. Jeder Tag ist wie unser erstes Date.
Bevor ich einsteigen kann, stemmt er rechts und links von mir die Hände gegen die Beifahrerseite und fängt mich zwischen seinem Körper und dem Auto. Mein Herzschlag beschleunigt. Ich lächle ihn an, rechne damit, dass er mich noch einmal küssen wird, was er aber nicht tut. Der Blick seiner strahlend grünen Augen ist ungewohnt intensiv.
»Davy. Du weißt schon, was du mit mir machst, oder? Was du in mir auslöst …«
Ich presse ihm die Hände flach gegen die Brust. »Du machst mich auch sehr glücklich.«
»Gut. Mehr will ich nämlich gar nicht, Davy. Ich möchte nichts mehr, als dich glücklich machen.«
»Das tust du«, versichere ich ihm.
Er nickt, bewegt sich aber keinen Millimeter. Betrachtet mich so eindringlich, als wolle er mich auswendig lernen.
Ich lege den Kopf schief, verwundert über seine Ernsthaftigkeit. Er ist nicht häufig so offen. »Zac?«
»Ich liebe dich«, flüstert er langsam.
In mir verkrampft alles. Diese drei Worte hat er bisher noch nicht zu mir gesagt.
Mein Herz zieht sich zusammen, aber es ist ein schöner Schmerz. Die schönste Art des Schmerzes. Ich atme tief ein und wieder aus. Ich bringe kein Wort heraus, es bleibt mir im Hals stecken.
Zacs Blick zuckt unruhig hin und her, er wirkt nervös. »Ich wusste nicht, dass ich es dir hier sagen würde. Jetzt. Auf dem Parkplatz. Ich meine … Ich weiß seit ein paar Wochen, dass ich dich liebe. Ich kann an nichts und niemand anderen denken als an dich –« Er grinst mich an. »Jetzt fang ich an zu plappern.«
»Hab ich gemerkt.«
Er küsst mich. Ein paar unserer bisherigen Küsse waren echt umwerfend, aber keiner war jemals wie dieser gewesen. Zac liebt mich. Er liebt mich!
Dann löst er sich von mir, um Luft zu schnappen, und flüstert: »Das wollte ich dir schon längst sagen, aber ich hatte jetzt erst den Mut. Tut mir leid, dass wir nicht an einem romantischeren Ort sind.«
Ich knuffe ihm gegen die Schulter. »Warum solltest du denn Angst haben?« Wahrscheinlich aus dem gleichen Grund, aus dem ich diese Worte noch nicht gesagt habe.
Seine Miene wird ernst und er umklammert mich fester. »Ich weiß nicht, ob ich es verkrafte, wenn du nicht das Gleiche fühlst.«
Ich berühre sein Gesicht, lege ihm die Fingerspitzen ans Kinn. Es ist stoppelig. Ich fahre mit den Fingern darüber, genieße das Gefühl. »Das wäre ganz unmöglich. Ich habe dich schon geliebt, bevor du dich überhaupt mit mir verabredet hast.«
Erleichterung huscht über sein Gesicht. Bevor wir ins Auto steigen, küsst er mich noch einmal, lang und liebevoll.
Die Fahrt bis zu mir nach Hause ist kurz. Wie benommen sitze ich neben ihm und genieße das Gefühl von seiner Hand in meiner Hand und allem, wofür es steht. Ich. Zac. Für immer. So fühlt sich das an. Ich weiß, ich bin erst siebzehn, aber wieso nicht? Wieso nicht für immer?
Schon zehn Minuten später sind wir bei mir zu Hause. In diesem Moment wünsche ich mir, nicht so nah an der Schule zu wohnen. Wünsche mir, wir könnten noch etwas länger in unserer kleinen Welt verweilen.
Zwei weitere Wagen stehen in unserer runden Auffahrt. Ich kenne sie nicht, dafür aber Dads Range Rover. Mitten in der Woche noch vor Einbruch der Dunkelheit zu Hause. Das passiert sonst nie.
Zac steigt mit mir aus und nimmt schnell meine Hand. Wir haben gerade die breite Steintreppe erreicht, die zum Hauseingang führt, als die Tür aufgeht. Mom tritt heraus und ich bleibe stehen.
Sie ist bleich, ihre sonst weichen Gesichtszüge verkrampft. Mom wahrt ihr jugendliches Aussehen, indem sie sich nie in der Sonne aufhält. Wirklich nie. Sie geht nur nachts in unserem Pool baden. Aber selbst diese Bemühungen scheinen in diesem Moment vergebens gewesen zu sein.
»Davy.« Mein Name ist nicht mehr als ein Ausatmen, dann starrt sie mich dermaßen intensiv und durchdringend an, dass ich direkt prüfe, ob ich plötzlich Ausschlag im Gesicht bekommen habe.
Ihr Blick schießt zu Zac. Sie nickt ihm zu. »Danke, dass du sie hergebracht hast.« Was so viel heißt wie: Verschwinde. Meine Eltern vergöttern Zac. Wenn ich noch nicht gewusst hätte, dass etwas nicht stimmt, wäre es mir spätestens jetzt klar geworden.
Zac drückt meine Hand und schaut mich mit seinen unfassbar grünen Augen an. Besorgnis liegt darin – Liebe. Den Blick kenne ich bereits, aber jetzt weiß ich auch, was er bedeutet. »Rufst du mich nachher an?«
Ich nicke.
Bevor er zu seinem Wagen geht, schaut er mich noch einmal an.
Schon sind Mom und ich allein. Sie wirft einen Blick über die Schulter und ich höre Stimmen, die aus dem Haus kommen. Ich erkenne Dads Bariton, aber nicht nur, weil mir seine Stimme so vertraut ist. Er spricht am lautesten.
»Mom? Was ist los?«
Sie zeigt zur Tür und ich betrete das Haus.
Ich lasse meinen Rucksack im Flur stehen. Zusammen gehen wir über den dunklen Holzboden ins Wohnzimmer. Ich wage mich nur langsam hinein, betrete vorsichtig den Orientteppich.
Sofort erblicke ich Dad, der abwechselnd steht, dann wieder rastlos herumläuft. Seine Arme und Hände sind permanent in Bewegung, während er spricht. Von Mitchell fehlt jedoch jede Spur. Ich lasse den Blick durch das große Zimmer streifen und entdecke den Direktor meiner Schule, MrGrayson. Als wir hereinkommen, steht er gerade auf. Er war noch nie bei uns zu Hause und es ist seltsam, ihn hier zu sehen und nicht auf dem Schulgelände. Irgendwie gehört er in meinen Augen nur nach Everton.
Ein weiterer Mann ist anwesend, den ich noch nie zuvor gesehen habe. Er trägt einen billigen Anzug. Die Ärmel reichen nicht mal bis zu seinen haarigen Handgelenken und auch sonst sitzt das Sakko nicht richtig, ist an den Schultern viel zu weit. Mir wurde beigebracht, gute Anzüge zu schätzen. Dad trägt Caraceni und Gucci. Der fremde Mann erhebt sich nicht und wirkt fast gelangweilt.
MrGrayson steckt eine Hand in die Jackentasche. Er richtet sich in versöhnlichem Ton an Dad. »MrHamilton, hören Sie mir doch bitte zu. Mir sind die Hände gebunden. Ich halte mich nur an die Vorschriften –«
»Gab es bei Mitchell etwa keine Vorschriften?«
Mitchell hat vor drei Jahren seinen Abschluss gemacht. Dabei steckte er ständig in Schwierigkeiten. Drogen. Mangelhafte Noten. Nicht, dass sich das nach seinem Start an der Uni wesentlich geändert hätte. Er kam noch während des ersten Semesters nach Hause und wohnt seither im Gästehaus. Dad zwingt ihn zur Mitarbeit in der Bank. Offiziell nennt er es »Praktikum«. Klingt halt besser als: »Mein Sohn ist Aushilfskassierer bei meiner Bank.«
Die Hamilton Bank ist in Familienbesitz, seit mein Urgroßvater sie gegründet hat. Aber es sieht ganz danach aus, als wäre Dad der Letzte in der Reihe. Mitchell ist für den Job nicht gemacht und ich habe andere Pläne.
Dad wedelt heftig mit den Armen. »Damals habe ich einen Scheck geschrieben. Eine großzügige Spende und damit war die Sache geregelt. Wieso geht das diesmal nicht? Wir sprechen hier schließlich von Davy! Sie ist ein verdammtes Wunderkind. Sie singt und beherrscht weiß Gott wie viele Instrumente, seit sie gerade mal laufen kann … Sie ist sogar schon vor dem Gouverneur aufgetreten, als sie erst neun war!«
Ich schließe kurz die Augen. Was auch immer hier los ist, es geht um mich.
»Ich habe darauf keinen Einfluss.« MrGrayson klingt, als würde er etwas Auswendiggelerntes aufsagen.
Dad stürmt aus dem Wohnzimmer, läuft ohne ein Wort an mir vorbei.
Da erst bemerkt MrGrayson mich. Sein Verhalten ändert sich komplett. »Davy.« Er schlägt die Hände zusammen. »Wie geht es dir?« Er spricht so langsam, als wäre ich schwer von Begriff.
»Sehr gut, MrGrayson. Wie geht es Ihnen?«
»Gut!« Dazu nickt er so übertrieben wie ein Wackeldackel. Sehr sonderbar.
Seine Augen vermitteln alles andere als Freude. Sein Blick huscht erst prüfend über mich und dann durch das Wohnzimmer – als wäre er auf der Suche nach einem Fluchtweg. Nach einem längeren Blick zur gläsernen Terrassentür schaut er den Mann auf der Couch an.
MrGrayson deutet auf ihn. »Das ist MrPollock.«
»Guten Tag«, begrüße ich ihn. »Schön, Sie kennenzulernen.«
Er antwortet nicht einmal, mustert mich nur aus seinen kleinen, dunklen Augen, die tief unter den Brauen liegen. Sein Mund öffnet sich ein winziges Stück, die Oberlippe nimmt eine leicht bedrohliche Krümmung an. Mich trifft eine plötzliche Erkenntnis: Er mag mich nicht.
Ein lächerlicher Gedanke, er kennt mich schließlich gar nicht. Er ist ein Fremder. Wieso sollte er schon eine vorgefasste Meinung über mich haben?
Ich höre, wie sich Dads Schritte wieder nähern. Atemlos betritt er das Zimmer, dabei ist er nicht weit gegangen. Er spielt jede Woche Racquetball und ist ziemlich gut in Form. Sein Gesicht ist rot, als wäre er zu lange in der Sonne gewesen.
Er wedelt mit seinem Scheckheft, während er sich in einen Sessel sinken lässt. Den Stift bereit, verlangt er: »Wie viel?«
Grayson wechselt einen Blick mit dem Fremden. Er räuspert sich und sagt jetzt fast sanft: »Sie haben mich nicht verstanden. Sie kann morgen unmöglich erscheinen.«
Ich mische mich ein. »Wo erscheinen? Was ist hier eigentlich los?«
Ich mache einen Schritt ins Zimmer, woraufhin Grayson sofort zurückweicht. Er schaut fast verzweifelt zu Pollock.
Dad fixiert noch immer sein Scheckheft und schreit: »Wie viel?«
Ich zucke zusammen, alles in meinem Brustkorb verkrampft sich. Mir stellen sich die Nackenhaare auf. Dad schreit nie. Das ist ihm zu unwürdig. Alles an dieser Situation ist falsch.
Jetzt zieht sich auch noch mein Bauch zusammen. Ich schaue zu Mom, die am Rande des Zimmers stehen geblieben ist, ihr Gesicht blass. Sie öffnet den Mund, befeuchtet die Lippen, als habe sie vor, etwas zu sagen, doch nichts kommt heraus.
Dann steht MrPollock auf. Erst jetzt fällt mir auf, wie klein er ist. Seine Beine und sein Rumpf scheinen genau gleich lang zu sein. Er fährt sich mit den quadratischen Händen über den billigen Stoff seiner Hose, mustert eingehend unser Wohnzimmer. Zuerst die Möbel, dann die Bücherregale, die vom Boden bis zur Decke reichen, und schließlich den Flügel, an dem ich seit meinem dritten Lebensjahr spiele.
Dad hebt seinen Blick und betrachtet Pollock beinahe hasserfüllt. Und ängstlich. Aber das kann nicht sein. Patrick Hamilton hat vor nichts und niemandem Angst. Vor allem nicht vor diesem Mann mit seinen kleinen, glänzenden Augen und dem schlecht sitzenden Anzug …
Ich wundere mich über Dads abweisende, harte Miene, über seine stoßweise Atmung. Liebend gern wäre ich zu ihm gegangen, um ihm eine Hand auf die angespannte Schulter zu legen. Einfach, um mich damit zu beruhigen. Dad so zu erleben bringt mich nämlich total aus der Fassung.
MrPollock geht zu Dad und bleibt vor ihm stehen, um auf ihn hinunterzublicken. Mein Vater steht auf, noch immer das Scheckheft in der Hand, die sich zur Faust ballt und so die Blätter zerknickt.
Pollock deutet mit dem Kopf zu mir. »Sie können sie nicht freikaufen.«
Ich kann nur ungläubig starren, verstehe rein gar nichts. Was soll ich denn angestellt haben? Panik kriecht mir heiß die Kehle hinauf und ich muss mich anstrengen, um schlucken zu können.
»Dad?« Meine Stimme ist nicht mehr als ein trockenes Krächzen.
Er dreht sich zu mir um, seine Augen glänzen feucht.
MrGrayson verabschiedet sich. Er lächelt mich kurz wohlwollend an. Im Vorbeigehen hebt er eine Hand, als wolle er mir die Schulter tätscheln, lässt sie aber doch wieder sinken.
Dann steht MrPollock vor mir und zwar so nah, dass ich seinen säuerlichen Kaffee-Atem riechen kann. Er holt eine Visitenkarte hervor, reicht sie mir. »Ich bin Ihr Sachbearbeiter. Das war mein erster und letzter Besuch hier, von nun an treffen wir uns in meinem Büro. Ich erwarte Sie morgen um Punkt zehn Uhr.«
Und keine Sekunde später, sonst… schwingt definitiv mit.
In meinem Kopf überschlagen sich die Gedanken. Ich starre auf die Karte, aber die Wörter verschwimmen mir vor den Augen.
Dann sind die Männer fort, nur noch meine Eltern und ich übrig.
Ich fahre herum, wende mich an Mom. »Wieso soll ich morgen zu ihm? Ich muss doch zur Schule –«
»Nein«, verkündet Dad und lässt sich langsam zurück in den Sessel sinken. »Musst du nicht.«
Mom kommt ins Wohnzimmer, mit der Hand streift sie über die Rückenlehne der Couch, als bräuchte sie Halt.
Dad fährt sich übers Gesicht, was seine Stimme dämpft, aber ich verstehe ihn trotzdem: »Mein Gott.«
Obwohl sie so leise sind, lassen mich die Wörter erschaudern.
Ich lecke mir über die trockenen Lippen. »Würde mir jetzt endlich jemand sagen, was hier los ist? Was meint er damit, dass er mein Sachbearbeiter ist?«
Mom schaut mich nicht an, sondern fixiert Dad mit ihrem Blick. Dad lässt die Hand sinken und atmet hörbar aus, während er den Kopf schüttelt. »Das können sie doch nicht machen.«
»Ach, Patrick.« Sie schüttelt ebenfalls den Kopf, als hätte er gerade etwas total Absurdes von sich gegeben. »Sie machen das doch im ganzen Land. Was können wir nur tun?«
»Irgendwas!«, zischt er. »Das kann doch nicht uns passieren. Nicht unserer Tochter!« Er schlägt die geballte Faust auf den Tisch und ich zucke unwillkürlich zusammen.
Eine böse Vorahnung lässt meine Augen brennen. Ich habe das Bedürfnis zu fliehen. Wegzurennen vor dieser offenbar fürchterlichen Neuigkeit, die meine Eltern so sonderbar verändert hat. Ich will zu Zac, mein Gesicht an seiner Brust verbergen und ihm dabei zuhören, wie er wiederholt, dass er mich liebt.
Schließlich schaut Mom mich doch an. Ihr Mund wird ganz schmal, so sehr presst sie die Lippen aufeinander. Es scheint sie alle Mühe zu kosten, mich auch nur anzusehen. »Du kannst nicht an die Schule zurückkehren.«
»Wie bitte? Ich –«
»Lass mich ausreden.« Sie holt tief Luft, als müsse sie gleich tauchen. »Du bist ausgeladen worden.« Ihre Mundwinkel krümmen sich bei den letzten Wörtern. Everton verweist seine Schülerinnen und Schüler nicht. Sie werden ›ausgeladen‹. Als könnte der vornehme Euphemismus darüber hinwegtäuschen, was diese Ausladung wirklich bedeutet.
Ich mache einen Schritt rückwärts und stoße dabei mit der Hüfte gegen einen Tisch, auf dem eine Auswahl von gerahmten Familienfotos steht. Eins landet krachend auf dem Boden. Ich bemühe mich nicht einmal, es aufzuheben. Ich schüttle den Kopf und flüstere: »Warum?«
Dad antwortet mir, seine Stimme trifft mich tief mit den Wörtern, die mein ganzes Leben für immer verändern werden. »Du hast das Mördergen.«
US-Justizministerium * FBI * Strafjustizbehörde
Kriminalitätsstatistik der Vereinigten Staaten von Amerika
JAHR
EINWOHNERZAHL
MORDE
VON HTS-TRÄGERNVERÜBTE MORDE
2017
320.494.019
102.209
59.212*
2019
322.320.103
181.717
98.052*
2021
332.012.992
234.020
196.015**
* HTS-Tests noch keine Vorschrift in den Gerichtsbezirken auf Landesebene
KAPITEL 2
Ich muss nachdenken, bis mir einfällt, wann wir an der Schule auf HTS getestet wurden. Das war Anfang des Schuljahres. Lange bevor die ersten Herbstblätter fielen und Integralrechnung mir Kopfzerbrechen bereitete. Lange vor der Homecoming-Feier von Everton. Lange bevor Zac sich zum ersten Mal mit mir verabredet hat.
Das Kuratorium Evertons ordnete an, dass alle Schüler getestet werden. Keine große Überraschung. Alle Einwohner der USA werden dieser Tage getestet. Selbst Dad verlangte, dass all seine Angestellten bei der Bank sich testen ließen. Ironie des Schicksals.
Wir alle wurden nach dem Unterricht zur Schulschwester geschickt. In meinem Fall hieß das, dass ich die Orchesterprobe verpasste. Daran erinnere ich mich noch genau. Wie sauer ich darüber war. Einmal kurz mit dem Wattestäbchen an der Wange entlanggestreift und das war es. Schon verschwand meine DNA in einem Röhrchen.
Ich glaube, jemand riss einen Witz, dass Albert Adolfson unübersehbar ein Träger war. Der Schwede ist der Star unseres Ringerteams und hat ein ernst zu nehmendes Gewaltproblem. Ich hatte ja insgeheim auf Steroide getippt, dann kam der Witz mit HTS.
Und jetzt bin ich der Witz. Diese Erkenntnis verschlägt mir den Atem. Ich bleibe nicht länger im Wohnzimmer bei Mom und Dad. Ertrag es einfach nicht. Dads Wut. Moms sonderbare Blicke. Das alles ergibt jetzt einen fürchterlichen Sinn.
Und MrPollock mit seinen kleinen, fiesen Augen …
Der ergibt jetzt auch Sinn. Er ist nun Teil meines Lebens.
Bilder blitzen in meinem Gedächtnis auf. Eins nach dem anderen. Eine endlose Reihe von Mördern in Sträflingskleidung. Und die Opfer, die trauernden Menschen, die nach der Tat zurückbleiben. Die Medien zeigen sie gern in Großaufnahme. Deshalb mache ich den Fernseher schon lange nicht mehr an.
Ich suche Zuflucht in meinem Zimmer, bleibe vor meinem Kommodenspiegel stehen und starre die Fotos von Zac und all meinen Freunden an, die daran klemmen. Frage mich, wie sie wohl reagieren werden. Zac und Tori werden mir sicher beistehen, aber die anderen? Werden die mit mir befreundet bleiben? Schon gehe ich rastlos in meinem Zimmer auf und ab, summe dabei eine sinnlose Melodie, suche Frieden, suche Trost. Seit meinen Kindertagen hat mich die Musik begleitet. Sie trägt mich nachts in den Schlaf und beruhigt mich, wenn ich mir Sorgen mache. Liedtexte und Noten tänzeln mir durch den Kopf, während ich darauf warte, dass der schreckliche Druck auf meinen Brustkorb endlich nachlässt. Dass die Gelassenheit zurückkehrt. Dass die Panik verschwindet.
Aber egal, wie viel ich summe, egal, wie viel Musik in meinen Gedanken spielt, es ändert nichts.
Also klappe ich den Laptop auf und suche nach HTS.
Ich kann es nicht ignorieren. Ich kann mich nicht ignorieren. Nein. Nicht ich.
Nicht ich, ganz egal was so ein beschissener DNA-Test aussagt. Mir dreht sich allein bei dem Gedanken der Magen um. Sie können es behaupten. Aber das stimmt nicht. Sicher nicht.
Es kann nicht stimmen.
Meine Suche dauert nur wenige Minuten. Das Erste, was auf meinem Bildschirm auftaucht, ist ein Mitschnitt über HTS. Dr.Wainwright interviewt darin eine Reihe von Mördern, die in Todeszellen sitzen. Ich höre mir an, wie sie ihre entsetzlichen Geschichten mit einem Mann teilen, der einen extrem gelassenen Gesichtsausdruck hat. Manche von ihnen lächeln eigenartig, während sie von ihren Vergehen sprechen. Beim Anblick dieser grinsenden Münder stellen sich mir die Haare auf. Ich stoße einen Seufzer aus. Ich bin keine von denen.
Dann hämmere ich die nächsten Suchbegriffe in die Tastatur und gelange auf eine andere Seite. Dort erwartet mich ein Video, in dem Extremisten brutal gegen drei Männer vorgehen … drei HTS-Träger. Aus den darunterstehenden Kommentaren wird klar, dass alle finden, die Männer haben genau das verdient.
Das ist der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt. Jetzt dreht sich mir buchstäblich der Magen um. Der Laptop rutscht mir vom Schoß, als ich zum Bad hechte und so lange würge, bis sich mein Magen entleert hat.
Als die Krämpfe nachlassen, taumle ich zurück in mein Zimmer und hebe den Laptop auf. Ich stelle ihn auf den Tisch, schalte ihn ab und lasse mich wieder aufs Bett fallen.
Allmählich verblasst das Sonnenlicht vor meinen Jalousien. Mein Handy klingelt und ich werfe einen schnellen Blick darauf. Zac. Ich kann jetzt nicht mit ihm sprechen. Noch nicht.
Ich drehe mich auf die Seite und schließe die Augen, presse eine Hand gegen den Mund, um das Schluchzen zu ersticken, das langsam in meiner Kehle aufsteigt und einen Weg hinaus sucht. Aber es gibt keinen Weg hinaus. Keine Fluchtmöglichkeit.
Irgendwann kann ich endlich wieder normal atmen und fühle mich bereit, meinen Eltern gegenüberzutreten. Das muss ich schließlich. Ich kann nicht so tun, als wäre nichts geschehen. Ich brauche sie, weil sie mir sagen müssen, dass alles gut werden wird. Wie es weitergehen wird. Was unser Plan ist. Ich hole tief Luft und öffne meine Zimmertür. Ein Stück die Treppe hinunter höre ich Dads Stimme und bleibe wie angewurzelt stehen.
»Sie ist keine Trägerin. Das würden wir doch wissen! Du hast diese ganzen Monster im Fernsehen gesehen. Den Bomber von Minneapolis … Den Kindergartenmörder von Atlanta. Wir würden doch wissen, wenn unsere Tochter eine von denen wäre!«
Ich zucke zusammen, gehe leise eine weitere Stufe hinunter.
»Sie nennen es das Mördergen«, sagt Mom. »Es schlummert, bis es aktiviert wird. Sie kommen nicht alle als Monster zur Welt …«
Ich sinke auf die Stufe und umschlinge meine Beine, ich kann ihnen doch nicht gegenübertreten.
Es klingt ganz so, als würde Mom glauben, ich wäre … eine von denen. Ein Monster, das nur auf die Dunkelheit wartet, um sich endlich zeigen zu können.
Ich vergrabe das Gesicht zwischen den Knien. Meine Schultern beben, aber ich weine nicht. Mache kein Geräusch. Ich bin keine Mörderin. Aber wenn ich dem Gerede Glauben schenken soll, dann werde ich eine. Alles nur eine Frage der Zeit. Denn das bedeutet es schließlich, HTS-Träger zu sein. Zumindest sagen das alle. Und offensichtlich glauben meine Eltern daran. Wenigstens Mom.
»Nein. Das muss ein Fehler sein!« Ja! Ich klammere mich an dieses Wort. Es ist ein Fehler. Das wird es sein. Ich höre ein leises Klirren, Dad gießt sich vermutlich einen Drink ein.
»Patrick.« Schärfe liegt in Moms Stimme. »Du hast gehört, was der Direktor gesagt hat. Er hat die Ergebnisse gegenprüfen lassen. Deshalb hat es so lange gedauert, der Test war schließlich schon im Herbst. Wir können die Augen nicht vor der Realität verschließen. Wir müssen uns dieser Sache stellen.«
Dad antwortet nicht. Nach einer Weile fügt Mom etwas hinzu, knapp und sachlich: »Ich bringe sie morgen zu diesem Termin mit dem Sachbearbeiter.«
»Ja, mach das.« Selbst hier auf der Treppe entgeht mir sein Ton nicht.
Mom selbstverständlich auch nicht. »Du machst mich dafür verantwortlich? Verstehe ich das richtig?«
»Von mir hat sie dieses verfluchte Gen jedenfalls nicht.«
»Dann ist das also meine Schuld?«, knurrt sie. »Das Gen ist rezessiv. Wir sind beide dafür verantwortlich. Sobald etwas schiefgeht, musst du einen Schuldigen finden. Du machst mich für Mitchell verantwortlich. Warum also nicht auch dafür, dass unsere Tochter eine Soziopathin ist?«
Ich keuche.
Es folgt ein lautes Klirren. Dads Glas trifft entweder die Wand oder den Boden.
Ich umklammere die Kante der Stufe, brauche Halt, damit ich nicht auch zerberste. Dabei bricht mir ein Fingernagel ab, so fest klammere ich.
Schwach dringt das Klingeln meines Handys aus meinem Zimmer. Sicher wieder Zac. Oder Tori.
Moms kratzige Stimme, leiser, unterdrückter. »Geht es dir jetzt besser?«
»Nein. Mir wird es nie wieder besser gehen, Caitlyn. Wie könnte es auch? Ich habe gerade meine Tochter verloren.«
Ich krümme mich, halte mir den Bauch, die Worte ein schmerzhafter Schlag. Halte mir den Mund zu, damit kein Laut entkommt. Ich will schreien, dass ich nicht fort bin. Ich bin der gleiche Mensch, der ich gestern war. Ich habe mich nicht verändert. Aber irgendwie doch. Für sie habe ich mich verändert. Ich bin verloren. Morgen wird es auch der Rest der Welt wissen.
Ich höre, wie die Terrassentür quietschend aufgeht, gefolgt von der Stimme meines Bruders. »Was gibt’s zum Essen? Ich bin am Verhungern.«
»Wir haben nichts gekocht«, blafft Mom. Nein. Kein Abendessen. Das haben wir völlig vergessen. »Es gibt noch Reste von gestern.« Ich höre Glas klirren, schätze, sie wühlt gerade im Kühlschrank. »Lasagne. Ein bisschen Knoblauchbrot. Ich mach es dir warm. Setz dich, wir müssen reden …«
Ich stehe auf und schleiche zurück in mein Zimmer, will die nun unweigerlich folgende Unterhaltung nicht mit anhören.
Wenn meine Eltern Mitchell eröffnen, dass seine Schwester nicht die ist, die sie erhofft hatten. Dieses Mädchen ist fort und wird nie wieder zurückkehren.
Ich finde keinen Schlaf. Gegen Mitternacht gibt Zac die Anrufversuche auf. Ich liege im Bett, starre an die Decke, die Hände auf dem Bauch gefaltet, ein Lied geistert mir durch den Kopf. Meine Augen sind knochentrocken. Seltsamerweise habe ich bisher nicht geweint, obwohl es sich anfühlt, als hätte ich alles verloren. Mir schwirrt der Kopf, im Hintergrund spielt eine Arie, während sich die Ereignisse des Tages jagen, dicht gefolgt von denen, die mir morgen bevorstehen. Zac wird noch da sein. Meine wahren Freunde. Ihr Verhalten wird sich nicht ändern, weil sie wissen, dass ich mich nicht verändert habe.
Sorge nagt an mir, während ich mir vorstelle, wie alle reagieren werden. Ich sage mir, dass nach dem Abschluss in ein paar Monaten sowieso alles anders gewesen wäre. Das richtet meine Gedanken jedoch auf die Zukunft, Richtung College. Ich bin von der Schule geflogen. Wie geht es jetzt weiter? Werde ich trotz HTS an der Juilliard anfangen dürfen? Ich seufze und fahre mir mit den Händen über das Gesicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß gar nichts mehr. Nur was ich bin. Was ich nicht bin. Ich bin keine Mörderin.
Jemand klopft an und öffnet dann sofort die Tür. Es ist mein Bruder. »Na?«
Er sieht aus wie Mom. Braune Augen und dunkles Haar. Dieselbe Augenfarbe habe ich auch, nur meine Haare sind heller. Wie die von Dad. Mein Vater ist schon ergraut, aber früher hatte er blonde Haare. Mom hat ihn kennengelernt, als er Rettungsschwimmer im Country Club war. Sie sagt, er sah aus wie der junge Brad Pitt. Wer immer das war.
Mitchell trägt die Haare lang und zottelig. Nicht aus stylischen Gründen. Er ist einfach zu faul. Ich kann ihm ansehen, dass Mom es ihm erzählt hat. Er weiß Bescheid.
Ich ringe mir ein Lächeln ab. »Ich schätze mal, damit bist du nicht mehr das schwarze Schaf der Familie.«
»Ach, hör schon auf«, sagt er, ohne es böse zu meinen. Er schiebt die Hände in die Taschen und tritt in mein Zimmer. Kaum hat er sich neben mir auf das Bett sinken lassen, sagt er: »Das ist doch Schwachsinn. Und das weißt du. Niemand kann die Zukunft vorhersagen. Deine Zukunft.«
Ich setze mich auf, schlage die Beine übereinander und ziehe mir ein Kissen auf den Schoß. »Etwas muss dran sein. Weshalb sollten sie sonst alle testen? Guckst du die Nachrichten? In manchen Staaten gibt es sogar richtige Lager –«
»Ja, in den total zurückgebliebenen. Aber nicht hier.« Er schüttelt den Kopf. »Wart mal ab. In ein paar Jahren kommt raus, dass das absoluter Quark ist mit diesem HTS. Irgendwelche Ärzte werden etwas finden, womit sie das alles widerlegen können.« Er wedelt mit der Hand, als würde er eine Fliege verscheuchen. Unsere Blicke treffen sich.
Gerne möchte ich ihm glauben. Wirklich. Dass all das in ein paar Jahren, vielleicht sogar schon eher, einfach nur noch eine schlimme Erinnerung sein wird.
Er lehnt sich auf die Seite. »Da draußen gibt es eine Menge gefährlicher Leute, Davy. Wir leben in einer gefährlichen Zeit. Die Menschen haben Angst. Und wenn die Menschen Angst haben, müssen sie sich an die Vorstellung klammern, sie hätten alles unter Kontrolle. HTS gibt ihnen das Gefühl, noch Kontrolle über all die Kriminellen da draußen zu haben.« Er drückt meinen Arm. »Und da gehörst du nicht dazu. Niemals. Man muss dich doch bloß ansehen, um das zu begreifen.«
Ich nicke, seine Worte geben mir Hoffnung. »Everton hat mich bereits ausgeladen.«
»Vergiss Everton. Ich habe jahrelang versucht, da rauszufliegen, aber Dad hat es immer wieder verhindert.«
Ich verdrehe die Augen und lache. Das tut gut.
Er stupst mich gegen die Schulter. »Hey, du packst das. Alle lieben dich. Du bist echt perfekt –«
Ich seufze. »Bin ich nicht, Mitchell.«
»Ich mein’s ernst.« Er sieht mir aufrichtig in die Augen. »Das wird sich alles in Wohlgefallen auflösen.«
»Dabei soll doch einfach nur alles so bleiben, wie es ist«, murmle ich in das Kissen. »Oder wenigstens nach Plan verlaufen.«
Es war nämlich ein schöner Plan.
»Ich weiß.« Er rollt sich auf den Rücken und starrt an die Decke. »Aber nichts bleibt je, wie es ist, Davy. Du musst dich einfach anpassen … Beweis ihnen, was für ein Schwachsinn dieses HTS ist.« Er lacht abgehackt. »Wenn jemand in dieser Familie ein Träger sein sollte, dann ja wohl ich. Ich bin der Versager.«
Plötzlich fängt mein Telefon wieder an zu klingeln. Ich betrachte es, warte, dass es aufhört. Zac ist wohl noch nicht bereit, mich aufzugeben. Hoffentlich ändert sich das nicht, wenn er die Wahrheit erfährt.
»Du musst es ihm sagen. Und besser, er hört es von dir als von jemand anderem. Er wird damit klarkommen.«
Ich nicke und umklammere das Kissen fester, als könnte ich so all meine Ängste und die hässlichen Erkenntnisse des Tages erdrücken. »Ich weiß. Morgen.«
SMS
18:45
Tori:
Hi, dachte wir üben heut Mathe. Kommst du noch?
20:11
Tori:
Wo steckst du??? Mach mir schon Sorgen
22:58
Tori:
Was ist los? Bist du sauer auf mich???
23:34
KAPITEL 3
Mom setzt mich vor dem Eingang ab, weil sie noch einen Parkplatz finden muss. Sie hat panische Angst, dass ich mich verspäte. Als würde sofort die Polizei ausrücken, wenn ich eine Minute zu spät bin oder so. Es ist das »oder so«, diese alles umfassende Ungewissheit, die sie nervös macht. Der Boden hat nicht einfach nur unter unseren Füßen nachgegeben, er wurde komplett weggerissen.
Der Schlafmangel macht mich benommen. Ein dumpfer Kopfschmerz lässt meine Schläfen pochen. Ich habe noch nicht mit Zac gesprochen, ihm nur eine Nachricht geschickt, dass ich krank sei und er mich nicht abholen muss. Das würde auch erst einmal mein Schweigen von letzter Nacht erklären. Es verschafft mir eine Gnadenfrist. Jedenfalls für den Moment.
In der Lobby der Wainwright Behörde sitzt eine Rezeptionistin an einem Empfangstresen. Sehr zweckorientiert. Wie die meisten öffentlichen Gebäude. Hinter ihr erstreckt sich das gesamte Erdgeschoss in einem Labyrinth aus Bürokabinen. Telefone klingeln. Stimmen bündeln sich zu einem leisen Dröhnen.
Ich sage der Frau meinen Namen, woraufhin sie zu den Stühlen deutet, die in einer Reihe an der Wand stehen.
Wie betäubt bewege ich mich dorthin, lasse mich auf das harte Plastik sinken, schiebe die Hände unter die Oberschenkel und starre mit trockenen Augen geradeaus. Ich habe Zacs Anrufe ignoriert, aber seine Nachrichten abgehört und den Klang seiner Stimme in mein Herz bluten lassen. Ich werde es ihm heute sagen müssen und obwohl ich weiß, dass er mich trotzdem lieben wird, frage ich mich, ob sein Blick sich dann verändert. So wie Moms.
Ein Typ, etwas älter als ich, sitzt ein paar Stühle entfernt. Ich mustere ihn verstohlen, frage mich, ob er auch das Gen trägt. Ob er so ist wie ich … nachweislich ein Träger, ohne im Geringsten bedrohlich zu sein. Und da trifft mich die Erkenntnis, dass ich bis gestern all das geglaubt habe. Dass jeder HTS-Träger gefährlich ist.
Der Typ trägt eine ausgeblichene grüne Jacke, die ihm einen militärischen Touch verleiht. Als hätte er gedient. Denn so ungepflegt wie er aussieht, ist er sicher kein aktiver Soldat. Er merkt, dass ich ihn betrachte, und sieht mich mit eisiger Kälte an, was mich davon überzeugt, dass er rein gar nicht so ist wie ich. Er ist ein wahrhaftiger Träger. Erschrocken, weil ich einem potenziellen Mörder in die Augen sehe, wende ich schnell den Blick ab.
Und dann bildet sich ein Klumpen in meinem Hals, denn in der Vorstellung der restlichen Bevölkerung gibt es keinen Unterschied zwischen ihm und mir. Ich muss überwacht werden. Deshalb bin ich hier.
Mom taucht kurz vor MrPollock auf, der uns auffordert, ihm zu folgen. Es sieht aus, als würde er wieder den gleichen Anzug tragen, nur eine andere Krawatte. Wir laufen im Zickzack durch das Labyrinth der Bürowürfel. Durch eine der Trennwände kann ich eine Frau telefonieren hören. Sie warnt jemanden mit monotoner Stimme, dass sie, sofern er nicht zu seinem nächsten Termin erscheint, einen Haftbefehl für ihn erlässt.
»Also gut.« Pollock schlägt eine steife, braune Akte auf und prüft einen Moment lang ihren Inhalt. Ohne Vorwarnung nimmt er ein schmales, schwarzes Gerät in die Hand. Er lehnt sich über den Tisch und zieht es einmal direkt vor meinem Gesicht durch die Luft. Ein kleines, blaues Licht leuchtet in der Mitte.
»Was ist das?«
»Gesichtsscanner«, antwortet er schroff.
Ich werfe einen Blick zu Mom. Ihre Finger spielen mit ihrer Perlenkette. Pollock legt den Scanner weg und trägt etwas in meine Akte ein, dann richtet er seine Aufmerksamkeit auf den Monitor und drückt ein paarmal auf die Tastatur.
Irgendwann schaut er auf. »Ich habe die hiesige öffentliche Schule bereits in Kenntnis gesetzt. Sie werden dort morgen erwartet.«
»Die Keller High School?« Sie liegt nur eine Viertelstunde entfernt, also näher an der Stadt. Ich war noch nie dort. In meiner Welt gab es seit dem Kindergarten nur Everton.
Er schaut mich mit diesen kleinen, dunklen Augen an. Ohne jede Gefühlsregung. »Sie sind siebzehn. Sie sind schulpflichtig. Und Sie haben Glück. In manchen Staaten werden Träger gar nicht mehr an öffentlichen Schulen zugelassen.« Die Art, wie er das sagt, wie er dabei nickt, gibt mir zu verstehen, dass er dieses Konzept für richtig hält, dass es auch hier angewendet werden sollte.
Dann sieht er Mom an und mir entgeht nicht, dass sein Blick jetzt weniger kalt ist. Wahrscheinlich hat er Mitleid mit ihr. Weil sie eine Tochter wie mich hat. »Sie werden sie morgen dort hinbringen müssen, MrsHamilton, um die Anmeldung abzuschließen. Keller hat schon ein paar Schüler mit HTS, insofern sind sie dort bereits vertraut mit dem Ablauf.«
Ich wechsle die Sitzposition.
»Bis dahin …« Er reicht mir eine Karte. »Das ist Ihr HTS-Ausweis. Tragen Sie ihn immer bei sich.« Dann gibt er mir einen großen Stapel Papier. »Und machen Sie sich mit den geltenden Vorschriften für HTS-Träger vertraut.«
Ich blättere durch die zusammengehefteten Seiten und schaue auf, als er mit Nachdruck sagt: »Unkenntnis ist keine Entschuldigung. Wenn Sie gegen eine der Regeln oder das Gesetz verstoßen, wird die Justiz schnell eingreifen.«
Bei diesen Worten fällt mir das Atmen noch schwerer. »Regeln?«, wiederhole ich.
Pollock stellt die Ellbogen auf den Tisch und legt die Fingerspitzen aneinander. »Ich werde Ihnen entgegenkommen und eine davon erklären. Vielleicht ist es die wichtigste Information, die Sie von diesem Termin mitnehmen.« Er löst die Hände voneinander, hebt einen Finger und hält ihn unheilvoll vor sich in die Luft. »Sie bekommen eine Chance. Eine. Aber sobald Sie jemanden verletzen oder sich in irgendeiner Weise bedrohlich oder gewalttätig aufführen, werden Sie markiert.« Er tippt sich an den Hals. »Ein Verstoß von Ihnen, ein Wort von mir und schon tragen Sie das H. Ich bin mir sicher, Sie haben es bereits gesehen.«
Nicht persönlich. Noch nie persönlich. Wir wohnen in einem guten Viertel. Ich gehe – ging – auf eine gute Schule. War immer in einem sicheren Umfeld. Wenn es dort Träger gab, dann keine markierten. Die kannte ich nur aus dem Fernsehen. Für gewöhnlich waren sie in Handschellen und wurden aus einem Gerichtssaal geführt. Oder streiften durch gefährliche Viertel. Sie waren zum Fürchten.
»Werden Sie jedoch infolge Ihres Verstoßes festgenommen, dann werden Sie nicht nur markiert, sondern kommen außerdem ins Gefängnis.« Pollock lehnt sich zurück. »In dem Fall endet meine Zuständigkeit für Sie.«
Ich nicke. »So weit wird es nicht kommen.«
Er grinst. »Das sagen sie alle.«
Das ist alles so ungerecht. Ich habe mich noch nie gestritten. Noch nie. Nicht mal in der Grundschule. Die Vorstellung, dass ich einen der Verstöße begehe, von denen er gesprochen hat, ist einfach lächerlich. Am liebsten würde ich ihn anschreien: Sehen Sie mich doch mal an! Ich bin kein schlechter Mensch! Ich bin kein Monster!
Pollock richtet seine Aufmerksamkeit wieder auf den Bildschirm und drückt erneut ein paar Tasten.
Meine leidenschaftliche Empörung verebbt, stattdessen legt sich Benommenheit wie eine Decke um mich. Ich schlinge sie enger um mich, damit ich nicht zittere. Er rattert noch mehr Informationen runter. Ablauf. Das Wort fällt oft. Er holt weitere Papierstapel hervor. Mom nimmt sie entgegen. Ich kann mich nicht bewegen. Nicht sprechen.
Zwar sehe ich, dass Pollocks Lippen sich bewegen, seine Worte kommen aber nicht bei mir an. Ich blende ihn aus und versinke in mir, lausche der Melodie, die sich durch meinen Kopf schlängelt.
Dann steht Pollock auf, unser Termin ist offenbar vorbei. Mom erhebt sich ebenfalls. Sie schaut mich mit aufgerissenen Augen an, blinzeln kann sie wohl nicht mehr.
Schwerfällig komme ich auf die Beine, die Arme vor mir verschränkt, umarme mich selbst. Plötzlich ist mir kalt. Extrem kalt. Innen wie außen, die Kälte geht mir bis ins Mark.
»Bis nächsten Monat. Und hoffentlich keinen Tag eher.« Pollock klappt meine Akte zu und schiebt sie an den Rand seines Schreibtischs. Es juckt mir in den Fingern, sie an mich zu reißen, damit ich mit eigenen Augen lesen kann, dass ich diese fürchterliche Kreatur bin, die beobachtet und bewacht werden muss wie eine tickende Zeitbombe. Denn vielleicht kann ich auf irgendetwas zeigen und sagen: Aha! Das stimmt nicht. Das kann ich Ihnen beweisen.
Ich nicke, weil ich nicht weiß, was ich sonst tun oder sagen soll. Drehe mich um, will meiner Mutter hinausfolgen, muss aber stehen bleiben, weil jemand anders die kleine Kabine betritt. Hineinschlendert vielmehr.
Mein Blick gleitet unkontrolliert an seinem langen Körper hinauf. Beine, Taille, Brust. Er ist muskulöser als Zac. Und größer. Gebaut wie ein Krieger, schießt es mir durch den Kopf.
Ich schaue ihm ins Gesicht, mustere die harten Züge. Auch wenn sein Gesicht nicht so makellos ist wie die, die man aus Filmen oder Magazinen kennt, so ist er doch zweifellos attraktiv. Unter seinen dicken Augenbrauen prangen tiefgründige Augen. Die Nase sieht aus, als wäre sie einmal gebrochen gewesen. Die blonden Haare sind zu lang, reichen ihm fast bis auf die Schultern und ich schätze, dass er sie sich selbst geschnitten hat.
Er hat die Art von Selbstbewusstsein, das jede Frau anzieht. Gesichtszüge wie in Stein gemeißelt, sonst aber auffällig entspannt und locker. Unvermittelt fällt mir ein Zitat aus Julius Caesar ein. Ein hohler Blick … Diese Leute sind gefährlich.
Ich weiß, dass er ein Träger ist. Das muss mir niemand sagen.
»MrO’Rourke, wie schön, dass Sie sich blicken lassen.« Pollock schaut zur Uhr. »Leider eine Stunde zu spät. Das ist inakzeptabel. Darüber müssen wir dringend sprechen.«
O’Rourke zuckt mit den Schultern. Eine verschnörkelte Tätowierung klettert seinen muskulösen Oberarm hinauf und verschwindet unter dem Ärmel seines grauen T-Shirts. Ich hebe den Blick, treffe seinen. Seine Augen sind rauchblau, die Iris von einem so dunklen Blau umrahmt, dass es fast schwarz wirkt. Er mustert mich von Kopf bis Fuß.
Mir wird ganz heiß unter seinem Blick. Ich. Hier. Man muss kein Genie sein, um sich auszumalen, was er denkt. Außerdem habe ich ihn ja schließlich genauso eingeordnet.
Allerdings sieht er auch wie ein Träger aus.
Sein harter Ausdruck erinnert mich an die vielen Gesichter, die ich aus dem Fernsehen kenne – von Kriminellen, die irgendein fürchterliches Verbrechen begangen haben, alles nachweislich Träger des HTS-Gens. Die unergründlichen Augen dieses Typen verbergen Geheimnisse, so tief, dass dort nie Licht hinfällt.
Er nimmt Pollock nicht einmal zur Kenntnis. Seine tiefe Stimme bringt die Luft zum Schwingen und stellt mir die Härchen auf. »Hallo, Prinzessin.«