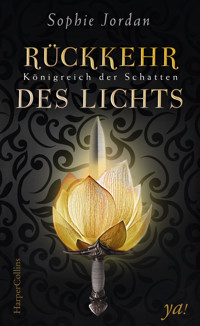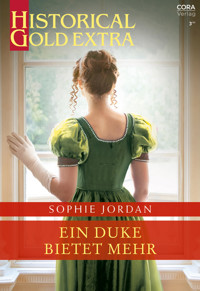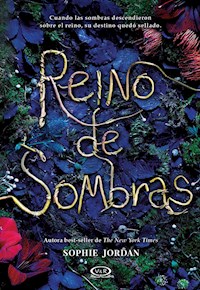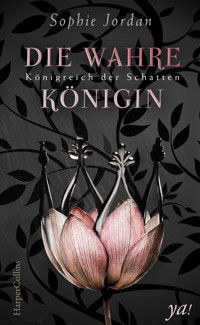Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Loewe Verlag
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: Infernale
- Sprache: Deutsch
Das packende Finale des spannenden Jugendbuch-Zweiteilers! Abermals liefert Firelight-Autorin Sophie Jordan eine fesselnde Geschichte, die sich kritisch mit Moral und Vorurteilen in der heutigen Gesellschaft auseinandersetzt. Natürlich kommen auch Romantik und Action nicht zu kurz – ein außergewöhnliches Lesevergnügen! Ich hatte geglaubt, Mörderin genannt zu werden und alles zu verlieren – meine Zukunft, meinen Freund, meine Freunde – wäre das Schlimmste, was mir passieren konnte. Aber ich habe mich getäuscht. Herauszufinden, dass sie recht haben? Herauszufinden, dass ich genau das bin? Das ist noch viel schlimmer. Seit Davy positiv auf das Mördergen (HTS) getestet wurde, hat sie alles verloren: ihre Familie, ihre Freunde, ihre Zukunft – und was am schlimmsten ist, sich selbst. Denn obwohl sie verzweifelt dagegen angekämpft hat, ist sie doch zu dem geworden, was sie nie sein wollte: eine Mörderin. Eine Widerstandsgruppe und ihr Anführer Caden geben ihr ein neues Ziel. Und Caden weckt Gefühle in ihr, zu denen sie glaubte, nie mehr fähig zu sein. Aber die Schuldgefühle lassen Davy einfach nicht los ... Infernale – Rhapsodie in Schwarz ist der zweite und finale Band der Reihe. Der erste Band lautet Infernale.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 436
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Für Kari Sutherland –sie hat mit mir fünf Bücher bewältigt und mir dabei unglaublich viel beigebracht.
TEIL 1
WIDERSTAND
Bekanntmachung des Präsidenten
Abschnitt 1: Finanzierung der Internierungslager
a) Innerhalb der nächsten achtundvierzig Stunden nach Veröffentlichung dieser Mitteilung wird der Wainwright Behörde in Abstimmung mit dem Finanzministerium und dem Amt für Haushaltswesen zum Zwecke der Verwaltung und zum Ausbau von Internierungslagern eine Summe von 1,27
KAPITEL 1
Der Mann, den ich getötet habe, lässt mir keine Ruhe.
Er besucht mich nachts. Als er das erste Mal den Weg in meine Träume fand, hielt ich das für einen Einzelfall. Einen plötzlichen, lästigen Albtraum, der mit der Nacht verblassen und nie wiederkehren würde.
Aber er kehrt wieder. Der Traum und er. Und allmählich muss ich mir eingestehen, dass er mich nie wieder verlassen wird. Braune Augen. Einschusswunde. Schwarzrotes Blut. Er wird immer bei mir bleiben.
Diese Erkenntnis sinkt langsam, schrecklich. So wie die Fänge eines Raubtiers sich unerbittlich und tief ins Fleisch bohren. Ich kann nicht ausweichen. Ich kann sie nicht abschütteln. Ich bin gefangen. Hoffnungslos von ihrem Kiefer umschlossen.
Sonderbarerweise hatte ich geglaubt, Mörderin genannt zu werden und alles zu verlieren – meine Zukunft, meinen Freund, meine Freunde – wäre das Schlimmste, was mir passieren konnte. Aber ich habe mich getäuscht. Das war es nicht. Herauszufinden, dass sie recht haben? Herauszufinden, dass ich genau das bin?
Das ist noch viel schlimmer.
Nachts ist er nicht mehr als ein Schatten in der Ecke des Zimmers. Ein dunkler, regloser Schatten, die Ränder unklar wie verwischte Bleistiftstriche.
Ich setze mich im Bett auf, ziehe die Knie an den Oberkörper. Sean liegt neben mir, seine Brust hebt und senkt sich langsam, er ahnt nichts von unserem nächtlichen Besucher. Ich schätze, er ist auch nur mein nächtlicher Besucher. Es gibt niemanden, der Sean heimsucht. Für ihn ist die Vergangenheit vergangen. Nichts mehr als das. Ich bin neidisch auf seine Fähigkeit, einfach mit den Dingen abzuschließen. Zu akzeptieren, wie er ist. Was er ist.
Meine Aufmerksamkeit wandert zurück zu dem toten Mann. Ich spüre, wie der mir vertraute Blick über mich schweift. Betrachte ihn, wie er mich betrachtet, während das gleichmäßige Summen der Zikaden in den Container dringt. Bei seinem Anblick kommt alles zurück. Der Moment, in dem der Direktor von Mount Haven mir keine andere Wahl ließ und von mir verlangte, dass ich jemanden töte. Obwohl … Harris hat mir eine Wahl gelassen. Könnte man sagen, wenn es zählt, dass er stattdessen Sean getötet hätte. Entweder ich erschoss diesen Unbekannten – einen namenlosen Träger – oder Sean starb. Das waren meine beiden Möglichkeiten. Egal, wie ich mich entschied, am Ende war jemand tot. Und mein Schicksal besiegelt.
Sean schläft unbekümmert weiter, sein Körper wie eine fein ausgearbeitete Marmorstatue, die dunklen Tätowierungen an Arm und Hals bilden einen extremen Kontrast zur helleren Haut. Ich suche in seinem Anblick, in seiner vertrauten, beruhigenden Anwesenheit nach Erleichterung. Schließlich habe ich seinetwegen diesen Mann umgebracht. Damit Sean weiterleben kann. Aber es funktioniert nicht. Unfähig, ihn länger zu betrachten, unfähig, die Erinnerung länger zu ertragen, wende ich mich ab.
Denn das ist Sean für mich geworden. Eine Erinnerung an den schlimmsten Moment meines Lebens. Ich bereue es nicht, ihn verschont zu haben. Trotzdem ändert das nichts daran, dass ich jetzt eine Mörderin bin.
Als wir gerade aus Mount Haven ausgebrochen und in diesem Container direkt an der Grenze zu Mexiko angelangt waren, hätte es nicht wunderbarer sein können. Sean. Ich. Wir waren wunderbar. Händchen halten, streicheln, küssen. Wie zwei Teenies, die sich gerade erst kennengelernt haben.
Und in gewisser Weise waren wir das ja auch. Wir schliefen jede Nacht eng umschlungen ein, unsere Körper wie zwei Löffel. Hinter den geflüsterten Wörtern und Küssen verbarg sich kein Druck. Sein Geruch, seine warme Berührung reichte mir vollkommen. Mit ihm zusammen zu sein erfüllte mich mit einer fast betäubenden Hoffnung – dem Glauben daran, dass alles wieder gut werden würde. War das wirklich erst ein paar Tage her? Wie schnell alles zu Staub zerfallen konnte.
Meine Fingernägel bohren sich in meine Handflächen, hinterlassen kleine weiße Halbmonde im Fleisch. Ich heiße den Schmerz wie eine verdiente Strafe willkommen. Dann rolle ich mich auf die Seite, tue so, als wäre die Gestalt nicht länger in der Ecke, würde mich nicht länger beobachten. Braune Augen. Einschusswunde. Schwarzrotes Blut.
Ich tue so, als wäre Sean nicht plötzlich jemand, den ich nicht länger ansehen, berühren oder lieben kann.
Ich schließe die Augen und sage mir, dass es irgendwann funktionieren wird. Dass es, wenn ich nur lange genug so tue, Wirklichkeit werden wird.
Ich bin als Erste auf, fühle mich gerädert und mir tut alles weh, weshalb ich extralang dusche. Ich lasse den Kopf hängen und mir das Wasser auf den Nacken niederprasseln. Sicher war es nicht gerade hilfreich, dass ich wach geblieben bin, aber die Angst vor einer erneuten Heimsuchung des Mannes mit den braunen Augen war einfach zu groß. Dabei waren mir eigentlich meine acht Stunden Schlaf immer das Wichtigste.
Zu Hause musste Mom mich morgens immer zwei- bis dreimal schütteln, um mich zu wecken. Ich habe mein Bett geliebt. Die Daunendecke. Die vielen Kissen und Stofftiere aus meiner Kindheit. Die Art, wie das Sonnenlicht durch die transparenten rosa-grünen Vorhänge fiel. Komisch, wie sehr man diese Kleinigkeiten vermissen kann. Was ich geben würde, um eins dieser alten Stofftiere wieder in den Arm zu nehmen! Um wieder dieses Mädchen zu sein. Manchmal machte Mom samstags Arme Ritter mit Würstchen. Der Geruch erfüllte das ganze Haus und lockte mich aus den Federn. Es fällt mir nicht leicht, zu akzeptieren, dass diese Zeit vorbei ist. Selbst das Essen an meiner früheren Privatschule Everton war köstlich. Damals habe ich das nicht zu schätzen gewusst. Mir fehlt die Salatbar und das Pfannengemüse, das man selbst zusammenstellen konnte.
Gils Kopf taucht hinter der Sofalehne auf, seine Haare stehen in alle Richtungen ab. Er reibt sich die Augen, während ich Müsli in eine Schale fülle. Es gibt keine Milch, aber ich habe mich schon daran gewöhnt, es trocken zu essen.
Ein Buch fällt zu Boden. Gil muss beim Lesen eingeschlafen sein. Es ist eine vergilbte, abgewetzte Ausgabe von Der Hobbit. Gestern Nacht hat er Sabine die Haupthandlung nacherzählt. Sie saß vor ihm wie ein kleines Mädchen: Die Arme um die Beine geschlungen, vor und zurück wippend, die Augen weit aufgerissen, während er ein Bild von Hobbits, Drachen und allerhand anderen mystischen Wesen vor ihren Augen entstehen ließ. Auch Sean hatte mit einem betrübten Lächeln zugehört, als er von ihnen zu mir blickte.
»Tut mir leid.« Ich zucke zusammen, als ich die Packung wieder auf den Tisch stelle. »Ich wollte dich nicht wecken.«
Blinzelnd greift Gil nach seiner Brille auf der umgedrehten Kiste, die uns als Couchtisch dient. Kaum ist er nicht mehr blind, betrachtet er mich. »Kein Problem, ich wollte sowieso aufstehen.«
Ich verzichte darauf, nach dem Grund zu fragen. Ist ja nicht gerade so, als hätten wir eine Menge zu tun. Sean überwacht das Geschehen unten am Fluss. Gelegentlich leistet Gil ihm Gesellschaft oder löst ihn ab. Im Moment warten wir eigentlich nur auf Samstag, denn dann werden wir die Grenze überqueren. Abgesehen von einem alten Kartenspiel und der staubigen Hobbit-Ausgabe haben wir in einer der hintersten Ecken des Containers noch ein Dame-Spiel gefunden. Das spielen wir oft, selbst wenn Gil fast immer gewinnt. Darin liegt aber die eigentliche Herausforderung, der Reiz zu spielen, weil wir alle hoffen, ihn doch einmal zu schlagen. Und weil die Zeit sich eben sehr zieht.
Ich kaue laut, während Gil sich einen der schon harten Bagels aus der Tüte fischt und hineinbeißt. Die Auswahl an Essen ist beschränkt. Als wir ankamen, haben wir ein paar Nahrungsmittel vorgefunden. Das meiste waren Lebensmittel, die generell nicht verfallen oder zumindest nicht allzu schnell Schimmel ansetzen.
»Ich hatte nicht gedacht, dass mir irgendwas aus Mount Haven fehlen würde«, murmelt er und wischt sich die Krümel von den Lippen.
Ich nicke. »Das Essen.«
»Ich habe noch nie so gut gegessen wie dort. Also, wenn du von riesigen Slushies und tütenweise Chips von der Tankstelle mal absiehst.«
Ich nicke erneut, tue so, als wäre ich seiner Meinung. Als hätte ich davor auch nicht gut gegessen. Aber das habe ich. Wir waren in den besten Restaurants. Japanisch. Chinesisch. Italienisch. Und meine Mom ist eine gute Köchin, selbst wenn sie nur ein- oder zweimal pro Woche selbst gekocht hat. Ihre Lasagne war so dick, dass man seine Gabel darin verlieren konnte. Dad hat allein bei ihrem Anblick fast zu sabbern angefangen. Mir zieht es schmerzhaft die Brust zusammen, unweigerlich frage ich mich, ob ich meine Familie je wiedersehen werde.
Sean und Sabine stoßen zu uns. Wir bewegen uns in geselliger Stille, jeder mit der Vorbereitung seines nicht gerade ansprechenden Frühstücks beschäftigt.
Sabine ist kein Morgenmensch. Wenn man ihr vor zehn Uhr ein Wort entlockt, kann man sich glücklich schätzen. Sie reißt die Verpackung eines Pop-Tarts auf und setzt sich gegenüber von mir an den Tisch. Sie schüttelt sich das lange, braune Haar aus dem Gesicht, ringt sich ein Lächeln ab und beißt dann in das Gebäck. Krümel fallen auf den Tisch, die sie einfach auf den Boden fegt.
Sean macht in einer der Wasserkannen Kaffee. Schon bald erfüllt der unverkennbare Geruch den Container. Sean bietet mir eine Tasse Kaffee an und ich nehme sie entgegen. Nach dem ersten bitteren Schluck greife ich zum Zucker und gönne mir einen großzügigen Löffel voll. Dann noch einen. Vielleicht kann ich eines Tages ja mal wieder einen Latte genießen. Vielleicht gibt es die ja dort, wohin wir fliehen. Vielleicht. In meinem Leben wimmelt es von Vielleichts. Noch zahlreicher als die Vielleichts sind jedoch die Nie-mehr-wieders.
Ich seufze gegen den Rand der Keramiktasse, dankbar für das Koffein, das sich langsam bemerkbar macht.
»Gut?«, fragt Sean.
»Ja. Danke.«
Sabines Blick wandert zwischen uns hin und her. Eine stumme Prüfung. Spekulation. Ich weiß, dass sie sich fragt, was mit uns los ist. Was mit mir los ist.
Sean schnappt sich die abgenutzte Karte, das Fernglas und seinen Notizblock. Die Karte knistert in seiner Hand, er sagt: »Bis später.« Er schaut uns nacheinander an, sein Blick verharrt am längsten auf mir. »Ich würde mich über etwas Gesellschaft freuen.«
Ich nicke, was sich abgehackt und unnatürlich anfühlt. »Klar. Ich komme gleich nach.« Als gäbe es etwas im Wohncontainer, das mich aufhält.
Die Tür schließt sich hinter ihm.
Gil steht auf. »Ich hoffe, es macht euch nichts aus, aber ich werde mal eins der Betten in Beschlag nehmen und noch ein bisschen schlafen. Dieses Sofa taugt nix.«
Er verschwindet, das Linoleum quietscht unter seinen nackten Füßen. Ich bin seit fast einer Woche hier und bringe es noch immer nicht über mich, auf diesem ekligen Boden barfuß zu laufen.
»Also, was ist los mit Sean und dir?«
Ich schaue auf. Sabine hat sich einen weiteren Pop-Tart vorgeknöpft. Sie kaut sehr intensiv und oft.
Trotz unserer nicht gerade sterneverdächtigen Ernährung, bestehend aus Pop-Tarts und trockenem Müsli, sieht sie gut aus. Besser als bei unserem ersten Treffen in Mount Haven. Sie hat Farbe im Gesicht, ihr Blick ist hell, aufmerksam.
»Was meinst du?«
Sie verdreht die Augen. »Du kannst ihn kaum ansehen.«
Ist es wirklich so offensichtlich? Wir kommen doch prima miteinander klar, lächeln viel. Ich spiele meine Rolle überzeugend. Dachte ich zumindest. »Bei uns ist alles gut. Völlig in Ordnung«, schwindle ich. Weil ich es nicht wahrhaben will. Weil es nicht wahr sein kann. Es geht einfach nicht. Was auch immer los ist, ich krieg das wieder hin. Zwischen uns ist bald alles wieder gut. Mit mir ist bald wieder alles gut.
»Klar.« Sie zieht einen Mundwinkel hoch. »Als wir hier angekommen sind, konntet ihr die Finger nicht voneinander lassen. Als wärt ihr in den Flitterwochen.«
Mein Gesicht wird warm. »Ach, es ist nichts weiter. Ich will gerade einfach nur über die Grenze. Wenn wir erst drüben sind, bin ich wieder entspannter.«
Sabine zuckt mit der schmalen Schulter. »Wir schaffen es oder wir schaffen es nicht. Ich an deiner Stelle würde die verbleibende Zeit mit Sean so gut nutzen, wie es geht. Eben weil wir geschnappt oder sogar getötet werden könnten. Carpe diem, du weißt schon.« Sie sagt das ganz sachlich. So läuft das jetzt. Unser mögliches Ableben ist kein besonderes, sondern nur noch ein alltägliches Thema. Geschnappt oder getötet. Zu diesem Zeitpunkt ein und dasselbe.
Ihr Lächeln verschwindet, sie starrt mich geradeheraus an, in ihren Augen ein grelles Funkeln. Fast, als wäre sie sauer auf mich. Wie soll ich ihr denn erklären, was in meinem Kopf los ist? Dass ich seit unserer Ankunft hier versuche, damit klarzukommen, dass ich diesen Mann getötet habe. Dass es schwierig ist, Sean so nah zu sein. Sehr schwierig.
Beim Aufstehen murmle ich etwas davon, dass ich das Bett machen muss, und gehe nach hinten. Ein Problem von Orten, die nur siebzig Quadratmeter groß sind, ist, dass man sich nirgendwo verstecken kann. Nicht voreinander. Und nicht vor Geistern.
Auch in dieser Nacht wache ich mit einem Ruck auf. Ich setze mich auf, öffne die Augen und schaue mich nach ihm um. Nach dem Mann, den ich getötet habe. Er ist nicht da. Ein erleichtertes Keuchen entweicht mir.
»Davy?« Sean ist bei mir, setzt sich ebenfalls auf. Ich blinzle kurz in das leere Zimmer, lege mich dann wieder hin und umklammere mit zu Fäusten geballten Händen das Laken vor meiner Brust. Ich starre an die Decke, konzentriere mich auf das Netz aus dünnen Rissen im Lack.
Sean kuschelt sich an mich, legt leicht seine Hand auf meinen Arm.
»Schlecht geträumt?« Seine tiefe Stimme brummt durch die Dunkelheit.
Ich nicke. Das ist leichter, als ihm zu erklären, dass ich aus Angst davor aufgewacht bin, der Mann, den ich getötet habe, könnte sich erneut dazu entschließen, mich heimzusuchen.
»Ist alles in Ordnung?«
Meine Stimme schneidet papierdünn durch die Luft. »Ja.«
»Wieso habe ich das Gefühl, das sagst du nur, weil du meinst, dass ich das hören will?«
Weil ich das hören will. Weil ich will, dass es wahr ist.
Ich drehe mich zu Sean. Er ist so nah, dabei fühlt er sich meilenweit entfernt an. Als hätte ich ihn in der Vergangenheit zurückgelassen. In Mount Haven, wo sie versucht haben, mehr aus uns zu machen als die Mörder, die wir laut unserer DNA sind. Etwas noch Schlimmeres. Dabei ist Sean gar nicht weit weg. Er ist genau hier. »Du brauchst dir keine Sorgen um mich zu machen.«
»Ich werde mir immer Sorgen um dich machen, Davy. So ist das, wenn man jemanden mag.«
»Ich weiß. Ich mag dich ja auch.« Ich bin mir nur nicht sicher, ob ich noch mit dir zusammen sein kann. So jedenfalls nicht. So, wie du es dir wünschst. So, wie du es verdienst.
Nach einer Weile nimmt er die Hand weg. Sofort atmet etwas in mir auf und das finde ich schrecklich. Ich finde es entsetzlich, dass ihm nicht entgangen ist, wie ich mich von ihm zurückgezogen habe. Sabine ist es aufgefallen. Er wäre ein Trottel, wenn er das nicht mitbekommen hätte. Am liebsten würde ich in Sabines Zimmer direkt gegenüber umziehen. Aber das wäre ja das absolute Warnsignal, dass etwas nicht stimmt. Dass ich ein Problem habe.
»Gute Nacht, Davy.«
»Gute Nacht«, erwidere ich.
Ich werde mich schon wieder fangen. Wir werden uns wieder fangen. Probleme werden doch ständig gelöst. Ich höre einfach auf, in Seans Nähe komisch zu sein, und dann nimmt alles andere ganz automatisch auch wieder seinen gewohnten Gang.
Ein wunderschöner Adler segelte durch die endlose Weite des Himmels, als er einen Pfeil zischen hörte. Der Adler kreischte, denn die Spitze durchbohrte seinen Körper. Tödlich verletzt stürzte er zu Boden, sein Lebenselixier versickerte im Sand. Er blickte auf den Pfeil, der in seiner Seite steckte, und musste erkennen, dass der Schaft mit seinen eigenen Federn bestückt war – sein Tod war von ihm selbst verschuldet.
Die Fabeln des Äsop, Der Adler und der Pfeil
KAPITEL 2
Gil kümmert sich ums Abendessen, wozu ich nur so viel sagen möchte: Ich hätte nichts dagegen, wenn ich nie wieder ein Erdnussbutterbrot in die Hand nehmen müsste. Ich habe richtig Sehnsucht nach einer warmen Mahlzeit. Nach Pommes. Himmel, nach Pizza.
»Wie mir das Essen meiner Mutter fehlt«, sagt Sabine, zupft ein Stück von ihrem Brot und steckt es sich in den Mund. »Sie hat Schnitzel gemacht. Und Sauerbraten. So richtig, versteht ihr?« Sie legt den Kopf schief. »Was meint ihr, werde ich je wieder deutsches Essen auf dem Teller haben?«
»In Deutschland vielleicht«, schlägt Gil vor.
Sabine lacht gespielt. »Ja, sicher. Ich glaube, da stehen meine Chancen besser, zu meiner Familie nach Garden City, Idaho zurückzukehren, als es bis nach Deutschland zu schaffen.« Viel hat Sabine bisher nicht von ihrer Familie erzählt. Ich weiß, dass sie eins von sechs Kindern ist – und das einzige mit HTS. Ihr Vater hatte darüber nachgedacht, mit ihr zu fliehen, wollte dann aber den Rest der Familie nicht zurücklassen. Nicht ihretwegen. Ich vermute, sie kann seine Entscheidung nachvollziehen, trotzdem wird die Gewissheit wehtun, geopfert worden zu sein.
»Aber da, wohin wir unterwegs sind …« Gil schüttelt den Kopf. »Ich bezweifle, dass du je wieder eine Bratwurst sehen wirst. Hat deine Mutter dir denn nie kochen beigebracht?«
»Sie hat es versucht, aber ich habe nicht aufgepasst. Mir war Robotertechnik wichtiger.«
»Das wusste ich ja gar nicht.« Gils Gesicht hellt sich auf.
»Ich war nicht besonders gut, aber die AG an der Highschool hat mir echt Spaß gemacht.«
»Du musst ziemlich gut gewesen sein, sonst hätten sie dich nicht nach Mount Haven geholt.«
»Das war, weil ich Deutsch und ganz passabel Französisch spreche. Was mir in Mexiko jetzt auch nicht gerade eine Hilfe sein wird.« Sie greift nach den Joghurts und knickt sich einen ab. Dabei scheint sie zu spüren, wie unsere Blicke auf ihr lasten. Sie schaut auf und zuckt mit den Schultern. »Außerdem hab ich einen Einserschnitt.«
»Oh.« Gil verdreht die Augen. »Das könnte natürlich auch den Ausschlag gegeben haben.«
Sabine streift sich langsam eine lange Strähne ihres blonden Haars hinters Ohr, lächelt nacheinander erst Gil und dann Sean und mich verhalten an.
»Ich hätte jetzt gern etwas von der Lasagne, die meine Mutter immer macht«, sage ich, weil mir endlich mal etwas einfällt, was ich zur Unterhaltung beitragen kann. Ich bin wild entschlossen, meine Ängste abzuschütteln und mich vor meinen Freunden normal zu verhalten. Denn sie sind meine Freunde. Die Einzigen, die mir geblieben sind. Ich muss mir Mühe geben.
»Enchiladas«, fügt Sean hinzu und beißt in sein Brot. Gil hat zwei für ihn gemacht. Gar nicht mal unklug, wenn man bedenkt, dass er mit einem Bissen eine halbe Scheibe verschlingt.
»Es wird vermutlich eher kein Problem sein, die zu bekommen. Wenigstens gutes mexikanisches Essen sollten wir kriegen.« Sabine nimmt sich noch einen Becher Joghurt, reißt den Deckel ab und leckt ihn sauber.
»Hoffentlich«, sage ich.
»Soll das ein Witz sein?« Gil schüttelt den Kopf. »Ich rechne mit richtigem mexikanischen Essen, so wie es meine abuela früher gekocht hat. Ich kann die chicharrónes gar nicht erwarten.«
Ich kann mir ein Grinsen nicht verkneifen. »Und wenn wir die nicht kriegen? Lassen wir den Deal platzen, bleiben für immer hier und essen bis an unser Lebensende Erdnussbutter und Joghurt.«
»Großartige Aussicht«, murmelt Sabine und wirft die leeren Becher in den nächstgelegenen Mülleimer.
»Wartet es nur ab. In einem Monat haben wir alle Heißhunger auf Erdnussbutter und Joghurt.« Sean stupst mir leicht gegen die Schulter. Ich lächle ihn an, was mir nicht einmal schwerfällt.
Sabine rümpft die Nase. »Das glaube ich eher nicht.«
Ich versuche, mir vorzustellen, wo wir in einem Monat sein werden, aber ich sehe nur grau. Ich habe nur ein unscharfes Störbild vor Augen, wenn ich an die Zukunft denke. Es gibt kein klares Bild und das ist immer noch ungewohnt. Noch vor ein paar Wochen konnte ich mir meine Zukunft bis ins kleinste Detail ausmalen. Abschlussprüfungen. Abschlussball. Zac und ich zusammen in New York. Juilliard.
Gil steht auf und bringt seinen Teller zur Spüle. »Ich knöpfe mir noch einmal das Radio vor.«
Sabine stöhnt. »Der Empfang ist unterirdisch.«
Er zuckt mit den Schultern. »Ich habe heute schon etwas gehört.«
Er setzt sich auf einen Stuhl am kurzen Ende der Küchenzeile und dreht am Radio herum. Sabine nimmt sich den dritten Joghurtbecher. Keine Ahnung, wo sie das alles hinsteckt, aber wenigstens sieht sie nicht mehr ganz so ausgemergelt wie in Mount Haven aus.
Statisches Rauschen erfüllt den Raum, während Gil nach einem Sender sucht.
Ich sehe Sean an. »Meinst du, sie suchen nach uns?« Weiter muss ich das gar nicht ausführen, er weiß, dass ich die Leute von Mount Haven meine. Diese Sorge lastet schon die ganze Zeit auf mir – vermutlich auf uns allen. Aber scheinbar verzichten wir bewusst darauf, dieses Thema anzusprechen. Forschend betrachte ich Sean.
»Ich bezweifle, dass sie jemanden vom Personal losschicken, um nach uns zu suchen. Ganz sicher werden da draußen einige Bescheid wissen, nach wem sie Ausschau halten müssen, aber bestimmt niemand aus Mount Haven selbst. Eher Agenten von der Behörde und der Grenzschutz.«
»Vermutlich stehen wir auf irgendeiner Liste«, meldet sich nun Gil zu Wort, obwohl er hoch konzentriert lauscht, während er am Sendersuchknauf dreht. »Wahrscheinlich ist jede Tankstelle zwischen hier und Austin mit unseren Fotos gepflastert. Und im Internet kann man uns sicher auch sehen.«
Sabine schnaubt und kratzt auch diesen Becher aus. »Was meinst du? Dass es eine hochoffizielle Liste von der Regierung gibt mit den meistgesuchten Trägern oder so was?«
Ich würde schätzen, dass es genau so eine Liste gibt. Und wir darauf stehen. Mein Bauch zieht sich zusammen. Ich muss daran denken, dass jeder Agent der Wainwright Behörde Fotos von uns hat und sie sich einprägen kann. Wenn wir dieses Land erst verlassen haben, werden wir nie wieder zurückkehren können.
»Vielleicht sollten wir unser Aussehen verändern«, schlägt Sean vor. »Natürlich bleiben wir immer zwei Jungs und zwei Mädchen, aber vielleicht lässt sich ja sonst was machen.«
Ich nicke, frage mich aber, wie wir das hier draußen anstellen sollen, schließlich sind wir mitten im Nirgendwo. Mit einem wissenden Grinsen steht Sabine auf und geht zum Badezimmer.
Gil konzentriert sich weiter auf das Radio, dreht am Knauf, Millimeter für Millimeter. Hin und wieder schallt ein Fetzen Texmex-Musik aus dem Lautsprecher. Ich verziehe das Gesicht. Es gibt also immer noch Musik auf der Welt. Aus irgendeinem Grund finde ich das sonderbar. Fast schon falsch. Was ein sehr merkwürdiger Gedanke für mich ist. Bin ich wirklich an einem Punkt angelangt, an dem es sich für mich falsch anfühlt, Musik zu hören?
»Hey.« Sean stupst mich an. »Iss dein Brot auf. Du brauchst die Energie.«
Ich ringe mir ein Lächeln ab und beiße noch einmal hinein, kämpfe dann mit der zähflüssigen Erdnussbutter.
Sean betrachtet mich, seine Brauen zusammengezogen, sodass dazwischen eine tiefe Sorgenfalte entsteht. Er sieht mich gar nicht mehr anders an. Als fürchte er, dass das Nächste, was er sagt oder tut, der Tropfen sein könnte, der das Fass zum Überlaufen bringt.
Da kehrt Sabine zurück, ein paar Schachteln in der Luft schwingend. »Ich habe gerade erst begriffen, wieso die hier unterm Waschbecken sind. Diese Schleuser haben wirklich an alles gedacht.«
»Was ist das?«, fragt Gil.
»Haarfärbemittel.« Sie liest vor, was auf den Schachteln steht. »Mokkabraun, Muskatnuss und Nachtschwarz.« Sie schaut von mir zu Sean mit einer hochgezogenen Augenbraue. »Wer zuerst?«
Sean und Gil sehen schweigend zu, wie Sabine mir mit der Küchenschere die Haare schneidet. Schnell fräst sie sich mit scharfen Schnitten durch die dichten Strähnen. Gil reißt immer weiter die Augen auf, je mehr lange Strähnen wie Löwenzahnsamen durch die Luft fliegen.
Wir waren uns einig, dass ein Kurzhaarschnitt mein Erscheinungsbild verändern würde, aber die Entscheidung fiel hauptsächlich aus Sorge, dass das Färbemittel sonst nicht reichen könnte. Die Anleitung empfiehlt zwei Schachteln für lange Haare und weil wir von jeder Farbe nur eine Schachtel haben, darf Sabine die Friseurin spielen.
Seans Gesichtsausdruck ist neutral, aber er beobachtet mich aufmerksam, schaut mir ins Gesicht – nicht auf die immer kürzer werdenden Haare. Wartet er darauf, dass ich zusammenbreche?
Es sind doch nur Haare. Hält er mich für so zerbrechlich? Ich schüttle den Kopf, höre aber sofort wieder auf, weil Sabine warnend zischt.
Also halte ich still und betrachte mich selbst im Spiegel, während Sabine langsam den Hinterkopf bearbeitet. Ich verfolge meine Wandlung seltsam distanziert. Merkwürdigerweise spüre ich so etwas wie Erleichterung. Als würde eine Last von mir abfallen. Als würde ich mit jeder Strähne, die zu Boden fällt, ein Stück meines alten Ichs hinter mir lassen und so Raum für ein neues Leben schaffen.
Meine Haare umrahmen nun dicht mein Gesicht und reichen bis kurz über die Ohrläppchen. Meine Augen stechen hervor und wirken riesig, weil mein Kopf ohne die voluminöse Haarpracht viel kleiner ist. Auch die Markierung sticht hervor: das dunkle Band mit dem eingekreisten H deutlicher denn je zu erkennen.
»Ich glaube, das ist einigermaßen gerade«, murmelt Sabine, die Stirn in vielen angestrengten Falten, so konzentriert ist sie bei der Sache. Sie steckt sich die Schere quer zwischen die Zähne und hockt sich vor mich, greift nach den Haarspitzen rechts und links von meinen Ohrläppchen und zieht daran, um zu testen, ob sie gleich lang sind.
»Ist doch egal«, sage ich. »Sind doch nur Haare.«
»Oh, du siehst ziemlich scharf aus so.« Sie grinst mich an.
Ich schnaube.
»Okay?« Sabine dreht sich zu Sean und Gil um, erwartet ihr Urteil.
Sean betritt das Bad und plötzlich wird es mir zu eng, ich werde fast klaustrophobisch. Er zieht leicht an einer Strähne im Nacken. »Die hier ist noch etwas zu lang.«
Sabine lehnt sich hinüber und schneidet sie ab. »Gut … Dann kommen wir jetzt zum lustigen Teil.«
Sie schüttelt die Plastikflasche mit der dunklen Färbung für ein paar Sekunden, ohne mit dem Grinsen aufzuhören.
»Dir macht das viel zu viel Spaß«, beschuldige ich sie.
Sie nickt. »Das kannst du wohl glauben. Vielleicht ist das ja meine Berufung. Wenn wir erst hier weg und in einem der Flüchtlingslager angekommen sind, kann ich vielleicht einen Friseursalon aufmachen.«
Sie stellt die Flasche ab, zieht mit der Präzision eines Chirurgen ein paar Plastikhandschuhe über und drückt sich etwas der dunklen Masse auf die Handfläche. Ein scharfer Geruch erfüllt das kleine Bad, beißt mir in die Nase und lässt mir Tränen in die Augen steigen. Sabine wirft mir einen schrägen Blick zu. »Das wird jetzt vermutlich wehtun.«
Ich lache. »Hör schon auf.«
»Das ist schließlich keine OP am offenen Herzen«, murmelt Gil von der Tür her.
Sabine schielt zu Sean, der noch immer den kleinen Raum ausfüllt. Sie zieht eine Augenbraue hoch. »Machst du mir ein bisschen Platz, Großer?«
Er zögert einen Moment, schaut von der Handvoll dunklen Glibbers zu mir.
Ich lächle ihn bestärkend an. »Es sind nur Haare«, erinnere ich ihn.
Und das sage ich nicht nur, um ihn aufzumuntern. Es ist die Wahrheit. Mir die Haare abzuschneiden und Nachtschwarz zu färben, wäre für mein früheres Ich unvorstellbar gewesen. Jetzt ist es mir nicht mal eine Sorge wert.
»Da hat sie recht«, stimmt Sabine zu. »Du bist ja schließlich nicht in ihre Haare verliebt, oder?«
Ich sehe Sabine scharf an, unterdrücke aber den Impuls, ihr mitzuteilen, dass er gar nicht in mich verliebt ist. Zumindest hat er die allseits bekannten drei Wörter bisher noch nicht ausgesprochen. Worüber ich ehrlich gesagt erleichtert bin. Ein solches Geständnis würde mir nur das Gefühl geben, dass ich an ihn gebunden bin, ihm gegenüber eine Verpflichtung habe, mit der ich mich gerade nicht auseinandersetzen will. Er bedeutet mir schon jetzt zu viel. Er, Gil und Sabine. Da brauche ich definitiv keine zusätzliche Last.
Ich halte den Mund, obwohl seit Sabines Worten eine angespannte Stille im Raum herrscht. Nein, das ist nicht unbehaglich. In keiner Weise.
Sabine verdreht die Augen und zieht mit einer Hand das Handtuch zurecht, das mir um die Schultern liegt. Sie lehnt sich vor und sagt, ganz nah an meinem Ohr: »Entspann dich.«
Mit diesen Worten klatscht sie die Handvoll Farbe auf meinen Kopf und fängt an, sie in meine verbliebenen Haare zu kneten. Es dauert nicht lange, bis ein feuchter, schwarzer Helm an meinem Kopf klebt.
Sabine wirft Gil einen Blick zu. »Gib mir eine halbe Stunde, dann gucken wir mal. Vielleicht dauert es auch länger.«
Gil schaut auf seine Uhr. »Ist gut.«
Sabines Blick landet auf Sean. »Jetzt du.«
»Also gut, dann mal los.« Er zieht sein T-Shirt aus und wirft es auf den Boden, zum Vorschein kommt sein muskulöser Brustkorb. Zac hat Rugby gespielt, dadurch habe ich viel Zeit mit Rugbyspielern verbracht. Und sie immer für ziemlich muskulös gehalten. Seit ich Sean kenne, muss ich meine Definition von »muskulös« noch einmal überdenken.
Sabine macht so große Augen, als hätte sie noch nie einen Jungen mit freiem Oberkörper gesehen. Und man kann einfach nicht anders, als Sean zu begaffen, das muss ich zugeben. Er nimmt mit seiner Präsenz das gesamte, kleine Bad ein.
Ich sitze auf dem Klodeckel und ertrage so gerade den Gestank des Färbemittels auf meinem Kopf. Es juckt und kribbelt auf der Kopfhaut, es kostet mich meine ganze Selbstbeherrschung, nicht meine Fingernägel in der tintenschwarzen Masse zu versenken, die auf meinem Kopf klebt. Der strenge Geruch brennt in der Nase und ich muss an meine Mutter denken. An ihr Entsetzen, wenn sie wüsste, dass ich mir die Haare färbe. Dann erstirbt diese Vorstellung. Es wäre nicht das Schlimmste, was ihrer Tochter in den letzten Monaten zustößt.
Sean sitzt seelenruhig auf einem umgedrehten Eimer, während Sabine sich um seine Haare kümmert. Als er sich zurücklehnt, sieht er genauso lächerlich aus wie ich. Gil wedelt mit der Hand vorm Gesicht. »Tut mir leid, ich muss hier raus, bevor ich ohnmächtig werde von diesem Gestank.«
»Weichei!«, ruft Sabine ihm nach, zieht die Handschuhe ab und wirft sie in den Müll. Dann nimmt sie ein Handtuch und wischt uns nacheinander die überschüssige Farbe vom Gesicht, damit keine braunen Flecken auf der Haut bleiben. »Bald seid ihr ein Paar brünetter Babes.« Ich lächle, ich kann nicht anders.
Sie dreht sich zum Waschbecken und wäscht sich die Hände, schrubbt die Stellen an den Armen, wo sie mit Färbemittel gekleckert hat.
Ich schiele zu Sean. »Schön, dich wieder lächeln zu sehen«, sagt er.
Bei diesen Worten verflüchtigt sich das Lächeln fast, ich muss richtig kämpfen, damit es nicht verschwindet.
»Wenn wir erst auf der anderen Seite sind, haben wir einen richtigen Grund, uns zu freuen, dann fällt das Lächeln umso leichter«, wirft Sabine ein und betrachtet uns beide im Spiegel.
Ich nicke, hoffe, dass sie damit recht behalten wird.
Entertainment Weekly
Pressemitteilung
5.Juni 2021
KAPITEL 3
In dieser Nacht lauert der tote Mann wieder in der Ecke. Ich schiele zu Sean, der tief und fest schläft. Nichts bringt ihn aus der Ruhe. Nicht mal das Mädchen neben ihm, das langsam den Verstand verliert. Trage ich passend zu dem Mördergen etwa auch noch eins für Geisteskrankheit? Schließlich drehe ich gerade ganz offensichtlich durch.
Ich richte den Blick wieder auf die Gestalt in der Ecke. Der Mann verharrt reglos in dieser Ich-kann-mich-jederzeit-auf-dich-stürzen-Position.
»Was willst du?«, will ich wissen, meine Stimme ein sanftes Flüstern. Ich kralle mich an der Decke fest aus Angst, Sean versehentlich zu wecken.
Vergebens warte ich auf eine Antwort, verberge mein Gesicht in den Händen und streiche mir dann fast mit Gewalt die Haare nach hinten, den Blick starr auf ihn gerichtet.
»Es tut mir leid. Verschwinde. Lass mich in Ruhe. Bitte, lass mich in Ruhe.« Ich wiederhole dies wieder und wieder, es kommt mir wie ein Mantra über die Lippen, immer schneller.
Seine kehlige, fast nicht vernehmbare Stimme dringt bis zu mir. Ich erstarre, alles an mir zieht sich eisig zusammen, während ich suchend ins Dunkel blicke und versuche, das heisere Wort zu verstehen, das er von sich gibt: »Niemals.«
Dieses einzelne Wort schneidet durch mich wie ein rostiger Draht. Natürlich wird er mich nie wieder in Ruhe lassen. Ich habe ihn ermordet. Sein Leben genommen. Ihm in die Augen geschaut, als er seinen letzten Atemzug tat. Ich kann mich unmöglich vor ihm verstecken. Er wird mich finden. Hier. In Mexiko. Egal, wohin ich auch gehe, er wird mir folgen.
Ein Schluchzer verstopft mir die Kehle und ich senke blind den Blick, wippe langsam vor und zurück, starre auf meinen Schoß, ziehe an meinen kurzen Haaren, bis mir die Kopfhaut wehtut. Unzusammenhängende, wirre Bitten entweichen mir, ich flehe ihn an, zu gehen, mich in Ruhe zu lassen. Ich weiß nicht, an wen ich mich richte. Vielleicht an Gott. Wenn Gott denn noch Gebeten von jemandem wie mir lauscht.
Ich lockere den Griff um meine Haare und schaue auf. Die dunkle Gestalt ist fort. Schatten wandern über die Wände und kündigen den Morgen an. Gott. Ich lache leise. Vielleicht verliere ich wirklich den Verstand. Halluziniere. Entweder ist es das oder ich werde wirklich von einem Geist heimgesucht. Egal, was davon zutrifft, mein Leben ist definitiv ziemlich kacke.
Sean schläft nach wie vor, verloren in seiner Traumwelt. Oder noch besser – in diesem seligen Stadium, in dem einen nicht einmal Träume erreichen können. Er ist völlig unbeeindruckt von seiner Vergangenheit und darum beneide ich ihn. Vielleicht nehme ich es ihm sogar übel. Obwohl das ja nicht mal seine Schuld ist.
Ich atme ein, aber das Zimmer ist zu eng, die Wände zu nah. Der Geruch meiner frisch gefärbten Haare dringt mir scharf in die Nasenflügel. Ich gleite aus dem Bett und laufe durch den schmalen Flur. Meine nur mit Strümpfen bekleideten Füße machen kein Geräusch, ich lasse die Handflächen an den Wänden entlanggleiten. Ich komme an dem kleinen Zimmer vorbei, in dem Sabine schläft. Gil schnarcht auf der Couch.
Vor der Eingangstür quetsche ich die Füße in die Stiefel und drehe den Türknauf, kann es kaum erwarten, an die frische Luft zu kommen und die schier endlose Weite um mich herum zu spüren. Vorsichtig, damit ich die anderen nicht wecke, öffne ich die Tür und schlüpfe hinaus.
Kühle Dämmerung begrüßt mich. Die Zikaden liefern sich ein Duell, ihr fast hypnotisches Summen legt sich wie eine Decke über die sonst dichte Stille. Dabei ist es die darunterliegende Stille, die mir zu schaffen macht. Sie pulsiert, als wäre sie lebendig, hämmert gegen meine Haut. Durch mich hindurch. Die Art von Stille, die man in der Stadt niemals hört. Auch in den Vororten nicht. Dieses undefinierbare Etwas fehlt, ein elektrisches Summen, das auf Zivilisation hindeutet. Menschen.
Ich streife mir die kurzen Strähnen hinter die Ohren, lege sie für die Kälte frei. Gleich darauf fange ich an zu frieren, setze die Füße vorsichtig voreinander, damit ich auf dem zerklüfteten Boden auf dem Weg zum Aussichtspunkt sicher vorankomme. Ein schneller Blick über die Schulter und ich sehe den klobigen Wohncontainer. Er sieht ungefährlich, aber grimmig und einsam aus, wie er da auf Betonpfeilern steht, die Holzplanken rissig und stellenweise bucklig. Das raue Klima fordert seinen Tribut. Er sieht genauso mitgenommen aus wie seine Umgebung.
Ein Kojote heult in der Ferne. Noch vor Monaten hätte mir das Geräusch Angst gemacht und ich hätte schnellstmöglich Schutz gesucht. Einem wilden Tier zu begegnen, wäre das Schlimmste gewesen, aber darüber mache ich mir keine Sorgen mehr. In der Dunkelheit lungert Schlimmeres als wilde Tiere. Dort lungert so etwas wie ich.
Der Wind zerrt an meinen Haaren, als ich mich auf den Felsvorsprung setze, von dem aus man weit das Tal mit dem Fluss überblicken kann. Dabei schabe ich mir an dem rauen Fels die Handflächen auf. Sean hat hier draußen Stunden verbracht, seine Haut ist ganz dunkel geworden, während er das Kommen und Gehen im Tal beobachtet hat.
Eine schwache Spur von Farbe deutet sich am Horizont an, gibt dem Himmel einen schmutzigen Blauton. Ich winkle die Beine an und umarme sie, drücke mir die Knie gegen die Brust. Hätte ich mal besser an eine Decke gedacht. Morgens und nachts ist es ziemlich kalt.
Ich weiß, dass die Temperatur nach oben schnellen wird, wenn die Sonne erst einmal aufgegangen ist und auf den Boden brennt – und uns im Container wie in einem Ofen röstet. Es gibt ein paar Tischventilatoren, aber die scheinen die heiße Luft nur hin und her zu pusten. Ich sollte die Kälte genießen, solange ich die Möglichkeit habe.
Der Kojote ist mittlerweile still. Jetzt ist da nur noch das Summen der Zikaden, das die Stille übertönt, während ich in die unter mir liegende Finsternis starre, wo ich mit gutem Willen Wasser schimmern sehen kann, das darauf wartet, von uns überquert zu werden.
Plötzlich wird mir eine Decke um die Schultern gelegt. Ich erschrecke mich, bin in Alarmbereitschaft und schaue schnell auf. Sean setzt sich neben mich.
»Du solltest jemandem Bescheid sagen, bevor du rausgehst.«
Ich nicke. Er hat natürlich recht. Wir sind Flüchtige. Die suchen uns. Na, vielleicht nicht ausdrücklich nur uns, aber sie suchen Träger. Wir können nicht die Einzigen sein, die sich hier verstecken in der Hoffnung, es über die Grenze zu schaffen.
»Danke.« Ich umfasse die Ecken der Decke mit den Fingern. Sie hilft ein bisschen gegen die Kälte, aber ich zittere trotzdem noch. Stille breitet sich zwischen uns aus, während wir in die ausklingende Nacht schauen.
Seans Stimme streichelt mich. »Bist du bereit, das hier hinter dir zu lassen?«
»Ich könnte kaum bereiter sein.« Vielleicht wird mich dort, auf der anderen Seite, der tote Mann nicht länger verfolgen.
Ich spüre Seans Blick auf mir. »Was ist los, Davy?«
Diesmal tue ich nicht so, als würde ich nicht wissen, worauf er anspielt. Das habe ich bei Sabine versucht, aber bei Sean wird das nichts bringen. Nicht nach all dem, was wir durchgemacht haben. Ich schulde ihm ein bisschen mehr. Trotzdem weiß ich noch nicht, wie ich es erklären soll. Bin ich bereit, zuzugeben, dass ich seit unserem Ausbruch aus Mount Haven Geister sehe? »Ich komme nicht über das hinweg, was ich in Mount Haven getan habe.« Deutlicher kann ich die Tatsache nicht formulieren, dass ich jemanden kaltblütig ermordet habe. Er weiß es zwar, aber das heißt ja nicht, dass ich es auch wirklich aussprechen kann.
Ich drehe mich zu ihm und verliere mich in seinen Augen. Sie glitzern blaugrau in der Morgendämmerung und ich sehne mich danach, wie glücklich mich diese Augen einmal gemacht haben. »Das wirst du noch«, sagt er.
Ich nicke, möchte ihm glauben, möchte so gern wieder glücklich sein.
»Hab Geduld«, fügt er hinzu. »Manchmal passiert etwas und du hast das Gefühl, du kommst nie darüber hinweg. Aber dann schaffst du es doch. Du lässt das hinter dir. Mit der Zeit wird es besser. Du vergisst. Vergibst. So was halt.« Es folgt eine lange Pause, als würde er über etwas nachdenken … als würde ihm etwas wieder einfallen. Wahrscheinlich das, was er sich selbst vergeben hat. »Das Leben geht weiter und du gehst mit.«
Es klingt fast so, als würde er das wirklich glauben. Ich betrachte ihn genau, suche in seinem Gesicht nach dem Bruch, der mir verrät, dass er es nicht glaubt – dass er sich selbst etwas vormacht. Mir. Aber da ist keiner. Er hat einen inneren Frieden mit sich geschlossen. Eine verzweifelte Sehnsucht nach genau diesem Frieden packt mich, presst mir schmerzhaft die Brust zusammen.
Er merkt, dass ich ihn mustere. »Was ist?«
»Du glaubst das wirklich.«
»Klar.« Der Anflug eines Lächelns umspielt seine Lippen. »Tue ich.«
»Dann kannst du also noch nichts wirklich Schlimmes getan haben, oder?«
Nicht wie ich.
Seine Kiefermuskulatur spannt sich an, sein Blick wandert fort von mir. Ich sehe, wie sich das Licht in seinen Augen verdunkelt. »Es war schlimm.«
»Erzähl mir davon.« Ich schaue seine Markierung an – das dunkle Band mit dem eingekreisten H. Wir sprechen darüber. Endlich. Darüber, wieso er markiert wurde. »Wie hast du dir die Tätowierung eingehandelt?«
Sein Blick trifft mich. Ich bekomme das Gefühl, als habe ich ihn mit meiner Stimme gezwungen, mich anzusehen.
»Erzähl es mir«, wiederhole ich, weil ich das hören muss. Ich warte schon so lange darauf, zu erfahren, was er getan hat – ob er überhaupt etwas getan hat. Er war noch ein Kind, als er von der Behörde markiert wurde. Schwer vorstellbar, dass er etwas Furchtbares getan haben soll. Ganz besonders in dem Alter. Er ist so ein guter, so pflichtbewusster Mensch – wie sollte er als kleiner Junge anders gewesen sein?
»Ich war elf«, sagt er, seine Stimme driftet ab. »Damals war ich noch nicht bei meiner Pflegemutter, sondern in einem Jungenheim. Wir waren in Schlafsälen untergebracht. Ich schlief oben in einem Etagenbett.« Er zuckt mit den Schultern. »Ich fand das super. Etagenbetten halt, du weißt schon.«
Ich nicke.
»Ich war da erst ein paar Monate, kam aus einer anderen Einrichtung, für die ich zu alt geworden war«, fährt er fort. »Ich habe jeden Tag um meinen Platz gekämpft. Buchstäblich jeden Tag. Ein paar von uns haben sich blutig geprügelt.«
»Klingt nach einem Knastfilm.«
»Ja, war auch so in der Art. Jeder Neuankömmling musste durch die Hölle. Ich hatte es fast geschafft, als ein neuer ankam. Ich weiß noch immer, wie er hieß. Branson.« Sean sagt den Namen mit einem tiefen Seufzer. »Er war ungefähr so alt wie ich, aber verdammt viel größer.«
»Noch größer?« Ich spüre, dass mir eine Augenbraue die Stirn hinauf entgleitet. Sean ist schließlich nicht gerade klein.
»Damals war ich noch so groß wie der Durchschnitt, bin erst kurz vor der neunten Klasse auf einen Schlag fünfzehn Zentimeter gewachsen. Branson war mit elf jedenfalls riesig und eigentlich schon erwachsen. Der Typ hatte jeden Nachmittag gegen drei einen Bart.«
Darüber muss ich lächeln.
Sean schnaubt. »Er wurde natürlich nicht lange gequält. Niemand wollte es mit ihm aufnehmen. An seinem zweiten Tag hat er entschieden, dass er mein Bett will.« Er lacht heiser. »Er hätte jedes andere der oberen Betten auswählen können, aber nein, ich war der Glückliche.«
Seine Hand legt sich auf meine, die zwischen uns auf dem steinigen Boden ruht. Dann fahren seine Finger über das Muster auf meinem Handrücken. Ausnahmsweise zucke ich nicht weg bei seiner Berührung. Ich bin viel zu gebannt von seiner Geschichte. Seine Worte fesseln mich wie ein Zauber.
»Ich konnte die Blicke aller auf mir spüren, als er von mir verlangte, das Bett mit ihm zu tauschen.« Seine Stimme ist ein tiefes Grollen und ich bin mir sicher, dass er die ganze Situation gerade noch einmal durchlebt. »Ich wusste, wenn ich nachgebe, würde –« Er schüttelt den Kopf und stöhnt. »Die hätten mich nie wieder vom Haken gelassen. Die Hölle hätte mich erwartet, vierundzwanzig Stunden am Tag, sieben Tage die Woche. Die wären erbarmungslos gewesen.«
»Und dann?«, bohre ich, will unbedingt wissen, wie es weiterging. Dabei will ich gleichzeitig, dass er nicht weitererzählt, weil ich Angst davor habe, was er noch offenbaren wird.
»Keiner von uns wollte nachgeben. So was von idiotisch.« Er lacht trocken. Ich kann nicht sagen, ob er sich oder Branson oder die ganze Situation meint. »Er wollte mich vom Bett zerren. Hat mich an den Füßen gepackt, aber ich habe ihm einfach die Füße entrissen und ihm ins Gesicht getreten. So fest ich konnte. Ich trug noch meine Schuhe, musst du wissen.«
Ich drehe die Hand unter seiner, bringe unsere Handflächen zusammen. Seine Haut ist warm und fest. Ich drücke seine Hand. Mehr kann ich nicht tun. Vielleicht nur ein nutzloser Versuch, Trost zu spenden. Dabei braucht er gar keinen Trost. Sagt er zumindest. Will, dass ich das glaube. Selbst wenn die Art, wie er meinen Druck erwidert, etwas ganz anderes sagt.
»Was ist dann passiert?«, frage ich.
»Er ist mehrere Meter rückwärts geflogen. Ich habe es krachen hören, als sein Kopf auf den Boden geknallt ist.« Er legt sich auf den Felsen, starrt in die verblassende Nacht hinauf. Man kann noch immer die Sterne sehen, von denen der Himmel übersät ist. Mit der einen Hand hält Sean weiter meine, die andere legt er sich über die Stirn. Er betrachtet den Himmel, als wäre er ein berühmtes Gemälde.
»Ist er …?«
»Sie haben ihn ins Krankenhaus gebracht. Mehrere Wirbel waren gebrochen. Außerdem hatte er eine Gehirnerschütterung. Ich habe ihn nie wiedergesehen. Wahrscheinlich musste er lange im Krankenhaus bleiben. Nach seiner Entlassung musste er ein Korsett tragen … das habe ich zumindest gehört.«
»Aber er konnte laufen.«
»Irgendwann wieder.« Er nickt. »Ich wurde sofort markiert und in eine Einrichtung für markierte Jungen verlegt. Dort habe ich einen meiner Pflegebrüder kennengelernt. Und dort hat Martha uns rausgeholt.«
»Das war ein Unfall –«, setze ich an, verstumme aber. Das sagt er immer und ich will es nie hören. Er sicher genauso wenig. »Das war einfach normaler Jungsquatsch. Dafür sollte man keine Markierung bekommen.«
»Aber dafür, dass man einen Jungen ohrfeigt, der sich wie ein Idiot verhalten hat?«
Beim Gedanken an Zac zucke ich zusammen. Ihn zu schlagen, war kindisch gewesen, eine achtlose Reaktion in einer blöden Situation. Dass sich der eigene Freund als bedeutend weniger als der Prinz entpuppte, für den ich ihn gehalten habe, war ein ziemlicher Schock gewesen. Trotzdem hätte der Schlag nicht als Verbrechen gewertet werden sollen. Er hätte mich nicht mein Leben lang zeichnen dürfen.
»Ich mache mir nichts vor. Wäre Branson jemand Wichtiges gewesen – nicht nur ein weiterer Träger –, hätten sie mich ins Gefängnis gesteckt. Und da wäre ich sicher noch heute.«
Dann hätte ich ihn nie getroffen.
Ich versuche, mir das vorzustellen. Ich glaube kaum, dass ich die Zeit an der Keller High nach meinem Rauswurf aus der Everton ohne ihn überstanden hätte. Die Wochen im Käfig waren schrecklich. Als wäre es noch nicht schlimm genug, dass wir Träger in einem ehemaligen Geräteraum der Sporthalle von den anderen Schülern isoliert wurden, inklusive abschließbarer Tür, gab es noch dazu den perversen Widerling Brockman, der auf uns sechs aufpassen sollte … Bei dem Gedanken, was Brockman mit mir hätte anstellen können, richten sich mir die Nackenhaare auf. Er machte bereits Coco das Leben zur Hölle, der einzigen anderen Trägerin an der Keller High. Er hatte das Gleiche mit mir vor. Und auch in Mount Haven war Sean immer da, um mich zu beschützen. Ob ich es nun wollte oder nicht.
»Wir tun alle nur unser Bestes, um in dieser Welt zu überleben, Davy.« Seans Stimme dringt in die flüchtige Dunkelheit. »Wir sind nicht perfekt, aber wir sind auch keine Monster. Wir sind einfach nur Menschen.«
»Ich weiß«, flüstere ich. »Ich gebe mir große Mühe, das zu sein.« Und das tue ich. Das tue ich wirklich.
Ich lasse mich neben ihn sinken und starre mit ihm in den sternenübersäten Himmel. Die Sterne erlöschen langsam, während der Tag übernimmt.
Langsam ziehe ich meine Hand fort von ihm, ich brauche noch immer Abstand.
»Zeit ist also die Lösung?« Ich versuche, nicht allzu skeptisch zu klingen. Ganz besonders nach all dem, was er mir gerade verraten hat.
»Das schaffst du schon, Davy.«
Er wirkt so sicher. Ich wünschte, das wäre ich auch. Nach einer Weile stemme ich mich auf die Ellbogen und schaue wieder hinunter auf den Fluss. Das ist alles, was ich brauche. Zeit und Freiheit. Ein Leben, das nicht von Reue zerfressen wird. Ein Leben, in dem mich keine braunen Augen und Einschusslöcher überall verfolgen. Dann erst kann ich endlich wieder ich selbst sein. Oder wenigstens ein vollkommen neues Ich, das sich nicht ständig über die Schulter sehen muss.
Die letzte Nacht im Container und ich kann nicht schlafen, lasse mich nicht schlafen. Vielleicht, weil wir sowieso in ein paar Stunden aufstehen müssen, um über die Grenze zu fliehen. Wenn wir erst drüben sind, treffen wir dort Kontaktpersonen. Menschen, die Trägern wie uns helfen und uns in mexikanische Flüchtlingslager bringen. Der Fahrer, der uns hier abgesetzt hat, gab uns die nötigen Informationen.
Vielleicht sind es aber auch meine Nerven, weil ich mir zu große Sorgen vor der bevorstehenden Reise mache. Könnte sein, dass mich das wach hält. Ich weiß, dass ich schlafen sollte, damit ich besser vorbereitet bin auf das, was uns erwartet. Aber ich kann einfach nicht.
Sean dreht sich und legt mir einen Arm um die Hüfte. Ich verkrampfe.
Langsam schiebe ich seinen Arm weg, aale mich aus dem Bett und schleiche aus dem Zimmer. Ich bin gerade zwei Schritte weit gekommen, da stehe ich Auge in Auge mit Sabine. Ich schlucke ein Keuchen hinunter.
»Entschuldigung«, flüstert sie.
»Hi«, antworte ich. »Wieso bist du auf?«
Sie hält ein Glas hoch. »Wasser. Und du?«
Ich werfe einen Blick über die Schulter zur geschlossenen Tür, weiß nicht, was ich Sabine antworten soll, nur, dass ich ihr nicht die Wahrheit sagen will. Besonders, weil ich so sehr damit ringe und wild entschlossen bin, meine Wahrnehmung zu ändern.
Statt der Wahrheit sage ich: »Ich konnte nicht schlafen.«
Sie nickt verständnisvoll. »Nervös wegen morgen?«
Ich schüttle den Kopf. »Eigentlich nicht, ich bin bereit.« Bereit und aufgeregt.
Sie legt den Kopf schief, mustert mich, ihr Blick dunkel in dem fensterlosen Flur. Sie deutet zu ihrem Zimmer. »Wollen wir reden? Da drin, um Gil nicht zu wecken?«
»Gern.« Ich folge ihr in das kleine Zimmer, setze mich auf das Bett, lehne mich mit dem Rücken an die Wand.
Sabine macht es mir gleich, setzt sich in den Schneidersitz und hält das Glas auf dem Schoß, fährt leicht mit dem Finger über den Rand. »Was glaubst du, wird uns da drüben erwarten?«
Ich zucke mit den Schultern. »Auf jeden Fall nichts Schlimmeres als hier, da bin ich mir sicher. Dort müssen wir uns keine Sorgen mehr machen, dass plötzlich jemand von der Behörde auftaucht.« Ich kann mir zumindest nicht vorstellen, dass sie Trägern bis nach Mexiko folgen werden. Und nach dem, was wir dann doch im Radio aufschnappen konnten, ist die mexikanische Regierung gerade voll und ganz damit beschäftigt, die Grenzen abzudichten. Im Land selbst werden keine Flüchtlinge gejagt.
Wir wussten, dass es kein Zurück mehr geben würde, wenn wir Mount Haven erst verlassen hatten. Keine zweite Chance. Wenn sie uns schnappen, sind wir tot. Ich lasse den Kopf gegen die Wand sinken und schaue Sabine lange an. Wir können uns nur nach vorn orientieren. »Da haben wir wenigstens eine Chance.«
»Hast du mal darüber nachgedacht, dass uns vielleicht ein weiteres Mount Haven drohen könnte?«
»Wie meinst du das?«
»Na, ein Haufen Träger zusammengepfercht … Wir wissen schließlich, wie gefährlich das werden kann.«
»Aber es wird niemanden geben, der uns aufeinanderhetzt, damit wir uns gegenseitig verletzen. Wir sind dort niemandem ausgeliefert.« Da liegt mehr Schärfe in meiner Stimme, als ich beabsichtigt habe. Ich kann nichts dafür. Sie ist einfach immer da. Die Gewissheit, dass ich genau das bin, was sie gesagt haben – was meine DNA prophezeit hat. Eine Mörderin. »Wir können gehen, wohin wir wollen. Das ist der gewaltige Unterschied. Dort wartet kein Gefängnis.«
Sie trinkt einen großen Schluck Wasser. »Wir sind trotzdem Gefangene –«
»Keine Gefangenen«, unterbreche ich sie. »Ich werde nie wieder eine Gefangene sein. Wir können kommen und gehen –«
»Aber wohin?« Als ich darauf nichts erwidere, schnaubt Sabine. Das Geräusch ärgert mich, will mir wohl so etwas sagen wie: Hab ich’s doch gewusst.
Sie schüttelt den Kopf. »Ich versuche nur, realistisch zu bleiben … und hoffe, das tust du auch.«
»Ich?« Ich blinzle. »Wieso sollte ich nicht realistisch bleiben?« Was immer sie damit überhaupt meint.
»Ich gehe nicht davon aus, dass es uns dort drüben unbedingt besser gehen wird.«
Das muss es einfach. Ich kann sie nur anstarren.
Sie fährt fort: »Wir sind alle anders … alle Träger. Aber das weißt du sicher. Ich meine das da …« Sie wedelt mit der Hand zu meinem Hals mit der Markierung. Ich unterdrücke den Impuls, danach zu greifen – ich könnte das Band ja doch nicht spüren. »Ein paar von uns sind Mörder. Und wir alle tragen die Veranlagung in uns. Das heißt ja nicht, dass wir herumlaufen und jeden abmurksen, den wir treffen, wir sind nur … eher dazu imstande. Manche Menschen tragen diese Gefahr nicht in sich, aber wir schon. Dir wird es besser gehen, wenn du das erst einmal akzeptiert hast.«
Ich schaue sie mit leerem Blick an, verarbeite langsam, was ich da gerade gehört habe. Ich weigere mich, ihrer Meinung zu sein. Ich werde niemals dieser Meinung sein. Ich will in diesem Punkt nicht anders sein. Ich will nicht eher dazu imstande sein. »Ich kann das nicht akzeptieren.«
»Du hast jemanden ermordet –«