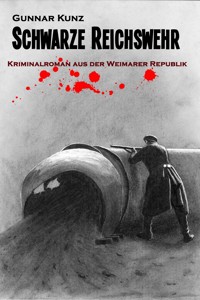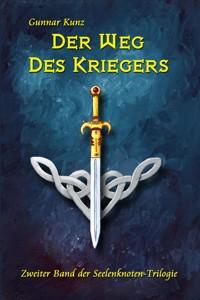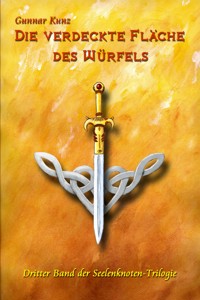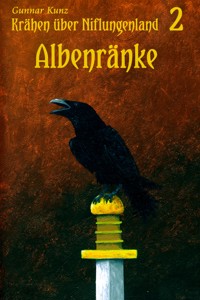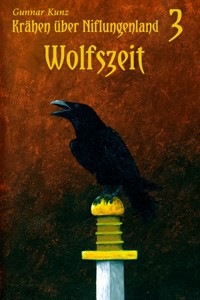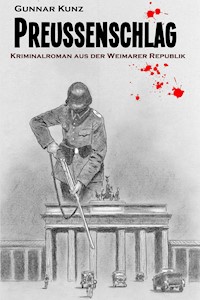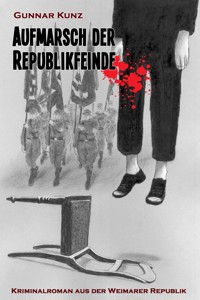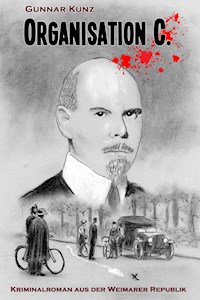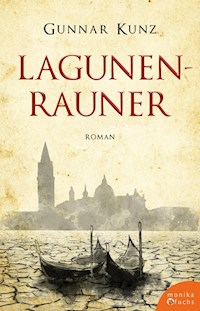7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Krimi
- Serie: Kriminalroman aus der Weimarer Republik
- Sprache: Deutsch
Berlin, 1923. Ein Pfund Butter kostet 1,3 Millionen Mark, der Dollar steht bei 3,9 Millionen, das Spekulantentum blüht. Kein Wunder, dass Philosophieprofessor Hendrik Lilienthal und Diana Escher, Assistentin von Max Planck, sich nicht anders zu helfen wissen, als nachts die Kartoffeläcker im Berliner Umland heimzusuchen. Doch plötzlich stehen sie vor einer übel zugerichteten Leiche. Gemeinsam mit Hendriks Bruder, Kommissar Gregor Lilienthal, stürzen sie sich in die Ermittlungen. Schnell finden sie heraus, dass das Opfer die unsicheren Zeiten für krumme Geschäfte genutzt hat. Ihre Untersuchungen führen sie zu Schiebern und Hehlern, zu Menschen am Rande der Existenz und nicht zuletzt in das von den Franzosen besetzte Ruhrgebiet, wo Auseinandersetzungen zwischen Deutschen und Besatzern, Saboteuren und Separatisten toben. Als sich Diana zu weit vorwagt, gerät sie in tödliche Gefahr.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 292
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Gunnar Kunz
Inflation!
Dieses ebook wurde erstellt bei
Inhaltsverzeichnis
Titel
Inflation!
Prolog
1.
2.
3.
Nachwort
Empfehlenswerte Literatur zum Thema
Weitere Bücher aus der Serie:
Impressum neobooks
Inflation!
Ein Kriminalroman
aus dem Berlin der Weimarer Republik
von Gunnar Kunz
Impressum:
Copyright 2019 by Gunnar Kunz, Berlin
Tel. 030 695 095 76
E-Mail über www.gunnarkunz.de
Alle Rechte vorbehalten
Einbandgestaltung: Rannug
Dieses E-Book, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt und darf ohne Zustimmung des Autors nicht vervielfältigt, wieder verkauft oder weitergegeben werden. Danke, dass Sie die Arbeit des Autors respektieren!
Prolog
Wenn Evolution die Folge bestmöglicher Anpassung an bestehende Lebensbedingungen ist, dann mussten Nachkriegszeit, Revolution und Geldentwertung zwangsläufig jemanden wie Ulf Weber hervorbringen. Das Geld liegt auf der Straße, man braucht es nur aufzuheben, lautete sein Motto, und dabei fragte er nicht nach Moral. Er hatte Bücher gefälscht und Kunden betrogen, metallene Graburnen gestohlen und Lebensmittelkarten mitgehen lassen. Er nahm mit, was sich an Gelegenheiten bot, und wenn dabei noch etwas Spaß abfiel, umso besser. Freunden gegenüber bezeichnete er sich gern als »moralisch großzügig«, und was ihn sympathisch machte, war die Tatsache, dass er diese Großzügigkeit nicht nur für sich in Anspruch nahm, sondern bereit war, sie auch anderen zu gewähren. Er war nicht gerade ein Ausbund an Tugend, aber er hatte seine Qualitäten.
Grüblerisch konnte man ihn sicher nicht nennen. Eine anständige Mahlzeit interessierte ihn mehr als geistige Nahrung, und für einen guten Scherz hätte er alle tiefsinnigen Betrachtungen der Welt hingegeben. Wäre er dazu in der Lage gewesen, hätte er vermutlich einen Witz darüber gerissen, dass er sich in den letzten Augenblicken seines Lebens um die Unversehrtheit seines neuen weißen Sakkoanzuges sorgte. Aber er wusste nicht, dass er nur noch achtzehn Sekunden atmen würde, und so bemühte er sich, seine Hose nicht schmutzig zu machen, als er sich niederhockte, um anhand einiger Kieselsteine zu demonstrieren, wie er es geschafft hatte, unter den Augen des Nachtwächters ein Schuhlager auszuräumen.
Der mit Wucht geführte Hammer krachte in sein Schädeldach, zersprengte den Knochen und trieb Splitter in den Gehörgang. Der Hammerkopf bohrte sich durch Hinterhaupts- und Schläfenlappen der Großhirnrinde in die graue und weiße Substanz und zerstörte Zellen und Nerven. Hirnwasser spritzte auf das Oberteil seines Sakkoanzuges, wo es sich mit dem Blut gerissener Arterien vermischte.
Und mit dem ihm eigenen Sinn für Humor hätte Ulf Weber garantiert den motorischen Impuls zu schätzen gewusst, der dafür sorgte, dass er die letzten anderthalb Sekunden auf dieser Erde mit dem Versuch verbrachte, ein Stück Hirnmasse von seinem weißen Anzug zu schnippen.
1.
Samstag, 11. August bis Dienstag, 11. September 1923
Wer nie sein Brot mit Gipsmehl aß,
wer nie vor schwerspatvollen Klößen
und kreideschweren Nudeln saß,
vor dem will ich mein Haupt entblößen
und fragen, fröhlich im Gemüt,
woher sein Weib das Mehl bezieht.
Volkswitz
1
Was hätte wohl Platon dazu gesagt, dachte Hendrik, während er, nach allen Seiten sichernd, auf den Kartoffelacker zukroch. Oder Aristoteles?
Er schaltete die Taschenlampe aus und hob den Kopf. Niemand zu sehen. Manche Bauern beschäftigten ehemalige Freikorpssoldaten, um ihre Felder zu bewachen. Aber hier schien alles ruhig, wenn man von der Handvoll Menschen absah, die im schwachen Licht des zunehmenden Mondes links und rechts von ihnen durch die Wiesen rund um Großbeeren schlichen.
Diana konnte es mal wieder nicht abwarten. Sie erhob sich, suchte den Horizont ab und rannte auf den Acker zu. Hendrik gab seine Deckung auf und folgte ihr. In der erstbesten Furche fielen sie nebeneinander auf die Knie und fingen an, auf der Suche nach vergessenen Frühkartoffeln mit bloßen Händen den Boden zu durchwühlen. Epikur hätte es verstanden, dachte Hendrik. Christoph Martin Wieland auch: Bei leerem Magen sind alle Übel doppelt schwer.
Seit die Inflation das Geld schneller wertlos machte, als es verdient werden konnte, war Hunger ihr ständiger Begleiter. Ein Professorentitel schützte keineswegs vor Armut; Hendrik wusste ebenso wenig wie ein Arbeiter, wie er mit einem Gehalt über die Runden kommen sollte, für das man kaum noch etwas kaufen konnte, wenn es bei einem ankam. Geld ist eine Ware, die leicht schimmelt, behauptete der Volksmund.
Diana mit ihrer Assistentenstelle bei Professor Planck ging es ähnlich. Nicht einmal ihr Chef wurde verschont. Einmal hatte Planck die Nacht im Bahnhofswartesaal verbringen müssen, weil der Wert der Mark im Verlauf einer einzigen Bahnfahrt unter den vergüteten Betrag für sein Hotelzimmer gesunken war.
»Hab’ eine«, flüsterte Diana triumphierend und verstaute eine schrumpelige Kartoffel in ihrer Leinentasche.
Die Ernte verspäte sich dieses Jahr um einige Wochen, hieß es in den Zeitungen. Wenigstens hatte die Frühkartoffelernte schon begonnen. Hendrik wühlte sich durch die trockene Erde. Irgendwann musste er doch fündig werden, bei jeder Ernte blieb die eine oder andere Kartoffel unentdeckt. Ah, da war etwas! Nein, nur ein Stein. Frustriert grub er weiter, seinen knurrenden Magen ignorierend. Was waren das nur für Zeiten, in denen ein Philosophieprofessor Bauern bestahl! Sobald die elementarsten menschlichen Bedürfnisse unerfüllt blieben, zählte plötzlich keine Moral mehr. Wie tief konnte man noch sinken?
In der Ackerfurche links von ihnen hustete jemand. Ein spärlicher Haarkranz tauchte auf und wurde zu einem alten Mann, der sich nach Atem ringend hinsetzte. Noch jemand, der wie sie mit der Vorortbahn herausgekommen war in der Hoffnung auf ein paar übersehene Kartoffeln. Das war das Schlimmste an der Situation: Da warf man alle moralischen Grundsätze über Bord, und dann wurde man trotzdem nicht satt, weil sämtliche Felder entlang der Bahnstrecken bereits mehrfach durchwühlt worden waren.
Manche Bauern erlaubten das Stoppeln auch ohne Erlaubnisschein, vielleicht hätten sie einfach fragen sollen. Aber damit hätten sie den Besitzer des Feldes nur gewarnt oder riskiert, dass er die Hunde losließ. Nein, es war schon besser so. Sie hätten eben woanders hinfahren sollen. Zu den ertragreicheren Böden in der Uckermark oder im Oderbruch, wo es Weizen gab, nicht bloß Roggen. Oder in den Spreewald: Gurken, Zwiebeln, Möhren. Hendrik hielt sich den schmerzenden Bauch. Er musste endlich aufhören, ans Essen zu denken.
Die Hungersnot dauerte nun schon Jahre. Erst wegen des Großen Krieges, dann folgten die Revolutionskämpfe, Putschversuche, Gebietsabtretungen … Im vorletzten Jahr mussten die Auslandskredite zur Abdeckung der ersten Goldmilliarde Reparationszahlungen beglichen werden, daher hatte die Reichsbank ihre Devisenankäufe verstärkt. Das Resultat war ein katastrophaler Kurssturz der deutschen Mark gewesen. Dazu kamen die Besetzung des Ruhrgebiets durch französische Truppen im Januar, Misswirtschaft, Kriegsgewinnlertum … Die Liste der Ursachen war endlos. Manche Menschen hungerten seit zehn Jahren. Seit zehn Jahren! Es gab Kinder, die kannten nichts anderes.
Hendrik wandte sich wieder der Furche zu. Diana war ihm bereits fünf Schritte voraus; er beeilte sich, sie einzuholen. Ein Professor, der stiehlt … Nie wieder würde er guten Gewissens vor jungen Menschen stehen und über Moral und Anstand reden können. Aber er kam sich in letzter Zeit sowieso wie ein Heuchler vor. Von Jahr zu Jahr unterrichtete er lustloser. Seine Studenten zogen es vor zu randalieren und nationalistische Hohlheiten von sich zu geben, statt über den Sinn des Lebens nachzudenken. Was hatte es für einen Zweck, ihnen von der Toleranz in Lessings Ringparabel zu erzählen, wenn sie noch nicht einmal die Dolchstoßlegende hinterfragten?
Andererseits – wie konnte er den Stab über sie brechen, wenn er selbst moralisch versagte? Und nicht nur, was die Diebstähle anging, nicht wahr? Bei Ludwig Sebald hatte er auch versagt. Eine Seele, die ihm anvertraut worden war, und er hatte sich dieses Vertrauens als unwürdig erwiesen. Er hätte den Tod des Studenten verhindern können, und den Tod von Außenminister Rathenau obendrein. Stattdessen hatte er Polizeiarbeit für ein Spiel gehalten und sich im Gefühl der eigenen Wichtigkeit gesonnt. Hybris!
Am liebsten würde er sich einfach hier im Acker auf den Rücken legen und das Leben über sich hinwegziehen lassen. Nicht mehr kämpfen müssen. Nicht mehr von morgens bis abends über Essen nachdenken. Es war doch sowieso alles sinnlos. Hendrik hielt inne und betrachtete den Erdboden. Die Versuchung war groß. Das liegt am leeren Magen, behauptete Diana immer. Hunger macht depressiv.
Mit aller Energie, die er aufbringen konnte, zwang sich Hendrik weiterzukriechen, aber das Gefühl der Sinnlosigkeit wollte nicht weichen. Seit heute Mittag hatte er nichts mehr gegessen. Fast nichts. Auf dem Weg vom Bahnhof Großbeeren hierher hatten er und Diana drei Walderdbeeren gefunden und redlich miteinander geteilt. Doch es spielte keine Rolle, ob man etwas aß oder nicht: Die Magenschmerzen begleiteten einen von morgens bis abends.
Am Rande des Feldes tauchten weitere Gestalten auf, die geduckt auf die umgepflügten Furchen zuhuschten, ein Vater mit drei Kindern, einen leeren Koffer für die erhoffte Beute unter dem Arm. Hendrik meinte sich zu erinnern, sie im überfüllten Vorortzug gesehen zu haben, in der vierten Klasse, eingekeilt zwischen abgezehrten Hamsterfahrern und heimkehrenden Arbeitern, die in Berlin eine Anstellung besaßen und dennoch hungrig blieben, weil der Lohn nicht mal für eine anständige Suppe reichte. Ein markenfreies Brot kostete heutzutage 240.000 Mark, ein Pfund Butter 180.000. Der Dollar stand bei 3,9 Millionen. Vor dem Krieg hatte er bei 4 Mark 20 gestanden. Inzwischen überstieg der Altpapierwert häufig den aufgedruckten Wert der Geldscheine.
Hendriks Hand stieß auf etwas Festes. Diesmal war es wirklich eine Kartoffel, eine große noch dazu. Er befreite sie von Erdklumpen und ließ sie in seine Tasche fallen. Wenn sie es schafften, ein paar Pfund davon zusammenzuklauben, brauchten sie eine Weile nicht mehr herzukommen. Vielleicht fanden sie auch Zwiebeln und Beeren, dann konnten sie Reibekuchen machen. Allerdings brauchte man dazu Eier, und die kosteten ein Vermögen. Frustriert zerbröselte Hendrik eine zusammengebackene Erdscholle. Er hatte Hagebuttensuppe und Brennnesselauflauf bis oben hin satt, erst recht Kürbismus: Kürbismus auf Brot, damit es nicht so trocken war, oder als Hauptmahlzeit zu Kartoffeln. Kürbismus morgens, mittags, abends – er konnte es nicht mehr riechen. Eine deftige Kartoffelsuppe mit Porree, Sellerie und Möhren, das wär’s! Oder Selleriebratlinge. Oder wenigstens ein Steckrübeneintopf.
Das Ende des Feldes war erreicht. Hendrik tat der Rücken weh von der ungewohnten Bückerei. Auch Diana sah erschöpft aus. Wie auf Kommando ließen sie sich zu Boden fallen. Diana rieb sich die schmerzenden Beine. Hendrik lächelte beim Anblick ihrer vertrauten Silhouette. Sie sah aus, als würde der erste Windhauch sie umpusten, dabei war sie eine erstaunlich zähe Person. Sie hätte es sich leicht machen können. Ihr Onkel war einer der führenden Industriellen des Landes, sie hätte ihn nur um Unterstützung bitten müssen. Aber dazu war sie zu stolz. Sie mochte ihn nicht. Und das Verhältnis zu ihrer Tante, die sie hin und wieder – immer seltener – besuchte, war auch nicht unproblematisch. Käte Unger steckte ihrer Nichte zwar gelegentlich eine Speckseite oder ein Pfund Butter zu, doch Diana kam sich dann immer wie eine Almosenempfängerin vor. Sie fand es demütigend. Da stahl sie lieber.
Hendrik schätzte ihre Freundschaft mit jedem Tag mehr. Sie ergänzten sich wunderbar, sie mit ihrer nie enden wollenden Energie, er mit seiner methodischen Art. Darüber hinaus besaß sie einen Sinn fürs Praktische, der ihm manchmal abging. Sie war sich nicht zu fein, ihr Fahrrad selbst zu reparieren. Mit einem Wort: Man konnte mit ihr nicht nur Pferde stehlen, sondern auch Kartoffeln.
Ein Rascheln von links – alarmiert fuhren Hendrik und Diana in die Höhe. Zwei Gestalten tauchten auf, blieben stehen, ebenso erschrocken über die unerwartete Begegnung wie sie. Der Schein einer Taschenlampe leuchtete Hendrik ins Gesicht.
»Machen Sie das verdammte Ding aus!«, fluchte er.
Der Lichtschein wanderte über die Leinentaschen mit dem mageren Inhalt. Die Neuankömmlinge entspannten sich und schalteten die Lampen ab. »‘tschuldigung«, meinte einer von ihnen und schob mit dem Zeigefinger seine Brille höher. »Dürfen wir uns zu Ihnen setzen?«
»Natürlich.«
Es waren zwei junge Burschen, Studenten möglicherweise. Hendrik betete, dass er ihnen nicht an der Universität über den Weg lief. Wie peinlich, wenn sie im Philosophieprofessor den Kartoffeldieb wiedererkannten! Aber augenblicklich waren ja Semesterferien; wenigstens ein Lichtblick. Die Hamsterfahrt der beiden schien jedenfalls erfolgreicher gewesen zu sein, denn ihre Rucksäcke beulten sich sichtlich.
»Lohnt sich das Feld hier?«, wollte der zweite, ein Kurzgeschorener mit abstehenden Ohren, wissen.
Diana schüttelte den Kopf. »Sie haben eindeutig die bessere Gegend erwischt.«
»Schwein gehabt. Einer der Bauern hat Kartoffeln und Blumenkohl verteilt, als wir gerade ankamen.«
»Immer sind wir am falschen Ort«, rief Diana und fluchte wie ein Droschkenkutscher, was die jungen Männer mit Erheiterung aufnahmen.
»Kennen Sie sich in der Gegend aus?«, erkundigte sich Hendrik. »Wir wollen weiter zur Genshagener Heide. Ist da was zu holen?«
»Kartoffeln, Teltower Rübchen, vielleicht ein paar Lupinen. Einen Pflaumenbaum gibt’s auch. Aber ich würd‘ nicht da lang gehen, wenn ich Sie wäre.«
»Warum nicht?«
»Da haben sie gerade eine Leiche gefunden. Die Polizei ist sicher bald hier, und wenn die Ihre Taschen sieht …«
»Eine Leiche?«
»Ja. Lag mitten in der Landschaft, mit eingeschlagenem Schädel. Mehr wissen wir auch nicht. Wir haben uns lieber verdrückt.«
Hendrik und Diana sahen sich an.
Zwanzig Minuten später näherten sie sich der Genshagener Heide, Hendrik mit gemischten Gefühlen. Was ihn betraf, er hatte im Krieg genug Leichen gesehen, dass es für ein Leben reichte. Aber Diana war nicht zu bremsen. Sie drängten sich durch die Menge der Schaulustigen, die sich unweigerlich einfand, wenn irgendwo ein Unglück geschah. Ihre erbeuteten Kartoffeln hatten sie in einem Gebüsch zurückgelassen.
Zwischen den Bäumen am Waldesrand stand ein Auto, ein Gräf & Stift VK1 Sportphaeton. Ein paar Meter davor lag eine Gestalt, im Mondlicht nur undeutlich auszumachen. Zwei Dorfpolizisten hielten die Neugierigen fern, machten dabei jedoch einen hilflosen Eindruck. Vermutlich hatten sie noch nie etwas anderes als eine Wirtshausschlägerei bearbeitet. Einer der beiden beugte sich immer wieder über das leblose Häufchen Mensch und schüttelte den Kopf, als könne er es nicht fassen, dass sich jemand in seinem Bezirk ermorden ließ. Der andere blätterte, sicher zum tausendsten Mal, in Papieren, die er dem Toten abgenommen hatte. »Ein Berliner«, sagte er immer wieder, »da soll sich die Berliner Polizei drum kümmern.« Sein Kollege nickte zustimmend. Keiner traf Anstalten, etwas zu unternehmen.
Diana schritt auf die beiden zu, ehe Hendrik sie zurückhalten konnte. »Ist die Berliner Kriminalpolizei schon verständigt?«
Der Angesprochene streckte seinen Rücken. »Alles Notwendige wird veranlasst, gehen Sie bitte wieder zurück.«
»Wenn Sie dort anrufen, verlangen Sie nach Gregor Lilienthal. Er ist der fähigste Beamte, den sie haben.«
»Ja?«
»Ich kenne ihn. Vielleicht haben Sie sogar Glück; es würde mich nicht wundern, wenn er sich mal wieder in seinem Büro die Nacht um die Ohren schlägt. Wenn sie ihm sagen, Diana Escher hätte ihn empfohlen, wird er sicher kommen.«
Der Polizist wirkte erleichtert. »Gute Idee. Lilienthal, ja?« Er wechselte einen Blick mit seinem Kollegen und machte sich endlich daran, das nächste Telefon aufzusuchen.
Hendrik verdrehte die Augen. Ob sein Bruder wirklich dankbar für diese Wertschätzung sein würde, wagte er zu bezweifeln. Gregor hatte genug mit den Verbrechen in der Stadt zu tun, ohne sich auch noch um Morde auf dem Land zu kümmern. Und der Regierungspräsident von Potsdam würde die Einmischung der Berliner Polizei auch nicht gerade begrüßen. Aber nun war es zu spät, etwas dagegen zu unternehmen.
Diana sah ihn triumphierend an, als sie zu ihm zurückkehrte. Hendrik verkniff sich einen Kommentar. Gemeinsam warteten sie zwischen den Schaulustigen. Was würde Gregor sagen, wenn er sie hier antraf? Vor allem: Wie sollten sie ihm ihre Anwesenheit erklären? Er konnte sich denken, dass dies kein Wochenendausflug war, mitten in der Nacht. Er würde sofort wissen, dass sie gehamstert hatten. Hendrik wand sich schon jetzt vor Verlegenheit. Der Bruder eines Kriminalkommissars klaut nachts bei Bauern! Vielleicht sollten sie besser verschwinden? Aber Diana sah nicht so aus, als würde sie freiwillig gehen, und im Übrigen würde Gregor durch die Dorfpolizisten erfahren, wem er es zu verdanken hatte, mitten in der Nacht herumgejagt zu werden. Also warteten sie weiter.
Die Zeit wurde ihnen lang. Die Anstrengungen des nächtlichen Abenteuers machten sich bemerkbar und brachten sie mehr als einmal zum Gähnen. Diana blickte immer wieder ungeduldig den Feldweg hinunter. Hendrik lächelte in sich hinein. Die Beziehung zwischen ihr und seinem Bruder war unverändert schwierig. Gregor bestand weiterhin auf einer förmlichen Anrede und wahrte Distanz. Gleichzeitig kam er alle naselang auf einen Sprung vorbei, um mit Hendrik über den neuesten Fall zu reden. Welch ein Zufall, dass das immer zu Zeiten geschah, in denen Diana zu Hause war! Sie dagegen schien in seiner Gegenwart von einer für sie untypischen Einsilbigkeit befallen.
Einmal, als sie alle drei gemeinsam zu Abend aßen, hatte Hendrik eine unschuldige Bemerkung über unausgesprochene Gefühle gemacht – genauer gesagt hatte er Nietzsche zitiert: Mancher findet sein Herz nicht eher, als bis er seinen Kopf verliert – und dafür von beiden Seiten unterm Tisch einen Tritt erhalten. Das hatte ihn davon kuriert, den Kuppler spielen zu wollen. Wenigstens schien Gregor begriffen zu haben, dass Hendrik und Diana wirklich nur Freunde waren, auch wenn es seinen Horizont überstieg, wie ein Mann und eine Frau miteinander leben konnten, ohne dass eine erotische Komponente mitschwang.
Hinter einer Anhöhe ging die Sonne auf und legte einen goldenen Glanz auf Bäume und Felder. Es schien wie ein Sakrileg, dass etwas so Schönes etwas so Brutales wie einen Mord beleuchtete.
Kurze Zeit später näherte sich von Großbeeren her ein Polizeiwagen und rumpelte über die Feldwege auf sie zu. Wie befürchtet befand sich Gregor unter den Insassen, Hendrik erkannte die Silhouette seines Bruders sofort. Einer der Dorfpolizisten ging dem Wagen entgegen, salutierte zackig, als die Beamten ausstiegen, und erstattete Bericht. Edgar Ahrens, Gregors Gehilfe, war auch dabei. Er entdeckte Hendrik und Diana und winkte ihnen zu. Simon Weinstein, der nur einssechzig große Chemiker, der der Polizei als Fachmann für die Spurensicherung diente, war bereits zum Tatort geeilt und untersuchte die unmittelbare Umgebung der Leiche. Wenn er einmal eine Witterung aufnahm, war er nicht zu halten.
Wie sich herausstellte, hatten die Kriminalbeamten in Großbeeren einen Kunstfotografen aus dem Bett geklingelt, der die Tatortfotos machen sollte. Um diese Zeit war im Präsidium wohl niemand mehr zu bekommen gewesen. Nachdem der Mann seinen Ekel überwunden hatte, packte ihn anscheinend die Berufsehre, denn er schleppte sein schweres Dreibeinstativ von einer Seite zur anderen auf der Suche nach dem perfekten Aufnahmewinkel. »Vorsicht mit dem Objektiv!«, fauchte er einen Beamten an, der sich nicht einmal in der Nähe der Ledertasche mit der Kamera befand.
Jetzt hatte der Dorfpolizist seinen Bericht beendet. Gregor und sein Assistent setzten sich in Bewegung und übersahen geflissentlich die ausgebeulten Taschen einiger Neugieriger. Hendrik wünschte sich weit weg, aber da sein Wunsch nicht erfüllt wurde, machte er gute Miene und lächelte seinen Bruder mit dem harmlosesten Gesicht an, das ihm zur Verfügung stand. Gregor hob nur eine Augenbraue, sagte jedoch kein Wort. Wie befürchtet genügte Diana dieses winzige Zeichen des Erkennens, um ihm wie selbstverständlich zur Leiche zu folgen, und so schloss sich Hendrik ihnen an.
Die drei gaben schon ein kurioses Trio ab, als sie über den Feldweg schritten: Hendrik, der so schlampig aussah wie Reichskanzler Cuno die wirtschaftliche Krise handhabte. Sein Bruder Gregor, korrekt wie ein Steuerbescheid und genauso trocken. Und zwischen ihnen Diana, dissonant wie eine Trillerpfeife in einem Brahms-Requiem. Für ihre nächtliche Aktion hatte sie einen dunklen Regenmantel übergezogen, aber darunter lugten die kubistischen Dekors ihres Jackenkleides hervor, und aus unerfindlichen Gründen hatte sie darauf bestanden, während ihres Raubzuges einen Topfhut mit Quaste aufzusetzen.
Drei Schritte vom Toten entfernt blieb Gregor stehen, um die Arbeit des Chemikers nicht zu behindern und keine Spuren zu zerstören, obwohl es dafür vermutlich zu spät war. Sollten wirklich verwertbare Abdrücke vorhanden gewesen sein, hatten die Aktivitäten der Schaulustigen sie längst unkenntlich gemacht. Gregor registrierte die kreuz und quer verlaufenden Fußspuren, ohne seine Verärgerung zu zeigen, und ließ den Anblick der Leiche auf sich wirken. Sein Blick wanderte von den nackten Füßen des Toten zum eingeschlagenen Schädel und wieder zurück, verweilte auf der Blutlache um den Kopf, auf dem weißen Anzug, den Kohlespuren auf dem Kragen und dem Ringfinger der linken Hand, der eine weiße Stelle aufwies, an der sich vermutlich einmal ein Ring befunden hatte. Er sagte nichts, zog keine voreiligen Schlüsse, sondern beobachtete nur. Hendrik fand es immer wieder unheimlich, wie sein Bruder guckte, wenn er sich an einem Tatort befand. Als zwinge er das Mordopfer mit der schieren Kraft seiner Blicke, ihm Auskünfte zu erteilen.
Der Fotograf breitete derweil umständlich seinen Mantel über die Kamera, um jeden unerwünschten Lichteinfall auszuschließen, nahm eine Kassette mit Glasplatten-Negativ aus einem Behälter und schob sie unter dem Schutz des Mantels in den Schlitz vor der Rückwand. Dann entfernte er den Mantel, klappte den Drahtrahmen des Rahmensuchers auf und nahm verschiedene Einstellungen vor. Endlich spannte er den Verschluss, visierte über die hintere Visiermarke und den Drahtrahmen den Bildausschnitt an und betätigte den Auslöser.
»Hast du schon etwas gefunden?«, wollte Gregor von Simon Weinstein wissen, der damit beschäftigt war, Bodenproben für eine spätere Vergleichsuntersuchung einzusammeln.
»Ja, ein besonders schönes Exemplar von einem Distelfalter.« Mit einer Pinzette hielt der Chemiker den leblosen Schmetterling hoch und verstaute ihn in einem Papiertütchen.
»Ich weiß, du hast gerade erst angefangen. Trotzdem: Kannst du mir schon etwas über den Toten sagen? Was er gemacht hat, wo er gewesen ist?«
Simon ließ sich in seiner Arbeit nicht stören. »Gegen acht Uhr abends ging er über einen Acker mit Hirtentäschelkraut und Vogelmiere, dabei ist er in einen Hundehaufen getreten, das beweisen seine Schuhsohlen.«
Unwillkürlich blickte Hendrik zu den nackten Füßen des Toten. Dass Simon Weinstein einen schrägen Humor pflegte, war unter Kollegen allgemein bekannt.
»Schon gut, ich habe verstanden«, sagte Gregor. »Gib mir einfach Bescheid, wenn du auf etwas Interessantes stößt.«
»Es gibt da einen Knieabdruck.« Simon deutete auf den Boden nahe dem linken Schienbein des Toten. Hier hatte sich ein Stoffmuster in die Erde gedrückt, das bei genauem Hinsehen eine Unregelmäßigkeit an der Seite aufwies.
Gregor hockte sich neben den Abdruck, registrierte und schwieg.
»Ich brauche mehr Seitenlicht, um die Schlagschatten unter dem Kinn auszugleichen«, maulte der Fotograf. »Überhaupt: Der Kontrast ist viel zu stark. Ich muss doch die Halbtöne hervorheben.« Niemand schenkte ihm Beachtung.
Mit Lupe und Pinzette untersuchte Simon die Fingernägel des Toten. »Keine Abwehrspuren«, murmelte er.
Der Chemiker hatte abgenommen, registrierte Hendrik. Deutlich sogar. Offenbar ging die prekäre Ernährungslage auch an ihm nicht spurlos vorüber.
Der Fotograf beschwerte sich, dass ihm die Sicht versperrt werde, und überhaupt, unter solchen Bedingungen könne er nicht arbeiten. Simon packte sein Spezialwerkzeug aus, den umgebauten Haartrockner, der ihn in die Lage versetzte, kleinste Fasern von einer Leiche zu saugen, und konterte, bei dem Tempo seien ja die Maden schneller mit ihrer Arbeit fertig.
Er war eben im Begriff, das Gerät in Gang zu setzen, als sich sein Blick irgendwo festfing. Ohne die betreffende Stelle aus den Augen zu lassen, holte er sein Merkbuch hervor, um etwas zu notieren. Dann zückte er eine Lupe und studierte den oberen Teil des Anzugs. »Ich glaube, hier haben wir etwas Interessantes«, meinte er.
Gregor ging neben ihm in die Hocke. »Ein Haar? Von einem Menschen?«
»Es stammt jedenfalls nicht von einem Distelfalter.« Simon steckte die Lupe wieder ein, fasste das Beweisstück mit der Pinzette an einer blutfreien Stelle und ließ es in ein verschließbares Glas fallen. Ein weiteres Haar wanderte in ein zweites Glas. Dann schaltete er den Haartrockner ein, der fauchend Staub und andere Partikel in ein Baumwollsäckchen sog.
Gregor richtete sich auf und nahm die beiden Dorfpolizisten in Augenschein, die eingeschüchtert unter den Zuschauern standen. Besonderes Augenmerk richtete er auf die Knie der beiden. Das Ergebnis schien ihn zu befriedigen. »Also, was haben Sie angefasst?«, wollte er wissen.
»Nichts«, verteidigte sich der eine. »Bloß den Anzug. Ich hab’ nach Papieren gesucht, die uns was über ihn verraten können.«
»Und, äh, ich hab’ ihm den Puls gefühlt«, stammelte der andere.
Gregor beherrschte sich. »Was haben Sie gefunden?«
»Das hier.« Beflissen griff der erste Polizist in seine Uniformtasche, zog einen Führerschein heraus und reichte ihn Gregor.
Der begutachtete das Dokument. »Ulf Weber, geboren 12.7.1883, wohnhaft Berlin, Mühlenstraße.« Er öffnete den Führerschein, studierte die Informationen über die abgelegte Fahrprüfung und betrachtete das Foto. Dann klappte er das Papier wieder zu. »Haben Sie das Auto angerührt?«
Unisono schüttelten beide den Kopf.
»Bloß von außen einen Blick reingeworfen«, meinte der eine.
»Ein Gräf & Stift«, schwärmte der andere. »Der österreichische Kaiser Franz Joseph fuhr eine Gräf & Stift-Limousine.«
»Und der ermordete Erzherzog Franz Ferdinand«, fügte der Erste hinzu.
Gregor ging zum Auto, Hendrik, Diana und die Dorfpolizisten im Schlepptau, und inspizierte es von allen Seiten, ohne etwas anzufassen.
»Solide«, sagte der eine Polizist.
»Hervorragende Verarbeitung«, bestätigte der andere.
»Muss einen Haufen Geld gekostet haben.«
»Vierradbremse.«
Die beiden betrachteten abwechselnd den silbernen Löwen auf dem Kühler und das elegante Innere des Wagens.
»Da drin sitzt es sich bestimmt bequem.« Man sah dem Polizisten an, dass er gern die Probe aufs Exempel gemacht hätte. Vielleicht hatte er es sogar getan, ungeachtet seiner Beteuerungen, und damit wertvolle Spuren kontaminiert.
Gregor hatte die Nase voll von den beiden und schickte sie unter Edgars Führung los, die Bewohner der umliegenden Höfe zu befragen. Dann drehte er sich zu Simon um. »Der Sanitätswagen für den Leichentransport müsste jeden Augenblick hier sein«, meinte er. »Schaffst du das so lange allein?«
»Was soll das heißen, allein?«, regte sich der Fotograf auf.
Der Chemiker nickte nur abwesend, während er mit einem Messer Schmutz unter den Fingernägeln des Toten hervorholte und in ein Papiertütchen schabte.
Jetzt richtete Gregor zum ersten Mal das Wort an Hendrik und Diana. »Soll ich euch mitnehmen?«
»Das wäre schön.« Hendrik war klar, dass ihm sein Schuldbewusstsein ins Gesicht geschrieben stand, aber Gregor schien durch den Toten so abgelenkt, dass er es nicht bemerkte.
Zu dritt marschierten sie zum Polizeiwagen.
Dort drehte sich Gregor noch einmal um und musterte Hendrik. »Seht zu, dass ihr nicht auffallt, wenn ihr eure Beute holt«, sagte er.
2
Auf dem Weg in die Innenstadt kamen sie durch Marienfelde, und Gregor entschied sich für einen Abstecher nach Lankwitz, um einen Blick in Ulf Webers Wohnung zu werfen. Minuten später bog er in die Mühlenstraße ein und hielt neben einer dichtbelaubten Linde. »Es kann eine Weile dauern«, sagte er.
»Wir kommen mit«, erklärte Diana.
Gregor äußerte sich nicht dazu.
Dem Klingelschild nach lag Ulf Webers Wohnung unterm Dach. Von dort oben hatte man bestimmt einen malerischen Blick auf den Gemeindepark gegenüber. Im Hausflur sahen sich die drei als Erstes dem Hinweis Betteln und Hausieren verboten gegenüber. Auf der Treppe musste man achtgeben, nicht über die Wellen zu stolpern, die die Teppichläufer aufwarfen. Im ganzen Treppenhaus gab es nicht eine einzige Stange, um die Teppiche an ihrem Platz zu halten. »Geklaut«, vermutete Gregor. Der Gedanke lag nahe. Metall war wertvoll. Ab dem dritten Stock fehlten sogar die Läufer selbst.
Vor der wuchtigen Wohnungstür Ulf Webers blieb Gregor stehen, doch nicht, um zu klingeln. Hendrik konnte nicht sehen, was los war, aber an der Anspannung im Oberkörper seines Bruders erkannte er, dass etwas nicht stimmte. Gregor zog seine Dienstwaffe, winkte ihnen zurückzubleiben und legte sein Ohr ans Holz der Tür. Jetzt bemerkte Hendrik, dass die nur angelehnt war.
Gregor drückte die Tür auf. »Kriminalpolizei!«, rief er in den Raum. »Ist da jemand?«
Keine Antwort.
Vorsichtig betrat er die Wohnung, die entsicherte Waffe in der Hand. Eine Diele knarrte unter seinen Füßen.
Hendrik und Diana wagten es, ihm zu folgen.
Es war eingebrochen worden, ohne jeden Zweifel. Schubladen waren herausgezogen, Truhen und Kisten aufgestemmt, ihr Inhalt über den Boden verstreut. Zerbrochenes chinesisches Porzellan lag neben den Überresten eines aufgeschlitzten Kissens, auf dem Teppich türmten sich achtlos hingeworfene Hemden und Krawatten, eine karierte Tangohose, Strümpfe, zwei Westen, ein Smoking, ein Panamahut und Manschettenknöpfe, dazwischen gab es Hunderte von Lebensmittelkarten, die wohl aus einem versehentlich aufgerissenen Karton gefallen waren und sich über den Raum verteilten.
Mit schnellen Schritten durchquerte Gregor das Wohnzimmer, sah in der Küche nach, im Schlafzimmer, im Bad, öffnete Schränke und überzeugte sich davon, dass sich niemand hinter den Möbeln verbarg. Endlich steckte er die Waffe wieder ein. »Ausgeflogen.« Er drehte sich um. »Ihr solltet doch draußen warten. Bleibt da stehen, damit ihr keine Spuren zerstört, die Kollegen vom Einbruchsdezernat werden sonst fuchtig. Und vor allem: Fasst nichts an.«
Diana machte ein mürrisches Gesicht, hielt sich aber an die Anweisung, auch wenn stillhalten nicht gerade zu ihren hervorstechenden Charaktereigenschaften zählte.
Hendrik ließ seinen Blick schweifen. Da gab es handgefertigte Möbel – Barock, Rokoko, Biedermeier, alles bunt durchmischt und ohne eine Spur von Geschmack zusammengestellt –, ein Klavier, das dem Staub nach zu urteilen nie benutzt wurde, Bücher mit einheitlichem Rücken, vermutlich nach dem Meter gekauft, Vorhänge aus Seide und eine klobige Stehlampe, die den Raum dominierte und die filigranen Jugendstilfiguren auf dem Beistelltisch erschlug. Außerdem ein auf den ersten Blick als schlechte Kopie zu entlarvender Rubens neben zwei Fälschungen von Kandinsky, dazwischen ein Zille, der möglicherweise sogar echt war, und an der Wand gegenüber ein japanisches Samuraischwert neben einem Vorderlader und einem Hirschgeweih. Auf dem Wohnzimmertisch lagen etwa zwei Dutzend Damenschuhe aus Schlangenleder, übersät mit weiteren Lebensmittelkarten.
»Ein Schieber, wie es aussieht«, meinte Gregor.
»Das war sicher der Mörder«, überlegte Diana und umfasste mit einer Handbewegung das Chaos in der Wohnung.
»Vermutlich. Die Tür ist nicht gewaltsam aufgebrochen; wer immer das getan hat, besaß einen Schlüssel.«
»Also Raubmord.«
Dazu mochte sich Gregor nicht äußern.
Auf dem Esstisch lag eine umgestoßene Milchflasche. Die weiße Pfütze auf der Holzplatte war nicht eingetrocknet, der Einbruch konnte also noch nicht lange her sein. Jemand hatte die Nacht genutzt, um sich unerkannt Zutritt zu verschaffen.
»Hat er nach etwas Bestimmtem gesucht?«
»Schwer zu sagen. Der Täter hat es jedenfalls eilig gehabt. Befürchtete wohl, jemand könnte auf ihn aufmerksam werden. Wir müssen die Nachbarn befragen, ob sie etwas gehört haben, immerhin gab es Scherben.«
Gregor unterzog den Inhalt des Kleiderschranks einer kurzen Untersuchung. Stoffe und Schnitt der Kleidung entsprachen der neuesten Mode. Ulf Weber schien ein Faible für Schwarz gehabt zu haben, allerdings gab es auch einen weiteren weißen Anzug und sogar einen in weinrot.
Eine aufgebrochene Schatulle zog Gregors Aufmerksamkeit auf sich. Mit einem Bleistift, um keine etwaigen Fingerabdrücke zu zerstören, drehte er sie herum.
»Was war da drin? Geld? Schmuck?«
»Möglicherweise. Ich sehe hier jedenfalls weder das eine noch das andere. Geschirr und Kunstobjekte hat der Einbrecher liegen lassen, die waren ihm wohl zu schwer, aber Geld und Schmuck hat er mitgenommen. Was uns schon mal eine Menge verrät.«
»Ja?«, meinte Hendrik.
»Er war allein und ohne Auto unterwegs. Andernfalls hätte er wenigstens die vergoldeten Karaffen und das Schwert fortgeschleppt.«
Das leuchtete ein. Die Hast, mit der der Täter geflohen sein musste, zeigte sich schon darin, dass er die Lebensmittelkarten nicht wieder eingesammelt hatte. Vielleicht hatte ihn der Lärm des zerbrechenden Porzellans in die Flucht getrieben.
Diana konnte es nicht lassen und ging zum Schreibtisch, um die dort aufgestellten Fotos zu betrachten. »Ich würde sagen, das war der Ermordete.«
Hendrik folgte ihr. Er hatte es vorgezogen, sich den Toten nicht so genau anzusehen, aber auch er erkannte ihn wieder. Ulf Weber im Gespräch mit Oberbürgermeister Böß. Ulf Weber, händeschüttelnd mit Emil Jannings. Ulf Weber, Arm in Arm mit Pola Negri und Anita Berber. Ulf Weber zwischen den Tiller-Girls.
Gregor kniete unterdessen neben den achtlos auf den Boden geworfenen Schubladen nieder und fischte zwischen Stiften und Packpapier eine Kladde hervor. Er blätterte darin herum und machte ein zufriedenes Gesicht. »Sieht nach einem Geschäftsbuch aus. Terminkalender, Aktienkurse, Spekulationsgeschäfte, Eingang und Ausgang von Schieberware … Sehr ordentlich, der Mann.«
»Stehen da auch die Namen der Leute drin, mit denen er Geschäfte gemacht hat?«
»Leider nur in einer Art Geheimschrift. Ulf Weber war vorsichtig.«
»Nicht vorsichtig genug«, warf Diana ein.
»Ja, er hat wohl keine Gewalt erwartet.« Wieder blätterte Gregor in dem Buch. »Initialen und kryptische Abkürzungen. Hier und da ein Deckname. Anscheinend ohne System, eher spontan und zufällig, wie es ihm gerade in den Sinn kam. Na ja, er benötigte das Buch ja auch nicht fürs Finanzamt, es sollte ihm wohl nur als Gedächtnisstütze dienen. Dennoch aufschlussreich.«
»Wenn der Täter es liegen ließ, bedeutet das doch sicher, dass er nichts mit den Schiebereien zu tun hatte«, meinte Diana. »Oder?«
»Ich bin geneigt, Ihnen zuzustimmen. Aber für Schlussfolgerungen ist es noch zu früh.« Er klappte das Buch zu und steckte es ein.
Schwere Atemzüge ließen die drei herumwirbeln.
»Wat soll’n det wer’n, wenn’s fertig is‘?« In der Tür stand eine korpulente Frau und stemmte die Fäuste in die Hüften. Sie sah aus wie jemand, der sich mit einem Happs einverleibt, wozu andere zehn Bissen brauchen, und kämpfte einen heroischen, aber aussichtslosen Kampf gegen Zeit und Schwerkraft, woran auch die überreichliche Verwendung von Rouge und Fischbeinschienen nichts änderte.
Gregor hielt ihr seine Messingmarke hin. »Kriminalpolizei. Und wer sind Sie, wenn ich fragen darf?«
»Gertrud Fraenkel. Wat will’n die Pollezei hier?«
»Sind Sie eine Nachbarin?«
»Mir jehört det Haus. Wo is‘n Herr Weber? Hat hier etwa eener wat jeklemmt?«
»Wohnen Sie im Haus?«
»Parterre.«
»Sie haben nichts gehört? Vergangene Nacht? Oder jemand Verdächtigen gesehen?«
»Inner Nacht war‘n die da? Wat sagt der Mensch dazu! Ham se wat mitjehen lassen?« Neugierig ließ Frau Fraenkel die Augen schweifen.
»Fehlt etwas?«
Sie zuckte die Achseln.
»Ich wüsste gern mehr über Herrn Weber. Was war er für ein Mensch?«
»War?« Die Augen der Zimmerwirtin wurden größer. »Woll’n Se damit sagen …«
»Es wäre einfacher, wenn Sie mich die Fragen stellen lassen und sich auf die Antworten beschränken würden.«
»Aba ick muss doch wissen, ob –«
»Wir haben Grund zur Vermutung, dass Herr Weber ermordet wurde.«
»Mein Jott!« Frau Fraenkel musste sich an einem Sessel festhalten. »Ermordet! Det is‘ bitter. Wer tut denn so wat?«
»Kannten Sie ihn gut?«
»Jut is‘ übertrieben. Aba natürlich kannt‘ ick ihn.«
»Ging er einem Beruf nach?«
Gertrud Fraenkels Augen wanderten über die Lebensmittelkarten, und man konnte ihr ansehen, dass sie dasselbe dachte wie Gregor zuvor. Aber sie antwortete: »Er macht in Bankjeschäfte, soviel ick weeß.«
»Erzählen Sie uns etwas über Herrn Weber.«
»Mein Jott, wat soll ick da sagen? Er is‘ dot, det is‘ doch eene Affenschande. Wat mach‘ ick denn nu‘ mit die Wohnung?«
Gregor sah sie auffordernd an, ohne seine Frage zu wiederholen, und endlich riss sie sich zusammen.
»Een ruhja Mieter. Hat nie Ärjer jemacht. Der konnte allet besorjen. Damit is‘ nu‘ wohl Essig.«
»Leben seine Eltern noch?«
»Nich‘, dass ick wüsste.«
»Geschwister? Sonstige Angehörige? Wen müssen wir benachrichtigen?«
»Ick gloobe, er hat ‘n Bruder. Aba der lebt nich‘ in Berlin.«
»Sondern?«
»Ick hab’ keen‘ blassen Dunst. Vielleicht in Bielefeld, da kommta her.«
»Was wissen Sie über seine Geschäftspartner?«
»Nischt.«
»Gab es Freunde?«
Frau Fraenkel schüttelte den Kopf.
»Feinde?«
Sie zuckte die Achseln.
Gregor war über die dünnen Auskünfte nicht gerade erbaut, das sah man ihm an. »Was ist mit Frauen?«
Die Wirtin zog die Nase kraus. »Na ja, wat soll ick sagen … Er war keen Kostverächter, wenn Se vastehen, wat ick meene. Hat jerne mal ‘rumpoussiert. Jibt ja jenug Valuta-Mädels, die der ihren abjebrannten Freunden ‘n Laufpass jeben und sich eem Finanzkräftijeren annen Hals werfen.«
»Jemand Bestimmtes?«
Wieder zuckte sie die Achseln. »Wat Festes hatta nich‘ jehabt.«
»Können Sie uns einen Namen sagen? Irgendetwas, das uns weiterhilft?«
»Nee. Von dem seine Weiber weiß ick janischt.«
Wieder sah Gregor sie schweigend an.
»Ick erinner‘ mich bloß noch an die eene, so’n dürret Jerippe. Na ja, wem’s jefällt … Wie hieß die gleich? Magda, gloob‘ ick. Jenau: Magda.«
»Einen Nachnamen oder eine Adresse haben Sie nicht, nehme ich an?«
»Nee. Aba ‘ne Zeitlang hat se uff’n Abend Blumen vakooft, am Küstriner und am Helsingforser Platz.«
Gregor machte sich Notizen. »Wann haben Sie Herrn Weber zuletzt gesehen?«
»Vor‘n paar Tagen. Uff‘n Freitag, gloob‘ ick. Aba man bloß flüchtig, im Treppenhaus.«