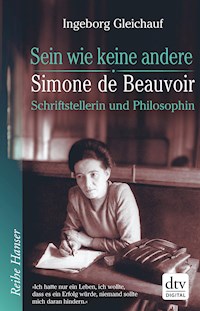10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks in Piper Verlag
- Kategorie: Poesie und Drama
- Sprache: Deutsch
Für vier Jahre, zwischen 1958 und 1962, waren sie ein Paar: Ingeborg Bachmann und Max Frisch. Ein Paar allerdings, von dem es keine gemeinsamen Fotos gibt und über das nur wenige Details nach außen drangen. Doch die beiden haben Spuren hinterlassen: in Paris, wo ihre leidenschaftliche Liaison beginnt, in Zürich, wo sie eine gemeinsame Wohnung beziehen, und in Rom, wohin Frisch seiner Geliebten folgt und bald von Eifersucht geplagt wird. Selbstkritisch gesteht er: »Das Ende haben wir nicht gut bestanden, beide nicht.« Noch über den schmerzvollen Bruch hinaus beziehen sie sich in ihren Werken aufeinander, geben sie in ihren Texten innerste Gefühle und Verwundungen preis. Ingeborg Gleichauf erzählt die Geschichte einer so großen wie unmöglichen Liebe.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Mehr über unsere Autoren und Bücher:
www.piper.de
Für Eberhard
Vollständige E-Book-Ausgabe der im Piper Verlag erschienenen Buchausgabe
2. Auflage 2013
ISBN 978-3-492-96382-4
© 2013 Piper Verlag GmbH, München
Umschlaggestaltung: Büro Jorge Schmidt, München
Umschlagmotiv: Dr. Kurt Husnik/Foto-Archiv Piper (oben); akg-images/AP (unten)
Datenkonvertierung: Kösel, Krugzell
[1]
Fremde Nähe
Sommer 1985
Max Frisch sitzt am Steintisch im Garten seines Hauses in Berzona, Valle Onsernone, Tessin. Ihm gegenüber hat der Übersetzer und Regisseur Philippe Pilliod Platz genommen. Mit ihm ist Frisch seit vielen Jahren befreundet. Pilliod hat mehrere Werke Frischs ins Französische übersetzt, kennt sich also aus in der Schreibwerkstatt des Schriftstellers. Vor ihnen stehen eine Flasche mit Weißwein und zwei Gläser. Manchmal erheben sich die beiden Männer, spazieren im Garten umher. Manchmal halten sie inne, bleiben nachdenklich stehen. Meistens aber sitzen sie am Tisch oder auf dem Verandamäuerchen.
Worum es gehen soll, wurde im Voraus besprochen: Max Frisch gibt dem Freund Interviews, deren spätere Ausstrahlung im Fernsehen geplant ist.1
Frisch äußert den Wunsch, es solle bereits im Titel deutlich werden, dass hier ein alter Mann spricht, einem 20 Jahre Jüngeren Rede und Antwort steht. Ein alter und ein junger Mann, und es ist der Jüngere, Philippe Pilliod, der einen gesetzten, gut gekleideten und ordentlich frisierten Eindruck macht. Frischs letzter Friseurbesuch muss einige Zeit zurückliegen, seine weißen Haare sind ziemlich lang, der Wind hat leichtes Spiel mit ihnen. Aber auch auf Fotos aus früheren Jahren fällt das Zusammenspiel von Haar und Wind immer wieder auf.
Max Frisch antwortet auf jede der Fragen bereitwillig, ruhig, aber nie in vorgefertigten oder auswendig gelernt wirkenden Sätzen. Er spielt nicht die Rolle des geübten Antwortgebers, die er sein ganzes Leben über oft genug eingenommen hatte. Er muss nicht auf Knopfdruck druckreife Aussagen machen.
Vielleicht spielt auch die Gegend, in der die Gespräche stattfinden, eine Rolle: Diese wilde Tessiner Berglandschaft begünstigt offenbar ein freieres Nachdenken und Sprechen. Anspruchslos wie die Natur um ihn wirkt auch Max Frisch. Als habe sie abgefärbt auf seinen Charakter. Max Frisch, der Heimatflüchtige, der Unstete, hier in Berzona scheint er angekommen zu sein, bleiben zu wollen, nicht gleich wieder an Abreise zu denken. Zumindest für diese freundschaftliche Begegnung mit Pilliod fühlt er sich am richtigen Ort.
Die Gespräche folgen einem gleichmäßigen Rhythmus, Frisch und Pilliod verstehen sich, haben sich schon vor diesen Interviews verstanden. Der Schriftsteller muss keine Angst haben, unversehens durch eine indiskrete Frage in die Enge getrieben zu werden. Er sieht sich keinem voyeuristischen Blick ausgesetzt. Zwischen den Gesprächspartnern geht es vertrauensvoll, offen, gelöst zu. Keine Anspannung, keine Gehemmtheiten. Max Frisch ist faszinierend präsent, argumentiert klar, erzählt flüssig und spannend.
Im Einklang mit der Umgebung, hin und wieder einen Schluck Wein nehmend, scheint nichts die gelassene und doch wachsame Ruhe der beiden Freunde stören zu können.
Bis ein Name fällt: Ingeborg Bachmann. Frisch springt auf, als habe ein Stromstoß seinen Körper durchzuckt, er weicht zurück, nimmt eine Art Fluchthaltung ein. Diese abrupte Reaktion überträgt sich auf die Zuschauer des Films. Es sieht aus wie ein großes Erschrecken, aber das Wort fasst nicht alles, was in diesem Moment da ist, plötzlich sehr nah erscheint. Die Frage nach dem Grund, die Frage danach, warum etwas geschieht, diese Frage, die die Natur nicht stellt, nur der aus der Natur entlassene Mensch. Auf einmal hat sie sich aufgebaut, massiv wie ein Gebirge und so, als gehöre sie dazu, ganz natürlich, schon immer. Max Frisch weiß es. Vielleicht hatte er vergessen, dass diese Frage lauerte, dass sie sich einfach nur für eine Weile still verhalten hatte. Wie beruhigend ist es, in der Natur zu sein, die den Menschen nicht braucht, die in keinen Erklärungszwang gerät, die einfach da ist. Anders aber steht es mit all den Erfahrungen, die Menschen anhäufen im Lauf ihres Lebens, Erfahrungen, die verstanden werden wollen, die ein forschendes Nachdenken herausfordern, keine Ruhe geben. Wechsel der Jahreszeiten, Sonne, Blitz und Donner, wild prasselnder Regen, das Zubereiten und Einnehmen der Mahlzeiten, Reparaturarbeiten am Haus, Gartenarbeit, manchmal der Besuch von Freunden: als ob das nicht genügen könnte, jetzt im Alter.
Und dann stellt der Freund auf einmal die Frage nach Ingeborg Bachmann. Sofort sind die Erinnerungen wieder da. Der Name Ingeborg Bachmanns fällt, als sei es das Natürlichste von der Welt, neben den vielen anderen Dingen auch über sie und die gemeinsame Zeit zu sprechen. Der Gesprächspartner Frischs ahnt es, ja weiß es vielleicht sogar, dass ohne die Begegnung mit Bachmann für Max Frisch fast alles anders gekommen wäre. Diese Beziehung kann nicht einfach nur eine Episode gewesen sein, ein Missverständnis. Wie steht Frisch heute dazu, was bewirkt die Nennung dieses Namens in ihm, hier in Berzona, jetzt, in dieser Stunde?
Ein kleines Zögern: Was war das damals mit Ingeborg, vor fast 30 Jahren, in Paris, Zürich, Rom, in der eigenen und der fremden Sprache, im Sprachengemisch, im Durcheinander der Gefühle, unter dem Diktat des Schreibenmüssens. Eine Liebe zwischen einem Schriftsteller und einer Schriftstellerin. Diese extreme Erfahrung, sie ist eingegangen in Frischs Arbeit, wie sie auch in Bachmanns Werk eingegangen ist, aber das Schreiben hat sie nicht verstehbar gemacht, sondern bloß ausgefaltet. Nach wie vor lässt Max Frisch der Name Ingeborg Bachmann in äußerste Unruhe geraten, ihn seine Grenzen spüren. Den erlösenden Satz, es hat ihn zu Lebzeiten Bachmanns nicht gegeben. Frisch hat sich ins Schreiben gerettet. Wieder und wieder hat er sich selbst und seinen Lesern Liebesgeschichten erzählt, hat verschiedene Frauenfiguren entworfen, ihnen Namen gegeben. Die wahre Geschichte der Beziehung zu Ingeborg Bachmann kann nicht erzählt werden. Das weiß Max Frisch. Und es beunruhigt ihn. Der verwirrende, vieldeutige Anfang, die gemeinsamen Jahre, die Trennung, über die er, Frisch selbst, schrieb: »Das Ende haben wir nicht gut bestanden, beide nicht.«2 Man mache im Leben vielleicht drei, vier oder fünf entscheidende Erfahrungen. Die Begegnung mit Ingeborg Bachmann habe für ihn zu diesen wichtigsten Erfahrungen gehört. Sie sei damals auf ihn zugekommen auf einem roten Teppich, was für das Zwischenmenschliche gefährlich gewesen sei. Sie hatte Vorrang, und er akzeptierte es. So sieht es der alte Max Frisch. Er denke häufig an sie, aber nicht mit einem Bewusstsein der Schuld, wohl aber mit dem Gefühl der Reue. Schuld wirkt endgültig, trennend, schafft eine letzte Realität. Reue hingegen bewahrt einen Zwischenraum aus ungelebten Möglichkeiten. Daran denkt Frisch jetzt, wenn er mit Philippe Pilliod über seine Liebe zu Ingeborg Bachmann spricht.
Ein Sturzflug sei es gewesen, aber nicht der eines Flugzeugs. Er denke eher an Ikarus dabei. Es ist nicht Altersweisheit, die Frisch so sprechen lässt. Vielmehr eine spezielle Art von Alterswachheit. Immer noch ist dieser Frisch ein Rebell, jemand, der an Utopien glaubt. Wenn einer von Reue spricht, will er nicht recht haben, sich nicht beruhigen in einer Eindeutigkeit, auch nicht in der einer Schuld. In Montauk heißt es, sie werde gebraucht, unsere Schuld, sie rechtfertige viel im Leben anderer. Wie recht Frisch hat. Er denkt daran, was hätte sein können, wenn es nicht gekommen wäre, wie es kam. Es hat keinen Schlussstrich gegeben. Auch wenn es aussah, als habe Frisch nach der Trennung von Bachmann einen radikalen Neuanfang gewagt. Noch einmal anfangen kann man auch dann, wenn man mit allem Vorangegangenen noch nicht am Ende ist. In jedem Anfang sind Reste von Vergangenem, führen ihr Eigenleben.
Frisch war nach dem Ende der Beziehung zu Ingeborg Bachmann sogleich in eine neue Liebesgeschichte geflüchtet. Mit der jungen, aufgeschlossenen, belesenen, fröhlichen, kommunikativen Studentin Marianne Oellers glaubte er, die Zeit mit Ingeborg Bachmann hinter sich lassen zu können, Abstand zu gewinnen, einen der für ihn so lebenswichtigen Anfänge zu schaffen. Wieder neu sein, heraustreten aus einer Lebenssituation, die unerträglich geworden ist. Es ist nicht der letzte Rettungsversuch geblieben. Alice Carey, eine junge Amerikanerin, sollte ein paar Jahre später Garantin sein für einen weiteren Neubeginn.
Das Leben kann scheitern, das weiß Frisch. Es ist eine seiner Grundeinsichten. In seinem Werk setzt er sich dauerhaft auseinander mit Möglichkeiten des Scheiterns. Und diese Einsicht in die Fragilität aller Lebensentwürfe gewinnt nun wieder eine starke Präsenz, hier in Berzona, am Steintisch, im Garten unter Bäumen. Dass man dem totalen Scheitern knapp entrinnen, dass man sich jederzeit verlieren kann und dann nichts mehr hilft, auch keine neue Beziehung. Frisch hat erleben müssen, dass er Vergangenes nicht abzuschütteln vermag. Alles, was war, das ganze Ausmaß an Erfahrungen, kann sich jederzeit zurückmelden, in Bildern, Träumen, Worten, Gesten. Es kann unerwartet in den Geschichten Platz nehmen, vielleicht sogar die Hauptrolle spielen. Zu einer blitzartigen Präsenz von Vergangenheit kommt es nun, als der Freund Pilliod die Dichterin Ingeborg Bachmann erwähnt. Es führt kein Weg vorbei an der Gewissheit: Dies war die ganz entscheidende, die herausforderndste Liebesbeziehung, die Frisch eingegangen war in seinem Leben. Eine Beziehung, deren Wirkung nie nachgelassen hat, das wird ihm jetzt von Neuem bewusst. Aber ist sie wirklich so restlos gescheitert, diese Liebe? Kann man von vollkommenem Scheitern sprechen, wenn etwas derart intensiv weiterwirkt, die Arbeit befeuert, einen immer wieder in eine verwirrende Unruhe versetzt? Oder ist es wie in vielen Büchern Frischs: Gerade dann, wenn man meint, dies sei eine Geschichte, die zwangsläufig ins Scheitern, in den Untergang führt, erheben sich kleine Inseln des Unmöglichen, die Hoffnung machen. Max Frisch hat den Faden zu Bachmann nicht zerschnitten. Er arbeitet an dem hauchdünnen Gewebe, das Erinnerung heißt.
Mit Ingeborg Bachmann kann in diesem Frühjahr 1985 kein Interview geführt werden. Sie ist seit zwölf Jahren tot. Sie kann auf Frischs Unruhe nicht mehr antworten. Die Frage nach dem Verlauf ihrer Beziehung zu Frisch hat auch sie immer wieder gestellt. Sie wollte ebenfalls verstehen, hat nach Gründen gesucht für das rasche Ende. Und hat für sich herausgefunden, dass diese Frage ins Nichts führt, dass es eine Frage ist, die Abgründe öffnet. In ihrem Schreiben hat auch sie Liebesgeschichten entworfen, Männerfiguren erfunden, ihnen Namen gegeben, ein- und mehrsilbige, und die Frage gestellt, ob man einen Mann mit einem einsilbigen Namen überhaupt lieben kann. Das Erlebte ist schließlich nicht nur zum Weinen, und das Ironische hat seinen Platz in den Geschichten und im Leben Ingeborg Bachmanns.
Könnte sie noch einmal angesprochen werden auf ihre Beziehung zu Max Frisch, hätte sie einen wie Philippe Pilliod sich gegenüber am Tisch sitzen, würde sie womöglich zunächst schweigen, nichts sagen oder wie viele Figuren ihrer Bücher antworten: Es war nichts. Damit gäbe sie ihre Betroffenheit direkt weiter an den Gesprächspartner. Das Utopische der Sätze, wie Bachmann es versteht, hier würde es noch einmal deutlich werden. Es war nichts: Es war die Möglichkeit für alles. Das ist gar nicht so weit weg von Frischs Rede von der Reue und vom Sturzflug des Ikarus. Es war Spruch und Widerspruch. Ein grandioser Anfang und ein trauriges Ende. Verzauberung, Entzauberung. Und Spielraumeröffnung für viele Nach-Geschichten.
In den Gesprächen im Alter, die Philippe Pilliod mit Max Frisch führt, ist Ingeborg Bachmann nicht nur dort präsent, wo ihr Name fällt. Sie ist Stichwortgeberin, abwesende dritte Gesprächspartnerin, taucht auf in Anspielungen, bleibt für Frisch eine gewichtige Stimme über ihren Tod hinaus. Die Auseinandersetzung Frischs mit seinen anderen Lebenspartnerinnen ist nicht zu vergleichen mit seinem lebenslangen Nachdenken über und seinem Denken an Ingeborg Bachmann. Anders als zum Beispiel nach dem Ende der Beziehung zu Marianne Oellers bleiben viele Fragen. Über Marianne Oellers schreibt Frisch in den Entwürfen zu einem dritten Tagebuch: »Sie lebt in Berlin (was ich weiß) in der lichten Jugendstil-Wohnung, die ihre Wohnung geworden ist. Wenn ich eine Frage hätte, so würde sie offener antworten als je, glaube ich. Ich habe keine Frage. Ökonomisch ist alles gelöst auf Lebenszeiten. Einmal fasst sie meine Hand, die auf dem Steintisch liegt zwischen Glas und Aschenbecher. Ihre Biografie, meine Biografie, Schnittpunkt im Vergangenen.«3 Was die Beziehung zu Marianne Oellers betrifft, herrscht für Frisch Klarheit, bezüglich Ingeborg Bachmann bleiben Rätsel.
Alles ist offen, und nichts ist geklärt. In diesem Moment in Berzona durchlebt Frisch die Höhen und Tiefen seiner großen Liebe zu Ingeborg Bachmann noch einmal. Bilder tauchen auf, Stimmen werden hörbar. Die Schauplätze dieser Liebe, Paris, Zürich, Rom, breiten sich aus vor dem inneren Auge. Die Vergangenheit schiebt sich über die Gegenwart. Auf der Bühne des Gedächtnisses wird ein Stück aufgeführt, das er kennt, denn er ist eine der zwei Hauptfiguren.
[2]
Erste Begegnung
Treulos ist meine Geliebte,
ich weiß, sie schwebt manchmal
auf hohen Schuh’n nach der Stadt,
sie küsst in den Bars mit dem Strohhalm
die Gläser tief auf den Mund,
es kommen ihr Worte für alle.
Doch diese Sprache verstehe ich nicht.1
Paris 1958
Hat nicht jede erste Begegnung ihre ganz eigene, besondere Vorgeschichte? Und wenn diese erste Begegnung den Beginn einer Liebesbeziehung markiert, wie groß ist dann erst die Bedeutung dessen, was vorher geschah oder auch gerade nicht, die Geschichte der Wünsche, Sehnsüchte, überhaupt der ganze Vorstellungs- und Gefühlskosmos, der sich auftut, wenn es um ich und du geht. Noch um ein Vielfaches komplizierter, schillernder, facettenreicher wird es, wenn der Blick sich richtet auf die Beziehung zweier Dichter oder Schriftsteller.
1956 erscheint Ingeborg Bachmanns zweiter Lyrikband Anrufung des Großen Bären. Bachmann, Jahrgang 1926, ist zu diesem Zeitpunkt längst keine unbekannte Autorin mehr. Schon 1953 hat sie den Preis der »Gruppe 47« erhalten, in der literarischen Öffentlichkeit der Nachkriegszeit gilt sie als außergewöhnliche lyrische Begabung. Und so sind es auch zunächst die Gedichte, durch deren Lektüre der Schweizer Schriftsteller Max Frisch die Dichterin kennenlernt. Die erste Begegnung Max Frischs mit Ingeborg Bachmann ist also gewissermaßen eine er-lesene.
Max Frisch ist zu diesem Zeitpunkt bereits 45 Jahre alt, verheiratet und Vater dreier Kinder, seit einem Jahr allerdings getrennt lebend von seiner Familie und vor allem dank seines 1954 erschienenen Romans Stiller ein international erfolgreicher Schriftsteller. Über das Privatleben der Dichterin weiß er eigenen Aussagen zufolge nichts. Er kennt nicht einmal die Gerüchte, die in der Öffentlichkeit über sie in Umlauf sind. Schon zu dieser Zeit, in den frühen Fünfzigerjahren, ist Bachmann eine Art Gerüchtefigur. Seinen Anfang nahm das öffentliche Geraune, als Bachmann 1952 in Niendorf zum ersten Mal bei einer Tagung der »Gruppe 47«auftrat und – wirkte, besonders auf die männlichen Zuhörer. Anders kann man es kaum nennen. Die Dichterin übte eine Faszination aus, die nicht allein mit dem Zauber ihrer Gedichte zu erklären war. Und schon begann man zu tuscheln im Kreis der Kollegen, Dichterinnen-Versteher, Kritiker, vor allem aus dem Umkreis der »Gruppe 47«: Fragil sei sie, ziemlich unsicher, schüchtern und doch auch ganz schön kokett, und ihre Augen würden weiß Gott wohin schauen. Und überhaupt sei sie eine perfekte Mischung aus energiegeladen und zögernd, mädchenhaft unbeholfen und damenhaft selbstsicher, und vor allem auch sehr elegant. Man stellte dieser geheimnisvollen Ingeborg Bachmann gern ihre Dichterinnenfreundin Ilse Aichinger gegenüber. Die sei viel unkomplizierter, aber eben auch geheimnisloser, uninteressanter. Und wie diese Ingeborg Bachmann ihre Gedichte rezitiert! So hauchig, dass man als Zuhörer den Eindruck hat, die Worte übten einen Balanceakt auf der fast schwebenden Atemluft und es könnte jederzeit zum Absturz kommen, zum Kollaps der Stimme. Joachim Kaiser kommt in einem Gespräch mit Helmut Böttiger vom 18.4.2007 dezidiert darauf zu sprechen: »Wenn Sie die sahen, wussten Sie: Das ist eine Dichterin! Dass sie natürlich, wenn sie vorlas, immer anfing zu hauchen und unter Tränen vorlas und ihr eigentlich jedes Mal die Manuskriptblätter hinfielen, und jedes Mal stürzten die Männer, um diesem armen scheuen Reh zu helfen, während die Frauen, auch meine, sagten: Mein Gott, hat sie das nötig, immer diesen Zirkus machen und so.«2 Aus heutiger Sicht ist es nichts Besonderes mehr, aber damals war das Phänomen ganz neu: dass eine Dichterin eine öffentliche Präsenz bekommt wie ein Popstar. Es zeigt, wie Öffentlichkeit und mediale Inszenierung immer weiter hineindrängen in den Bereich der Vermittlung von Kunst, zum Beispiel von Literatur. Selbst die Lyrik bleibt nicht verschont. Diese Ingeborg Bachmann, sie ist ein literarisches Fräuleinwunder, und Frisch will nichts davon mitbekommen haben. Und so betritt er also Schneeland, unbegangen, und die einzigen Spuren sind Worte und Sätze, sind Gedichte. Gedichte, deren Bilder faszinieren in ihrer Mischung aus Sinnlichkeit und Intellektualität. Ihn springen vor allem diejenigen Verse Bachmanns an, in denen sie schreibt von der jahrhundertelangen Wiederholung sinnloser Liebesschwüre und -riten, um dann im selben Gedicht die einmalige späte Einweihung in die Liebe literarisch zu evozieren. Das lyrische Ich spricht in einem Gedicht aus dem Zyklus Anrufung des Großen Bären von der Lava, die herabfährt, von verschlossenen Körpern, verwunschenen Räumen und dem Dunkel, das die Fingerspitzen ausleuchten. Es sind Bilder von starker sinnlicher Kraft, die einen wie Frisch, der immer auf der Suche ist nach der großen Leidenschaft, unbedingt begeistern müssen. Wie geheimnisvoll muss eine Geliebte sein, die »auf hohen Schuh’n nach der Stadt« schwebt, die im Winter im Wald unter den Tieren lebt als »Baum unter Bäumen«, stumm unter Fischen und Dunkles sprechend vom Grund der Gläser in den Bars, die wie ein Mund sind, den sie mit dem Strohhalm küsst, wie es in Bachmanns Gedicht »Nebelland«heißt.
Es ist noch nicht sehr lange her, dass Max Frisch sich entschieden hat für den Beruf des freien Schriftstellers. Bis vor einem Jahr hat er ein eigenes Architekturbüro gehabt, er hat ein Schwimmbad gebaut, Häuser entworfen. Max Frisch, der Architekt und Schriftsteller, ist ein exakter Konstrukteur, aber schon immer hat es ihn gestört, dass ein Haus, sobald es steht und bezogen werden kann, ein für alle Mal fertig ist. In Bachmanns Gedichten erlebt er den Gegenentwurf zu diesem Konstruieren, Bauen, Fertigstellen: Er versinkt in einem Reich der Möglichkeiten, in dem es nicht weniger genau zugeht, wo aber nichts jemals »fertig« ist, die eigene Phantasie sich entzünden kann, einem freien Assoziieren keine Grenzen gesetzt sind.
Max Frisch ist sich bewusst, dass Authentizität und autobiografisches Schreiben nicht dasselbe sind. Aus diesen Gedichten spricht für ihn eine authentische Stimme, aber es ist nicht die reale Person Ingeborg Bachmann. Die Nähe zu den Gedichten, ein unmittelbares Berührtwerden von der Musikalität und Ausdruckskraft dieser Sprache gehen einher mit der verehrenden Distanz der Dichterin gegenüber. Frisch verehrt Bachmann für ihre große Kunst. Noch in den Gesprächen mit Philippe Pilliod wird das deutlich, wenn er erzählt, dass er das lyrische Werk Bachmanns bewunderte und noch immer bewundert, und schließlich aus dem Gedicht »Alle Tage«zitiert.
Im Juni 1958 hört Frisch im Hamburger Rundfunkstudio das Hörspiel Der Gute Gott von Manhattan von Ingeborg Bachmann und ist, wie schon bei der Lektüre der Gedichte, ja eigentlich noch stärker und auf der Stelle fasziniert, elektrisiert. Da ist einerseits die Musikalität der Verse, die Frisch bereits kennt, und doch kommt nun etwas hinzu, ein anderer Ton, bedingt durch das Dialogische, das Szenische, den auf eine dramatische Zuspitzung hinauslaufenden Gang der Handlung. Hier fühlt Frisch sich literarisch ganz zu Hause. Es erscheint ihm nahezu unglaublich, wie in diesem Hörspiel eine Frau über die Liebe schreibt, über eine ganz und gar verrückte Liebe, die die Welt aus den Angeln hebt und neu macht wie am ersten Tag. Auch die Sprache, die Bachmann den Liebenden geliehen hat, tönt für Frisch einerseits zauberhaft fremd, aber dann auch vertraut: »Ich möchte nur ausbrechen aus allen Jahren und allen Gedanken, und ich möchte in mir den Bau niederreißen, der Ich bin, und der andere sein, der ich nie war.«3 Das sagt nicht Max Frischs Stiller aus dem gleichnamigen Roman, sondern Jan, die männliche Hauptfigur in Bachmanns Hörspiel. Hier, in Der Gute Gott von Manhattan, scheint in noch radikalerer Weise als bei ihm selbst, in seinem Roman Stiller vor allem, etwas an- und ausgesprochen zu werden, das ihn in Unruhe versetzt wie nichts sonst: die Frage, wie man lebendig bleiben, dem Starren einer festen, scheinbar selbstverständlich von außen und von den eigenen Gewohnheiten verordneten Identität entkommen kann. Ein verwirrender Glanz geht von den Sätzen aus, die diese Dichterin ihren Figuren in den Mund legt. Derselbe Glanz, den Frisch bereits in ihren Gedichten wahrgenommen hat. Er kann nicht wissen, dass der Komponist Hans Werner Henze seine Freundin Ingeborg Bachmann in Briefen die »Karfunkelhafte« nennt, womit er vor allem auch auf ihre glänzende Dichtung anspielt. Henze hat Gedichte Bachmanns vertont, und gerade zu dieser Zeit arbeitet die Dichterin am Libretto für eine Oper nach Kleists Prinz von Homburg, für die Henze die Musik komponiert. Ingeborg Bachmann ist also eine ungemein vielseitige Schriftstellerin, was in der literarischen Öffentlichkeit bis dahin gar nicht wahrgenommen wird.
Die Begegnung Frischs mit Der Gute Gott von Manhattan markiertnach der Lektüre der Gedichte noch einmal einen Anfang, ein erneutes Kennenlernen dieser geheimnisvollen literarischen Stimme, vor dem Beginn der realen Beziehung. Denn wieder ist der Ort die Fiktion. Allerdings bleibt es diesmal nicht bei der verehrenden Distanz. Jetzt sucht Frisch die konkrete Nähe zur Schriftstellerin, zur Person, die ihm über das dramatische Geschehen im Hörspiel und dessen kunstvolle Ausgestaltung nähergekommen ist, der er sich schreibend, thematisch verwandt fühlt. Er hält es nicht mehr aus, muss die Frau kennenlernen, die solch aufregende Texte zu Papier bringt.
Ob es auch für Ingeborg Bachmann eine Begegnung mit Frisch vor dem konkreten ersten Kennenlernen gegeben hat? Hinweise auf frühe Frisch-Lektüreerfahrungen Bachmanns fehlen. Zwar gab es 1948 eine Theateraufführung Frischs im Theater in der Josephstadt in Wien, aber ob Ingeborg Bachmann damals im Publikum saß, bleibt Spekulation. Auch berichtet Marie Luise Kaschnitz in ihrem Tagebuch, dass Bachmann ihr im März 1958 eine Geschichte erzählte, in der es um die Notlandung eines Flugzeugs in Lateinamerika ging, was einen Hinweis liefern könnte auf die Lektüre von Homo faber. Sollte Bachmann diesen Roman wirklich vor der Begegnung mit Frisch gelesen haben, ist anzunehmen, dass sie angetan war davon, denn in keinem der Romane Frischs ist die Rede von einer so gewaltigen existenziellen Erschütterung wie in Homo faber. In diesem Buch passiert das Unwahrscheinliche, Widernatürliche, als wäre es ganz selbstverständlich. Menschen gehen aneinander zugrunde, egal ob man das Schicksal oder Zufall nennen will.
Ingeborg Bachmann ist eigenen Aussagen zufolge seit ihrer Jugend eine manische Leserin. Das Lesen ist für sie wie eine Ausschweifung, beinahe eine Sucht. Dabei sind es nicht allein unzählige Bücher, Romane, historische und andere Sachbücher, die sie sich vornimmt. Auch die vielen wie zufälligen Begegnungen mit Worten, mit Textzeilen und Reklame, mit Ankündigungen von Veranstaltungen oder Geburts- und Todesanzeigen springen die auf alles Sprachliche überwach reagierende Leserin an, schreiben sich ein in ihr Gedächtnis, um irgendwann in einem eigenen Text verwandelt wieder aufzutauchen. Bachmanns Leben verleibt sich seit der frühen Jugend alles Gelesene ein, es wird Teil davon. Der Titel von Frischs Stück Biedermann und die Brandstifter muss der Dichterin mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit in die Augen gesprungen sein.
Auch Bachmanns erste Begegnung mit Frisch ist also die zwischen einer Leserin und einem Schriftsteller, wenn vielleicht auch die Vielfalt der Leseeindrücke nicht so groß gewesen ist wie bei Frisch.
Anfang Juli 1958. Max Frisch hält sich in Paris auf, nicht als Tourist, sondern weil sein Stück Biedermann und die Brandstifter die französische Premiere in einem Gastspiel des Zürcher Schauspielhauses erlebt. Ort der Aufführung ist das Theatre des Nations an der Place du Châtelet. Frisch reist leidenschaftlich gern. Er braucht diesen Abstand von der Schweiz, von Zürich, er braucht die Distanz zur gefühlten Enge, zum so wenig Welt- und Zukunftsoffenen seiner Heimat. Trotz der Trennung von seiner Frau wohnt Frisch weiterhin in direkter Nähe zur Familie, nämlich in Männedorf am Zürichsee, er ist noch nicht geschieden. Der Draht hin zu einer gewissen bürgerlichen Sesshaftigkeit ist also nicht völlig zerschnitten. Aber man darf sich nichts vormachen: Die Trennung ist ein gewaltiger Schritt gewesen, den viele seiner Freunde und Bekannten nicht gutheißen konnten. Einfach abgehauen sei er und habe seine Frau und die Kinder allein gelassen. Eine Frisch nahestehende Künstlerin erzählt dem Frisch-Biografen Julian Schütt in einem persönlichen Gespräch am 21. November 1996, sie sei Frisch nach der Trennung einmal auf der Straße begegnet. Er sei mit offenen Armen auf sie zugekommen, aber sie sei einfach grußlos weitergegangen.4 Und als ob das nicht skandalös genug wäre, hat er auch noch eine Geliebte, Madeleine Seigner-Besson, eine Frau mit drei Kindern, die in einer für diese Zeit sehr offenen Ehe lebt. Seit sechs Jahren ist Frisch mit ihr zusammen, bespricht seine Texte mit ihr, sie unternehmen gemeinsame Reisen unter anderem nach Griechenland und Spanien. Es ist offenkundig: Frisch hat Probleme damit, in einer endgültigen Beziehung zu Hause zu sein. Er ist ein Streuner, ein Suchender, ein Abenteurer, einer allerdings, der den Bürger nicht ganz abwerfen kann. Frischs Noch-Ehefrau Trudy ahnt das, vielleicht wusste sie es ja von Anfang an, denn sie klagt nicht an, sie möchte vor allem, dass die Kinder den Kontakt zu ihrem Vater halten, sie zieht keinen Schlussstrich.
Zürich und Paris: Vom Bahnhof seiner überschaubaren Heimatstadt geht 1958 Frischs Reise mitten hinein in eine flirrende Metropole. Paris bietet Raum für Utopien, Visionen, lang gehegte Wünsche, hochfliegende Phantasien. Im Dezember 1950 war Frisch schon einmal dort. In seinem Notizbuch ist darüber zu lesen: »Wintersonntag. Ganz heiter und klar: jetzt mein Leben in die Hand nehmen. In Zürich verkomme ich durch Gewöhnung.«5
Frisch erlebt Paris als eine Stadt für Anfänger, für Aufbruchswillige, Aufbruchssüchtige, und er träumt sich wachen Auges durch die Straßen. »Paris – die Stadt erscheint mir heute wie eine Frau, der man ansieht, dass sie zur Geliebten werden könnte. Sie ist es noch nicht. Ich gehe ihr den ganzen Tag nach; immer zu Fuß. Sie wechselt von Stunde zu Stunde. Grauer Himmel, Schneetreiben, Schleier; plötzlich ist es wieder heller, Sonne auf den reichen Fassaden, Wolkenzauber, Messinglicht, und über den schwarzen Kuppeln blaut ein Himmel, wie nur der Winter ihn hat, so blaß, so kühl und zart, aber hart, spröde, klingend und von unendlicher Höhe.«6 Wie immer, wenn Frisch sich einer Stadt annähert, spürt er dem Landschaftlichen darin nach, dem Jahreszeitlichen, der Witterung, Aspekten von Naturgeschehen. Frisch fühlte sich 1950 »unbändig« wohl in Paris. Es war eine Art Vorbereitung auf Amerika, wohin er 1951 mit einem Stipendium der Rockefeller Foundation reisen sollte. Die Erinnerung an Paris ist Vergegenwärtigung einer rauschhaften, erwartungsvollen Stimmung.
Nun kommt es im Juni 1958, nachdem die beiden großen Romane Stiller und Homo faber erschienen sind, zu einer Wiederbegegnung mit Paris. Die Stadt, die ihn vor ein paar Jahren so euphorisch begrüßt hat, kommt ihm auch jetzt entgegen, mit frühsommerlichem Licht und Wärme. »Auf der Welt sein: im Licht sein«7, hatte er vor einem Jahr in Griechenland geschrieben, am letzten Tag einer Reise mit der Geliebten Madeleine Seigner-Besson. In Paris in diesem Frühsommer 1958 kann er genau das von Neuem spüren.
Ende der Leseprobe