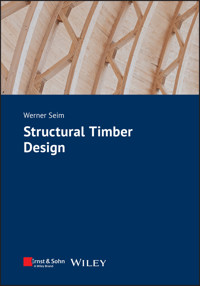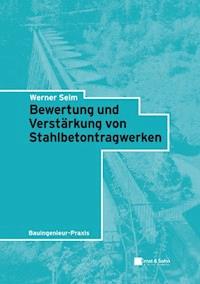52,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Wiley-VCH
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Serie: Bauingenieur-Praxis
- Sprache: Deutsch
Das Buch umfasst die wichtigsten theoretischen Grundlagen der Berechnung und Bemessung von Verbindungen und Tragelementen, sowie für den Tragwerksentwurf typischer Konstruktionen und Gesamttragwerke des Ingenieurholzbaus.
Über das Basiswissen und die einfache Normenanwendung hinaus, werden Berechnungsmethoden für Holztragwerke vorgestellt und erläutert. Wichtige Schwerpunkte bilden dabei Holz-Beton-Verbundkonstruktionen, Konstruktionen mit Brettsperrholz, weitgespannte Träger für Hallentragwerke und Brücken, Platten und Scheiben für den mehrgeschossigen Holzbau sowie geklebte und formschlüssige Verbindungen. Ein eigenes Kapitel ist der Schwingungsberechnung und Erdbebenbemessung gewidmet.
Zusammen mit dem Band ?Ingenieurholzbau ? Basiswissen? ist das Werk ideal als Lehrbuch für Studierende des Bauingenieurwesens sowie als Praxishandbuch für planende Ingenieure, die ihr Wissen erweitern und auffrischen wollen und neben der Anwendung der Normen und Richtlinien auch ein grundlegendes Verständnis der Phänomene und der rechnerischen Modellierung anstreben.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 242
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Cover
Titelseite
Impressum
Vorwort
1 Theoretische Grundlagen
1.1 Festigkeiten und Maßstabseffekt
1.2 Bruchmechanik – sprödes Versagen
1.3 Plastizitätstheorie
1.4 Berechnungsverfahren für zusammengesetzte Querschnitte – γ-Verfahren
1.5 Verschieblicher Verbund einer geklebten Verbindung
1.6 Berechnung nach Theorie II. Ordnung
Literatur
2 Bauteile
2.1 Träger und Stützen als zusammengesetzte Bauteile
2.2 Weit gespannte Träger
2.3 Platten und Scheiben aus Brettsperrholz
2.4 Rechnerische Modellierung von Bauteilen
Literatur
3 Anschlüsse und Verbindungen
3.1 Formschlüssige Holz-Holz-Verbindungen
3.2 Gelenkige und biegesteife Anschlüsse
3.3 Verbindungen und Anschlüsse mit Brettsperrholz
3.4 Geklebte Verbindungen
3.5 Verstärkung bei Querzugbeanspruchung
Literatur
4 Tragwerke unter dynamischen Einwirkungen
4.1 Dynamik und Schwingungen
4.2 Schwingungsverhalten von Decken
4.3 Erdbebensicheres Bauen
Literatur
5 Tragwerksentwurf
5.1 Mehrgeschossiger Holzbau
5.2 Hallentragwerke
5.3 Brücken
Literatur
Stichwortverzeichnis
End User License Agreement
List of Illustrations
Chapter 1
Abb. 1.1 Kantholz mit Ästen: (a) zugbeansprucht, (b) biegebeansprucht und (c) Sp...
Abb. 1.2 (a) Statistische Verteilung unterschiedlicher Festigkeiten von Nadelhol...
Abb. 1.3 Balken mit B- und D-Bereichen infolge lokaler Diskontinuitäten.
Abb. 1.4 (a) Beanspruchungsmoden und (b) beispielhafte Spannungs-Dehnungs-Bezieh...
Abb. 1.5 Eingeschnittener Balken mit zwei Einzellasten.
Abb. 1.6 (a) Energiebilanz und (b) Last-Verformungs-Beziehung beim Rissfortschri...
Abb. 1.7 Ausgeklinktes Trägerauflager.
Abb. 1.8 Einschnittige Holz-Holz-Verbindung (a) Versagensmechanismus mit zwei Fl...
Abb. 1.9 Schubfeldmodell: (a) statisches System, (b) Annahme Schubfluss und (c) ...
Abb. 1.10 Zusammenwirken von Querschnitten: (a) zwei Einzelquerschnitte ohne Ver...
Abb. 1.11 Definition von Kräften und Verschiebungen im Bereich der Verbundfuge.
Abb. 1.12 Verbundträger: (a) Seitenansicht im Auflagerbereich, (b) geometrische ...
Abb. 1.13 Einfeldträger mit sinusförmiger Linienlast.
Abb. 1.14 Verlauf der Biege- und Schubspannungen am unterteilten Verbundquerschn...
Abb. 1.15 Beispiel für Verbundansätze mit plastischem Verhalten: (a) Bohrpfahl, ...
Abb. 1.16 Eingeklebte Gewindestange mit verschieblichem Verbund: (a) Geometrie u...
Abb. 1.17 Eingeklebte Gewindestange mit verschieblichem Verbund: (a) Randbedingu...
Abb. 1.18 Berechnung nach Theorie I., II. und III. Ordnung – schematischer Vergl...
Abb. 1.19 Ersatzkräfte für Imperfektionen: (a) Druckstab und (b) kippgefährdeter...
Abb. 1.20 Imperfektionen: (a) Schiefstellung, (b) Vorkrümmung und (c) Überlageru...
Chapter 2
Abb. 2.1 Zusammengesetzte Querschnitte.
Abb. 2.2 (a) Wellstegträger mit aufgelösten Stegen infolge Feuchteeinwirkung (Qu...
Abb. 2.3 (a) Steg- und Kastenträger mit flächiger Verklebung, (b) Biegespannunge...
Abb. 2.4 Tafelelement als Verbundquerschnitt: (a) Definition der mitwirkenden Br...
Abb. 2.5 (a) Hohlkastenelement Lignotrend, (b) Schubverformung der Querlage und ...
Abb. 2.6 Querschnittsformen von HBV-Decken.
Abb. 2.7 Anschauungsmodelle mit unterschiedlichen HBV-Verbindern: (a) mit eingek...
Abb. 2.8 Holzschrauben als Verbindungsmittel für Holz-Beton-Verbundträger: (a) s...
Abb. 2.9 (a) HBV-System mit eingeklebtem Streckmetall als Schubverbinder und (b)...
Abb. 2.10 Spannungsverteilung am Holz-Beton-Verbundquerschnitt: (a) Beton überdr...
Abb. 2.11 Anwendung Holz-Beton-Verbund: (a) Sanierung einer Decke mit HBV (Quell...
Abb. 2.12 Holz-Beton-Verbund mit Stahlbetonfertigteilen: (a) Kunststoffhülsen fü...
Abb. 2.13 Zusammengesetzte Druckstäbe: (a) mit kontinuierlicher Verbindung, (b) ...
Abb. 2.14 Zusammengesetzte Druckstäbe mit kontinuierlicher Verbindung: (a)–(d) m...
Abb. 2.15 Zweiund dreiteilige gespreizte Druckstäbe: (a) mit Zwischenhölzern und...
Abb. 2.16 Gespreizte Stäbe – Beanspruchung der Bindehölzer (Zwischenhölzer sinng...
Abb. 2.17 Gespreizte Stützen: (a) mit N-förmiger und (b) mit V-förmiger Vergitte...
Abb. 2.18 Krümmung einer Brettlamelle.
Abb. 2.19 Balkenelement aus einem gekrümmten Träger: (a) Dehnungen und Biegespan...
Abb. 2.20 (a) Gekrümmter Träger, (b) Satteldachträger und (c) Satteldachträger m...
Abb. 2.21 Satteldachträger mit gekrümmtem Untergurt: (a) aufgesetzter First und ...
Abb. 2.22 Beispielhafte Anschlüsse für Fachwerkträger.
Abb. 2.23 Geometrische Größen für Fachwerke.
Abb. 2.24 Gebäude in Brettsperrholzbauweise.
Abb. 2.25 Aufbau einer Brettsperrholzplatte – vom Einzelbrett zum Brettsperrholz...
Abb. 2.26 Herstellung von Brettsperrholzelementen: (a) Klebstoffauftrag und (b) ...
Abb. 2.27 Wandelemente aus Brettsperrholz: (a) CNC-gesteuerter Abbund und (b) mi...
Abb. 2.28 Definition der Schnittgrößen und Spannungen für Platten und Scheiben a...
Abb. 2.29 Verteilung der Biegespannungen für schubstarren und nachgiebigen Verbu...
Abb. 2.30 Geometrische Zusammenhänge und Übergang zum effektiven Querschnitt.
Abb. 2.31 Verformung der Lagen infolge Schub, Ermittlung der Ersatzschubsteifigk...
Abb. 2.32 Biege- und Schubspannungen bei Brettsperrholzplatten: (a) Haupttragric...
Abb. 2.33 Brettsperrholzplatten unter Schubbeanspruchung: (a) Schubbeanspruchung...
Abb. 2.34 Schnittgrößen (Biegemomente
m
x
,
m
y
) und Auflagerkräfte einer Platte: (...
Abb. 2.35 Bereiche mit konzentrierter Lasteinleitung – Querdruck unter Einzellas...
Abb. 2.36 Lasteinleitung, kritischer Schnitt und mitwirkende Breite: (a) zentral...
Abb. 2.37 Wandscheibe aus Brettsperrholz unter horizontaler Beanspruchung in der...
Abb. 2.38 BSP-Wandelemente unter Schubbeanspruchung: (a) Mechanismus – reiner Sc...
Abb. 2.39 Brettsperrholzelement – kombinierte Beanspruchung aus Normalkraft und ...
Abb. 2.40 Modellierung von Tragwerken mit formschlüssigen Verbindungen – Stütze-...
Abb. 2.41 Modellierung von Tragwerken mit mechanischen Verbindungsmitteln: (a) T...
Abb. 2.42 Wandtafel: (a) Ersatzbiegesteifigkeit und (b) Ersatzschubsteifigkeit.
Abb. 2.43 Verformung
u
ϕ
infolge der Rotation des BSP-Elements.
Chapter 3
Abb. 3.1 Formschlüssige Holzverbindungen der griechischen Antike. (Quelle: Orlan...
Abb. 3.2 Innenansicht und Konstruktionsdetail des Tamedia-Gebäudes in Zürich.
Abb. 3.3 Anschluss unter reiner Druckbelastung.
Abb. 3.4 Druckkräfte aus Diagonalen – Kopfbänder.
Abb. 3.5 Druckkräfte aus Diagonalen – Sparrendach.
Abb. 3.6 Zug- und Druckkräfte aus Diagonalen: (a) Kopfbänder, (b) und (c) Kehlba...
Abb. 3.7 Querkraftanschluss zwischen Haupt- und Nebenträgern: (a) statisches Sys...
Abb. 3.8 Exzentrische Krafteinleitung in Diagonalen: (a) mit gleicher und (b) mi...
Abb. 3.9 Grundformen der Blattverbindungen: (a) liegendes Blatt, (b) stehendes B...
Abb. 3.10 Gerades Hakenblatt mit Bezeichnungen.
Abb. 3.11 Blattverbindungen: (a) Verlauf der Schubspannungen und (b) Sicherung g...
Abb. 3.12 (a) Schräges Hakenblatt mit Keilen und (b) gerades Blatt.
Abb. 3.13 Zugbeanspruchte schwalbenschwanzförmige Blattverbindung – Grundgeometr...
Abb. 3.14 Blattverbindungen mit mechanischen Verbindungsmitteln: (a) biegesteife...
Abb. 3.15 Versätze: (a) Stirnversatz, (b) Fersenversatz und (c) doppelter Versat...
Abb. 3.16 Lagesicherung von Versätzen: (a) Sondernagel, (b) Bolzen und (c) Streb...
Abb. 3.17 Konstruktive Regeln für den Stirnversatz.
Abb. 3.18 Konstruktive Regeln: (a) Fersenversatz und (b) doppelter Versatz.
Abb. 3.19 Kräftespiel am Stirnversatz: (a) Kontakt Rückenfläche und (b) Reibung ...
Abb. 3.20 (a) Zapfenverbindung an einer Stütze, (b) Zapfenverbindung an einem Ri...
Abb. 3.21 Bezeichnungen an einer Zapfenverbindung.
Abb. 3.22 Geometrische Bedingungen für Zapfenverbindungen.
Abb. 3.23 Fiktive Geometrie für die Berechnung der Tragfähigkeit von Zapfen: (a)...
Abb. 3.24 Schwalbenschwanzförmige Verbindung: (a) geometrische Randbedingungen u...
Abb. 3.25 Formschlüssige Verbindungen (a) Nachgiebigkeiten im Vergleich und (b) ...
Abb. 3.26 Vereinfachte Kennlinie und Nachgiebigkeiten von Holzverbindungen nach ...
Abb. 3.27 Zugstoß mit eingeschlitztem Stahlblech.
Abb. 3.28 Druck- oder Zugstoß mit seitlichen Laschen.
Abb. 3.29 Biegebeanspruchter Balkenstoß.
Abb. 3.30 Stützenfuß: (a) gelenkig, mit biegesteifer Verbindung zwischen Stahlei...
Abb. 3.31 (a) Fachwerkknoten, (b) ideale Situation, (c) realitätsnahe Modellieru...
Abb. 3.32 „Langes Auflager“ mit seitlicher Halterung: (a) Rissbildung infolge un...
Abb. 3.33 Hoher Träger mit Gabellagerung (Seitenansicht): (a) Rissbildung infolg...
Abb. 3.34 Rahmenecke mit Dübelkreis.
Abb. 3.35 Biegesteifer Balkenstoß mit eingeschlitztem Stahlblech: (a) Vektoraddi...
Abb. 3.36 Zugstoß: (a) mit außenliegender Lasche, (b) ohne zugfeste Verbindungsm...
Abb. 3.37 Elementstöße bei Brettsperrholzkonstruktionen: (a) Eckstoß/T-Stoß, (b)...
Abb. 3.38 Auflagerbereich, Wand-Decken-Anschluss mit Stahlblechformteilen und El...
Abb. 3.39 Lastfluss an einer BSP-Wandscheibe: (a) ohne und (b) mit vertikalem St...
Abb. 3.40 (a) Lastfluss bei einer Deckenscheibe unter horizontaler Belastung und...
Abb. 3.41 Geschraubte Anschlussschmalseite mit Verstärkung.
Abb. 3.42 Erste Beispiele für die Brettschichtholzbauweise: (a) Brücke über die ...
Abb. 3.43 Einteilung der Klebstoffe.
Abb. 3.44 Pressvorrichtung für Brettschichtholz.
Abb. 3.45 Schäftung: (a) Seitenansicht; (b) Kraftzerlegung.
Abb. 3.46 Geometrie der Keilzinkenverbindung.
Abb. 3.47 Herstellung von Verbindungen mit eingeklebten Stahlstangen nach Steige...
Abb. 3.48 Schraubenpressklebung.
Abb. 3.49 Verstärkungsmaßnahmen am Beispiel einer Ausklinkung: (a) Vollgewindesc...
Abb. 3.50 Qualitativer Verlauf der Schubspannungen und Querzugspannungen im Bere...
Abb. 3.51 Verstärkung einer Ausklinkung mit eingeklebten Gewindestangen und effe...
Abb. 3.52 Ausklinkung mit beidseitiger, außenliegender Verstärkung.
Abb. 3.53 Beispiele für Anschlüsse mit Querzugbeanspruchung.
Abb. 3.54 Beispiel eines Queranschlusses mit Zangen und zwei Verbindungsmittelgr...
Abb. 3.55 Beispiel von Verstärkungen für Queranschlüsse: (a) innen liegend mit V...
Abb. 3.56 Ermittlung der Biegerandspannungen an Durchbrüchen über die Anteile au...
Abb. 3.57 Lage der potenziellen Rissebene und mögliche Verstärkung mit innen lie...
Abb. 3.58 Erhöhte Schubspannungen durch Umlagerungen der Schubspannungen vom B-i...
Abb. 3.59 Schematische Anordnung von Querzugverstärkungen bei: (a) Satteldachträ...
Abb. 3.60 (a) Verteilung der Biegespannungen in einem gekrümmten Träger und (b) ...
Abb. 3.61 Verteilung der Verstärkungselemente in Trägerlängsachse.
Abb. 3.62 Maximale und effektive Schubspannung in einer Klebefuge der Querzugver...
Abb. 3.63 Verstärkung einer Stahlblech-Holz-Verbindung mit Stabdübeln durch eing...
Abb. 3.64 Last-Verformungs-Verhalten von Stahlblech-Holz-Verbindungen mit Stabdü...
Abb. 3.65 Spaltversagen eines Dübelkreises mit Verstärkungsmöglichkeit.
Chapter 4
Abb. 4.1 Einmassenschwinger: (a) Masse-Feder-System, (b) Einfeldträger und (c) K...
Abb. 4.2 Freie, ungedämpfte Schwingung des Einmassenschwingers: (a) Verschiebung...
Abb. 4.3 Freie und gedämpfte Schwingung des Einmassenschwingers.
Abb. 4.4 Mehrmassenschwingermodell für ein viergeschossiges Gebäude zur Bestimmu...
Abb. 4.5 Zweifeldträger mit (a) gleichen und (b) unterschiedlichen Spannweiten.
Abb. 4.6 Balkenlage mit Träger: (a) Träger als nachgiebiges Auflager und (b) Bie...
Abb. 4.7 Balkenlage mit Beplankung – Definition von Längsund Quersteifigkeit.
Abb. 4.8 Schwingungstechnisches Bewertungsschema für Deckenkonstruktionen nach H...
Abb. 4.9 Brettsperrholzwandelemente unter zyklischer Belastung: (a) Versuchsaufb...
Abb. 4.10 Abgrenzung duktiler und nicht duktiler Bereiche mit der „Kettenanalogi...
Abb. 4.11 Anordnung von aussteifenden Wänden: (a) ungünstig und (b) günstig.
Abb. 4.12 Gliederung von Gebäudegrundrissen: (a) ungünstig und (b) günstig, nach...
Abb. 4.13 Steifigkeit aussteifender Wände über die Höhe eines Gebäudes: (a) ungü...
Abb. 4.14 (a) Horizontales Antwortspektrum, siehe auch Gln. (4.36)–(4.38), und (...
Abb. 4.15 Spektrale Antwortbeschleunigung im Plateaubereich für Deutschland für ...
Abb. 4.16 Schematische Darstellung der geologischen Untergrundklassen in Deutsch...
Abb. 4.17 Beispielhaftes Gebäude, vereinfachtes Modell (Ersatzstab).
Abb. 4.18 Verteilung der Gesamterdbebenkraft über die Höhe eines Gebäudes.
Abb. 4.19 (a) Mehrmassenschwinger multimodal und (b) räumliche modale Analyse.
Abb. 4.20 Duktile und nicht duktile Elemente einer Wandtafel.
Abb. 4.21 Duktile und nicht duktile Elemente einer Brettsperrholzwand.
Abb. 4.22 Definition der gegenseitigen Stockwerksverschiebung.
Chapter 5
Abb. 5.1 Beispiele für mehrgeschossigen Holzbau: (a) Blockbau Saas-Balen (Quelle...
Abb. 5.2 Schalltechnisch entkoppelte Wand-Decken-Knoten: (a) mit Elastomerlager ...
Abb. 5.3 Anordnung von Erschließungskernen: (a) zentral und (b) am Rand.
Abb. 5.4 Beispiele für mehrgeschossigen Holzbau: (a) C13 Berlin (Quelle: Kaden +...
Abb. 5.5 Deckenauflager ohne Querdruck: (a) Wandtafeln mit Schwellen aus Furnier...
Abb. 5.6 Historische Dachtragwerke: (a) Marienmünster Reichenau, ca. 1235 und (b...
Abb. 5.7 Vergleich der Marktanteile von Holz, Stein, Stahl und Beton bei Tragkon...
Abb. 5.8 (a) Vergleich genagelter Brettbinder mit Stahlquerschnitt aus Kersten (...
Abb. 5.9 Beispielhafte schematische Hallengrundrisse mit Nutzungsbereichen und E...
Abb. 5.10 Haupttragelemente im Grundriss: (a, b) linear gerichtete Systeme, (c) ...
Abb. 5.11 Haupttragelemente im Querschnitt mit Varianten zur Installationsführun...
Abb. 5.12 Hallenkonstruktion (a) ohne und (b) mit Nebenträgern.
Abb. 5.13 Tragsystem für Hallentragwerke: (a) linear addiert (Quelle: Jens Marku...
Abb. 5.14 Aussteifungskonzepte für Hallentragwerke: (a) steife Deckenscheibe mit...
Abb. 5.15 (a) Kranbahn aus Holz (Quelle: picslix-fotografie) und (b) Anprallschu...
Abb. 5.16 Bogentragwerke: (a) Auflagerkräfte und Normalkraftbeanspruchung und (b...
Abb. 5.17 Konstruktionsprinzipien: (a) Bohlenbinder (Gilly 1797) und (b) Zolling...
Abb. 5.18 Multihalle Mannheim: (a) Innenansicht und (b) Detail Knotenpunkt.
Abb. 5.19 Elefantenhaus im Zoo Zürich: (a) Innenansicht und (b) Detail (Quelle: ...
Abb. 5.20 Holzbrücken in der Antike: (a) Modell der Rheinbrücke bei Köln (Quelle...
Abb. 5.21 Rheinbrücke bei Säckingen: (a) Seitenansicht und (b) Innenansicht.
Abb. 5.22 Querschnittstypen für Brücken: (a) Deckbrücke, (b) Trogbrücke und (c) ...
Abb. 5.23 Holzbrücken in Nordamerika: (a) Mountain-Creek Bridge, British Columbi...
Abb. 5.24 Fußgängerbrücke über die Dreisam bei Ebnet. (a) Seitenansicht, (b) Det...
Abb. 5.25 Verlauf der Brückenachse im Lageplan mit Anschluss an den Verkehrsweg:...
Abb. 5.26 Radwegebrücke bei Breisach: (a) Untersicht und (b) Detail Aufhängung.
Abb. 5.27 Brücke als Teil des Verkehrsweges im Höhenplan: (a) mit Einschnitt und...
Abb. 5.28 Typische Brückenquerschnitte mit Angaben zu den Gebrauchsklassen (aus ...
Abb. 5.29 Bohlenbeläge: (a) ohne und (b) mit Nuten zur Rutschsicherung, aus Qual...
Abb. 5.30 Unplanmäßiges Fahrzeug auf einer Fußgängerbrücke.
Abb. 5.31 Horizontale Einwirkungen aus Wind (mit Verkehrsband) und Holmlasten.
Abb. 5.32 Queraussteifung (schematisch) von Brücken: (a, b) Trogbrücken, (c) Dec...
Guide
Cover
Inhaltsverzeichnis
Titelseite
Impressum
Vorwort
Begin Reading
Stichwortverzeichnis
End User License Agreement
Pages
V
III
IV
IX
X
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
205
206
207
208
209
Ingenieurholzbau
Vertiefung: Tragwerke und Berechnungsmethoden
Werner Seim
Mit Beiträgen von Johannes Hummel
Autor
Prof. Dr.-Ing. Werner Seim
Fachgebiet Bauwerkserhaltung und Holzbau Institut für Konstruktiven Ingenieurbau Universität Kassel
Kurt-Wolters-Straße 3
Titelbild
Kaeng Krachan Elefantenpark, Zoo Zürich (Foto: Wolfram Kübler, Walt Galmarini AG); Grafik: Werner Seim
Alle Bücher von Ernst & Sohn werden sorgfältig erarbeitet. Dennoch übernehmen Autoren, Herausgeber und Verlag in keinem Fall, einschließlich des vorliegenden Werkes, für die Richtigkeit von Angaben, Hinweisen und Ratschlägen sowie für eventuelle Druckfehler irgendeine Haftung.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
© 2022 Wilhelm Ernst & Sohn, Verlag für Architektur und technische Wissenschaften GmbH & Co. KG, Rotherstraße 21, 10245 Berlin, Germany
Alle Rechte, insbesondere die der Übersetzung in andere Sprachen, vorbehalten. Kein Teil dieses Buches darf ohne schriftliche Genehmigung des Verlages in irgendeiner Form – durch Photokopie, Mikroverfilmung oder irgendein anderes Verfahren – reproduziert oder in eine von Maschinen, insbesondere von Datenverarbeitungsmaschinen, verwendbare Sprache übertragen oder übersetzt werden. Die Wiedergabe von Warenbezeichnungen, Handelsnamen oder sonstigen Kennzeichen in diesem Buch berechtigt nicht zu der Annahme, dass diese von jedermann frei benutzt werden dürfen. Vielmehr kann es sich auch dann um eingetragene Warenzeichen oder sonstige gesetzlich geschützte Kennzeichen handeln, wenn sie nicht eigens als solche markiert sind.
Print ISBN 978-3-433-03234-3
ePDF ISBN 978-3-433-60930-9
ePub ISBN 978-3-433-60931-6
oBook ISBN 978-3-433-60929-3
Umschlaggestaltung Stefanie Eckert-Kimmig, stilvoll, Kappelrodeck
Satz le-tex publishing services GmbH, Leipzig
Gedruckt auf säurefreiem Papier.
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Vorwort
Die Geschwindigkeit, mit der im Holzbau neue Produkte in die Praxis eingeführt werden, ist im Vergleich mit den übrigen Konstruktionswerkstoffen des Bauwesens schon fast atemberaubend. Dies führt dazu, dass der Holzbau bei weit gespannten Hallentragwerken und im Industriebau seinen Marktanteil kontinuierlich vergrößert und dass mit dem mehrgeschossigen Bauen nach und nach ein neues Anwendungsgebiet erschlossen wird. Hier vergeht derzeit kaum ein Monat, in dem nicht über einen neuen Höhenrekord berichtet wird, und das immer wieder auch aus Ländern, die man bisher nicht zu den klassischen Holzbaunationen zählt.
Bei einer solchen Innovationsgeschwindigkeit können normative Regeln zur Bemessung von Tragelementen und Verbindungen nicht immer Schritt halten. Sie müssen es auch nicht, wenn Ingenieurinnen und Ingenieure mit den allgemeinen Berechnungsmethoden gut vertraut sind und mit den Grundlagen, auf denen diese Methoden aufbauen. Auf dieser Basis können auch neue, auf den ersten Blick ungewohnte Regelungen zu einzelnen Produkten eingeordnet und sicher interpretiert werden. Und bereits beim Tragwerksentwurf können innovative Produkte für neuartige Lösungen vorgeschlagen werden.
In diesem Sinn bilden im vorliegenden zweiten Band ,,Ingenieurholzbau – Vertiefung“ das erste Kapitel zu den theoretischen Grundlagen und das fünfte Kapitel zum Tragwerksentwurf eine Klammer für das zweite und dritte Kapitel, in denen Berechnungsmethoden für Tragelemente und Verbindungen vorgestellt und erläutert werden, welche im ersten Band ,,Ingenieur-Holzbau – Basiswissen“ keinen Platz mehr fanden. Wichtige Schwerpunktthemen sind Verbundbauteile sowie geklebte und formschlüssige Verbindungen. Ein eigenes Kapitel ist der Schwingungsberechnung und der Erdbebenbemessung gewidmet. Die einzelnen Kapitel sind inhaltlich eigenständig strukturiert. Man muss das Buch nicht von vorne nach hinten durcharbeiten, sondern kann, wenn man möchte, mit demjenigen Thema einsteigen, welches einen am meisten interessiert.
Der Inhalt des Buches deckt sich weitgehend mit den Inhalten der ,,Holzbau-Vertiefung“ im Masterstudiengang Bauingenieurwesen an der Universität Kassel und baut auf den Vorlesungsunterlagen auf, welche in den vergangenen Jahren dort am Fachgebiet Bauwerkserhaltung und Holzbau erarbeitet wurden. Carsten Pörtner, Martin Schäfers, Heiko Koch, Lars Eisenhut, Tobias Vogt, Johannes Hummel, Michael Schick, Timo Claus, Sascha Schwendner, Giuseppe D’Arenzo und Jens Frohnmüller haben in dieser Zeit als wissenschaftliche Mitarbeiter ganz wesentlich zur Entwicklung unseres Lehrkonzeptes beigetragen. Bianca Böhmer hat für die Inhalte des zweiten Bandes eine Vielzahl handschriftlicher Notizen in Textform gebracht. Ai Phien Ho und Ann-Katrin Westermann haben sich als studentische Mitarbeiterinnen mit großer Sorgfalt um eine gute und einheitliche grafische Darstellung gekümmert. Wichtige Hinweise zum Abschnitt Brücken gehen auf Matthias Gerold zurück. Bei allen möchte ich mich sehr herzlich bedanken.
Mein besonderer Dank gilt Johannes Hummel, der die Herausgabe der gedruckten Vorlesungsmanuskripte, auf denen dieser Band beruht, betreut und das vierte Kapitel mit verfasst hat.
Kassel, im September 2021
Werner Seim