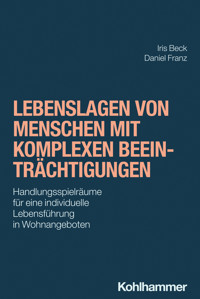Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Kohlhammer
- Kategorie: Bildung
- Sprache: Deutsch
Inklusion in das Gemeinwesen und Inklusion in Angebote der Bildung, Erziehung und sozialer Unterstützung sind untrennbar aufeinander bezogen. Das Buch verschafft hierzu einen grundlegenden Einblick, indem zentrale Fragestellungen der Verwirklichung gerechter Bildungs- und Erziehungschancen im Rahmen konkreter sozialräumlicher Strukturen und auf der Ebene eines Gemeinwesens behandelt werden: Was bedeutet Inklusion und Partizipation in der Gemeinde bzw. im Sozialraum, und welche historischen und aktuellen Konzepte und Verständnisweisen gibt es hierzu? Wie können sich Bildungseinrichtungen sozialräumlich positionieren und vernetzen? Wie kann in einem regionalen oder kommunalen Rahmen Inklusion geplant und umgesetzt werden, welche Akteure, welche Handlungsansätze und Instrumente gibt es? Wie sind kommunale oder regionale Bildungslandschaften über die Lebensspanne zu denken, welche Begründungen und welche Ansätze existieren hierzu? Welche Chancen und welche Grenzen beinhalten soziale Räume als Orte der Lebensführung, und wie wirken transnationale und globale Entwicklungen hierauf? Das dem Buch zugrunde liegende Inklusionsverständnis ist sozialwissenschaftlich fundiert und erfährt seine normative Begründung in der menschenrechtlichen und gerechtigkeitstheoretischen Perspektive.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 401
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inklusion in Schule und Gesellschaft
Herausgegeben von
Erhard Fischer, Ulrich Heimlich
Joachim Kahlert und Reinhard Lelgemann
Band 4
Iris Beck (Hrsg.)
Inklusion im Gemeinwesen
Verlag W. Kohlhammer
Dieses Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwendung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechts ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und für die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
1. Auflage 2016
Alle Rechte vorbehalten
© W. Kohlhammer GmbH, Stuttgart
Gesamtherstellung: W. Kohlhammer GmbH, Stuttgart
Print:
ISBN 978-3-17-031322-4
E-Book-Formate:
pdf: ISBN 978-3-17-031323-1
epub: ISBN 978-3-17-031324-8
mobi: ISBN 978-3-17-031325-5
Für den Inhalt abgedruckter oder verlinkter Websites ist ausschließlich der jeweilige Betreiber verantwortlich. Die W. Kohlhammer GmbH hat keinen Einfluss auf die verknüpften Seiten und übernimmt hierfür keinerlei Haftung.
Vorwort der Reihenherausgeber
Vor dem Hintergrund der UN-Behindertenrechtskonvention, die seit 2009 für Deutschland verbindlich gilt, entwickelt sich die Idee der Inklusion zu einem neuen Leitbild in der Behindertenhilfe. Sowohl in der Schule als auch in anderen gesellschaftlichen Bereichen sollen Menschen mit Behinderung von vornherein in selbstbestimmter Weise teilhaben können. Inklusion in Schule und Gesellschaft erfordert einen gesamtgesellschaftlichen Reformprozess, der sowohl auf die Umgestaltung des Schulsystems als auch auf weitreichende Entwicklungen im Gemeinwesen abzielt. Der Ausgangspunkt dieser Entwicklung wird in Deutschland durch ein differenziertes Bildungssystem und eine stark ausgeprägte spezialisierte sonderpädagogische Fachlichkeit bezogen auf unterschiedliche Förderschwerpunkte bestimmt. Vor diesem Hintergrund soll die Buchreihe »Inklusion in Schule und Gesellschaft« Wege zur selbstbestimmten Teilhabe von Menschen mit Behinderung in den verschiedenen pädagogischen Arbeitsfeldern von der Schule über den Beruf bis hinein in das Gemeinwesen und bezogen auf die unterschiedlichen sonderpädagogischen Förderschwerpunkte aufzeigen. Der Schwerpunkt liegt dabei im schulischen Bereich. Jeder Band enthält sowohl historische und empirische als auch organisatorische und didaktisch-methodische sowie praxisbezogene Aspekte bezogen auf das jeweilige spezifische Aufgabenfeld der Inklusion. Ein übergreifender Band wird Ansätze einer interdisziplinären Grundlegung des neuen bildungs- und sozialpolitischen Leitbildes der Inklusion umfassen.
Die Reihe wird die folgenden Einzelbände umfassen:
Band 1:
Inklusion in der Primarstufe
Band 2:
Inklusion im Sekundarbereich
Band 3:
Inklusion im Beruf
Band 4:
Inklusion im Gemeinwesen
Band 5:
Inklusion im Förderschwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung
Band 6:
Inklusion im Förderschwerpunkt geistige Entwicklung
Band 7:
Inklusion im Förderschwerpunkt Hören
Band 8:
Inklusion im Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung
Band 9:
Inklusion im Förderschwerpunkt Lernen
Band 10:
Inklusion im Förderschwerpunkt Sehen
Band 11:
Inklusion im Förderschwerpunkt Sprache
Band 12:
Inklusive Bildung – interdisziplinäre Zugänge
Die Herausgeber
Erhard Fischer
Ulrich Heimlich
Joachim Kahlert
Reinhard Lelgemann
Inhalt
Vorwort der Reihenherausgeber
Einleitung
Historische und aktuelle Begründungslinien, Theorien und Konzepte
Iris Beck
1 Lebenslagen behinderter Menschen – Rahmendaten und Einblicke
2 Inklusion im Gemeinwesen: Entwicklungsstränge, Begründungszusammenhänge und konzeptionelle Ansätze
Literatur
Schule, Gemeinwesen und Inklusion. Möglichkeiten und Grenzen sozialraumorientierter Schulentwicklung
Joachim Schroeder
1 Die Schule und ihr Umfeld
2 Exklusionsprozesse im Sozialraum und die Folgen für die Schule
3 Inklusive Entwicklungsplanung im Schulbezirk
4 Neue Aufgaben für die inklusive Schulentwicklung
Literatur
Lokale und kommunale Teilhabeplanung
Albrecht Rohrmann
1 Traditionslinien der Behindertenpolitik und -hilfe
2 Chancen einer kommunalen Behindertenpolitik
3 Die UN-Behindertenrechtskonvention als soziale Innovation
4 Inklusion als Thema in der Bevölkerung
5 Inklusive Gemeinwesen planen
Literatur
Bildung in der inklusiven Stadtgesellschaft der Gegenwarten. Theoretische Reflexionen zu Optionen der Vernetzung, Planung und Partizipation durch eine kommunale Sozialpädagogik
Stephan Maykus
1 Stadtgesellschaft der Gegenwarten und Inklusion
2 Mikro-stadtsoziologische Perspektive auf Inklusion
3 Inklusive Bildung und kommunale Sozialpädagogik
4 Optionen von Vernetzung, Planung und Partizipation in Kommunen
5 Statt eines Fazits: Erziehungswissenschaftliche Positionierungen
Literatur
Soziale Räume als Orte der Lebensführung. Optionen, Beschränkungen und Befähigungen
Gudrun Wansing
1 Zur Einführung: Über die Notwendigkeit, den Referenzrahmen von Inklusion zu bestimmen
2 Inklusion in der modernen Gesellschaft – Bedingungen für die Lebensführung
3 Inklusion – global oder lokal? Räumliche Differenzierung und soziale Ungleichheit
4 »(Re-)Territorialisierung des Sozialen« – Zur (Wieder-)Entdeckung von Räumen und Orten
5 Soziale Räume, Behinderung und Teilhabe – Ein interdependentes Verhältnis
Literatur
Autorenverzeichnis
Einleitung
»Man könnte […] sagen, dass die Gemeinde jener Ort ist, an dem die Gesellschaft als höchst komplexes Phänomen unmittelbar anschaulich wird, während ausnahmslos alle weiteren Erscheinungsformen der Gesellschaft sehr schnell abstrakt werden«, so René König (1958, S. 9) in seiner grundlegenden Bestimmung von Gemeinde als einer Grundform der sozialen Wirklichkeit, die alle Formen des sozialen Lebens – wie Familien, Nachbarschaften, Freundesgruppen, Vereine und andere soziale Kreise – ebenso einschließt wie alle Funktionen der Lebensführung: Einrichtungen der Versorgung ebenso wie Angebote der Erziehung und Bildung, des Wohnungs- und Arbeitsmarktes, der Freizeit, Gesundheit, Kultur, des Sports oder der politischen Teilhabe. Gleichzeitig sind diese Formen und Funktionen konkret »verortet« und werden dadurch erlebbar, während »Gesellschaft« oder »das Bildungssystem« unanschaulich bleiben. Dabei schwingt in der etymologischen Herkunft des Wortes das »Gemeinsame« des räumlichen Bezugs ebenso mit wie das »Gemeinsame« einer »Gemeinschaft«. Der gemeinsame Raum kann ein rechtlich umgrenzter Aufenthaltsort sein, wie ihn die Kommune als Verwaltungseinheit darstellt. Er kann aber auch die soziale Verortung der Menschen meinen, was ihre Lebensführung und ihre Beziehungen betrifft, und diese ist nicht mit administrativen Grenzen deckungsgleich. Und so, wie die individuelle Lebensführung von größeren, staatlichen, aber auch nationale Grenzen überschreitenden globalen Strukturen beeinflusst wird, werden auch die Kommunen und Gemeindeverbände in ihrer Entwicklung davon beeinflusst. Dabei unterscheiden sich aber die vorfindlichen Lebensbedingungen nach wie vor nicht nur zwischen Weltregionen, sondern auch zwischen Ländern und innerhalb der Länder von Region zu Region und auch innerhalb einer Kommune. Die alltägliche Lebensführung ist und bleibt aber lokal gebunden. Die Frage, ob Menschen generell und behinderte Menschen im Speziellen im Gemeinwesen leben, stellt sich unter dem Gesichtspunkt der territorialen Gliederung von Gebieten nicht. Zweifellos stellt sie sich aber hinsichtlich der Handlungsspielräume, die zur Erfüllung wichtiger Anliegen der Lebensführung zur Verfügung stehen, und der gleichberechtigten Zugänglichkeit und Nutzbarkeit der Spielräume. Sozial ungleiche Zugänge in Abhängigkeit z. B. eines ungünstigen Sozialstatus wie eines fehlenden Schulabschlusses wirken sich auf den Zugang zum Ausbildungsmarkt ebenso aus, wie der Wohnort selbst schon bessere oder schlechtere Bedingungen für den Zugang zu Wohnraum, Arbeitsplätzen oder zur Gesundheitsversorgung bieten kann. Für die Lebensführung wiederum ist kennzeichnend, dass sich die einzelnen Bereiche wie Mobilität, Wohnen, Schulbesuch oder Erwerbstätigkeit gerade nicht voneinander trennen lassen, sondern im Gegenteil die einzelnen Bereiche jeweils als Kontextfaktoren füreinander betrachtet werden müssen, wobei sie bezogen auf den Lebensverlauf unterschiedliche Bedeutung und Gewichtung erfahren. So ist im Kindesalter der Schulbesuch zentral, aber ohne das Wohnen nicht denkbar, das Wohnen wiederum nicht ohne ein Mindestmaß an Infrastruktur von Versorgungsangeboten.
»Gemeinde« muss über die Verwaltungseinheit hinaus als sozialer Raum gedacht werden, der deutlich kleiner als ein rechtliches Gebiet, aber auch weit darüber hinausreichen kann und sich in unterschiedlichen Dimensionen konkretisiert: als Raum der sozialen Beziehungen ebenso wie als Raum von Machtpositionen, die sich durch den sozialen Status ergeben; als Raum, der dem Einzelnen zugänglich ist und als Raum der Artikulierung und Durchsetzung von Interessen. Zugänge zu wichtigen Gütern wie Arbeitsplätzen, Versorgungsangeboten, Wohnungen usw. sind mit Interessensdurchsetzung und damit auch immer mit Konflikten verbunden, und diese zeigen sich nirgends so deutlich wie auf der kommunalen und regionalen Ebene. Inklusion wiederum realisiert sich genau hier, in der Feinstruktur sozialräumlicher Bedingungen, also zwischen den national und global agierenden Systemen der Wirtschaft und der Lebenswelt: Der Vorgang der Inklusion bezieht sich auf Mitgliedschaften in Organisationen. Die individuelle Lebensführung ist hochgradig abhängig vom Zugang zu organisationsgestützten Strukturen wie dem Kindergarten, der Schule, Arztpraxen oder Kliniken. Dass in der UN-Behindertenrechtskonvention der Inklusion in das Gemeinwesen und dem Recht auf ein Leben in der Gemeinschaft ein sehr großer Stellenwert zukommt, erklärt sich so einmal aus der Erkenntnis, dass zur Realisierung gleichberechtigter Lebenschancen neben den Rechtsansprüchen entsprechende Strukturen und Handlungsprozesse vor Ort, bezogen auf konkrete Lebensbedingungen und auf die Sonder- wie die Regelangebote, erforderlich sind. Zum anderen muss die Lebensführung als Ganzes in den Blick genommen werden, sollen Bruchstellen nicht schon vorprogrammiert werden: Schon im horizontalen Gefüge einer Lebenssituation muss z. B. die Entscheidung für eine bestimmte Beschulungsform im Kontext mit gegebenenfalls erforderlichen außerschulischen Hilfen zur Ermöglichung des Schulbesuchs getroffen werden, abgesehen von allen Fragen, die sich mit Blick auf die Bezugnahme einer Schule selbst auf Strukturen vor Ort stellen, z. B. was das Beschaffen von Praktikumsplätzen betrifft oder hinsichtlich der Lebensbedingungen der Familien. Vertikal betrachtet geht es um die Gestaltung der Übergänge zwischen Lebensphasen und Lebensbereichen, um den Einbezug der Kontextfaktoren einer Lebenssituation als Ganzes und damit auch um Fragen der interdisziplinären Kooperation. Bereits die Salamanca-Erklärung der UNESCO von 1994 hebt durchgängig die Notwendigkeit der Verknüpfung der Schule und der Bildungspolitik mit außerschulischen Bereichen (Gemeinde) und der Sozial-, Arbeits- und Gesundheitspolitik heraus. Inklusion in das Gemeinwesen und Inklusion in Angebote der Bildung, Erziehung und sozialen Unterstützung sind untrennbar aufeinander bezogen. Zahlreiche der in den Leitlinien der Salamanca-Erklärung beschriebenen Maßnahmen beziehen sich hierauf, zusätzlich stellen »externe unterstützende Systeme« und »Perspektiven in der Gemeinde« zwei von insgesamt sieben eigenen Aktionsbereichen dar.
Mit »Inklusion« und »Gemeinwesen« geht es tendenziell »um alles«, nämlich sowohl um alle Lebensphasen als auch um alle Lebensbereiche. Diese können und sollen aber nicht alle eine explizite Thematisierung im vorliegenden Band erfahren. Vielmehr soll ein grundlegender Einblick in die übergeordneten und zentralen Fragestellungen der Verwirklichung gerechter Bildungs- und Erziehungschancen im Rahmen konkreter sozialräumlicher Strukturen und auf der Ebene eines Gemeinwesens gegeben werden. Folgende Fragen sind für die Beiträge leitend geworden:
Was bedeutet Inklusion und Partizipation in der »Gemeinde« bzw. im »Sozialraum«, und welche historischen und aktuellen Konzepte und Verständnisweisen gibt es hierzu? Diesen Fragen widmet sich schwerpunktmäßig der erste Beitrag. Die historischen Bezüge zu früheren fachlichen, aber auch sozialpolitischen Leitzielen und Konzepten einer Gemeinde-Orientierung, die auch demokratietheoretische Bezüge hat, sollen Wurzeln und Traditionen ebenso wie Brüche und Kontroversen der aktuellen Entwicklung verdeutlichen. Dazu gehören auch eine kritische Auseinandersetzung mit dem Gemeindebegriff sowie mit Ansätzen der Raumsoziologie, neben einer einführenden Aufarbeitung des empirischen Wissens um den Stand des Lebens im Gemeinwesen angesichts von Behinderung.
Wie können sich Bildungseinrichtungen (am Beispiel Schule) sozialräumlich positionieren und vernetzen? Joachim Schroeder diskutiert anhand interdisziplinärer raumtheoretischer Ansätze das komplexe Verhältnis der Institution Schule zum sozialen Umfeld und legt eine Bestimmung der Aufgabenfelder einer inklusionsorientierten Schulentwicklung dar, die systematisch den Sozialraum einbezieht, einschließlich eines Beispiels zur Vorgehensweise einer inklusionsorientierten qualitativen kommunalen Schulplanung. Dabei werden auch Mobilität, Migration und Transnationalisierung als sozialräumlich wirksame Prozesse thematisiert und die damit einhergehenden Herausforderungen für die Schulentwicklung am Beispiel der Verschränkung von Behinderung und Migration verdeutlicht.
Wie kann in einem regionalen oder kommunalen Rahmen Inklusion geplant und umgesetzt werden, welche Akteure, welche Handlungsansätze und Instrumente gibt es? Albrecht Rohrmann vertritt ausgehend von den Benachteiligungen im alltäglichen Leben und der schleppenden Umsetzung der Barrierefreiheit die These, dass die Neuausrichtung der Behindertenpolitik und der Teilhabeleistungen für Menschen mit Behinderungen insbesondere auch einer Neubestimmung der kommunalen Behindertenpolitik bedarf. Wie eine solche kommunale Behindertenpolitik entwickelt werden kann, bildet den Schwerpunkt des Beitrags. Planerische Ansätze zur Entwicklung eines inklusiven Gemeinwesens werden vorgestellt, die das Ziel haben, die Barrieren für behinderte Menschen und andere sozialen Gruppen zu artikulieren, analysieren und im Rahmen partizipativer und lernorientierter Prozesse zu überwinden.
Wie sind kommunale oder regionale Bildungslandschaften über die Lebensspanne zu denken, welche Begründungen und welche Ansätze existieren hierzu? Mit dem Beitrag von Stephan Maykus wird der Fokus auf die kommunale Umsetzung von Bildungschancen gerichtet, in der die Parzellierung nach Leistungsfeldern überwunden werden soll. Inklusion als Entwicklungs- und Gestaltungsaufgabe für unterschiedliche Akteure stößt vor Ort nach wie vor auf getrennte Zuständigkeiten, Gesetze, Finanzierungsformen und Trägerstrukturen. Wie kann also ein kommunaler Bezug aussehen, der Vernetzung, Planung und Partizipation in den bestehenden Systemgrenzen ermöglicht? Die Perspektive des Beitrags richtet sich auf die einer Stadtgesellschaft der Gegenwart mit ihren Merkmalen der Segregation, Exklusion und Inklusion, Kommunikation und Anerkennung. Die Grenzen und Chancen der Stadt als inklusiver Raum und als theoretische Kategorie für die Analyse einer kommunalen Inklusion werden modellhaft geklärt, um zu einem Gestaltungsrahmen zur Planung inklusiver Bildung und Partizipation sowie zu Möglichkeiten der Vernetzung und Moderation unterschiedlicher Systemlogiken zu gelangen.
Welche Chancen und welche Grenzen beinhalten soziale Räume als Orte der Lebensführung, und wie wirken transnationale und globale Entwicklungen hierauf? Der abschließende Beitrag von Gudrun Wansing nimmt das Motiv der Lebensführung wieder auf. Die Inklusionsbedingungen der modernen Gesellschaft konfrontieren den Menschen mit komplexen Anforderungen, die sich ihnen zudem in unterschiedlichen Lebensbereichen auf je spezifische Weise stellen, und zwar zum einen hinsichtlich der alltäglichen Koordination innerhalb einer Lebensphase als auch bezogen auf den Lebenslauf. Der Beitrag liefert einen mehrperspektivischen Betrachtungsrahmen von Inklusion, der funktionale, normative und räumliche Dimensionen von Lebensbedingungen beleuchtet und in ihrer Bedeutung für die Lebensführung (von Menschen mit Beeinträchtigungen) diskutiert.
Alle Beiträge sind einerseits grundlegend im Sinn der theoretischen Fundierung angelegt und ermöglichen andererseits Einsichten in die Umsetzung anhand von Forschungsergebnissen, am Beispiel von praktischen Entwicklungen und anhand konzeptioneller Überlegungen. Für alle Beiträge ist die Konzentration auf Fragen der Bildung, Erziehung und Partizipation leitend, die institutionsübergreifend mit Blick auf Problemstellungen analysiert werden, die prinzipiell für alle Handlungsfelder relevant oder darauf übertragbar sind. Da die schulische Bildung sowohl bezüglich des angesprochenen Leserkreises der Bandreihe als auch bezüglich ihrer Scharnierstellung im Lebenslauf eine zentrale Bedeutung hat, ist dieses Feld jedoch auch explizit repräsentiert. Zugleich macht gerade der Bereich der Schule die Komplexität und auch die Spannungsfelder der Thematik deutlich: Denn hier geht es zum einen um benachteiligte, hierunter auch lernbeeinträchtigte Kinder und Jugendliche, für die Kooperationen mit der Kinder- und Jugendhilfe ebenso gefordert werden wie die Debatte um den Sozialraum in Bezug auf diese Gruppen häufig einzig auf »benachteiligte Stadtviertel« verkürzt wird. Zum anderen geht es um geistig, körperlich oder sinnesbehinderte Kinder und ihre Familien, die wiederum oft in Debatten um sozialräumliche Schulentwicklung und um inklusive Bildungslandschaften vergessen werden und für die ebenfalls Kooperationen und Unterstützungssysteme – sowohl horizontal in einer Lebenssituation als auch vertikal an den Übergängen im Lebenslauf – notwendig sind. Gleichzeitig stellt sich die Aufgabe der Inklusion unterschiedlichster Gruppen – nicht nur in Bezug auf Behinderung – und eines sozialräumlichen Denkens, das den sozialen Raum nicht erst »draußen vor der Tür« beginnen lassen darf, soll die Gestaltung der Bildungsorte selbst, was Aneignung, Partizipation und soziale Beziehungen betrifft, nicht vergessen werden. Diese Problematiken müssen als quer zu allen Handlungsfeldern liegend begriffen werden.
Dem Band liegt ein Verständnis von Inklusion zugrunde, das sozialwissenschaftlich fundiert ist und seine normative Begründung durch die menschenrechtliche Perspektive der UN-BRK erfährt. Hieraus entspringt die Bedeutung sowohl einer auf Partizipation gerichteten Bildung mit ihren vielfältigen Lernorten als auch einer kommunalen Planung und Umsetzung von Bildungs- als Lebenschancen. Die damit einhergehenden Spannungsfelder werden im vorliegenden Band nicht unterschlagen, sondern es werden Wege zu ihrer produktiven Bewältigung aufgezeigt, mit den Chancen, aber auch den Grenzen, Widersprüchen und Konflikten, die sich immer ergeben, wenn es um die Herstellung gerechter Bildungschancen geht. Inklusion stellt hierfür ein zentrales Mittel dar, sie ist aber kein Zweck an sich, sondern bemisst sich letztlich an der Frage, worin sich eine anerkannte und individuell befriedigende Lebensführung eigentlich bemessen lässt.
Historische und aktuelle Begründungslinien, Theorien und Konzepte
Iris Beck
»Die Ausgeschlossenen sollen nicht ins alte System eingeschlossen werden […], sondern als Gleiche in einem neuen institutionellen Moment […] partizipieren. Man kämpft nicht für die Inklusion, sondern für die Transformation.« (Dussel, 2013, These 14.13)
1 Lebenslagen behinderter Menschen – Rahmendaten und Einblicke
1.1 Behinderung als Prozess erschwerter Partizipation am Leben in der Gemeinschaft und Gesellschaft
International wird Behinderung als ein Prozess der Erschwerung von Aktivitäten und der Partizipation aufgrund negativer Wechselwirkungen zwischen einer Person mit Störungen bzw. Beeinträchtigungen ihrer physischen, geistigen oder psychischen Funktionen und Faktoren ihrer sozialen und materiellen Umwelt betrachtet (International Classification of Functioning, DImDI, 2004; Schuntermann, 2011). Behinderungen entstehen in Relation zu bestimmten Normen, Werten und Einstellungen, zu strukturellen und situativen Kontexten und Anforderungen. Sie werden als eine gesellschaftliche Positionszuschreibung existent, wenn sich mit umfänglichen Beeinträchtigungen negative Bewertungsprozesse und Benachteiligungen, also Folgen für die Lebensführung im Sinne einer erschwerten Teilhabe, verbinden.
Behinderung ist ein komplexes, relatives, mehrdimensionales und prozesshaftes Geschehen, das von vielen Faktoren beeinflusst wird. Aber auch bereits das Ausmaß einer Beeinträchtigung (z. B. der Motorik) oder einer funktionellen Störung (z. B. eine Krankheit des Bewegungsapparates) werden durch äußere und personale Bedingungen beeinflusst, z. B. durch die medizinische Versorgung oder das Alter und den Gesundheitszustand einer Person. Ob es also zu Erschwernissen von Alltagsaktivitäten und der Partizipation kommt, und wenn ja, zu welchen, geht weder linear-kausal aus einer funktionellen Störung noch aus einer Beeinträchtigung hervor.
»Daß sich physische Schädigungen des Sehens bis zum Grad der Blindheit auf die Funktionabilität (Verhalten, Erleben, Lernen) des Individuums beeinträchtigend, erschwerend auswirken, erscheint plausibel. So wird u. a. von der meist verzögerten Entwicklung der Motorik berichtet, […] von der Erschwerung der Orientierung im Raum, von der Schwierigkeit, bei kognitiven Prozessen die ausfallenden visuellen Wahrnehmungen durch taktile und auditive zu ersetzen […] Die individuellen Unterschiede sind allerdings aufgrund der hohen Komplexität von sonstigen Wirkvariablen, zu denen insbesondere die Persönlichkeitsstruktur, Intelligenz, soziale Umwelt, ökonomische Bedingungen, Erziehung u. a. gehören, so groß, daß gegenüber Generalisierungen erhebliche Vorsicht geboten ist.« (Speck, 1996, 206f.)
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!