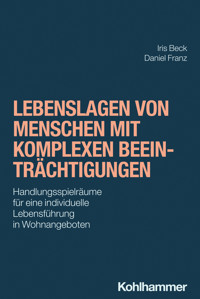
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Kohlhammer Verlag
- Kategorie: Bildung
- Sprache: Deutsch
Menschen mit komplexen Beeinträchtigungen sind mit hohen Exklusionsrisiken und Einschränkungen einer gleichberechtigten Lebensführung konfrontiert. Wie es gelingt, ihre Lebenslagen zu verbessern, ist eine Kernfrage der Reformprozesse vor dem Hintergrund der UN-Behindertenrechtskonvention, die das IMPAK-Projekt am Beispiel des Lebens in Wohnangeboten untersuchte. Dabei wird eine menschenrechtliche Perspektive leitend und der Anschluss an die Lebenslagenforschung hergestellt. Differenziert werden Bedingungen für die Umsetzung von Inklusion und Partizipation, Personen- und Sozialraumorientierung aufgezeigt. Die Leistungssteuerung der Bundesländer rückt dabei ebenso in den Fokus wie die Organisationsstrukturen der Angebote, die Anforderungen an die Mitarbeitenden und der Alltag, in dem sich die Handlungsspielräume der Menschen verwirklichen. Hinzu kommen Einblicke in die politischen und rechtlichen Rahmenbedingungen, die Spannungsfelder professionellen Handelns in diesem Feld und in Verständnisweisen von Behinderung und Beeinträchtigung.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 722
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
Cover
Titelei
Autor:innenverzeichnis
Vorwort
Glossar
Literatur
Einleitung
1 Lebenslage und komplexe Beeinträchtigung – zum Erhalt von »Lebenschancen aus der gesellschaftlichen Produktion als Sozialgüter«
1.1 Anerkennung gleichberechtigter Lebenschancen im historischen Rückblick: Geschichte misslungener Grenzverschiebungen?
1.1.1 Zwischen Verwahrung, Fürsorge und Erziehung: Entwicklungsphasen bis 1945
1.1.2 Zwischen Umgestaltung und Beharrung: das Ausbleiben grundsätzlicher Reformen
1.2 Komplexe Beeinträchtigung und Behinderung – Annäherung an eine Begriffsbestimmung für hochgradig eingeschränkte Möglichkeiten einer gleichberechtigten Lebensführung
1.2.1 Behinderung – ein multifaktorielles Wechselspiel zwischen Menschen und ihrer Umwelt
1.2.2 Behinderung und Beeinträchtigung in der UN-BRK, im Sozialrecht und der Sozialberichterstattung
1.2.3 Schwere und Komplexität von Behinderung und Beeinträchtigung im Fachdiskurs
1.2.4 Komplexe Beeinträchtigung als Arbeitsbegriff im IMPAK-Projekt
1.3 Der Lebenslagenansatz – Eröffnung von Handlungsspielräumen für eine individuelle Lebensführung
1.3.1 Grundverständnis und sozialpolitische Relevanz für die ›Verteilung‹ von Lebenschancen
1.3.2 Inklusion, Partizipation und Teilhabe als Bedingung der Lebenslage – Leitziele für die Verwirklichung von Lebenschancen
1.3.3 Zur Untersuchung von Lebenslagen
1.4 Leistungssteuerung, -organisation und -erbringung: ›Herstellung‹ von Lebenslagen
1.4.1 Einfluss und Grenzen sozialpolitischer Steuerung von außen und die Wirkmacht innerer Bedingungen
1.4.2 Die moderne Organisation des Helfens: ›Herstellung‹ von Lebenslagen
1.4.3 Qualitätsentwicklung als Bearbeitung von Spannungsfeldern zwischen dem lebensweltlich Erwünschten und dem organisatorisch Machbaren
1.4.4 Professionelle Leistungserbringung im Alltag: Anforderungen, Kompetenzen und Spannungsfelder
1.4.5 Literatur
2 Ausgangslage, Ziele und Vorgehensweise der IMPAK-Studie
2.1 Kenntnisse der Lebenslagen von Menschen mit komplexen Beeinträchtigungen
2.2 Bedingungen und Grenzen der Umsetzung einer gleichberechtigten Lebensführung in Wohnangeboten
2.2.1 Leistungssteuerung durch das Sozialgesetzbuch IX/Bundesteilhabegesetz und die UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderung
2.2.2 Angebotslandschaft und Leistungserbringung für eine ›vergessene Gruppe‹
2.3 Die Untersuchungsanlage
2.3.1 Ziele und Ableitung von Untersuchungsschritten
2.3.2 Sampling und methodisches Vorgehen
2.3.3 Literatur
3 Organisiert(es) Wohnen – Einblicke in Entwicklung und Strukturen der Untersuchungsstandorte und die Lebensbedingungen der Adressat:innen
3.1 Die ›Bestandsaufnahme‹: Übersicht über die einzelnen Erhebungsschritte und das Untersuchungssample
3.1.1 Inhalte und methodisches Vorgehen
3.1.2 Die Anbieter und die Untersuchungsstandorte: Kurzüberblick über ihre historische Entwicklung, Größe und Lage
3.2 Für wen sind die Anbieter da? Leistungstypen, Aufnahme- und Ausschlusskriterien
3.2.1 Finanzierungsformen, Leistungsvereinbarungen und Leistungstypen
3.2.2 Ausschluss- und Aufnahmekriterien in Leistungsvereinbarungen und Konzeptionen
3.2.3 Umgang mit Ausschlusskriterien
3.2.4 Zwischenfazit: Passung zum Angebot als Leitkriterium?
3.3 Wer lebt an den Standorten? Einblicke in die soziale Lage der Adressat:innen und erste Hinweise auf ihren Unterstützungsbedarf
3.3.1 Soziodemographische Merkmale der Adressat:innen
3.3.2 Räumliche Bedingungen und Ausstattungen der Untersuchungsstandorte
3.3.3 Leistungsrechtliche Zuordnungen nach ›Behinderungsart‹ und zugeschriebene Bereiche von Beeinträchtigungen
3.3.4 Zwischenfazit: Institutionelle Zuordnungslogiken und ihre Folgen für die Teilhabe
3.4 Das Wohnen organisieren: Angebots-, Organisations-, Personalstrukturen
3.4.1 Bedarfs- und Angebotsentwicklung und -planung
3.4.2 Organisationsstrukturen und -entwicklung
3.4.3 Überwiegend weiblich und in Teilzeit!? Personalstrukturen und -entwicklung
3.4.4 Zwischenfazit: Grenzziehung und Grenzverschiebung als Strategien im Umgang mit strukturellen Versorgungslücken und fehlenden verbindlichen Standards
3.5 Hinweise auf die Umsetzung von Partizipation, Personen- und Sozialraumorientierung aus Sicht der Leitungskräfte
3.5.1 Umsetzung von Partizipation
3.5.2 Personenorientierung
3.5.3 Inklusion im Gemeinwesen und Sozialraumorientierung
3.5.4 Zwischenfazit: erste Hinweise auf Bedingungen der Leistungserbringung
3.6 Fazit und Arbeitsthesen
3.6.1 ›Äußere‹ Bedingungen (Struktur I)
3.6.2 Handlungsspielraum der Organisation (Struktur II)
3.6.3 Handlungsspielraum der Adressat:innen
3.6.4 Literatur
4 Bedarfslagen, Leistungssystematiken und Angebotsstrukturen – zur Makro-Ebene der Leistungssteuerung
4.1 Theoretische Rahmung: Implementations- und Steuerungsfragen
4.2 Problemformulierung und -normierung: Was ist eigentlich ›komplexe Beeinträchtigung‹?
4.2.1 Einblicke in Leistungssystematiken
4.2.2 Zur Kategorie ›komplexe Beeinträchtigung‹
4.2.3 Zwischenfazit I: ›komplexe Beeinträchtigung‹ als Konstruktion des Hilfesystems
4.3 Praktische Implementation: Steuerung und Umsetzung
4.3.1 Ausgangslage: Versorgungsstrukturen von Menschen mit komplexer Beeinträchtigung
4.3.2 Zielgruppenbezogene Steuerung
4.3.3 Einzelfallbezogene Steuerung: Bedarfsermittlungsverfahren
4.3.4 Sozialräumliche Steuerung in Sozialplanung/Sozialraumorientierung
4.3.5 Zwischenfazit II: Steuerungsprobleme
4.4 Kritik und Umgestaltung: Weiterentwicklung der Angebotslandschaft
4.4.1 Maßnahmen zur Verbesserung der Versorgungslage
4.4.2 Weiterentwicklung von Angeboten
4.4.3 Zwischenfazit III: Hinweise auf Steuerungstypen
4.5 Empirisches Fazit: Komplexe Beeinträchtigung als verschärftes Exklusionsrisiko
4.6 Anschluss an den Fachdiskurs
4.6.1 Einzelfallbezogene Steuerung: Personenzentrierung mit Hindernissen
4.6.2 Zielgruppenbezogene Steuerung: die »Greatest Hits« der Behindertenhilfe
4.6.3 Sozialräumliche Steuerung: Regionale vs. überregionale Strukturen
4.7 Gesamtfazit
4.7.1 Literatur
5 Handlungssicherheit, -fähigkeit und Fachlichkeit – zur Meso-Ebene der Leistungserbringung aus Sicht der Mitarbeiter:innen
5.1 Die Mitarbeiterbefragung: Vorannahmen zu Anforderungen und Arbeitsbelastungen, Konzeption der Untersuchung und Untersuchungssample
5.1.1 Anforderungen und Arbeitsbelastungen in der Arbeit mit Menschen mit komplexen Beeinträchtigungen
5.1.2 Handlungssicherheit, -fähigkeit und Fachlichkeit: Konzeption und Themen der Befragung
5.1.3 Das Untersuchungs-Sample: soziodemografische Merkmale und Aspekte der Arbeitssituation
5.2 Kommunikation: Schlüsselelement für Partizipation und Handlungsfähigkeit
5.2.1 ›Dein Wille zählt‹ – Nutzung von Unterstützter/Alternativer Kommunikation
5.2.2 Kommunikation und Stellvertretung
5.2.3 Kommunikation und individuelle Assistenzplanung
5.2.4 Kommunikation und ›herausfordernde Verhaltensweisen‹
5.2.5 Zwischenfazit: Kommunikation, Deuten und Stellvertretung als Parameter für Partizipationsmöglichkeiten
5.3 Bedarf und Bedürfnis – Strukturierung des Arbeitsalltags als Schaltstelle für Person- und Sozialraumorientierung
5.3.1 Soziale Beziehungen und sozialer Raum: zwischen strukturellen Chancen und Zwängen
5.3.2 Das Verhältnis zwischen wichtigen Zielen, Aufgaben und dem ›Alltagsgeschäft‹ und die Funktion der individuellen Assistenzplanung
5.3.3 Zwischenfazit: Soziale Teilhabe als Kristallisationspunkt zur Lösung von Widersprüchen im Alltag
5.4 Alles nur eine Frage der ›Haltung‹!? – Anforderungsbewältigung als Wechselspiel aus strukturellen und individuellen Bedingungen
5.4.1 Denkweisen, Ziel- und Aufgabenverständnis und Umgang mit arbeitsfeldspezifischen Spannungsfeldern im Spiegel der Rollenbilder
5.4.2 Subjektives Belastungs- und Angsterleben der Mitarbeiter:innen
5.4.3 Organisationsprozesse und -strukturen als Schlüssel zur Herstellung von Handlungssicherheit
5.4.4 Zwischenfazit: Zusammenspiel von Haltung, Qualifikation und strukturellen Bedingungen: Parameter zur Anforderungsbewältigung und zur Umsetzung von Personenorientierung
5.5 Empirische Generalisierung der Ergebnisse
5.5.1 Anforderungsbewältigung im Alltag: Versuche der Lösung von Widersprüchen zwischen ›Mitte‹ und ›Peripherie‹ mit Folgen
5.5.2 ›Alltagswirksamkeit‹ struktureller Bedingungen als Schlüssel der Öffnung oder Begrenzung von Handlungsspielräumen
5.6 Fehlbeanspruchung als Ursache und Folge ›institutioneller Orientierung‹? – Diskussion und Einordnung der Ergebnisse
5.6.1 Handlungsunsicherheit als strukturelles Merkmal der Arbeit in Wohngruppen
5.6.2 Die ›Binnenzentrierung‹ als Seismograph von Mitte und Peripherie der Handlungslogik Leistungserbringung: Wohlbefinden im Mittelpunkt!?
5.6.3 Institutionelle Orientierung als Organisationskultur
5.6.4 Literatur
6 Alltägliche Lebensführung – Handlungsspielräume von Menschen mit komplexen Beeinträchtigungen auf der Mikro-Ebene
6.1 Methodischer Hintergrund des vierten Untersuchungsschritts
6.1.1 Analytisches Vorgehen
6.1.2 Methodisches Vorgehen des vierten Untersuchungsschritts
6.2 Unterstützungsbedarf und Abhängigkeit
6.2.1 Körperbezogener Unterstützungsbedarf
6.2.2 Regie- und orientierungsbezogener Unterstützungsbedarf
6.2.3 Kommunikationsbezogener Unterstützungsbedarf
6.2.4 Zusammenspiel und weitere Merkmale von Unterstützungsbedarfen
6.3 Unterstützungshandeln und Rahmenbedingungen
6.3.1 Grundstrukturen der Wohnangebote
6.3.2 Soziale Bedingungen
6.3.3 Sozialräumliche Beschaffenheit
6.3.4 Räumliche Bedingungen
6.3.5 Unterstützungshandeln
6.4 Das Zusammenspiel aus Unterstützungsbedarfen und -handeln: komplex und voraussetzungsvoll
6.4.1 Unmittelbares Unterstützungshandeln
6.4.2 Unmittelbare Voraussetzungen für das Handeln
6.4.3 Übergeordnete Voraussetzungen für das Handeln
6.5 Eine durch Restriktionen geprägte Lebensführung
6.5.1 Konsequenz: Ein von Restriktionen geprägter Alltag
6.5.2 Verdichtungen und Verkettungen von Restriktionen – eine komplexe Dynamik aus Unterstützungsbedarf und organisatorischen Rahmenbedingungen
6.6 Bedingungen der Öffnung und Begrenzung von Handlungsspielräumen – zusammenfassende Einschätzung
6.6.1 Literatur
7 Handlungsspielräume eröffnen – Lebenslagen verbessern
7.1 Äußere Bedingungen der Lebensführung: Ergebnisse aller Untersuchungsschritte
7.1.1 Organisiert wohnen – die ›Bestandsaufnahme‹ als Ausgangs- und Bezugspunkt der Gesamtuntersuchung und der Triangulation
7.1.2 Zur Makro-Ebene der Leistungssteuerung
7.1.3 Zur Meso-Ebene der Leistungsorganisation und -erbringung
7.1.4 Zur Mikro-Ebene der alltäglichen Lebensführung und des Unterstützungshandelns
7.2 Das Gesamt an Lebenschancen: die Lebenslage von Menschen mit komplexen Beeinträchtigungen
7.2.1 Lebenschancen vergleichen und bewerten
7.2.2 Ressourcen und Inklusion angesichts komplexer Beeinträchtigung
7.2.3 Kollektive Handlungsspielräume
7.3 Handlungsspielräume der Leistungssteuerung und -erbringung
7.3.1 Komplexe Beeinträchtigung, komplexe Anforderungen, komplexes Handeln
7.3.2 Personenorientierung, Sozialraumorientierung, Partizipation – zur Umsetzung fachlicher Standards
7.4 Lebenslagen verbessern – Impulse für die Weiterentwicklung von Hilfen für Menschen mit komplexer Beeinträchtigung
7.4.1 Literatur
Abbildungs- und Tabellenverzeichnis
Die Autor:innen
Dr. Iris Beck ist Professorin für Allgemeine Grundlagen und Soziologie am Arbeitsbereich Pädagogik bei Behinderung und Benachteiligung an der Universität Hamburg.
Dr. Daniel Franz ist Professor für gesundheitsbezogene Soziale Arbeit an der Medical School Hamburg.
Iris Beck/Daniel Franz
Lebenslagen von Menschen mit komplexen Beeinträchtigungen
Handlungsspielräume für eine individuelle Lebensführung in Wohnangeboten
Unter Mitarbeit von Magdalena Birnbacher,Nicole Franke, Henning Karten,Jessica Meyn und Katharina Sipsis
Verlag W. Kohlhammer
Dieses Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwendung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechts ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und für die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Die Wiedergabe von Warenbezeichnungen, Handelsnamen und sonstigen Kennzeichen in diesem Buch berechtigt nicht zu der Annahme, dass diese von jedermann frei benutzt werden dürfen. Vielmehr kann es sich auch dann um eingetragene Warenzeichen oder sonstige geschützte Kennzeichen handeln, wenn sie nicht eigens als solche gekennzeichnet sind.
Es konnten nicht alle Rechtsinhaber von Abbildungen ermittelt werden. Sollte dem Verlag gegenüber der Nachweis der Rechtsinhaberschaft geführt werden, wird das branchenübliche Honorar nachträglich gezahlt.
Dieses Werk enthält Hinweise/Links zu externen Websites Dritter, auf deren Inhalt der Verlag keinen Einfluss hat und die der Haftung der jeweiligen Seitenanbieter oder -betreiber unterliegen. Zum Zeitpunkt der Verlinkung wurden die externen Websites auf mögliche Rechtsverstöße überprüft und dabei keine Rechtsverletzung festgestellt. Ohne konkrete Hinweise auf eine solche Rechtsverletzung ist eine permanente inhaltliche Kontrolle der verlinkten Seiten nicht zumutbar. Sollten jedoch Rechtsverletzungen bekannt werden, werden die betroffenen externen Links soweit möglich unverzüglich entfernt.
1. Auflage 2025
Alle Rechte vorbehalten© W. Kohlhammer GmbH, StuttgartGesamtherstellung: W. Kohlhammer GmbH, Heßbrühlstr. 69, 70565 [email protected]
Print:ISBN 978-3-17-040720-6
E-Book-Formate:pdf: ISBN 978-3-17-040721-3epub: ISBN 978-3-17-040722-0
Autor:innenverzeichnis
Dr. Iris Beck ist Professorin für Allgemeine Grundlagen und Soziologie am Arbeitsbereich Pädagogik bei Behinderung der Universität Hamburg. Iris Beck lehrt und forscht zu Lebenslagen und Lebensbewältigung von Menschen mit Behinderung und zur Umsetzung von Inklusion und Partizipation sowie zur Entwicklung bedarfsgerechter Unterstützungssettings insbesondere für Menschen mit komplexen Beeinträchtigungen.
Dr. Daniel Franz ist Professor für gesundheitsbezogene Soziale Arbeit an der Medical School Hamburg. Daniel Franz lehrt und forscht im Schnittfeld der Themenfelder Gesundheit, Behinderung und Alter – immer mit dem Fokus auf gelingende Lebensführung und umfassende Partizipation unter erschwerten Bedingungen sowie auf professionelles Handeln in den entsprechenden Unterstützungssettings.
Magdalena Birnbacher studierte Erziehungs- und Bildungswissenschaft (M. A.) im Profilbereich Partizipation und Lebenslanges Lernen an der Universität Hamburg und promoviert am Arbeitsbereich Pädagogik bei Behinderung und Benachteiligung der Universität Hamburg zum Thema ›Unterstützungsprozesse im Kontext von komplexen Beeinträchtigungen in institutionalisierten Wohnangeboten‹.
Nicole Franke studierte Erziehungs- und Bildungswissenschaft (M. A.) im Profilbereich Partizipation und Lebenslanges Lernen und Soziologie an der Universität Hamburg. Inzwischen arbeitet sie beim Träger der Eingliederungshilfe im Kreis Pinneberg und ist dort mitverantwortlich für den Aufbau und die Etablierung der Ansprechstelle »einfach teilhaben«.
Henning Karten ist Logopäde und studierte Erziehungswissenschaften (Diplom) an der Philipps Universität Marburg mit dem Schwerpunkt Sozial- und Sonderpädagogik. Er war in verschiedenen Feldern der Eingliederungshilfe tätig wie Tagesförderung und Fallmanagement. Inzwischen ist er beim Leistungsanbieter »Leben mit Behinderung Hamburg« in der Angebotsberatung tätig und Teilhabeberater im Hamburger Modellprojekt »Sozialraumorientierte Eingliederungshilfe.«
Dr. Jessica Meyn studierte Sonderpädagogik und Sozialwissenschaften (Lehramt) und promovierte an der Universität Hamburg zu ungleichen Partizipationschancen in heterogenen (Lern-)Gruppen. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Leuphana Universität Lüneburg mit den Schwerpunkten gesellschaftswissenschaftliche (Lehrkräfte-)Bildung und (Lehrkräfte-)Bildung für nachhaltige Entwicklung.
Katharina Sipsis studierte Erziehungs- und Bildungswissenschaft (M. A.) im Profilbereich Partizipation und Lebenslanges Lernen an der Universität Hamburg. Sie war als Fallmanagerin im Fachamt Eingliederungshilfe Hamburg tätig und übernahm anschließend die Leitung der Eingliederungshilfe in einer besonderen Wohnform des Leistungsanbieters »Sozialkontor«. Inzwischen ist sie in der Sozialbehörde Hamburg als Referentin im Projekt »Zentrum für Teilhabe« tätig.
Vorwort
Zwischen 2005 und 2012 wurden in Hamburg durch die Umwandlung stationärer Wohnangebote oder Neugründungen mehr als 700 Plätze in ambulanten Wohnangeboten geschaffen. Ausdrückliches Ziel war es, dass von diesem Prozess auch Menschen mit damals sogenanntem ›hohem Hilfebedarf‹ profitieren. Dies gelang trotz der Entwicklung von alternativen Modellen selbstbestimmten Wohnens für den Personenkreis nur eingeschränkt. Die Befürchtung, dass sich die stationären Angebote zu ›Schwerstbehindertenzentren‹ entwickeln, war für uns der Anlass, den Bedingungen genauer auf die Spur kommen zu wollen, die – unabhängig von der Benennung ›stationär‹ oder ›ambulant‹ – eine individuelle Lebensführung für Menschen ermöglichen, die in besonderem Maß auf Unterstützung angewiesen sind. Gleichzeitig wollten wir dazu beitragen, die unzureichende Kenntnis über ihre Lebenslagen zu verbessern. Ein solches Forschungsvorhaben erfordert Geld, Zeit, Personal, vor allem aber viel Unterstützung durch die Menschen, die mehr oder weniger direkt von einer solchen Untersuchung betroffen sind. Dass das IMPAK-Forschungsprojekt durchgeführt werden konnte, ist in erster Linie Rolf Hamacher-Heinemann, vor Projektbeginn Referent im Bundesministerium für Arbeit und Soziales, zu verdanken. Sein Engagement für Menschen mit komplexen Beeinträchtigungen öffnete uns die Tür zur Antragstellung auf Forschungsförderung im BMAS. Der große Dank an ihn verbindet sich mit ebenso großem Dank an Dr. Rolf Schmachtenberg vom BMAS. Aber ohne die Menschen, die in den von uns untersuchten Wohnangeboten leben und arbeiten, wären die Untersuchungen gar nicht möglich gewesen. Den Adressat:innen, Mitarbeiter:innen, Leitungskräften und Geschäftsführungen gilt unser ganz besonderer Dank. An jedem Untersuchungsstandort waren wir willkommen und erhielten einen tiefen Einblick in den Alltag. So sehr, wie sich die Untersuchungsstandorte in ihren Bedingungen unterscheiden, eint sie der Wille, die Lage der dort lebenden Menschen verbessern zu wollen.
Auch auf der Ebene der Bundesländer stießen wir auf große Bereitschaft der Leistungsträger, uns breite Einblicke in ihre Leistungssteuerung zu geben. Kontinuierliche fachliche Unterstützung erhielten wir durch unseren Beirat, namentlich Prof. Dr. Wolfgang Lamers, Prof. Dr. Albrecht Rohrmann, Dr. Helmut Schröder, Edgar Seeger und Prof. Dr. Monika Seifert. Wissenschaftliche Expertise steuerten zudem Dr. Christian Bradl, Prof. Dr. Wolfgang Schütte und Dr. Katharina Silter bei. Und stellvertretend für all die Menschen, die dieses Projekt von Seiten der Universität Hamburg in unterschiedlichsten Funktionen – als studentische Hilfskräfte, von Seiten der Verwaltung oder der Technik – tatkräftig unterstützt haben, möchten wir Marie Marten, Eike Oliczewski, Horst Ramm und Tanja Warnecke nennen. Ihnen allen gilt unser großer Dank.
Glossar
Ambulant/StationärBis zum Inkrafttreten des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) wurden Wohnformen danach unterschieden, ob man mit relativ wenig Assistenz in einer Wohnung oder Wohngemeinschaft leben kann (ambulant) oder aber viel Assistenzbedarf hat, was i. d. R. gleichbedeutend mit dem Wohnen in stationären Angeboten war (»rund um die Uhr versorgt«, in einer Wohngruppe in einem oder angegliedert an ein Wohnheim). Mischformen gab und gibt es, sie haben sich aber nicht bundesweit durchgesetzt. Das BTHG gibt keine Legaldefinition für die bisherigen stationären Einrichtungen der Eingliederungshilfe mehr vor, sie werden aber i. d. R. als »besondere Wohnformen« bezeichnet. Ambulantes Wohnen existiert als Begriff im Gesetz nicht mehr, sondern fällt unter die Assistenzleistungen zur sozialen Teilhabe. Wir verwenden die Begriffe ›ambulant‹ und ›stationär‹ mit einfachen Anführungsanzeichen: Zum einen galten zum Untersuchungszeitpunkt diese Bezeichnungen noch und wesentlich verändert hat sich die Angebotslandschaft seitdem auch nicht. Zum anderen wollen wir damit signalisieren, dass es problematische Trennungen sind, weil jede Wohnform ein möglichst selbstbestimmtes Leben ermöglichen sollte und es eher um die Logik der Leistungserbringung geht (eher an der Institution oder eher an der Person orientiert).
›Herausfordernde Verhaltensweisen‹Der Begriff ›herausfordernde Verhaltensweisen‹ wird hier unter der Prämisse der Anschlussfähigkeit an den im angloamerikanischen Fachdiskurs geprägten Terminus ›Challenging Behaviour‹ nach Emerson und Einfeld (2011) verwendet. Im Speziellen erfolgt die Begriffsnennung mit Blick auf die von Feuser (2008) aufgeworfene Nuancierung durch den Begriff Verhaltensweisen, der gegenüber dem Begriff Verhalten stärker hervorhebt, dass es um soziale Zuschreibungsprozesse geht, die in hohem Maße auch Menschen mit komplexen Beeinträchtigungen betreffen (vgl. Bradl 2018, S. 5). Die einfachen Anführungszeichen sollen verdeutlichen, dass der Begriff keine Eigenschaft der Menschen meint, sondern seine Verwendung stark kontext-, person- und situationsabhängig ist. Emerson (1995) bezieht sich zusätzlich auf die ernsthafte Fremd- oder Selbstgefährdung im Zuge gezeigter ›herausfordernder Verhaltensweisen‹, gemeint sind vor allem sogenannte aggressiv-ausagierende Verhaltensweisen (vgl. Dieckmann et al. 2007, S. 16 f.). Wir schließen auch ängstlich-gehemmte Verhaltensweisen ein, die sich als ›Rückzug‹ oder ›in sich gekehrt sein‹ äußern können. Sie muten nicht bedrohlich an, dennoch sind sie als herausfordernd anzuerkennen, weil sie die individuelle Teilhabe am Leben im Gemeinwesen erheblich einschränken können (vgl. Dieckmann et al. 2007, S. 17).
Komplexe BeeinträchtigungDie Bestimmung von komplexer Beeinträchtigung, wie sie hier für die Untersuchung leitend geworden ist, löst sich von Abgrenzungen anhand einer bestimmten ›Behinderungsart‹. Stattdessen stehen Gemeinsamkeiten der Lebenswirklichkeit im Blickpunkt, die sich in besonders hohen Risiken der Exklusion, der sozialen Abhängigkeit und von Belastungserfahrungen zeigen. Entsprechend wurden in die Untersuchung Menschen unabhängig von einem ›Etikett‹ wie z. B. ›geistig beeinträchtigt‹ einbezogen. Komplexe Beeinträchtigungen ergeben sich nach unserem Verständnis, wenn – unabhängig von der Frage des Vorliegens einer oder mehrerer ›Schädigungen‹ – nicht nur eine funktionale Einschränkung z. B. der Bewegung vorliegt, sondern weitere Bereiche wie z. B. das emotionale Erleben oder die Wahrnehmung betroffen sind, ohne dass diese zwangsläufig mit der ›Schädigung‹ in Verbindung stehen oder aus ihr hervorgehen müssen. Entsprechend können Menschen mit komplexen Beeinträchtigungen von individuell höchst unterschiedlichen und vor allem unterschiedlich zusammenwirkenden Einschränkungen betroffen sein, die immer Folge eines multifaktoriellen Wechselspiels und entsprechend sozial mit bedingt sind. Komplexe Beeinträchtigungen können zu Behinderung im Sinn erschwerter Teilhabe führen. Die Gefahr besonders hoher Exklusionsrisiken und Einschränkungen gleichberechtigter Lebensführung besteht vor allem dann, so unsere These, wenn die Diskrepanz zwischen der psycho-physischen Disposition und situativen Anforderungen in basalen Bereichen der Lebensführung erheblich ist und dies zu objektiven und subjektiv erlebten Belastungen sowie hoher sozialer Abhängigkeit führt (Beck & Franz 2019, S. 147).
Personenzentrierung und PersonenorientierungDer Begriff Personenorientierung wird in Anlehnung an Walter Thimm verwendet, der in den 1980er Jahren sein Modell einer gemeindenahen Behindertenhilfe mit dem Ziel entwickelte, gleichberechtigte Kommunikations- und Interaktionsstrukturen und eine individuelle Lebensführung zu ermöglichen anstatt die Lebensführung den Mitteln und Zielen der Organisationen unterzuordnen und anzupassen. Dazu gehören die umfassende Erhebung und Umsetzung des individuellen Assistenzbedarfs, die Stützung und Förderung sozialer Beziehungen und der Partizipation sowie die Veränderung der Angebotsstrukturen. Das ist der Kern des unseres Wissens nach von ihm erstmals so bezeichneten Wandels von der institutionellen zur personalen, an der alltäglichen Lebensführung ausgerichteten Orientierung (Thimm 1989). Der Begriff Personenzentrierung stammt aus der Psychiatrie und setzt am gleichen Problem an, der institutionellen ›Unterbringung‹ von Menschen ohne Berücksichtigung normaler Lebensvollzüge, bezieht sich aber vor allem auf die Erhebung und Umsetzung des individuellen Assistenzbedarfs. Mittlerweile findet er sich im BTHG und bezieht sich hier in erster Linie auf die Ausrichtung der Leistungen an der Lebenslage der Adressat:innen sowie eine bedarfsdeckende, einheitliche Leistungsgewährung. Überall, wo die fachliche Bedeutung gemeint ist, wird Personenorientierung verwendet und Personenzentrierung nur dann, wenn es explizit um das Geschehen der gesetzlichen Leistungssteuerung nach dem BTHG geht.
Teilhabe-, Gesamtplanung des Trägers und individuelle Assistenzplanung des AnbietersTeilhabe- und Gesamtplanung beschreibt die Prozesse der Erhebung und Planung individueller Teilhabeleistungen nach dem BTHG auf administrativ-leistungsrechtlicher Ebene der Leistungsträger. Assistenzplanung und Teilhabemanagement sind auf der Ebene der Leistungserbringer angesiedelt und beschreiben den Prozess der Implementation des Gesamtplans in konkrete Assistenzleistungen anhand von Verfahren und Instrumenten (auch: individuelle Teilhabeplanung, Teilhabemanagement, Assistenzplanung, persönliche Zukunftsplanung etc.).
Unterstützte/Alternative KommunikationUnterstützte Kommunikation umfasst laut Kristen alle pädagogischen und therapeutischen Angebote und Maßnahmen, um Menschen mit sehr unterschiedlich ausgeprägten Einschränkungen im Erwerb kommunikativer und sprachlicher Kompetenzen sowie erheblich eingeschränkten oder fehlenden Fähigkeiten zur lautsprachlichen Äußerung eine Erweiterung resp. Verbesserung kommunikativer Möglichkeiten anzubieten (vgl. Kristen 2002, S. 15). Der deutschsprachige Begriff knüpft an die im internationalen Fachdiskurs gängige Bezeichnung Augmentative and Alternative Communication (AAC) an. Der Terminus AAC meint den systematischen und planvollen Einsatz von Kommunikationsformen in Ergänzung oder als Ersatz zur Lautsprache.
UntersuchungsstandortDie IMPAK-Untersuchung fand an zehn Untersuchungsstandorten statt, gelegen in fünf Bundesländern. Alle Untersuchungsstandorte sind Wohnhäuser, von denen es zwei Typen gibt:
Literatur
Beck, I. & Franz, D. (2019): Personorientierung bei komplexer Beeinträchtigung. Herausforderungen für Handlungsspielräume und bedarfsgerechte Unterstützungssettings. In: Teilhabe, 58 (4), Marburg: Lebenshilfe-Verlag Teilhabe, S. 146 – 152.
Bradl, C. (2018): IMPAK-Workshop »Herausforderndes Verhalten«. 19. 12. 2018, Universität Hamburg. Unveröffentlichtes Arbeitspapier.
Dieckmann, F., Haas, G. & Bruck, B. (2007): Herausforderndes Verhalten bei geistig behinderten Menschen – zum Stand der Fachdiskussion. In: F. Dieckmann & G. Haas (Hg.): Beratende und therapeutische Dienste bei geistiger Behinderung und herausforderndem Verhalten (S. 15 – 419. Stuttgart: Kohlhammer.
Emerson, E. (1995): Challenging Behaviour: Analysis and Intervention in People with Intellectual Disabilities. Cambridge: Cambridge University Press.
Emerson, E. & Einfeld, S. L. (2011): Challenging behaviour. Third edition. Cambridge: Cambridge University Press.
Feuser, G. (2008): Intensiv, herausfordernd, aggressiv? Auffälliges Verhalten von behinderten Menschen verstehen. In: Evangelisches Diakoniewerk (Hg.): 36. Martinstift-Symposion. An Grenzen kommen. Begleitung von behinderten Menschen mit herausforderndem Verhalten (S. 34 – 44). Gallneukirchen: Evangelisches Diakoniewerk.
Kristen, U. (2002): Praxis Unterstützte Kommunikation. Eine Einführung (4. überarb. und erw. Auflage). Düsseldorf: Verlag Selbstbestimmtes Leben.
Thimm, W. (1989): Entwicklungsperspektiven kommunaler Behindertenpolitik. In: Sozialreferat der Stadt München (Hg.): Zur Situation Behinderter in München. München: Eigendruck.
Einleitung
Iris Beck & Daniel Franz
Vor dem Hintergrund der UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen haben Bemühungen um die Verbesserung der Lebenssituation von Menschen mit Beeinträchtigungen eine neue Dynamik erhalten. Die angezielten Veränderungen beziehen sich im Kern auf den Status der Betroffenen als Bürger:innen mit gleichen Rechten (Menschenrechtsperspektive), auf die Inklusion im Sinne eines gleichberechtigten Zuganges zu den Feldern der Lebensführung anhand angemessener und wirksamer Maßnahmen und auf die Partizipation im Sinne von Entscheidungs- und Beteiligungsmöglichkeiten. Mit diesen Prozessen sollen letztlich Handlungsspielräume dafür geöffnet werden, dass Menschen ihr Leben nachhaltig und perspektivisch nach eigenem Ermessen gestalten können. Für Menschen mit komplexen Beeinträchtigungen zeigen sich bei der Umsetzung dieses Wandels besonders gravierende und nachhaltige Bruchstellen, sie profitieren wenig davon und lernen, arbeiten und wohnen nach wie vor überwiegend in Sondereinrichtungen. Diese Problematik zieht sich seit den Anfängen der De-Institutionalisierung im 20. Jahrhundert durch nahezu alle Reformbestrebungen von Hilfen für Menschen mit Beeinträchtigungen.
In der Fachdiskussion und in der Praxis werden für die Bezeichnung des Personenkreises, der von besonders hohen Exklusionsrisiken betroffen ist, Begriffe wie schwerste, mehrfache oder komplexe Beeinträchtigung bzw. Behinderung verwendet, sehr häufig im Zusammenhang mit einer geistigen Beeinträchtigung. Wir sprechen hingegen von komplexen Beeinträchtigungen, wenn nicht nur eine funktionale Einschränkung, z. B. der Bewegung, sondern weitere Einschränkungen, z. B. des emotionalen Erlebens oder der Wahrnehmung vorliegen, aber ohne, dass sie zwangsläufig mit kognitiven Einschränkungen verbunden sein müssen. Einem subjektorientierten und sozialwissenschaftlichen Verständnis folgend geht es vielmehr um eine Lebenswirklichkeit, die von einer sehr hohen sozialen Abhängigkeit, hohen Exklusionsrisiken und subjektiven Belastungserfahrungen geprägt ist. Die vorliegende Publikation verfolgt in diesem Zusammenhang eine doppelte Zielsetzung: Zum einen wird anhand des Lebenslagenansatzes die Situation von Menschen mit komplexen Beeinträchtigungen anhand eines Betrachtungsrahmens analysiert, wie er generell an die Lebensführung von Menschen angelegt wird. Damit wird die menschenrechtliche Perspektive auf sie als Bürger:innen mit gleichen Rechten leitend und ein Anschluss an die Sozialberichterstattung und Lebenslagenforschung im allgemeinen und zur Lage von Menschen mit Beeinträchtigungen im speziellen geleistet. Zum anderen stehen die Chancen und Grenzen der Umsetzung von Personen- und Sozialraumorientierung und Partizipation im Bereich des Wohnens von Menschen mit komplexen Beeinträchtigungen im Fokus, der von der Makro-Ebene der Leistungssteuerung über die Ebene der Organisation der Wohnangebote bis zur Mikro-Ebene des Alltagslebens reicht, immer unter der Fragestellung, welche Bedingungen ihre Handlungsspielräume begrenzen und welche sie öffnen.
Damit bietet die hier vorliegende Publikation zum einen grundlegende Orientierungen dazu, wie Lebenslagen sozialpolitisch gesteuert und personenbezogene Dienstleistungen organisiert werden und welche Arbeitsanforderungen und -belastungen sich stellen. Ebenso grundlegende Einblicke werden geboten in die historischen Entwicklungsphasen pädagogischer und sozialer Angebote für Menschen mit komplexen Beeinträchtigungen, in die Anforderungen der Arbeit im Feld von Behinderung und komplexen Beeinträchtigungen, die Steuerung und Entwicklung der Wohnangebote und die Chancen und Grenzen, die sich aus der UN-Konvention über die Rechte behinderter Menschen und dem Sozialgesetzbuch IX ergeben (▸ Kap. 1 und ▸ Kap. 2). Zum anderen, und das ist das Herzstück der Publikation, werden differenzierte empirische Einblicke in die Lebenslagen ermöglicht. Die IMPAK-Untersuchung (Implementation von Partizipation und Inklusion für Menschen mit komplexen Beeinträchtigungen) lief über einen Zeitraum von drei Jahren in fünf Bundesländern an zehn Untersuchungsstandorten. Sowohl hinsichtlich der dort lebenden Menschen als auch hinsichtlich der formalen Struktur, Größe, Lage etc. bilden die Standorte typische Unterstützungssettings für den Personenkreis ab. Vor Ort wurden Interviews mit Geschäftsführungen und Leitungskräften, Dokumentanalysen, eine Mitarbeiterbefragung und intensive Alltagsbeobachtungen durchgeführt. Zusätzlich erfolgte auf der Ebene der Bundesländer eine Untersuchung der sozialpolitischen Steuerungsebene.
Kapitel 3 stellt grundlegende Informationen zu den Anbietern und ihrer Angebots- und Organisationsentwicklung, zu den Untersuchungsstandorten und den Mitarbeiter:innen sowie zu den dort lebenden Menschen und ihren Wohnbedingungen bereit.
Kapitel 4 beleuchtet unter dem Fokus der Implementation bedarfsgerechter Unterstützung die Prozesse der Leistungssteuerung auf der Makro-Ebene der Leistungsträger.
Kapitel 5 wechselt auf die Meso-Ebene der konkreten Leistungserbringung durch die Mitarbeiter:innen vor Ort und stellt Anforderungen an ihre Tätigkeit und Professionalität, aber auch Belastungen des Arbeitslebens in den Mittelpunkt.
Kapitel 6 präsentiert die Ergebnisse mehrerer über einen längeren Zeitraum gelaufener teilnehmender Beobachtungen auf der Mikro-Ebene des Alltagslebens und fokussiert auf die Verwobenheit von individuellen Bedürfnissen, dem Unterstützungsbedarf und dem konkreten Unterstützungshandeln im jeweiligen Setting.
Auch in diesen Kapiteln erfolgen stets Bezüge zum Diskussions- und Forschungsstand der jeweiligen Thematiken, sodass sie Informationen liefern, die über die Untersuchung und eigene Forschungsergebnisse hinausgehen. In Kapitel 7 werden die Untersuchungsergebnisse verdichtet zusammengefasst und unter der ›Brille‹ der Handlungsspielräume aufeinander bezogen. So entsteht ein Bild davon, über welche Ressourcen die Menschen verfügen, die in Wohnangeboten leben, ob und wie sie gesellschaftlich inkludiert sind, wie sich ihre Lebenslagen letztlich darstellen und was die entscheidenden Bedingungen dafür sind, dass Partizipation, Personen- und Sozialraumorientierung auch für Menschen mit komplexen Beeinträchtigungen wirksam umgesetzt und vielfältige individuelle Lebenswege ermöglicht werden.
1 Lebenslage und komplexe Beeinträchtigung – zum Erhalt von »Lebenschancen aus der gesellschaftlichen Produktion als Sozialgüter«1
Iris Beck
Die Durchsetzung von Bildungs- und Teilhabechancen für Menschen mit Behinderung war ein mühsamer und von Bruchstellen gekennzeichneter Prozess. Der historische Rückblick (▸ Kap. 1.1) zeigt, dass er für Menschen mit komplexen Beeinträchtigungen besonders begrenzt verlief und Kriterien wie ›Leistungsfähigkeit‹ und ›Unabhängigkeit von Pflege‹ bis heute problematische Wirkungen darauf entfalten. Aktuelle Verständnisweisen von Behinderung wie die International Classification of Functioning (ICF; WHO 2001) heben dagegen als Ursache erschwerter Teilhabe das Wechselspiel zwischen Menschen mit Beeinträchtigungen und Barrieren in ihrem Umfeld hervor. Auf dieser Basis und einer Analyse des Fachdiskurses um ›komplexe‹ oder ›schwere‹ und ›schwerste‹ Behinderung wird ein sozialwissenschaftliches Verständnis von ›komplexer Beeinträchtigung‹ vorgestellt, in dessen Zentrum besondere Belastungen, Abhängigkeiten und Exklusionsrisiken stehen (▸ Kap. 1.2).
Zur Untersuchung der Lage von Menschen mit komplexen Beeinträchtigungen ist ein Betrachtungsrahmen notwendig, der alle äußeren Faktoren in den Blick nimmt, die ihre Lebensführung beeinflussen, von der Ebene der rechtlichen Bedingungen über die Organisationen und Dienstleistungen bis hin zu den sozialen Beziehungen. Dafür eignet sich der Lebenslagenansatz, der wie die UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderung (Beauftragter der Bundesregierung 2018) auf die Verwirklichung einer unabhängigen, gleichberechtigten Lebensführung abzielt (▸ Kap. 1.3). Inklusion und Partizipation bilden Bedingungen der Lebenslage, sie lenken den Blick auf Ein- und Ausschlusskriterien für den Zugang zu Lebensbereichen und die Möglichkeiten des Einzelnen, auf seine Lebensführung aktiv Einfluss zu nehmen. Zur Analyse von Einflüssen und Wirkungen äußerer Bedingungen ist eine Anbindung an wissenschaftliche Begründungszusammenhänge erforderlich, die Aufschluss geben, wie die Leistungssteuerung, -organisation und -erbringung im Bereich personenbezogener Dienste funktioniert und welchen Bedingungen, Spannungsfeldern und Grenzen sie unterliegt (▸ Kap. 1.4).
1.1 Anerkennung gleichberechtigter Lebenschancen im historischen Rückblick: Geschichte misslungener Grenzverschiebungen?
1.1.1 Zwischen Verwahrung, Fürsorge und Erziehung: Entwicklungsphasen bis 1945
Studien zur historischen Durchsetzung von Bildungs- und Teilhabechancen von Menschen mit Behinderung, die Schlüsse auf die Situation von Menschen mit komplexen Beeinträchtigungen zulassen, liegen u. a. vor von Moser (1995, 1997, 1998) und Möckel (2007). Sie geben wichtige Hinweise darauf, warum Veränderungsprozesse hier so schleppend und begrenzt verliefen. Dass die Heilpädagogik wie die Pädagogik insgesamt von ihren Ursprüngen an sowohl von humanitärem Emanzipationsbestrebungen als auch von Brauchbarkeitsgedanken geprägt war (Moser 1997), spielt dafür eine wichtige, aber nicht die einzige Rolle. Die Entstehung und Ausbreitung (heil-)pädagogischer Einrichtungen steht im Zusammenhang mit wirtschaftlichen, rechtlichen und politischen Entwicklungen. Setzt ein Wandel ein, hat er weitreichende Folgen für die Lebenschancen der betroffenen Menschen und die bis dahin bestehende Erziehungs- und Bildungswirklichkeit (Möckel 2007, S. 25), die durch neue Institutionalisierungs- und Professionalisierungsprozesse verändert wird. Diese Grenzverschiebung kommt aber nur unter bestimmten, »notwendigen und zureichenden Bedingungen« zustande (a. a. O, S. 23). Das Bewusstsein dafür, dass die Lage verändert werden muss, ist dafür ebenso erforderlich wie die Erkenntnis, dass sie verändert werden kann (vgl. a. a. O.). Zur flächendeckenden Umsetzung braucht es aber die staatliche Anerkennung und rechtliche Absicherung dieser Ansprüche, also günstige gesellschaftliche Rahmenbedingungen.
Die historischen Entwicklungsphasen pädagogischer und sozialer Hilfen für Menschen mit Behinderung stellen weder klar voneinander abzugrenzende Etappen dar, noch bauen sie nahtlos aufeinander auf (Möckel 2007), vielmehr kommt es zu Überlappungen, Ungleichzeitigkeiten, Brüchen und Rückschritten.
Die ersten systematischen Bemühungen reichen in die Zeit der Aufklärung des späten 18. Jahrhunderts zurück. Hier bildeten sich ein gesellschaftliches Bewusstsein für soziale Notlagen und ein Erziehungs- und Bildungsoptimismus heraus. Die öffentliche Anerkennung, die die Bildungserfolge einzelner Personen wie dem Abbè de l'Èpee bei tauben Menschen und von Victor Haüy bei blinden Menschen fanden (Möckel 2007, S. 30 ff.), schlug sich in der Zeit ab 1780 in der Gründung einzelner Anstalten mit Beschulung nieder. Die flächendeckende Ausbreitung und Absicherung der Beschulung aller blinden und tauben Kinder war jedoch ein sehr langer Durchsetzungsprozess. Die europäischen Staaten haben die Einrichtung und Finanzierung dieser Schulen lange der privaten und kirchlichen Wohlfahrt überlassen (a. a. O., S. 24), als die allgemeine Schulpflicht schon längst durchgesetzt war und in staatlichen Schulen erfüllt wurde. Daran erkennt man die Brisanz der Situation: denn wenn es die Kraft des Faktischen war, nämlich dass sich angesichts der pädagogischen Erfolge bei blinden und tauben Menschen das Bild so wandelte, dass ein Ausweichen vor der staatlichen Verantwortung irgendwann nicht mehr möglich war, gibt es tiefgreifende Ursachen für die Grenzen dieses Wandels im Fall der Menschen mit komplexen Beeinträchtigungen. Für Menschen mit geistigen, körperlichen und psychischen Beeinträchtigungen setzte dieser Prozess zwar auch zwischen 1850 und 1870 ein, war aber deutlich eingeschränkter in Sachen Beschulung und viel länger ausschließlich von privaten und caritativen Bemühungen abhängig. 1874 bestanden 27 Anstalten für damals sogenannte ›Idioten‹ und ›Schwachsinnige‹ im damaligen Gebiet Deutschlands, diese Zahl wuchs auf 226 im Jahr 1910 an (Moser 1998, S. 76). Trotz der geltenden allgemeinen Schulpflicht waren
»schwerere Körperbehinderungen sowie geistige Behinderungen [...] das Merkmal für Ausschluss aus dem allgemeinen Bildungsbereich [...]. Diese Menschen wurden in gesonderten Anstalten untergebracht, die durch das Merkmal der Fürsorge, aber auch der Verwahrung gekennzeichnet sind« (Moser 1998, S.7).
Im Schulsystem kommt es ab 1880 zu einer Differenzierung von Regel- und Sonderschule, es entstehen ›Hilfsschulen‹ für lernschwache (aber ›schulbildungsfähige‹) Schüler:innen und weitere Sonderschulen (im Bereich Sprache, Sehbeeinträchtigung, Schwerhörigkeit), die Professionalisierung der Sonderschullehrerausbildung schreitet voran. Alle »weiteren sonderpädagogischen Tätigkeiten [...] [waren] ausnahmslos dem Bereich der Fürsorge und damit dem Bereich der Erziehung, des Privaten, zugeordnet« (a. a. O., S.7) und somit nicht im Fokus der öffentlichen Bildung.
In den Anstalten für blinde und taube Menschen gab es jedoch beides unter einem Dach: den Internats- bzw. Wohnbereich als das ›private‹, erzieherische Moment und die Schule als staatlich finanzierten, aber vom Regelschulsystem separierten Bereich, auf den häufig die Ausbildung und Beschäftigung in der ›eigenen Welt‹, z. B. in angegliederten Werkstätten, folgte. Bis weit in die 1990er Jahre hinein fanden Bildung und Erziehung vieler blinder und tauber Menschen von der Kindheit bis zum Übergang ins Erwachsenenalter wohnortfern in überregionalen Sondereinrichtungen statt. Für die geistig und körperlich beeinträchtigten Menschen bildeten sich eigene Anstalten in freier – überwiegend konfessioneller – Trägerschaft. Nur ein Teil dieser Anstalten hatte eigene Schulen für einen kleinen, für ›bildungsfähig‹ erklärten Personenkreis, aber weder die Finanzierung dieser Schulen noch die Ausbildung von Fachkräften wurden dafür staatlich getragen. In den sich ab 1900 stark ausbreitenden örtlichen Hilfsschulen – den späteren ›Lernbehindertenschulen‹ – wurde dann aber genau dieser Personenkreis wohnortnah unterrichtet. Entsprechend fürchteten bereits damals die Anstalten, ihre ›bildungsfähigen‹ Adressat:innen zu verlieren und zu ›Schwerstbehindertenzentren‹ zu werden.
Ab Ende des 19. Jahrhunderts wird die Anstaltsfürsorge zur staatlichen Aufgabe, aber als »geschlossene Armenfürsorge« (Bradl 1991a, S. 25). Moser (1998, S. 76) urteilt, dass damit
»für die anwachsende Zahl der Anstaltsklientel – trotz Formulierung von Erziehungsabsichten und teilweiser Einbindung von Schulen (zunächst vor allem konzipiert als Ausbildungs-Seminarschulen für künftige Anstaltslehrer) – die Pflegebedürftigkeit dieser Personengruppe (›Pfleglinge‹) herausgestellt und der Anspruch auf Bildung aufgrund der Anbindung an die Armenfürsorge unterschlagen [wurde]«.
Wenn Erziehung stattfand – »sofern nicht ohnehin Bewahrung und Pflege die Betreuungsarbeit in den Anstalten bestimmten«, war sie »entweder beschränkt auf die später an Bedeutung verlierenden Anstaltsschulen oder in ausgeprägt religiös-klösterlichem Gewand in Erscheinung getreten« (Bradl 1991a, 584, zit. nach Moser 1998, S. 76). Mit der Einteilung nach ›Bildungsfähigkeit‹, ›praktischer Brauchbarkeit‹ (Nützlichkeit als Arbeitskraft) und ›Unbrauchbarkeit‹ oder ›Unheilbarkeit‹ entstehen Kategorien, die im Nationalsozialismus zur Scheidemarke für das Lebensrecht werden:
»Wer ein ungeteiltes Recht auf Leben für alle Menschen, auch der Schwerstbehinderten, einfordert, bejaht ein Bildungsrecht für alle, das Erziehung und Bildung nicht von irgendwie definierten Voraussetzungen wie Sprachfähigkeit oder intellektuelle Mindestkompetenz oder dergleichen abhängig macht« (Antor & Bleidick 1995, S. 11).
Bis Ende der 1920er Jahre hatte sich ein öffentliches Schul-, Erziehungs- und soziales Hilfesystem samt zahlreichen Verbänden der freien Wohlfahrtspflege entwickelt. Für die kriegsgeschädigten Soldaten entstand die Idee der Rehabilitation: Sie sollten über die finanzielle Unterstützung hinaus Leistungen erhalten, die ihnen, wie vor dem Krieg, eine eigenständige Lebensführung ermöglichen. Hier übernahm der Staat die Verantwortung für die Finanzierung medizinischer und beruflicher Rehabilitationsleistungen, während alle anderen Menschen mit Behinderung im ›toten Winkel‹ der öffentlichen Wahrnehmung und staatlichen Verantwortung verblieben. Die Finanzierung der Anstalten erfolgte auch in der Weimarer Republik eingeschränkt im Rahmen der Armen- und Fürsorgegesetze.
Für eine umfassende Anerkennung von Bildungs- und Teilhaberechten waren somit eine ganze Reihe von Bedingungen nicht oder unzureichend erfüllt:
Folgt man Möckel (2007), dann ist die Grenze der Pädagogik in Sachen Bildungsfähigkeit, Bildungsrecht und Methodik für einzelne Gruppen zu wenig oder gar nicht verschoben worden. Die Bildungserfolge bei einzelnen Gruppen führten nicht zu einer Übertragung auf alle Menschen mit Behinderung. Fehlendes Wissen war eine wichtige Ursache, aber auch das defizitäre Menschenbild und Vorurteile angesichts schwerer Beeinträchtigungen (vgl. a. a. O.).
So wenig, wie die pädagogische Aufgabe erkannt wurde oder erkannt werden konnte, so wenig wurde die Notlage des Personenkreises und der Angehörigen als soziales und nicht nur als ein individuelles Problem gedeutet. Das hatte erhebliche Folgen für die Finanzierung der Anstalten und die Auffassung über Art und Ausmaß der Hilfen.
Auf der anderen Seite begünstigten die ›Privatheit‹ der Anstalten und die Dominanz von Erziehung und Pflege den Verbleib der Menschen im reinen Fürsorgesystem. Das wiederum hatte Folgen in Form einer anhaltend unzureichenden Professionalisierung und, so Moser (1998), einer nicht erfolgten wissenschaftlichen Grundlegung in diesem Bereich. Entsprechend konnten sich kaum Wirkungen entwickeln, die eine Grenzverschiebung begünstigt hätten. Und dort, wo ›Bildungsfähigkeit‹ zuerkannt wurde, war dies nicht verbunden mit umfassender Schulbildung. Ab- und Ausgrenzungen wurden somit in den Anstalten selbst grundlegend wirksam, wenn auch in unterschiedlichem Ausmaß.
Auch die Verbände boten kein einheitliches, klar auf Erziehung und Bildung gegründetes Bild. Eine eindeutige Interessensvertretung dem Staat gegenüber wurde dadurch verhindert. Die dem Staat abgerungene Finanzierung aus den Armen- und Fürsorgesetzen spiegelte im Grunde den Zweck vieler Anstalten wider, reduzierte sie aber gleichzeitig wieder darauf.
In den 1920er Jahren geriet angesichts der Kriegsfolgen, ökonomischen Krisen und einer stärker werden sozialdarwinistischen Diskussion, in der die verheerende Rede von ›lebensunwertem Leben‹ entstand (Brill 1994, Klee 1983), die öffentliche und freie Wohlfahrtspflege unter Druck. Auch unter den Anstaltsleitern, der Ärzte- und Lehrerschaft und in den Verbänden fanden sich Stimmen, die Maßnahmen wie die Zwangssterilisation oder gar die ›Euthanasie‹ befürworteten. Dass den Anstalten Methoden und Kenntnisse fehlten, ihre Bemühungen aus heutiger Sicht ›nur‹ caritativ waren und das Bild vom Menschen mit Behinderung auch innerhalb des Hilfesystems von Vorurteilen geprägt war, kann der damaligen Zeit nicht umstandslos zum Vorwurf gemacht werden. Die Katastrophe der Tötungsaktionen und Zwangssterilisation in der NS-Zeit ist keine direkte Folge davon, aber sie verweist auf bereits vorhandene Bruchstellen, die in ihrer Dramatik benannt werden müssen: Ohne Bildungsrecht kann auch das Recht auf Leben in Frage gestellt werden (Antor & Bleidick 1995). Die Folgen für das Bild von Menschen mit Behinderung waren auch nach 1945 tiefgreifend. Vorurteile und Einstellungen bis hin zur Befürwortung des ›Sterbenlassens‹ von schwer beeinträchtigten Neugeborenen nahmen in Deutschland erst ab ca. Mitte der 1980er Jahre deutlich ab (Cloerkes 2007). Die Verdrängung der Geschehnisse war gesellschaftlich, aber auch innerhalb der Einrichtungen, Sonderschulen, der Verbände und der Wissenschaft langdauernd und umfassend. Abgesehen von einzelnen Publikationen (wie die von Klee 1983 oder Wunder 1987) kam es erst nach 1990 zu einer breiten Aufarbeitung (z. B. für den Verband Deutscher Sonderschulen Ellger-Rüttgardt 1998).
1.1.2 Zwischen Umgestaltung und Beharrung: das Ausbleiben grundsätzlicher Reformen
Der Alltag war in vielen Einrichtungen nach 1945 bis in die 1970er Jahre von Missständen, was Standards der Unterbringung, Versorgung, Förderung betrifft, und auch von Gewalt geprägt. 1971 setzt die damalige Bundesregierung eine Sachverständigenkommission ein, die die Lage in den Psychiatrien untersuchen sollte (die sogenannte Psychiatrie-Enquête). Im Zwischenbericht (Deutscher Bundestag 1973) werden schwerwiegende Mängel konstatiert, zusammengefasst und bekannt geworden mit dem Satz »dass eine sehr große Anzahl psychisch Kranker und Behinderter in den stationären Einrichtungen unter elenden, z. T. als menschenunwürdig zu bezeichnenden Umständen« (a. a. O., S. 23) leben muss.
»Überalterung der Bausubstanz, katastrophale Überfüllung in gewissen Bereichen, Unterbringung in Schlafsälen, unzumutbare sanitäre Verhältnisse und allgemeine Lebensbedingungen, vor allem für chronisch Kranke, kennzeichnen einen gegenwärtigen Zustand, dessen Beseitigung nicht einfach auf unabsehbare Zeit verschoben werden kann« (a. a. O.).
Für den Landschaftsverband Rheinland werden exemplarisch Zahlen angegeben:
»In den sechs Rheinischen Landeskrankenhäusern Bedburg-Hau, Bonn, Düren, Düsseldorf, Langenfeld und Viersen stehen 22,3 % der Betten (3060) in Häusern, die vor der Jahrhundertwende, 49,9 % (5835) in Häusern, die zwischen 1900 und 1925, und 5,3 % (721) in Häusern, die zwischen 1926 und 1953 errichtet worden sind. Nur 22,5 % der Betten (3082) stehen in Neubauten aus der Zeit zwischen 1954 und 1969« (a. a. O.).
18 Häuser mit 1347 Betten wurden als abbruchreif bezeichnet, im Durchschnitt waren ca. 35 % der Landeskrankenhäuser überbelegt (a. a. O., S. 24), in vielen Schlafsälen standen mehr als 5 Betten, viele Patient:innen hatten noch nicht einmal einen Schrankraum (a. a. O., S. 35). Die Sachverständigen-Kommission kommt zum Schluss, dass unverzüglich Reformen in den psychiatrischen Krankenhäusern umgesetzt werden müssen, die mit dem Modellprogramm Psychiatrie der Bundesregierung ab 1975 eingeleitet werden.
Der Auftrag der Kommission beschränkte sich weitgehend auf die psychiatrische und psychotherapeutische Versorgung, die Situation der Heime der Behindertenhilfe rückte nur rudimentär in den Blick und weitreichende Reformen blieben aus. 1973 lebten nach Angaben der Bundesvereinigung Lebenshilfe (1975) 52.000 Menschen mit geistiger Beeinträchtigung in den evangelischen und katholischen Anstalten des damaligen Westdeutschlands. Daneben lebten 1200 Menschen in den 50 gemeindenahen Wohnstätten der Lebenshilfe. Mit ihren i. d. R. 24 Plätzen boten sie im Vergleich zu den Anstalten völlig neue und ›normalisierte‹ Wohnbedingungen. Aber selbst zu dieser Zeit erfolgte weiter ein Ausbau und Neubau von Großeinrichtungen, im Anschluss an das traditionelle Beschützungs- und Separierungskonzept als »beschützende Lebensräume« oder »therapeutische Wohnsiedlungen« [...] gedacht« (Bundesvereinigung Lebenshilfe 1975, S. 71), vergleichbare Anstrengungen für dezentrale Wohnstätten seien nicht erkennbar (a. a. O.).
Die Aufarbeitung der jüngeren Geschichte einschließlich der Anerkennung der Opfer von Gewalt in Heimen der Behindertenhilfe hat erst jetzt breiter eingesetzt. Einblicke in den Alltag in diesen Einrichtungen bis weit in die 1970er Jahre bietet u. a. das »Dokumentationsprojekt Zwangsunterbringung« und das Projekt »Heimkindheiten« des Landesarchives Baden-Württemberg (2022a und b). Die Kultusministerkonferenz befasste sich überhaupt erst 1960 mit dem Sonderschulwesen und konstatierte in dem damaligen Gutachten zwar: »Das deutsche Volk hat gegenüber den Menschen, die durch Leiden und Gebrechen benachteiligt sind, eine geschichtliche Schuld abzutragen. Sie dürfen nicht als weniger wertvoll betrachtet werden« (Bleidick 1998, S. 98). Aber in demselben Gutachten wurden für Schüler:innen mit sogenannter geringer Erziehbarkeit und Bildbarkeit sowie mit Pflegebedarf keine Schulen vorgesehen, man sprach lediglich von heilpädagogischen Lebenskreisen (a. a. O., S. 106). Diese wiederum wurden als Tagesstätten aus der Not heraus – und weil eine Anstaltsunterbringung ihrer Kinder für sie nicht in Frage kam – von den ab Ende der 1950er Jahre entstandenen Elternvereinen aufgebaut und i. d. R. selbst getragen (!). Die flächendeckende Umsetzung der Beschulung auch der geistig, schwer körperlich beeinträchtigten und erheblich ›verhaltensauffälligen‹ Kinder erfolgte erst ab den späten 1960er und frühen 1970er Jahren.
Mit Inkrafttreten des Bundessozialhilfegesetzes (BSHG) 1961 wurde anerkannt, dass erschwerte Lebenssituationen nicht nur individuelles Schicksal, sondern auch sozial bedingt sind. Auch Behinderung galt nun als eine solche ›besondere Lebenslage‹ im Sinn erschwerter Teilhabe. Damit verbunden war erstmals ein Recht auf soziale Leistungen für alle Menschen mit Behinderung, unabhängig von ihrer Ursache. Dennoch waren auch hier Kriterien dafür leitend, wer oder was als ›eingliederungsfähig‹ und damit als leistungsberechtigt galt, orientiert an Auffassungen über Selbstständigkeit, Leistungsfähigkeit, ›normales Verhalten‹. Der Besuch einer Werkstatt für Menschen mit Behinderung (WfbM) knüpft sich bis heute daran, dass ein Mindestmaß an wirtschaftlich verwertbarer Arbeitskraft erbracht werden muss und weder ein ›außerordentlicher Pflegebedarf‹ noch eine ›Fremd- oder Eigengefährdung‹ vorliegt (§ 219, (2) Sozialgesetzbuch IX, Bundesamt für Justiz o. J.). Somit lassen sich für ganze Generationen nach dem Krieg geborener Menschen mit Behinderung erhebliche Verluste an Lebenschancen konstatieren. Noch in den 1980er Jahren kam es im Verband Deutscher Sonderschulen (VDS, heute Verband Sonderpädagogik) zu Auseinandersetzungen über die Frage des Bildungsrechts der damals sogenannten schwerbehinderten Kinder (Stinkes 1998).
Die Entwicklung des Unterstützungssystems erfolgte nach 1945 äußerst zögerlich und entlang den vor 1933 entstandenen Strukturen. Gesetzesreformen der 1970er Jahre, u. a. die Verabschiedung des Schwerbehindertenrechts 1974, führten dann zu einem Ausbau der Leistungen, angefangen von der Frühförderung bis zur beruflichen Rehabilitation und den Werkstätten für Menschen mit Behinderung. Dieser Ausbau erfolgte allerdings in Form eines reinen Sondersystems, das die tradierten Strukturen der Großeinrichtungen gerade für die komplex beeinträchtigten Menschen nicht in Frage stellte. Aber nun zog dieses System erstmals breitere Kritik auf sich. Ab den 1970er Jahren bilden sich neben den Kriegsopfer- und Elternverbänden neue Formen von Zusammenschlüssen, die Selbsthilfe und Interessenvertretung zu einer Angelegenheit der Menschen mit Behinderung machten (Radtke 1990). Mit den Elternverbänden teilten sie die Ablehnung der großen Einrichtungen und die Forderung nach ambulanten Hilfen, aber es ging ihnen um mehr. Die ›Clubs Behinderter und ihrer Freunde‹ (CeBeeF-Bewegung, a. a. O., S. 258) forderten ein partnerschaftliches Miteinander und gesellschaftliche Integration, die sogenannte ›Krüppelbewegung‹ wandte sich gegen gesellschaftliche Verhältnisse, die Behinderung überhaupt erst schaffen. Auf dem ›Krüppeltribunal‹ 1981 wurden Menschenrechtsverletzungen angeklagt und in der Folge neue Formen selbstbestimmter Hilfen wie die Peer-Beratung und die Assistenzgenossenschaften (a. a. O.) entwickelt. Daneben entstanden erste Modelle ›ambulanten‹ Wohnens, darunter einige wenige auch für Menschen mit schweren körperlichen oder geistigen Beeinträchtigungen (beispielhaft: Verein zur Förderung der Integration Behinderter 2002), und maßgeblich von Elterninitiativen getragene Modelle integrativer Beschulung.
Das international wichtigste Reformkonzept dieser Zeit, das aus Skandinavien stammende Normalisierungsprinzip, entfaltete in vielen europäischen und englischsprachigen Ländern ab Ende der 1950er Jahre Wirkung, aber nur dort, wo es mit gesetzlichen Reformen verbunden war, kam es zu größeren Veränderungen. ›Ein Leben so normal wie möglich zu führen‹ meint primär die Verbesserung der Lebensbedingungen und die Veränderung des Unterstützungssystems (vgl. Franz & Beck 2022), im Fokus stehen individuelle Bedürfnisse, Respekt, Würde und gleiche Rechte sowie die »Abkehr von defizitorientierten, segregierten Versorgungsstrukturen« (Beck & Greving 2012, S. 180). Mit dem Begriff Enthospitalisierung ist in diesem Zusammenhang die Auflösung krankenhausähnlicher Langzeitunterbringung in Psychiatrien ohne jegliche pädagogische Perspektive gemeint, entsprechende Ansätze wurden in Deutschland insbesondere ab den 1980er Jahren umgesetzt. Ansätze der Deinstitutionalisierung zielen hingegen auf die Auflösung oder umfassende Reform aller Einrichtungen, die die Lebensführung von Menschen ihren institutionellen Regeln und Zwängen unterordnen (vgl. Franz 2014 für einen Überblick und eine Analyse dieser Ansätze in Deutschland). Mit diesen Entwicklungen konnten die Grenzen der ›Eingliederungs‹- und der ›Bildungsfähigkeit‹ zwar verschoben, aber nicht endgültig beseitigt werden. Umfassende sozialgesetzliche und bildungspolitische Reformen blieben ebenso aus wie umfassende innere Reformen durch die Einrichtungen selbst. Letztlich geht es hier um fortdauernde Exklusionsrisiken und der Begriff »Schwerstbehindertenzentren« kann als eine besonders drastische Formel dafür bezeichnet werden. Als Negativszenario weist er auf die Gefahr der Bildung von ›Restgruppen‹ hin, von einem ›harten Kern‹, der sich nur schwer ›inkludieren‹ lässt. Solche Begriffe diskreditieren aber die Menschen, um die es dabei geht, und der Blick in die Geschichte hat verdeutlicht, dass es dabei nicht nur um eine spezifische Gruppe, sondern Menschen mit ganz unterschiedlichen Beeinträchtigungen geht.
1.2 Komplexe Beeinträchtigung und Behinderung – Annäherung an eine Begriffsbestimmung für hochgradig eingeschränkte Möglichkeiten einer gleichberechtigten Lebensführung
1.2.1 Behinderung – ein multifaktorielles Wechselspiel zwischen Menschen und ihrer Umwelt
Das gesellschaftliche Bild von Behinderung hat sich verändert, dennoch können sich damit nach wie vor bestimmte Vorstellungen (»Rollifahrer:in«) und feste Eigenschaftszuschreibungen (»Menschen mit XY sind immer fröhlich«) verbinden. Die Rede von ›den‹ Menschen mit Behinderung begünstigt Verallgemeinerungen und die Vorstellung, die Behinderung liege ›im Menschen‹. Demgegenüber stellte bereits 1972 der Soziologe Christian von Ferber heraus, dass die
»Rede vom behinderten Menschen [...] eine spezifische Situation [meint], in der diese Menschen zur Gesellschaft stehen und die die amtliche Zählung und die medizinische Rubrizierung nur sehr unzureichend beschreiben und zum Ausdruck bringen. Die Kategorie der Behinderung stellt auf die gesellschaftliche Teilhabe dieser Menschen ab« (a. a. O., S. 31).
Damit werden zwei wichtige Dinge zu einem Zeitpunkt festgestellt, als noch ein stark auf die ›Schädigung‹, defizitorientiertes Bild vorherrschend ist:
Behinderung wird erstens als soziale Situation gesehen, als »Beschränkung in der Entfaltung eines [...] breiten Fächers von Sozialbeziehungen« (a. a. O., S. 32). »Die wissenschaftliche Beschäftigung mit dem Problem der Behinderung zeichnet je länger desto deutlicher seine gesellschaftliche Bedingtheit« (a. a. O., S. 34).
Aus der gesellschaftlichen (Mit-)Verursachung der Lage resultieren zweitens auch eine gesellschaftliche Verantwortung und damit ein Anspruch auf soziale Leistungen, unabhängig von Art, Ursache oder Ausmaß der Behinderung.
Christian von Ferber hat aus soziologischer Sicht die Lage von Menschen mit Behinderung als »Minderheitenproblem eigener Art« (von Ferber 1972, S. 31) bezeichnet und damit die Verbindung zu anderen, ebenfalls benachteiligten Gruppen hergestellt, ohne die Lage behinderter Menschen damit gleichzusetzen. Vielmehr ist genaueres Wissen erforderlich, wie es zu Beschränkungen und Benachteiligungen in der Lebensführung kommt, welche Faktoren daran beteiligt sind und welche Folgen sich für die Lebensführung entwickeln. Von Ferber ging es darum, sich »nicht länger an einer einfach strukturierten biologischen Determination« (a. a. O., S. 35) zu orientieren, sondern in »komplexen [...] multifaktoriellen Bedingungsreihen« (a. a. O.) zu denken, an deren Erforschung »biologische, psychologische und soziologische Denkmodelle Anteil haben« (a. a. O.).
Dieses Verständnis hat spätestens mit der Internationalen Klassifikation von Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit (International Classification of Functioning, abgekürzt ICF) der Weltgesundheitsorganisation (WHO 2001) Anerkennung gefunden. Die ICF dient zur Betrachtung der Folgen von gesundheitlichen Einschränkungen, der Gesundheitsbegriff umfasst aber weitaus mehr als die Abwesenheit von Krankheit: Ein Mensch gilt als funktional gesund, wenn seine körperlichen (gemeint sind damit auch die sinnesbezogenen, geistigen und psychischen) Funktionen und Strukturen als ›normal‹ gelten, er Aktivitäten des täglichen Lebens ausführen und sein Dasein in allen ihm wichtigen Lebensbereichen »in der Weise und dem Umfang entfalten kann, wie es von einem Menschen ohne Beeinträchtigung der Körperfunktionen oder -strukturen oder der Aktivitäten erwartet wird« (Partizipation) (Schuntermann 2011, S. 251). In die Betrachtung von Behinderung fließen biologische, psychologische und soziale Faktoren ein, der ICF unterliegt also ein mehrdimensionales Behinderungsverständnis. Dabei wird die Relativität und Prozesshaftigkeit von Behinderung hervorgehoben: der
»Zustand der funktionalen Gesundheit einer Person [wird] als das Ergebnis der Wechselwirkung zwischen der Person mit einem Gesundheitsproblem [...] und ihren Kontextfaktoren (bio-psycho-soziales Modell der ICF) aufgefasst. Ist das Ergebnis dieser Wechselwirkung negativ, liegt eine Beeinträchtigung der funktionalen Gesundheit (kurz: funktionale Problematik) der Person vor. Jede funktionale Problematik wird in der ICF Behinderung genannt« (a. a. O., S. 251 – 252).
Kontextfaktoren können sich positiv oder als Barrieren auswirken. Eine Schädigung oder Störung von körperlichen Funktionen oder Strukturen (beispielsweise des Sehnervs) kann in Abhängigkeit des Vorhandenseins oder des Zugangs zu Therapien, Hilfsmittel oder Förderung zu mehr oder weniger Beeinträchtigung (beispielsweise des Sehens) führen. Eine Beeinträchtigung kann in Wechselwirkung mit Barrieren zu Aktivitäts- und Partizipationseinschränkungen führen, Förderfaktoren können bestimmte Folgen abpuffern oder verhindern. Umgekehrt können sich Aktivitäts- und Partizipationseinschränkungen wieder auf körperliche Funktionen auswirken, Wechselwirkungen und Folgen sind in jede Richtung denkbar. Die ICF dient nicht dazu, Menschen einen Status als behindert zuzuweisen, wie das im Sozialrecht der Fall ist, sondern bio-psycho-soziale Aspekte von Krankheitsfolgen umfassend zu beschreiben, es geht also um behindernde Bedingungen und Situationen. Demzufolge kann es auch keine Einteilung von Menschen in Gruppen auf der Basis von ›Behinderungsarten‹ oder einem global bestimmten ›Hilfebedarf‹ geben, wie z. B. ›geistig behindert‹ oder ›Hilfebedarfsgruppe IV‹. Vielmehr geht es um Menschen mit (unterschiedlichen) funktionalen Einschränkungen (wie z. B. Beeinträchtigungen des Sehens oder der Bewegung), deren Aktivitäten (wie z. B. Lesen) und Partizipation durch Barrieren behindert wird. Die ICF ist kein Modell im wissenschaftlichen Sinn, da sie wenig theoretisch begründet ist, und kein Diagnose- oder Assessment-Instrument, sondern stellt eine gemeinsame Sprache zur internationalen und interdisziplinären Verständigung sowie eine Systematik zur umfassenden Beschreibung von Krankheitsfolgen bereit. Allerdings unterliegt ihr ein unhinterfragtes Normalitätsverständnis, das nicht unkritisch übernommen und als Messlatte der ›Leistungsfähigkeit‹ an Menschen mit Behinderung angelegt werden sollte. Unklar bleibt letztlich auch, was eine gelingende Partizipation und gleichberechtigte individuelle Lebensführung ausmacht. Das Verständnis von Partizipation beschränkt sich auf die Teilhabe an Lebensbereichen, ohne diese zu begründen oder Art und Form der Beteiligung zu beschreiben.
1.2.2 Behinderung und Beeinträchtigung in der UN-BRK, im Sozialrecht und der Sozialberichterstattung
Das Behinderungsverständnis der ICF ist sehr weit gefasst, jede Einschränkung der Aktivitäten und Partizipation, unabhängig von Dauer und Ausmaß, gilt als Situation der Behinderung. Das unterscheidet diese Definition von amtlichen Behinderungsdefinitionen, anhand derer Rechtsansprüche festgestellt und Abgrenzungen vorgenommen werden. Der Denkansatz der ICF ist aber wesentlich in die Behinderungsdefinition der UN-BRK eingeflossen:
»Zu den Menschen mit Behinderungen zählen Menschen, die langfristige körperliche, seelische, geistige oder Sinnesbeeinträchtigungen haben, welche sie in Wechselwirkung mit verschiedenen Barrieren an der vollen, wirksamen und gleichberechtigten Teilhabe an der Gesellschaft hindern können« (Art. 1 Satz 2, Beauftragter 2018, S. 8).
Die Neubestimmung des Behinderungsbegriffs im Sozialgesetzbuch (SGB) IX durch das Bundesteilhabegesetz 2018 wiederum ist nahezu identisch mit dem Behinderungsverständnis der UN-BRK, folgt also auch der ICF, und hebt ebenfalls auf die Einschränkung der gleichberechtigten Teilhabe durch Barrieren ab, die hier als einstellungs- oder umweltbedingt konkretisiert werden. Der Begriff der Beeinträchtigung wird im SGB IX als eine Abweichung des Körper- und Gesundheitszustandes »von dem für das Lebensalter typischen Zustand« bestimmt. Damit stellt sich wie in der ICF die Frage, welche Normen dem ›typischen Zustand‹ unterliegen. Die Unterteilung der Beeinträchtigungen wie in der UN-BRK lässt auf den ersten Blick ihre Gleichsetzung mit der Ebene der Schädigung vermuten, gemeint sind aber die Folgen im Sinne länger andauernder funktionaler Einschränkungen (z. B. des Sehens oder Bewegens usw.); im SGB IX ist eine Dauer von länger als sechs Monate festgelegt. Ist das der Fall, kann die amtliche Anerkennung einer Behinderung beantragt werden. Dann wird orientiert an der ICF die Teilhabe-Erschwerung in Lebensbereichen festgestellt und im Grad der Behinderung (GdB) ausgedrückt (BMAS 2021, S. 23). Dass man ab einem GdB von mehr als 50 immer noch als ›schwerbehindert‹ mit Anspruch auf den ›Schwerbehindertenausweis‹ gilt, schafft zwei ›Sorten‹ von Behinderung, was der ICF und dem relationalen Gedanken widerspricht. Tatsächlich fungiert der GdB 50 als Schwelle für den Anspruch auf gesetzliche Nachteilsausgleiche; ab einem GdB von 30 kann eine Gleichstellung beantragt werden, das geschieht vor allem dann, wenn sonst die Teilhabe am Arbeitsleben gefährdet ist.
Viele Studien zur Lage von Menschen mit Behinderung beruhten lange Zeit einzig auf der amtlichen Schwerbehindertenstatistik und Menschen, die den ›Ausweis‹ aus unterschiedlichen Gründen nicht beantragen oder erhalten, aber ebenfalls als behindert gelten können, fielen entsprechend heraus. Um ein Gesamtbild der Anzahl und Lage von Menschen mit Behinderung zu ermöglichen, wurde mit dem ersten Teilhabebericht der Bundesregierung (BMAS 2013) ein neuer Weg beschritten. Als Element der Sozialberichterstattung der Bundesregierung wird er in jeder Legislaturperiode erstellt und informiert über den Stand und die Entwicklung der Teilhabe von Menschen mit Beeinträchtigungen im Vergleich zu Menschen ohne Beeinträchtigungen. Menschen mit Beeinträchtigungen meint hier alle Personen mit einer eingeschränkten Leistungsfähigkeit bei Aktivitäten im Zusammenhang mit Schädigungen oder Störungen körperlicher Funktionen oder Strukturen (BMAS 2021, S. 21). Sie gelten als behindert, wenn ihre Beeinträchtigungen »so mit Barrieren in ihrer räumlichen und gesellschaftlichen Umwelt zusammen [wirken]«, dass sie »dadurch nicht gleichberechtigt mit Menschen ohne Beeinträchtigungen an einzelnen Lebensbereichen teilhaben können« (a. a. O.). Auf dieser Basis werden im Teilhabe-Bericht neben der Schwerbehindertenstatistik auch Daten des Sozio-Ökonomischen Panels einbezogen, in den unabhängig vom Schwerbehindertenstatus nach längerfristigen Aktivitätseinschränkungen und Teilhabe-Behinderungen gefragt wird.
Eine erhebliche Weiterentwicklung erfuhr die Sozialberichterstattung der Bundesregierung durch die Teilhabe-Befragung (BMAS 2022), deren Behinderungsverständnis vollständig der ICF folgt. Erstmals wurde in Deutschland eine Repräsentativ-Untersuchung von Menschen, die in Privathaushalten und in Wohn- und Pflegeangeboten leben, zu selbsteingeschätzter Beeinträchtigung und Behinderung durchgeführt. Funktionale Beeinträchtigungen werden hier nicht mehr, wie in der ICF oder im SGB IX, in Anlehnung an die früheren ›Behinderungsarten‹ (körperlich, geistig, psychisch, sinnesbezogen) unterteilt, sondern nach Funktionen wie Sehen, Hören, Sprechen, Bewegen, Lernen, Denken, Erinnern oder Orientieren, zusätzlich wurde nach Beeinträchtigungen durch chronische Erkrankungen und Schmerzen gefragt (BMAS 2022, S. 29). Die Befragten konnten angeben, ob sie eine oder mehrere Beeinträchtigungen haben, als wie stark sie sie jeweils empfinden und wie sehr sie die Beeinträchtigung jeweils im Alltag einschränkt:
»jeder Mensch ist Teil der sozialen Umwelt und muss sich mit dieser tagtäglich auseinandersetzen. Dies gilt ganz unabhängig von sozialen Merkmalen, die im jeweiligen Leben eine Rolle spielen. Insofern bündeln sich in der individuellen Alltagsbewältigung, wenn auch für jeden Menschen verschieden, doch immer jene bedeutungsvollen Zugänge oder Eingrenzungen, Chancen oder Hürden, Freiräume oder Barrieren, denen sich ein Mensch gegenübersieht und die aus seiner Lebensumgebung ableitbar sind« (a. a. O., S. 30).
Aktivitäts- und Partizipationserschwernisse spiegeln sich somit in Angaben dazu wider, was den Alltag »etwas, ziemlich oder stark einschränkt« (BMAS 2022, S. 31). Dafür »werden die beiden Angaben zur Stärke der individuellen Beeinträchtigung und zur Einschränkung im Alltag miteinander verknüpft« (a. a. O., S.31). Begriffe wie ›schwer‹-, ›schwerst‹- oder ›mehrfachbehindert‹ werden auf diese Weise ebenso überwunden wie die Einteilung von Menschen nach ›Behinderungsarten‹ und es ist eine viel genauere Differenzierung zwischen Funktionseinschränkungen, deren Zahl und jeweiliger Stärke und ihrer Auswirkung im Alltag (Behinderung) möglich. Menschen können eine oder mehrere Beeinträchtigungen haben, die ganz unterschiedlich zusammenwirken und je spezifische Einschränkungen mit sich bringen können. So kann eine Beeinträchtigung gering, aber die Alltagseinschränkung stark sein und damit eine Behinderung vorliegen und umgekehrt eine als stark empfundene Beeinträchtigung zu keinerlei Einschränkungen führen, solange sich keine Barrieren auftun. Menschen mit Beeinträchtigungen und subjektiv empfundenen Alltagseinschränkungen sind also immer auch behindert. Auf dieser Basis wird in der Teilhabe-Befragung zwischen Menschen ohne und mit Beeinträchtigung und Menschen (mit Beeinträchtigung) und Behinderung unterschieden.
1.2.3 Schwere und Komplexität von Behinderung und Beeinträchtigung im Fachdiskurs
Ansätze relationaler Verständnisweisen von ›schwerster‹ Behinderung als Gegenmodell zu ›naturalistischen Dogmen‹ (Feuser 2009)
Während in der Teilhabe-Befragung und im Teilhabebericht im konkreten Fall von Menschen mit Beeinträchtigungen, z. B. des Sehens und, sofern sie Teilhabeeinschränkungen erfahren, generell von Behinderung gesprochen wird, gibt es in der Pädagogik bei Behinderung nach wie vor eine Auseinandersetzung um Begriffe, die die Situation von Menschen hervorheben, deren Teilhabe in besonders hohem Maß erschwert ist. Gemeint sind damit erhebliche Zugangsbeschränkungen zu Angeboten der Erziehung, Bildung, Förderung und Therapie, »Ausschlusskriterien für die Schwächsten unter den Menschen mit Behinderungen« (Fornefeld 2019, S. 50), Menschen, »die ›man nicht sieht‹, nicht einmal mehr im Versorgungssystem« (a. a. O.). Darin liegt das Gemeinsame dieses sehr heterogenen Personenkreises. Würde diese Problematik nicht bestehen, wäre diese Auseinandersetzung, die auf eine ›Sichtbarmachung‹ zielt, nicht erforderlich. Weil im IMPAK-Projekt diese Menschen im Mittelpunkt stehen, müssen Verständnisweisen dessen, was mit der Schwere oder Komplexität gemeint ist, freigelegt werden, ohne damit vorwegzunehmen, was sich empirisch wie und wem als ›schwerste‹ oder ›komplexe‹ Beeinträchtigung zeigt.
1991 erschien als letzter von 12 Bänden des Handbuchs der Sonderpädagogik der Band »Pädagogik bei schwerster Behinderung« (Fröhlich 1991). Eine solche Pädagogik stehe noch in den Anfängen, so der Herausgeber Fröhlich (a. a. O., S. V). Tatsächlich liegen zu diesem Zeitpunkt bereits Publikationen und Konzeptionen vor, aber ohne, dass innerhalb der wissenschaftlichen Pädagogik bei Behinderung das Bildungsrecht bei ›schwerster‹ Behinderung durchgängig anerkannt war. Insofern setzt der Band hier ein Zeichen und deswegen spricht Fröhlich im Vorwort auch von »immensen Gefährdungen durch schwerste und bei schwerster Behinderung«. Er führt nicht nur die in den frühen 1990er Jahren wieder entflammten Diskussionen »um die Grenzen von Lebensfähigkeit und Lebensrecht« (a. a. O.) an, sondern sieht Gefährdungen auch in einer Pädagogik, der »systematische Lern- und Entwicklungsprozesse unmöglich erscheinen« (a. a. O.). Dagegen setzt er die Notwendigkeit interdisziplinärer Forschung und ganzheitlicher Entwicklungsförderung. In seinem grundlegenden Beitrag »Zum Begriff ›Schwerste Behinderung‹« greift Heinz Bach (1991, S. 3) »Einfälle, Vorstellungen, Handlungsimpulse« in kritischer Absicht auf, die Begriffe wie schwerste (auch: schwerstmehrfache) Behinderung damals aus Sicht unterschiedlicher Disziplinen in Theorie und Praxis auslösten und es bis heute teilweise noch tun: Medizinisch gehe es um die besonders hohe oder große Schädigung mit der Folge der Postulierung von ›Unbehandelbarkeit‹ und ›Dauerbewahrungsbedarf‹, psychologisch gesehen um eine »extrem altersabweichende Entwicklungsstufe«, pädagogisch gesehen löse der Begriff »Unerziehbarkeit« aus (a. a. O., S. 4). Feuser (2009) hat solche Vorstellungen der »Unerziehbarkeit, Unverständlichkeit und Bildungsunfähigkeit« und damit verbundene Handlungspraktiken treffend als »naturalistische Dogmen« bezeichnet. Ihnen hatte er 1989 mit seiner Konzeption einer entwicklungslogischen Didaktik ein anderes Bild entgegensetzt. Auch Bach (1991) verweist auf damals vorliegende Konzepte einer vertieften Pädagogik, die das »subjektive Erleben der eigenen Extremsituation – einschließlich vorhandener physischer Einschränkungen, Belastungen und Schmerzen« anspricht (a. a. O., S. 4). Erforderlich sei aber auch die soziologische Perspektive, was den Zusammenhang zum Umfeld und hier besonders belastende und ausgrenzende Reaktionen betrifft.
Begriffe wie schwerst- oder mehrfachbehindert haben in der Folge Kritik auf sich gezogen, weil sie oft nicht die psychosoziale Dimension mehrfacher Benachteiligungen oder besonders hoher Isolierung gemeint haben. Eher stellen sie »Superlative einer negativen Abweichung von der üblichen erwarteten Leistungsfähigkeit« (Beck 1998, S. 273) dar, die in sich schon »Momente der Resignation und des Pessimismus« transportieren (a. a. O.). Die Gefährdung liegt entsprechend bereits in solchen Konnotationen, hinter denen Möglichkeiten von Selbstbestimmung und eigener, sinnerfüllter Lebensführung zurücktreten. Von der Praxis her betrachtet – gerade im Bereich der schulischen Förderung und des Wohnens mit Assistenz – können die Bezeichnungen als institutionelle Sammelbegriffe für Bedarfslagen angesehen werden, die sich ›querstellen‹ zu einer Gliederung nach abgegrenzten und spezialisierten ›Behinderungsarten‹, aus einem solchen System ›herausfallen‹ oder es vor ›besondere Herausforderungen‹ stellen. Exemplarisch konnte man dies im § 15 der Verordnung über die sonderpädagogische Förderung (Ausbildungsordnung sonderpädagogische Förderung – AO-SF) des Landes Nordrhein-Westfalen von 2005 noch folgendermaßen lesen:
»Als schwerstbehindert gelten Schüler und Schülerinnen, deren geistige Behinderung, Körperbehinderung oder Erziehungsschwierigkeit erheblich über die üblichen Erscheinungsformen hinausgeht oder bei denen zwei oder mehr der Behinderungen Blindheit, Gehörlosigkeit, anhaltend hochgradige Erziehungsschwierigkeit, geistige Behinderung und hochgradige Körperbehinderung vorliegen« (Hervorhebungen d. A.).
Obwohl diese Verordnung mittlerweile aufgehoben ist, findet man diese Bezeichnungen nach wie vor auf Homepages einzelner Förderschulen. Auch Wohnangebote tragen Bezeichnungen wie ›Wohnpflegeheim für Schwerst- und Mehrfachbehinderte‹ (vgl. ▸ Kap. 3.2.1).
Menschen seien nie zu jeder Zeit behindert, »angesichts jeder Aufgabe, wie behaftet mit einer Eigenschaft«, so Bach (1991, S. 5). Behinderung sei vielmehr »eine Relation zwischen einer psycho-physischen Disposition und einer Anforderung unter bestimmten Bedingungen, zwischen den Komponenten
der Erlebens- und Verhaltensdisposition, die eine Schädigung aufweist,
einer Erwartung, die nicht erfüllt werden kann und eine Belastung darstellt, und
Bedingungen, die u. U. als Benachteiligungen die Diskrepanz vergrößern« (a. a. O., Hervorhebungen im Orig.).
Mit der Erlebens- und Verhaltensdisposition ist ein wechselseitiges Beziehungsgeflecht aus somatischen, emotionalen und kognitiven Aspekten gemeint, das sich als »psycho-physische Gewordenheit« (Bach 1991, S. 5) aus der ›Schädigung‹ und Umwelteinflüssen entwickelt. Erwartungen und Anforderungen, die nicht erfüllt werden, können sich als Belastungen auf den Menschen auswirken. Diese Diskrepanz kann sich dann durch nachteilige, erschwerende soziale oder strukturelle Bedingungen vergrößern. Bach sprach von einer komplexen Beeinträchtigung dieser Disposition und meinte damit, dass eine Schädigung sich so auswirken kann, dass nicht nur z. B. eine motorische Funktion und damit das Bewegungshandeln betroffen ist, sondern auch das emotionale Erleben oder die Kommunikation (Sprachhandeln). Die Komplexität ist entsprechend nicht additiv zu denken und sie resultiert auch nicht aus einer ganz bestimmten (z. B. kognitiven) oder mehreren Schädigungen, dagegen wendet sich Bach explizit. Jede Beeinträchtigung kann sich als ›schwerste‹ Behinderung auswirken und es kann »viele unterschiedliche Arten von schwerster Behinderung geben« (a. a. O., S. 7). Es sei grundsätzlich »nur begrenzt richtig und zumindest i. d. R. unzureichend, von dem ›Körperbehinderten‹, dem ›Geistigbehinderten‹ usw. zu sprechen – und dadurch die Aufmerksamkeit von vornherein weitgehend auf ein Problem und auf eine Aufgabenstellung zu beschränken« (Bach 1991, S. 7, Hervorhebungen im Orig.). Damit wird komplexe Beeinträchtigung zu einem »konstitutiven Merkmal« (Bach 1991, S.7) schwerster Behinderung (!) – keine Rede von ›schwerster Behinderung‹ ohne das Vorliegen komplexer Beeinträchtigung –, aber umgekehrt führt eben gerade nicht jede komplexe Beeinträchtigung auch zu einer schwersten Behinderung. Diese bezieht sich auf die Relation zwischen Menschen und ihrem Umfeld – nach Bach auf Anforderungen, Belastungen und Benachteiligung – und wird von hier aus inhaltlich bestimmt.





























