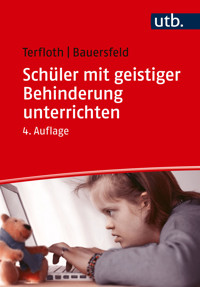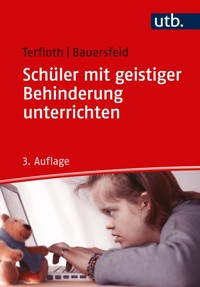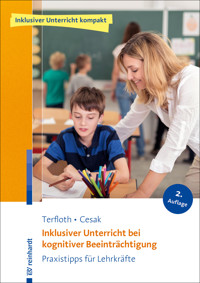
23,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ernst Reinhardt Verlag
- Kategorie: Bildung
- Sprache: Deutsch
Wie kann Inklusion von Schüler:innen mit kognitiver Beeinträchtigung gelingen? Lehrkräfte fühlen sich mit dieser Aufgabe oft allein gelassen. Genau dort setzt dieses Buch an. Neben Informationen zu kognitiver Beeinträchtigung und mögliche Konsequenzen für die Teilhabe am Unterricht bietet es wertvolle Unterstützung für die Unterrichtspraxis: didaktische Hinweise, Hilfen für die Differenzierung, Leistungsbewertung, Strukturierung von Lernhandlungen, Visualisierung etc. Beispiele und Praxismaterial erleichtern Lehrkräften ohne sonderpädagogische Vorkenntnisse den Einstieg in die Gestaltung von inklusivem Unterricht. Hilfreich sind auch die Hinweise zur Zusammenarbeit im Lehrkräfteteam, mit anderen Professionen und mit Erziehungsberechtigten. Die zweite Auflage ist durchgehend aktualisiert und enthält einige neue Praxismaterialien.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 81
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Inklusiver Unterricht kompakt
Karin Terfloth · Henrike Cesak
Inklusiver Unterricht bei kognitiver Beeinträchtigung
Praxistipps für Lehrkräfte
2., überarbeitete Auflage
Mit 11 Abbildungen und 11 Tabellen
Ernst Reinhardt Verlag München
Prof. Dr. Karin Terfloth, Heil- und Sonderpädagogin, lehrt Pädagogik bei schwerer geistiger und mehrfacher Behinderung und Inklusionspädagogik an der PH Heidelberg.
Dr. Henrike Cesak, Sonderpädagogin, arbeitet seit mehreren Jahren im inklusiven Unterricht und lehrte an der PH Heidelberg im Bereich Geistig- und Mehrfachbehindertenpädagogik.
Die erste Auflage erschien unter dem Titel „Schüler mit geistiger Behinderung im inklusiven Unterricht. Praxistipps für Lehrkräfte“.
Im Ernst Reinhardt Verlag ebenfalls erschienen:
Tilly Truckenbrodt /Annette Leonhardt:
Schüler mit Hörschädigung im inklusiven Unterricht. Praxistipps für Lehrkräfte
(3., überarb. Aufl. 2020; ISBN: 978-3-497-02939-6)
Petra Breuer-Küppers / Rüdiger Bach:
Schüler mit Lernbeeinträchtigung im inklusiven Unterricht. Praxistipps für Lehrkräfte
(2016, ISBN: 978-3-497-02636-4)
Karin Terfloth / Sören Bauersfeld:
Schüler mit geistiger Behinderung unterrichten. Didaktik für Förder- und Regelschule
(4., überarb. Aufl. 2024; UTB-M; ISBN: 978-3-8252-6337-9)
Hinweis
Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in diesem Werk berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnungen nicht zu der Annahme, dass solche Namen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei zu betrachten wären und daher von jedermann benutzt werden dürften.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über >http://dnb.d-nb.de< abrufbar.
ISBN 978-3-497-03286-0 (Print)
ISBN 978-3-497-61986-3 (PDF-E-Book)
ISBN 978-3-497-61987-0 (EPUB)
2., überarbeitete Auflage
© 2025 by Ernst Reinhardt, GmbH & Co KG, Verlag, München
Dieses Werk, einschließlich aller seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne schriftliche Zustimmung der Ernst Reinhardt GmbH & Co KG, München, unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen in andere Sprachen, Mikroverfilmungen und für die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen. Der Verlag Ernst Reinhardt GmbH & Co KG behält sich eine Nutzung seiner Inhalte für Text- und Data-Mining i.S.v. § 44b UrhG einschließlich Einspeisung/Nutzung in KI-Systemen ausdrücklich vor.
Dieses Werk kann Hinweise/Links zu externen Websites Dritter enthalten, auf deren Inhalt der Verlag keinen Einfluss hat und die der Haftung der jeweiligen Seitenanbieter oder -betreiber unterliegen. Ohne konkrete Hinweise auf eine Rechtsverletzung ist eine permanente inhaltliche Kontrolle der verlinkten Seiten nicht zumutbar. Sollten jedoch entsprechende Rechtsverletzungen bekannt werden, werden die betroffenen externen Links soweit möglich entfernt.
Printed in EU
Cover unter Verwendung eines Fotos von © contrastwerkstatt / Fotoliag (Agenturfoto. Mit Models gestellt)
Lektorat 1. Auflage: Susanne Sigmund, Berlin
Satz: JÖRG KALIES – Satz, Layout, Grafik & Druck, Unterumbach
Ernst Reinhardt GmbH & Co KG, Kemnatenstr. 46, D-80639 München
Net: www.reinhardt-verlag.de E-Mail: [email protected]
Inhalt
Vorwort
1Lernen mit einer kognitiven Beeinträchtigung
1.1Formen kognitiver Beeinträchtigung
1.1.1Schüler:innenschaft
1.1.2Ausgewählte Syndrome
1.1.3Komplexe Behinderung
1.1.4Förderbedarf geistige Entwicklung
1.2Mögliche Konsequenzen für die Aktivität und Teilhabe
1.2.1Aneignung
Zusatzinfo „Kognitive Entwicklung“
1.2.2Handlungskompetenz
Zusatzinfo „Exekutive Funktionen“
1.2.3Kommunikation
Zusatzinfo „Unterstützte Kommunikation“
1.2.4Kernkompetenzen Lesen, Schreiben und Rechnen
Schriftspracherwerb
Rechnen
Memo „Konsequenzen für die Unterrichtsplanung“
2Kooperation und Teamarbeit
2.1Zieldifferenter Unterricht
2.1.1Zielgleich / zieldifferent
2.1.2Bildungsanspruch und Lebensfelder
2.2Teamteaching
2.3Zusammenarbeit mit Erziehungsberechtigten
2.4Kooperationspartner:innen
Memo „Erfordernisse für den GU mit Schüler:innen mit und ohne SP GE“
3Unterrichtsgestaltung
3.1Didaktische Vorgehensweisen
3.1.1Aufbereitung von Bildungsinhalten
3.1.2Kompetenzen
Zusatzinfo „Kompetenzraster
3.1.3Leistungsbewertung
3.2Differenzierung
3.3Strukturierung
3.3.1Lernhandlungen strukturieren
3.3.2Visualisierung / Materialien strukturieren
Zusatzinfo „Leichte Sprache“
3.3.3Lernumgebung strukturieren
3.4Soziale Integration in der Klasse
Memo „Konsequenzen für die Unterrichtsplanung“
4Praxismaterial
Literatur
Glossar
Bildnachweis
Vorwort
Anwendung
Dieser Praxisband wurde für Lehrkräfte an allgemeinen Schulen entwickelt, die einen oder mehrere Schüler:innen mit kognitiver Beeinträchtigung unterrichten. Grundlagenwissen aus dem sonderpädagogischen Schwerpunkt Geistige Entwicklung wird mit Erfahrungen aus der Unterrichtspraxis verknüpft. Die Handreichung unterstützt die Vorbereitung und Durchführung eines zieldifferenten Unterrichts.
Inhalt
Aufbauend auf Erkenntnissen zum Thema kognitive Beeinträchtigung werden verschiedene Aneignungsmöglichkeiten von Bildungsinhalten beschrieben und Maßnahmen zur Unterstützung von Lernprozessen erläutert. Eine zentrale Rolle spielen dabei die gezielte Förderung der Handlungskompetenz sowie die Berücksichtigung individueller Kommunikationsmöglichkeiten. Um die Partizipation von Schüler:innen mit kognitiver Beeinträchtigung am inklusionsorientierten Unterricht durch Strukturierung und Differenzierung ermöglichen zu können, ist eine effektive Zusammenarbeit im (interdisziplinären) Team unerlässlich. Anregungen für die Gestaltung von Teamarbeit und zur Kooperation mit Erziehungsberechtigten werden skizziert. Das letzte Kapitel enthält exemplarisches Praxismaterial.
Hinweise
Zu Beginn jeden Kapitels wird auf die Lernbedürfnisse und -chancen im Kontext einer kognitiven Beeinträchtigung eingegangen. Konkrete Empfehlungen für den Unterricht sind grau hinterlegt. Die Randspalte dient der Orientierung mittels Symbolen (s. folgende Übersicht) oder Schlagworten. Begriffe, die durch eine Lupe und Kursivschrift hervorgehoben sind, werden im Glossar erläutert. Am Ende eines Kapitels befindet sich im Memo eine Zusammenfassung der zentralen Inhalte.
1Lernen mit einer kognitiven Beeinträchtigung
Im Schuljahr 2022/2023 wurden in Deutschland 595.700 Schüler:innen mit einem festgestellten sonderpädagogischen Förderbedarf unterrichtet. Davon sind ca. 18 % dem sonderpädagogischen Schwerpunkt Geistige Entwicklung (SP GE) zugeordnet (KMK 2024, XVI.). Im Schuljahr 2021/2022 wurden von den 103.007 Schüler:innen des Schwerpunktes 14.208 an allgemeinem Schulen unterrichtet (KMK 2022). Der Personenkreis lässt sich nicht mit rein medizinischen Erklärungsmustern beschreiben. Als charakteristisch gelten Einschränkungen in den adaptiven Kompetenzen, der Aneignung, Handlungskompetenz und Kommunikation. Diese können sich auf die Kompetenzen im Lesen, Schreiben und Rechnen auswirken.
1.1Formen kognitiver Beeinträchtigung
Die Schülerschaft im SP GE zeigt sich sehr heterogen im Spannungsfeld von einer komplexen Behinderung bis hin zu leichten Formen von Lernschwierigkeiten.
1.1.1Schüler:innenschaft
Definition
American Association on Intellectual and Developmental Disabilities (AAIDD) wird eine „intellectual disability“ als eine bedeutsame, im Kindesalter beginnende und dauerhafte Einschränkung der intellektuellen Funktionen definiert. Sie geht mit bedeutsamen Einschränkungen der adaptiven Kompetenzen einher, d. h. konzeptionellen, sozialen und praktischen Fähigkeiten zur Bewältigung der sozialen Anforderungen im Alltag (Schalock et al 2021).
Mehrperspektivität
Die „Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit (ICF)“ der Weltgesundheitsorganisation beschreibt den Gesundheitszustand und ggf. Behinderung und rückt von einer festlegenden Kategorisierung ab. Sie betrachtet den Zusammenhang zwischen den individuellen Merkmalen eines Menschen, der Unterstützung von Aktivitäten im Rahmen einer barrierefreien Umgebung sowie den Teilhabemöglichkeiten und Umweltfaktoren (Weltgesundheitsorganisation 2005). Zu den Komponenten zählen:
■die Körperstrukturen (anatomische Teile des Körpers wie Organe, Gliedmaßen und deren Bestandteile),
■die Körperfunktionen (physiologische Funktionen von Körpersystemen),
■die Aktivitäten (Durchführung einer Aufgabe oder Handlung, z. B. im Bereich Lernen, Mobilität etc.) sowie
■die Partizipation bzw. Teilhabe einer Person (Einbezug in eine Lebensgemeinschaft).
Kontextfaktoren
Diese Bereiche stehen in einem Wirkungszusammenhang mit den Kontextfaktoren, die wiederum unterteilt werden:
■Als Umweltfaktoren gelten materielle, soziale und einstellungsbezogene Einflussgrößen auf die Lebenssituation der jeweiligen Person.
■Personenbezogene Faktoren sind Eigenschaften oder Attribute wie Alter, Geschlecht, Bildung, Ausbildung, Erfahrung, Persönlichkeit und Charakter, Fitness etc.
In dem Modell in Abbildung 1 wird Behinderung sowohl durch die individuellen Voraussetzungen als auch durch die sozialen Gegebenheiten bedingt.
Abb. 1: ICF-Modell (Weltgesundheitsorganisation 2005, 23)
Eine kognitive Beeinträchtigung umfasst demnach nicht nur medizinisch feststellbare Defizite und eingeschränkte Aktivitätsmöglichkeiten, sondern ggf. auch fehlende technische oder personelle Kompensation durch die Umwelt und das Vorhandensein sozialer Barrieren zur Teilhabe. Im umfassenden Abstimmungsbedarf zwischen individuellen Faktoren, Assistenz und Anpassung der Lernumgebung wird häufig eine Herausforderung im Kontext von kognitiver Beeinträchtigung gesehen.
Weiterführende Literatur
Weiterführende Informationen zur ICF: https://www.bfarm.de/DE/Kodiersysteme/Klassifikationen/ICF/_node.html, 19. 08. 2024
1.1.2Ausgewählte Syndrome
In Bezug auf die Körperstrukturen und -funktionen können typische Erscheinungsbilder unterschieden werden.
Liegen bei verschiedenen Personen bestimmte Auffälligkeiten in gleicher oder ähnlicher Weise vor und können diese auf eine gemeinsame Ursache zurückgeführt werden, so spricht man von einem Syndrom.
Ursachen
Die Ursachen, die zu einer kognitiven Beeinträchtigung führen können, werden drei verschiedenen Zeitabschnitten zugeordnet (Tab. 1).
Tab. 1: Ursachen kognitiver Beeinträchtigung (Kannewischer/Wagner 2012, 78 modifiziert durch die Autorinnen)
Zeitpunkt
Ursache
Vor der Geburt
■Genetik (z. B. Fehlbildungssyndrome oder Stoffwechselerkrankungen)
■Äußere Faktoren (z. B. Virusinfektionen, Alkohol, Drogen)
■Multifaktorielle Ursachen (Neuronalrohrdefekte)
■Unbekannte Ursache (40–50 %)
Während der Geburt
z. B. Hirnschaden durch Sauerstoffmangel oder Blutung
Nach der Geburt
z. B. Hirnhautentzündung, Trauma
genetische Disposition
Die Tatsache, dass bei mehr als der Hälfte der Schüler:innen mit dem SP GE ein chromosomal oder durch eine Stoffwechselstörung bedingtes Syndrom vorliegt (Kannewischer/Wagner 2012) spricht dafür, im Folgenden einen kurzen Überblick über einige der am häufigsten vorkommenden Syndrome zu geben (Tab. 2; Stöppler 2017).
Die Darstellungen in Tabelle 2 sind mit großer Vorsicht zu betrachten, weil sie immer nur eine Facette einer Persönlichkeit beschreiben. Was einen Menschen mit seinen individuellen Fähigkeiten und Interessen ausmacht, wird jedoch von unzähligen anderen Faktoren beeinflusst. In diesem Bewusstsein bietet das Wissen um Erscheinungsbilder dennoch die Chance, spezifische Bedürfnisse der Schüler:innen besser erkennen und berücksichtigen sowie realistische Zukunftsperspektiven entwickeln zu können (Sarimski 2019).
Tab. 2: Häufige auftretende genetisch verursachte Syndrome
Syndrom
Erläuterung
Trisomie 21
Chromosom 21dreifach vorhanden(veraltete BezeichnungDown-
Syndrom
)
Häufigkeit:
1: 600–800
Erscheinungsbild und Beeinträchtigung:
■schräg nach oben geneigte Lidspalten
■eine geringe Muskelspannung
■Neigung zu Seh- und Hörbeeinträchtigungen, Herzfehlern sowie zu Adipositas
■verzögerte Sprachentwicklung
Mögliche Besonderheiten im Unterricht:
■Erlernen von Schriftsprache möglich
■häufig hohe Sozialkompetenz
■ausgeprägte pragmatische Fähigkeiten
■Stärken im visuellen Bereich
■Musikalität
Fragiles-X-
Syndrom
Häufigkeit:
1: 3.000–4.000
Erscheinungsbild und Beeinträchtigung:
■längliches Gesicht, verhältnismäßig großer Kopf und große Ohren
■motorische Schwierigkeiten
■Aufmerksamkeits- und Kontaktstörungen
■sprachliche Auffälligkeiten
■Epilepsie
Fragiles-X-
Syndrom
Mögliche Besonderheiten im Unterricht:
■soziale Ängstlichkeit
■ausgeprägte Impulsivität
Williams-Beuren-
Syndrom
Häufigkeit:
1: 7.500–15.000
Erscheinungsbild und Beeinträchtigung:
■meist großer Mund mit vollen Lippen, kleines Kinn
■tiefe raue Stimme
■Probleme bei der Nahrungsaufnahme
■schwacher Muskeltonus
■meist freundliches, offenes Wesen
Mögliche Besonderheiten im Unterricht:
■Stärken im sprachlichen bzw. schriftsprachlichen und musikalischen Bereich
■Unterstützungsbedarf beim Überwinden von Ängsten, dem Aufrechterhalten der Aufmerksamkeit und im Umgang mit dem Geräuschpegel in der Klasse
äußere Einflüsse
Syndrome können nicht nur genetisch verursacht, sondern auch durch Stoffwechselstörungen oder äußere Einflüsse bedingt werden (Tab. 3; Stöppler 2017).
Tab. 3: Durch äußere Einflüsse verursachte Syndrome
Phenylketonurie1: 10.000
Fetales Alkoholsyndrom1: 300–1.000
Ursache