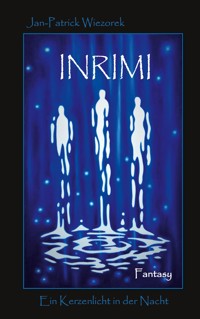
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: TWENTYSIX
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Inrimi Initius Perfektus
- Sprache: Deutsch
Fantasy mit Herz, Hirn, Humor und Härte Ein naiver Junge vom Lande, der in sich die Kräfte der alten Haranen hat; eine junge Frau, die ihr Gedächtnis verloren hat und dafür Freund und Feind findet; ein Spion, der aus der Kälte des Nordens kommt und mehr als Wärme im Süden findet. Sie alle führt ihr Weg durch eine Welt voller Tragik, Dramatik und bizarrem Humor. INRIMI ist eine phantastische Reise, ein Mix verschiedener Elemente der Fantasy-Literatur. Ob verzauberte Momente voller Poesie, ob harte Kämpfe oder geschliffene Dialoge voller Spott und Humor, INRIMI führt sie alle zusammen und macht Appetit auf mehr. Eine Geschichte für Leib, Geist und Seele. jan-wiezorek.de
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 825
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Das Reich Brindirion und die Nordlande
Ein ausführliches Glossar befindet sich frei zum Download auf der
Homepage:
https://www.jan-wiezorek.de
Und natürlich sollen die drei vermeintlichen Hauptfiguren einmal hier
namentlich vorgestellt sein:
Roman – ein Bauernbursche aus Ostbrunn, sehr erfahren in Fragen
des Rübenanbaus und der Schweinezucht.
Shintra – eine junge Frau, die ihre Vergangenheit sucht und eine
turbulente Gegenwart findet. Sie erhält so manchen Namen noch
hinzu (die werden hier aber noch nicht verraten).
Bantor – ein junger Spion aus dem Norden, mit einer harten
Vergangenheit.
Für Heike Schmiedeknecht und Bernd F.
TIEF IN DER ERDE IST EIN LICHT. DOCH WAS DORT IST, DAS WEI MAN NICHT.
ES SCHEINEN DIE AUGEN VON WUNDERN ERFREUT, ES LEUCHTEN DIE STERNE, ZU SPLITTERN ZERSTREUT.
TIEF IN DER ERDE IST EIN LICHT. DOCH WAS DORT IST, DAS WEIß MAN NICHT.
Indrigam littandei, Inrime?
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Auf den Hängen Benedors
Ein Gehöft im Schoße der Hügel
Der Falke am Himmel
Kerzenlicht
Der Mund, der falsche Kunde gibt
Komm nur, komm
Begegnung am Wegesrand
Das Gräsermeer
Trügerischer Schein
Gerüchte
Grenzer Berenors
Die Zwergenpforte
Dun Fion
Tief im Westen
Durch den Regen von Brunn
Ariond Findeon
Bettelheim
Westfelder
Der Marsch der Marionetten
Mein tapferer Metzlaf
Tag des Frigurat und zwei eingeschlagene Fressen
Diener und Herr
Lubien
Wohin ziehen die Wolken
Hochzeitsfeiern
Diener des Salonlöwen
Der Brief
Im Grasland Berenors
Ein Rabe auf dem Grab
Der Schlaf ist der kleine Bruder des Todes
Freund oder Feind?
Das Fest der Fruchtbarkeit
Mistvieh
Ein Parias in Dun Fion
Der wissende Mund spricht in Rätseln
Auf der Weststraße in Brunn
Die Entscheidung eines Grenzers
Das Haus des Geldes
Danke, Falo, für deine Suche
Das Lied der Drossel
Die Wut ist der Schrei nach Fehlern
Die Übergabe
Tief in der Erde ist ein Licht
Ein kleiner Vorposten in Berenor
Im Bauch der Stadt
Ein gefallenes Fort
Eine Kathedrale der Erde
Schade um sie alle
Im Bauch der Welt
Der letzte Grenzer
Was bist du?
Ein Funke, der in der Asche glüht
Der Nacht entgegen
Vorwort
Eine Reise beginnt.
Genauer gesagt beginnen eigentlich drei Reisen, denn
INRIMI erzählt die Geschichte von drei sehr verschiedenen
Figuren in der Welt von Brindirion. Dabei schließen sich den
Dreien einige Gefährten an, sodass am Ende eigentlich eine
ganze Bande an wunderbaren und eigensinnigen Figuren die
Geschichte erlebt, und keine davon würde sich auf der Bühne in
einer Nebenrolle wähnen. Und ich wiederum muss ihnen da
durchaus Recht geben.
Damit das Ganze nicht ein klitzeklein wenig
unübersichtlich wird stehen auf der Homepage ein Glossar und
eine größere Karte zum Download bereit.
Auf den Hängen Benedors
Es waren hohe, kreischende Schreie, die sie aus der Schwärze holten. Sie wollte die Augen öffnen, doch sie waren verkrustet und verklebt.
Dann kam der Schmerz. Ein stechender Schmerz im Kopf, als ob sich lange Stahlspitzen hineinbohren würden.
Als nächstes fing das Zittern an – Kälte und Feuchtigkeit. Schüttelfrost überkam sie. Ihre Lippen zitterten.
Etwas bohrte sich in ihre Hand. Erschrocken zuckte sie zurück, und das Rascheln von Federn war zu hören. Krähenfraß! Ich bin Krähenfraß, dämmerte es ihr. Sie konzentrierte sich darauf, die Augen zu öffnen.
Der schneidende Lichtstrahl, der durch ihr linkes Auge stach, beschied dem Bemühen einen zweifelhaften Erfolg. Rechts blieb es dunkel.
Sofort wurde der Kopfschmerz stärker, und Übelkeit stieg in ihr auf.
„Verdammt“, war das erste Wort, das sie mühsam hervorbrachte, und mit der linken Hand strich sie sich über die schweißnasse Stirn und tastete ihr Gesicht ab.
Der beißende Schmerz, den die Hand an der rechten Gesichtshälfte auslöste, ließ immerhin den Kopfschmerz für kurze Zeit zurücktreten.
Sie zog die Knie hoch und winkelte die Beine an. Es half nach einiger Zeit. Vorsichtig öffnete sie ein zweites Mal das linke Auge, und wenig später sah sie verschwommen einen wogenden Schatten über sich.
„Ein Baum“, murmelte sie und war froh, dass die Umrisse langsam klarer wurden.
Jetzt bemerkte sie den brennenden Durst.
Dann sah sie die Krähen im Baum über sich. Sie beäugten sie mit ruckartig seitwärts gelegten Köpfen.
Früher mochte ich Krähen, dachte sie. Krähen, Nebel, die Berge, das grüngraue Meer. Benedor…
Wo bin ich? Sie schreckte nach kurzem Dämmern auf. Sie konnte sich an nichts erinnern, nicht mal ihr Name fiel ihr ein. Ein Niemand bin ich, was ist bloß geschehen?
Dann schüttelte es sie wieder, und mit einem Mal stieg ihr Mageninhalt hoch. Unter dröhnenden Kopfschmerzwellen erbrach sie sich.
Mit einem Seufzer fiel sie zurück ins Gras und beschloss, sich wieder den Träumen hinzugeben. Krähenfraß und Landschaftsbilder. Wieder kamen Kopfschmerz und Übelkeit.
Das plötzliche Aufflattern der Vögel im Baum nahm sie kaum noch wahr. Doch da war dieses sanfte Streichen im Gras. Wie Schritte, dachte sie und schaute in Richtung der leisen Geräusche. Ein undeutlicher Schatten hob sich ab vom tristen Grau des Himmels. Etwas entfernte sich, doch sie konnte nicht erkennen, was es war. Zu verschwommen war ihre Sicht, zu dumpf der Schmerz und die klopfende Übelkeit.
Ich werde hier sterben, dämmerte es ihr, und wie auf ein Stichwort hin kamen die Krähen zurückgeflogen.
Sie holte fahrig mit der rechten Hand aus und streifte durch das Gras, bis sie plötzlich etwas Hartes spürte. Mühsam drehte sie den Kopf und sah verschwommen einen Tonkrug neben sich. Einen Tonkrug und ein in große Blätter eingewickeltes Bündel.
Sofort wollte sie sich aufrichten, doch ein ganzes Konzert aus Schmerzen, Schwindel und Übelkeit zwang sie zurück in die Rückenlage.
Wie der Wind mich zärtlich streichelt, so wie der Wind mich zärtlich bettet zu meinem langen Schlaf, fielen ihr die Verse ein, und sie entspannte sich zum ersten Mal seit ihrem Erwachen. Sie glitt in das Zwischenreich der Träume und versank in einen unruhigen Schlummer.
Der Schlaf war wie ein schwarzes Loch, durch das sie ins Bodenlose fiel. Sie überschlug sich und drehte sich um die eigene Achse. Langsam entglitt sie in den tanzenden Strudel des Vergessens. Und in dem Strudel war eine Stimme, die sprach ganz sanft zu ihr.
Ich falle und stürze.
Ja, du fällst und du stürzt.
Wenn ich gefallen bin und gestürzt, dann werde ich sterben.
Ja, dann darfst du sterben.
Wenn ich gestorben bin, dann fressen mich die Krähen.
Ja, und ich.
Dann ist mein Tod nicht sinnlos.
Nein, kein Tod ist sinnlos, denn er nährt ja anderes Leben.
Umarme mich, mein Tod, so wie eine Mutter ihr krankes Kind.
Ich umarme dich und reiße dich auseinander, damit die Spuren nicht das Kommende fehlleiten.
Was ist das für ein Schrei – er ist klagend und voll Grauen.
Es ist der Schrei deiner Todesfee, sie hat dich stets geliebt, und nun muss sie klagen.
Bin ich denn schon tot?
Nein, mein Kind, aber der Weg ist nicht mehr weit.
Dann lasse ich los, lasse ab von des Lebens Mühe.
So ist es gut, lass los den Lebenszwang.
Noch eines will ich wissen.
Ja, mein Kind.
Werde ich noch sein, auch nach dem Tode?
Gedulde dich, Wildkätzchen, dort bei dem Licht wirst Antwort du erhalten.
Das Licht war gleißend und sanft zugleich, verlockend nach all der Dunkelheit. Sie wunderte sich, wie sie sich darauf zu bewegte, ohne einen einzigen Schritt zu gehen. Als ob sie schwebe, als ob sie stehen würde und im Stand zu der Lichtpforte gesogen würde.
Und endlich war sie da, endlich würde sie im Lichte erstrahlen oder eben vergehen, sich auflösen.
Doch vorerst wunderte sie sich über den Geschmack des Lichtes, flüssig und scharf, wie mit Pfefferschoten gewürzter Schnaps.
Sofort überkam sie ein derber Hustenreiz, und sie verschluckte sich und spürte, wie das Zeug ihr die Kehle hinunter rann und zugleich durch die Nase hinaus.
Instinktiv öffnete sie die tränenden Augen, und das wundersame Licht verschwand, um einem trüben Grau zu weichen. Dem Grau eines regenreichen Tages in den Höhen von Benedor.
Wildkätzchen hatte sie die Stimme im Traum genannt. Wildkätzchen oder Shintra, wie die Elbarien sagten, fiel ihr zwischen dem Husten und Würgen ein. So war sie als kleines Mädchen genannt worden, doch von wem? Alles Grübeln nutzte nichts, der Schleier ihres Vergessens war undurchdringlich.
Die verschwommenen Umrisse einer Gestalt, die sich über Shintra beugte, nahmen nur sehr langsam eine klare Form an. Die Form eines wild aussehenden jungen Mannes. Lange dunkle Locken schienen in alle Richtungen abzustehen, und unter der Lockenpracht sahen Shintra zwei lebhafte, dunkle Augen an. Eine leicht gekrümmte Nase traf auf einen vollen, besorgt verkniffenen Mund, umrahmt von einem kurzen Bart.
„Ruhig, trink das!“, sprach der Mund, und sie tat instinktiv das Gegenteil und sprühte einen Mundvoll brennender Flüssigkeit direkt in das Gesicht des Fremden.
Für kurze Zeit verschwanden Locken, Gesicht und Gestalt aus ihrem Sichtfeld, dann tauchte alles zusammen, freilich mit einem weniger besorgten als säuerlichen Gesichtsausdruck wieder auf.
„Was soll der Mist? Denkst du, ich mach mir die Mühe, eine Sterbende zu vergiften?“, fragte er, und Shintra musste trotz Kopfschmerz, Schrecken und Schwindel zugeben, dass das nicht dumm klang.
„Also, noch mal von vorne, trink das in kleinen Schlucken!“, forderte seine beruhigende Stimme sie auf.
Shintra trank, aber nur, wie sie sich selbst vergewisserte, weil sie einen Mordsdurst hatte. Sofort spürte sie die wärmende, belebende Wirkung und wurde gleich mutiger, indem sie versuchte, sich aufzurichten.
„Sachte, sachte“, riet er ihr, und sie fiel zurück ins Gras.
Der Fremde legte ihr vorsichtig eine zusammengerollte Decke unter den Kopf und kramte dann in dem Bündel. „Wenn es geht, iss das!“ Er hielt etwas Unbestimmbares, Grünes in der Hand.
Shintra nickte leicht, und er fütterte sie mit dem Grünzeug.
Es schmeckte würzig nach frischen Kräutern, nach Minze und Thymian. Da waren auch noch andere, ihr unbekannte Aromen, aber in jedem Fall schmeckte das Zeug gut.
Und es wirkte! Sie fühlte sich besser, und ein Teil der dumpfen Schmerzen ging auf ein erträgliches Maß zurück.
Der Fremde sah sie kurz an, nickte dann und sagte: „Ich kümmere mich mal um ein Nachtlager. Bleib einfach hier liegen und entspann dich!“
Sie hätte ihm ganz gerne einen Vogel gezeigt, von wegen einfach liegen bleiben – sie konnte ja gar nicht anders. Aber etwas an dem, was er gesagt hatte, beruhigte Shintra, und die Schwärze des Schlafes fiel über sie wie ein sanftes dunkles Tuch.
Als sie erwachte, war es tiefe Nacht. Blass schien der Abglanz einiger verlorener Sterne. Ein kleines Feuer brannte rechts von ihr, und sie drehte sich seiner Wärme dankbar entgegen.
Auf der anderen Seite des Feuers saß der Fremde im Schneidersitz, in einen weiten Mantel mit Kapuze gehüllt.
Sein Gesicht war im Schatten der Kapuze verborgen, nur Nase und Kinnspitze lugten hervor.
„Geht es dir besser?“, fragte er knapp.
„Ja, ich fühle mich nicht mehr, als wäre ich von einem Steinbrecher durchgewalkt worden“, antwortete sie verschlafen.
„Gut, denn morgen müssen wir hier verschwinden!“, beschied er, als ob damit alles gesagt wäre.
Natürlich war es das nicht. Ganz im Gegenteil. Eher wurde Shintras Trotz geweckt, und noch bevor sie sich besinnen konnte, bahnten sich schon die ersten Fragen ihren Weg.
„Wer bist du eigentlich, dass du über mich bestimmst, wann ich zu gehen habe und wohin?“
„Trink das hier und rede nicht so viel. Du musst so schnell wie möglich wieder zu Kräften kommen!“, war die Antwort, die freilich alle Fragen offenließ.
Shintra funkelte die schwarze Kapuze an und knurrte: „Ich habe dich etwas gefragt, Fremder, und ich trinke nicht alle deine Mixturen! Wer weiß, was es diesmal für ein Zeug ist, vielleicht ein Trank, der willenlos macht.“
„Den hätte ich dir im Schlaf gegeben.“ Leise fügte er hinzu:„Ich heiße Falo.“
„Also gut, Falo. Was machst du hier?“, fragte sie und nahm den Trank, den er ihr reichte.
Er schwieg und kramte stattdessen in einem Beutel, um einen Lappen hervorzuholen, den er mit einer Tinktur übergoss. Den reichte er ihr und deutete auf ihr Gesicht. Sie verstand und reinigte vorsichtig die Wunde oberhalb des rechten Auges.
„Ich hab dich was gefragt, Falo“, setzte Shintra erneut an.
„Und ich hab geantwortet. Ich bin Waldläufer, Kundschafter, Jäger, Vagabund. Such dir was aus. Du hast Glück, dass ich hier vorbei kam. Deine bisherige Gesellschaft wollte weniger reden, eher fressen.“
Das zumindest leuchtete ihr ein. Es war richtig. Sie hatte Glück gehabt. Kein Krähenfraß.
„Was ist geschehen?“, fragte Falo nach einer Weile.
Diesmal schwieg sie. Es war die Frage, die nach dem Erwachen, nach den Schmerzen und der Übelkeit in ihr aufgestiegen war. Sie hatte keine Antwort. Sie kam aus undurchdringbarer Schwärze. Es war, als tastete sie blind in einem dunklen, unergründlichen Gang mit vielen Türen, die zu den Kammern ihrer Erinnerung führten. Allein sie fand sie nicht.
„Ich weiß es nicht“, sagte sie in das lange Schweigen. Er nickte bloß und legte ein Scheit ins Feuer.
„Ich kann mich nur an Bruchstücke erinnern, und die sind ohne Zusammenhang. Ich weiß nicht einmal meinen Namen.“ Dann lächelte sie. „Ausgerechnet an einen Kosenamen aus meinen Kindertagen kann ich mich erinnern. Sie nannten mich Wildkätzchen. Shintra, doch ich weiß nicht mehr, wer mich so rief. Es ist, als ob die Menschen und Ereignisse meiner Vergangenheit in einem dichten Nebel verborgen wären. Doch manchmal lichtet er sich, und ich sehe etwas.“ Sie blickte unsicher ins Feuer.
„Also gut, Shintra.“ Er betonte den Namen, als wäre er ihm vertraut. „Die Wunde sah nach einem Schlag mit einem stumpfen Gegenstand aus. Einem Ast oder einer Keule“, sagte er, um ihrer Suche eine Richtung zu geben.
„So fühlt sie sich auch an“, brummte Shintra, und ein Lächeln umspielte ihren Mund. Ein Lächeln, doch kein fröhliches.
Er deutete auf den Trank in ihrer Hand.
Sie verzog das Gesicht, blies die Backen auf und stieß die Luft aus. Doch dann sagte sie mit einem langen Seufzer: „Erzähl mir was von dir, wenn ich schon nichts über mich weiß. Das würde mir das Trinken um einiges leichter machen.“
Falo überlegte kurz und lehnte sich dann zurück. Er blickte versonnen ins Feuer, als ob dort die Erinnerungen an sein Leben aufflackerten. Das Licht spielte Fangen mit den Schatten auf seinem Gesicht, und er begann zu erzählen.
„Ich war ein Hirte in Fallund, in Süd-Brunn. Meine Eltern waren Hirten, wie zuvor meine Großeltern … Schafe, Fatura, Hügel und Armut.“ Er machte eine Pause und sah ihr beim Trinken zu.
Das Zeug schmeckte nach starkem Alkohol, und die bitteren Kräuter obsiegten gegen die wohlschmeckenden. Sie zog eine Grimasse.
Er lächelte kurz und fuhr dann fort.
„Jetzt ziehe ich durch die Länder Brindirions. Meist ohne Ziel als Fährtenleser oder Vagabund, je nach Standpunkt des Betrachters.“ Falo machte eine kurze Pause und trank ebenfalls etwas von dem Zeug.
„Vagabund?“, fragte sie verwundert.
„Vagabund. Zumindest in den Augen der Vogtbüttel, Förster und der Stadtwache. Was sie nicht davon abhält, meine Dienste in Anspruch zu nehmen, wenn dem hiesigen Vogt, dem Landgraf oder sonst wem etwas abhanden gekommen ist. Meist etwas auf zwei Beinen, das entweder seinem eigenen Willen gehorcht oder Probleme mit der Gerichtsbarkeit hat … Dann bin ich Falo, der Fährtenleser.“
„Wie kam es dazu? War dir das Leben eines Hirten nicht gut genug?“ Sie war erleichtert, dass der Schmerz nachließ. Stattdessen fühlte sie sich, als würde sie in warmem Wasser schweben. Falo antwortete nicht gleich. Er stand auf und deckte sie mit einer geflickten Buragdecke zu. Schließlich ließ er sich wieder nieder, zog die Beine unter seinen Umhang und blickte ins Feuer. Sie hatte die Augen schon geschlossen, als er langsam mit ruhiger Stimme weitererzählte.
„Ich war seit Kindertagen auf den Weiden und Hängen. Ich hätte nicht sagen können, ob ich ein guter Hirte war oder ob ich ein Hirte sein wollte. Es gab niemanden, der danach fragte. Doch eines war mir klar. Es machte mich glücklich, draußen unter dem freien Himmel zu sein, bei den Tieren auf den Sommerweiden. Mein Vater lehrte mich alles, was ein Hirte wissen muss, und dabei sprach er nicht viel. Das meiste zeigte er mir. Also lernte ich, Schafe zu hüten und zu schweigen.“
Das Feuer flackerte kurz, als der Wind auffrischte. Falo lauschte in die Nacht hinein, doch es waren nur das Wispern des Windes in den Bäumen und der einsame Schrei eines Kauzes zu hören.
„Und wie wurde aus dem schweigsamen Hirten ein Vagabund?“, fragte Shintra nach einer Weile.
„Nun, in einem strengen Winter kamen die Wölfe von den Bergen im Norden herunter und zogen hungrig durch die Hügellande von Fallund. Viele Schafe unserer Herde wurden gerissen, und unsere Lebensgrundlage war bedroht. Ich war mittlerweile siebzehn Winter alt und im gleichen Maße furchtlos, wie ich ahnungslos war. Da mein Vater zu alt war, sich der Sache anzunehmen, zog ich aus, um mit den anderen Hirten die Wölfe zu vertreiben.“ Er hielt inne und blickte in die Ferne, verzog das Gesicht, und schließlich fuhr er fort. „Niemand wollte mitkommen – sie hatten alle Angst. Ihre Vorwände reichten von der Sorge um die zurückgelassenen Familien bis hin zum Opfer an Makasahr, den Gott des Winters. Niemand kam, bis auf Parlo, mein Freund und Gefährte aus den glücklichen Tagen der Kindheit. Wir packten unsere Jagdbögen, genug Proviant und ein paar der kostbaren Wolfseisen auf einen Schlitten, nahmen unsere besten Hirtenhunde mit und folgten den Wolfsspuren in die waldbedeckten Hügel. Es war Irrsinn, und das hatte man uns auch zu verstehen gegeben. Doch wir waren jung, und so machten wir uns auf den Weg.“
Wieder schwieg er und sah, dass Shintra sich in die Decke eingerollt und die Augen geschlossen hatte.
„Erzähl weiter … bitte“, bat sie schläfrig, nachdem sie sein Schweigen bemerkt hatte.
„Wir folgten der Spur tief in die Falten, so heißen die südlichen Ausläufer der Hügellande. Die Anhöhen dort sind im Winter tief verschneit, und nur Fallensteller und Jäger wagen sich dann dort hin. Am dritten Tag unserer Jagd“ – Falo spuckte das Wort regelrecht aus – „hörte ich das Heulen, und uns wurde klar, dass wir das Rudel gefunden hatten. Zwei huschende Schatten verrieten mir, dass das Rudel uns ebenfalls entdeckt hatte, und eilig zogen wir auf die Trollnase – eine Hügelkuppe, die mit einem hohen Menhir versehen ist.“
Wieder machte er eine Pause, und wieder bat sie ihn, weiterzuerzählen. Also setzte Falo seine Geschichte fort, doch er schien sie nicht ihr zu erzählen. Vielmehr war es, als ob er sie der Nacht anvertraute und seine Worte verbrannten in den Flammen zu kleinen Funken, die in den nächtlichen Himmel stiegen.
„Es war eine regelrechte Hatz, denn nun hatten wir das Rudel im Nacken, und der hohe Schnee erschwerte uns den Aufstieg. Parlo war erschöpft und lief hinter mir, die Hunde bildeten den Abschluss. Wir hofften, uns auf der Trollnase besser verteidigen zu können. Zuerst erwischten sie Zarf, den ältesten meiner Hunde. Nie werde ich sein Jaulen vergessen. Das gab uns aber Zeit, den schneebedeckten Menhir zu erreichen. Wir wandten uns um und nahmen die Bögen auf. Es war schwierig, im Schneetreiben etwas zu sehen. Die Hunde knurrten, und wir machten einige Schemen am Rande unseres Sichtfeldes aus, flüchtige Schatten im blendenden Weiß. Dann kamen sie. Wir schossen, und Parlo traf einen. Doch es waren zu viele. Zwei fielen über Parlo her und ich hörte nur noch seine Schreie. Ich erwischte zwei, doch seine Schreie waren inzwischen verstummt. Dann sah ich das restliche Rudel. Zehn Schatten, die mich anstarrten. Ich bekam Panik und rannte zu dem Menhir. Meine Hunde waren dicht hinter mir. Nun musste ich den eisbedeckten Stein erklimmen, und das Knurren der Hunde verriet mir, dass die Wölfe ganz nah waren.
Immer wieder rutschte ich ab und rechnete damit, dass sich die Reißzähne eines Wolfes in meinen Winterstiefeln festbissen. Dann hörte ich einen Wolf aufheulen. Danach wurde es merkwürdig still, und ich rutschte langsam zurück an den Fuß des großen Felsbrockens. Es nützte alles nichts, ich musste das Gepäck loswerden oder meinen Bogen zurücklassen, um besser klettern zu können. Verhungern oder Wehrlosigkeit und ich entschied mich rasch.
Plötzlich spürte ich etwas in meinem Rücken. Ein Gefühl, als ob etwas Tödliches auf mich gerichtet war. Meine Finger krallten sich in den eiskalten Stein. Ich zog mich Stück für Stück hoch.
Dann hörte ich ein Knurren, so tief und hungrig. Das konnte kein Wolf sein. Und in dem Knurren war …“
Falo sprang mitten im Satz auf und griff rasch zu einem langen Bündel, das bei seinem Gepäck lag. Blitzschnell zog er einen Langbogen aus dem Futteral und spannte ihn.
Er verschwand leise im Dunkel, und es wurde still. Seufzend richtete Shintra sich halb auf und spähte in die Nacht. Das Feuer war mittlerweile heruntergebrannt. Nichts war zu sehen und nichts zu hören.
Mühsam hielt sie die Augen geöffnet und den Schlaf fern. Shintra wusste, wenn sie sich dem Schlafe hingäbe, dann würde sie …
Ein sanftes Rütteln weckte Shintra.
Verwirrt kämpfte sie sich aus einem dumpfen Schlaf, der wie tiefes Wasser war, aus dem sie um Luft ringend auftauchte.
„Wir müssen hier weg!“, flüsterte Falo eindringlich.
Mühsam öffnete Shintra die Augen. „Was war denn los?“, fragte sie benommen.
„Ich weiß es nicht genau, aber wenn es das war, was ich befürchte, bekommen wir bald Besuch.“ Eilig packte Falo zusammen. Shintra versuchte aufzustehen, und es klappte besser, als sie zu hoffen gewagt hatte.
Shintra war es trotz ihres Zustandes recht, dass sie aufbrachen. So kamen die Fragen nicht wieder hoch, wer sie war, wohin sie ging, was geschehen war. Sie war froh, dass Falo den Weg bestimmte. An dem Waldläufer war etwas, das ihr Vertrauen gab. Etwas, was sie ihm folgen ließ.
Sie machten sich auf den Weg durch das klamme Gras. Im Osten dämmerte es, und die Schatten eines großen Gebirgsmassives zeichneten sich zu ihrer Linken ab.
Schweigend folgte sie Falo, und zu ihrem Glück ging es stetig bergab.
Sie mussten vom Gebirge her kommen, doch was dort geschehen war – sie hielt inne. Sie hatte entschieden, den schwarzen Abgrund in ihrem Gedächtnis erst einmal zu meiden. Auch wenn er sie jetzt beim langsamen, gleichmäßigen Gehen lockte und anzog, zu groß war die Gefahr, in ihn hineinzufallen. Sie musste sich dem dunklen Schlund vorsichtig nähern, und das brauchte Zeit.
Die aufgehende Sonne verdrängte mit ihrem goldenen Schein die dunklen Gedanken und enthüllte eine schöne, weite Landschaft. Tatsächlich fiel das Land um sie herum vom Gebirge aus ab und war geprägt von weiten Wiesen, die von Tannenwäldern und in tieferer Lage von dichten Laubwäldern durchbrochen wurden. In der Ferne war ein großer Fluss sichtbar, der links von ihnen vom Gebirge begrenzt wurde und sich nach Osten in einer großen Bucht verlor.
„Wohin gehen wir?“, fragte Shintra matt, nachdem sie einen guten Teil des Vormittags marschiert waren.
„Zur Pforte von Brahn, der Zwergenpforte. Und von da aus weiter nach Brunn, dem Hügelland, das sich weit nach Westen erstreckt, und an dessen Westausläufer sich das Pantartal anschließt. Dort ist unser Ziel, die Stadt Dun Fion“, antwortete Falo und wies mit der Rechten zunächst nach Südwesten und dann weit nach Westen.
„Unser Ziel?“, fragte sie erschöpft.
Falo lief noch ein Stück weiter, ehe er antwortete: „Vertrau mir. Ich bringe dich in Sicherheit. Die Wunde an deinem Kopf hat dir jemand beigebracht. Und dieser Jemand ist noch hier in der Gegend.“
Die Namen der Orte tanzten im Kreise des Schwindels, der sich mit zunehmender Erschöpfung in ihrem Kopf ausbreitete. Noch an den Gedanken geklammert, woher sie die Pforte von Brahn kannte, sackte Shintra in die Knie und stöhnte, als sie in das hohe Gras glitt. Sofort fiel sie in einen dumpfen Schlaf, in dessen Dunkel kein Platz für Träume war.
Achselzuckend ließ sich Falo neben ihr nieder und blickte sich um. Sie würden in dem hohen Gras nicht auszumachen sein, also war der Platz für eine Rast ebenso gut wie ein sorgfältig gewähltes Versteck. Ihr Hauptproblem waren ohnehin nicht die Verstecke, die sie zum Rasten wählten, sondern die Spuren, die sie hinterließen. Die Spuren im Gras und die Spuren ihres Geruchs, wie er noch bitter dachte, denn nicht alle Verfolger würden sich auf ihre Augen verlassen müssen. Er wusste, dass sie in der Nähe waren, und die Geräusche der gestrigen Nacht hatte Falo nicht vergessen. Außerdem war da noch sein Instinkt.
Er nahm seinen Bogen, spannte ihn und legte ihn griffbereit neben sich. Dann überließ auch er sich einem leichten Schlaf, wobei er als Mantra den Satz seines elbarischen Lehrmeisters mit in den Schlaf nahm: Das falsche Geräusch weckt meine Sinne, das falsche Geräusch weckt meine Sinne, das falsche Geräusch …
Es war ein leises Rascheln, das ihn hochfahren ließ. In Windeseile war Falo auf den Knien, hatte einen Pfeil eingelegt und sah sich schnell um: Gras, ein paar dicht stehende Büsche, ein Baum, durch den der Wind fuhr, sonst nichts. Und dennoch wusste er, dass etwas nicht stimmte. Vorsichtig hob er den Kopf aus dem Grasmeer, das sie umgab.
Noch bevor er etwas sehen konnte, vernahm er ein Klicken, das mehr verriet als freie Sicht auf vierhundert Schritt.
Rasch duckte Falo sich und rüttelte an Shintras Schulter. Benommen öffnete sie die Augen und wollte sich aufrichten, doch er drückte sie wieder zu Boden, wobei er ihr den Zeigefinger auf den Mund legte.
Sie nickte kurz zum Zeichen, dass sie verstanden hatte, und er wies zu den Buschdickichten hin. Sie robbten auf dem Boden liegend durch das Gras und versuchten dabei, so leise wie möglich zu sein.
Zwischendurch horchte Falo ein-, zweimal, doch nichts war zu hören. Fragend blickte Shintra ihn an. Er schüttelte nur den Kopf und drängte weiter. Sie hatten das Dickicht schon fast erreicht, da hörten sie wieder das Klicken und einen schrillen, pfeifenden Ton.
Rasch schlugen sie sich in das dichte Gestrüpp und wühlten sich durch zahllose Dornen.
„Verdammt, was war das?“, fragte Shintra japsend, während sie sich durch dichte Ranken drängen musste.
„Orad Jha, auch Äugler genannt!“, stieß Falo hervor und blickte sich dabei hektisch um.
„Nie von gehört!“, erwiderte sie und stolperte dann über eine dicke Dornenranke direkt in einen dichten Busch.
„Stell dir Kreaturen vor, die nur aus einem riesigen Auge, einem Maul und spinnenähnlichen Beinen bestehen, dann hast du ein Bild von diesen Mistviechern“, brachte Falo keuchend hervor, während er ihr hoch half.
Verstört sah sie ihn an und fragte: „Warum habe ich noch nie von solchen Biestern gehört?“
„Sie sind recht frisch in der Menagerie Brindirions. Aber das hat Zeit, lass uns hier verschwinden, denn neben anderen unangenehmen Eigenschaften sind sie exzellente Späher.“ Er drehte sich um und setzte den Weg durch das Buschwerk fort. Unsicher wandte sie sich um, folgte ihm und verfluchte leise ihre Amnesie.
Krabbelnde Glupschaugen, widerlich, dachte sie und vernahm weiter hinten das Klicken, etwas schwächer als zuvor.
Schweißgebadet und am Ende ihrer Kräfte brach Shintra durch das letzte Gestrüpp und taumelte zu Boden.
„Wir müssen weiter!“, drängte Falo und hielt ihr ein kleines Flakon an den Mund. Ein süßlicher Geschmack mit starkem Alkohol rann ihr die Kehle hinunter, und augenblicklich wich die Erschöpfung zurück.
„Schnell, es wird nicht lange dauern, und es wimmelt hier so nur vor Kroms und Nordlingen!“
Sie wollte schon zur Frage ansetzen, wer zum Henker Kroms und Nordlinge waren, als ein dumpfes Horn aus nordöstlicher Richtung erschallte.
Die weiter entfernte Antwort aus dem Nordwesten ließ nicht lange auf sich warten, und ihr wurde klar, dass – was immer das für Burschen waren –, es nicht der richtige Zeitpunkt war, deren Absichten herauszufinden. So schnell ihr geschundener Körper es zuließ, rannte sie mit Falo über die weiten Wiesen, die sich jenseits des Dickichts vor ihnen flussabwärts erstreckten.
Wir schaffen es!, dachte sie, und neue Kraft durchströmte ihre Glieder. Sie schloss zu Falo auf, der vor ihr in leicht geduckter Haltung floh.
Sie passierten eine größere Baumgruppe und hatten freie Sicht auf das Flusstal. Der Fluss war ein ganzes Stück näher gekommen, und Shintra konnte die Stelle ausmachen, wo ein Ausläufer des Gebirges bis zum Ufer hinab reichte. An dieser Stelle war eine hohe Mauer mit einem noch winzig erscheinenden Tor errichtet.
„Es ist nicht mehr weit bis zur Pforte!“, rief Falo außer Atem und schaute nervös nach hinten, doch die Baumgruppe nahm ihm die Sicht auf ihre Verfolger.
„Dann los!“, stieß Shintra aus, überwand den aufkommenden Schwindel und sie liefen den Hang hinab.
In diesem Moment brachen links von ihnen mehrere Gestalten aus dem Wäldchen, eher springend als rennend.
Sofort wichen sie ein Stück nach rechts aus und wurden schneller. Ein Stück weiter kreuzte ein Bachlauf ihren Fluchtweg. Er maß mehr als zwei Schritt und war recht tief in das weiche Grasland geschnitten. Zunächst folgten sie ihm, doch das führte sie immer weiter nach Nordwesten, sodass die Pforte im Südosten in weitere Ferne rückte.
„Wir müssen springen!“ Falo warf seinen Rucksack über den Bachlauf.
Shintra kam zum Stehen, und sofort sackten ihr die Beine weg. Der Schmerz kehrte zurück, sobald ihr Körper zur Ruhe kam, und ihr wurde schwarz vor Augen.
Ein zischendes Geräusch weckte sie aus ihrer Umnachtung, ein Pfeil, den Falo abgeschossen hatte. Der gellende Schrei verriet ihr, dass der Pfeil sein Ziel gefunden hatte.
Sie sah sich um, und eine der springenden Gestalten fiel zuckend ins hohe Gras.
Dann erstarrte Shintra. Mit einem Mal erkannte sie die geduckten Gestalten.
Ihre lumpigen Röcke und Wämser, mit schmutzigem Fell gefüttert. Die starken Arme mit ledernen Bändern und Knochenketten geschmückt. Die von Wut verzerrten ledrigen Gesichter. Einige der Kerle rissen ihre Münder auf und entblößten die großen Zähne. Sie stießen Flüche in ihrer harten Sprache aus und bedrängten sie mit Speeren und kurzen schartigen Klingen.
In ihrer groben Sprache nannten sie sich Kroms, ein Volk, das schon vor den ersten Menschen hier gelebt hatte, älter als die Pelaboris, wilder und grausamer als alle anderen Bewohner Brindirions.
Ihre Erstarrung hielt an, denn mit dem Anblick der Kroms kam in Shintra die Erinnerung an einen furchtbaren Kampf auf. Es war, als hätte sie in dem dunklen Gang eine der Türen erreicht und sie geöffnet. Dahinter sah sie ein apokalyptisches Bild. Zahllose Kroms drängten über einen schmalen Grat gegen die Mauern einer starken Festung. Viele von ihnen stürzten im Getümmel in die finstere Tiefe hinab. Unbeirrt strömten weitere nach und warfen die Gefallenen am großen Sturmbock achtlos beiseite. Eine Sturmbrücke aus Eichenbohlen überspannte die Kluft, wo die Verteidiger die Zugbrücke hochgezogen hatten. Stählerne Widerhaken hielten sie an Ort und Stelle, und über die Eichenbohlen fuhr ein ums andere Mal der Sturmbock gegen die Zugbrücke.
Dreimal schon hatten sich durch die Erschütterung die Haltehaken aus dem Holz gelöst und dreimal schon waren solche Sturmbrücken mitsamt den Rammböcken und ihren Bedienmannschaften in die unermessliche Tiefe gestürzt.
Sie waren schlicht ersetzt worden.
Der Sturmbock fuhr immer wieder gegen das große Tor der Festung. Der harte Aufprall erzeugte einen infernalischen Trommelschlag. Doch das Tor hielt stand. Rings um Shintra herum auf dem Wehrgang warfen abgemagerte Gestalten Steine auf die Angreifer hinab oder schossen Pfeile auf sie.
Mit einem Mal erhellte sich der schmale Bereich, denn ein Feuerregen ging vor dem Tor nieder. Der Rammbock und seine Bedienmannschaft standen sofort in Flammen, und Panik brach unter den Angreifern aus.
Eine schnelle Bewegung holte Shintra aus ihrer Erinnerung zurück. Eine dieser Kreaturen sackte direkt vor ihr zusammen – ein Pfeil ragte ihr aus der Stirn. Der Schrei erstarb und es wurde still. Hektisch sah Shintra sich um. Sie waren umzingelt. Falo stand direkt neben ihr, den Bogen erneut gespannt und mit ruhigem Gesichtsausdruck.
Mindestens zwanzig Kroms hatten sich im Halbkreis um sie versammelt. Hinter ihnen war der Bachlauf. Ein kurzer Blick zeigte Shintra, dass sie den Graben nicht ohne Anlauf überspringen konnten.
„Was machen wir nun?“, fragte sie.
„Ruhig bleiben. Die Kroms warten noch. Hätten sie den Befehl, uns zu töten, wären wir …“ Er brachte den Satz nicht zu Ende, denn Unruhe breitete sich unter ihren Feinden aus, und eine Seite des Halbkreises wich zurück.
Ein Reiter in rauchschwarzer Rüstung erschien. Sein Gesicht war durch einen massiven Helm mit einem Visier in Form einer Wolfsschnauze verdeckt. Mit einer Geste gebot er Schweigen und wandte den Wolfskopf Shintra zu.
„Was haben wir denn da aufgescheucht? Eine verletzte Wildkatze und einen Streuner.“ Die Stimme klang blechern durch das Visier. „Sagt, was macht ihr hier in der Wildnis der Provinz Angharst?“
„So viel ich weiß, ist dies die Grafschaft Benedor“, erwiderte Falo ruhig.
„Senke deinen Bogen, Streuner. Und du“, der Wolfskopf wandte sich in Richtung Shintra, „dein Gesicht kommt mir bekannt vor. Wer bist du?“
Lärm kam auf, als die zweite Verfolgergruppe eintraf. Sie bildete einen zweiten Halbkreis hinter den Kroms, und ihr Anblick zog die Aufmerksamkeit Shintras auf sich.
Es waren hoch gewachsene, breitschultrige Krieger in Lederrüstungen mit Fellbesatz. Grimmige Gesichter blickten unter langen, hellen Haaren auf Falo. Der ließ wortlos den Bogen sinken. Es hatte keinen Sinn. Ihre Feinde würden sie in Stücke hauen.
„Gut so, lass deine Waffen fallen und kommt langsam herüber.“
Ein Klicken schreckte Shintra aus ihrer Starre auf. Der dumpfe Schmerz und die Übelkeit waren mit dem versiegenden Rausch ihres Fluchtinstinktes zurückgekehrt.
Sie schaute kurz auf, aber der dichte Kreis ihrer Feinde schirmte die Sicht auf die herankommenden Äugler ab.
Sie stand vor dem schimmernden Reiter und fand, dass die Wolfsfratze seines Helmes herablassend auf sie niederblickte.
„Du bist aus der gefallenen Festung entkommen, Wildkätzchen“, ertönte die blecherne Stimme– eher eine Feststellung denn eine Frage.
„Ich weiß es nicht“, antwortete sie und lächelte innerlich über die Ironie der Situation, dass diese klassische Lüge ausnahmsweise der Wahrheit entsprach.
„Mach es dir doch nicht so schwer“, war die höhnische Erwiderung.
„Sie sagt die Wahrheit“, mischte sich Falo ein, der inzwischen von den Nordmännern an Händen und Füßen gefesselt wurde.
„Natürlich“, beschied der Reiter und stieg von seinem Ross, um sich zu den Gefangenen ins Gras zu setzen.
„Wollt Ihr nicht Euren Helm absetzen und uns mit dem Anblick Eures Angesichtes erfreuen?“, fragte Shintra mit spöttischem Unterton.
Der Wolfshelm wandte sich ihm zu und verharrte. Langsam hob er die Rechte und öffnete das Visier. Und diesmal breitete sich ihr Lächeln aus, denn die stechenden Augen und die Narbe zeigten sich nur wenig menschlicher als das Wolfsvisier.
Rings um sie herum herrschte nunmehr Betriebsamkeit. Die Kroms errichteten Verschläge und Zelte, die Nordlinge postierten Wachen und bauten ein größeres Zelt auf. Feuer wurden entfacht, und im Hintergrund wurde ein Pferch für die Pferde und abseits des Lagers ein weiterer Pferch für andere Kreaturen errichtet.
„Ich erkenne einen Vagabunden, wenn ich einen sehe, und weiß um die Bedeutung eines Vagabunden in diesem Kriege“, sagte der Ritter in Falos Richtung.
Falo machte sich wenige Illusionen über seine Bedeutung in diesem Krieg und schwieg. Also wandte sich der Wolfsritter wieder Shintra zu. „Zurück zu dir. Du bist aus dem Hause Alobahr?“
Shintra sah den Ritter unverwandt an und schwieg.
„Also gut, wenn mein Zelt bereitet ist, werde ich ein wenig ruhen. Danach erwarte ich eine befriedigende Antwort von dir. Solltest du dich mir nicht anvertrauen wollen, so werden meine Vorgesetzten in Habdurad oder Ariond Naram, wie Ihr es nennt, sich dieser Frage annehmen. Mit weitaus weniger Höflichkeit, wie ich fürchte.“ Der Ritter stand langsam auf und wandte sich an zwei Nordlinge, um sie als Wachen für die Gefangenen einzuteilen. Daraufhin verschwand er in dem großen Zelt, dessen Eingangstuch ein Wappen mit eben jenem Wolfskopf war.
Ein Gehöft im Schoße der Hügel
„Da sind wieder welche, da, auf der alten Landstraße!“ Roman zeigte aufgeregt auf die fernen Gestalten, die in einem langen, trägen Zug daherkamen. „Sollen wir ihnen etwas zu essen bringen?“, fragte er und wandte sich dabei um in die Richtung des alten Bauern, der auf einem Grashalm kauend auf dem knarrenden Schaukelstuhl saß und nun mit der Hand die Sonne abschirmte.
„Nein“, raunte er. „Lass sie in Ruhe ziehen. Sie haben genug Vorräte bei sich.“ Der alte Bauer schloss die Augen.
Es herrschte einen Moment Schweigen. Roman blickte immer noch auf den Zug aus Leuten und Fuhrwerken. „Es werden immer mehr, und sie wirken so …“ Er suchte nach den richtigen Worten.
„Verzweifelt, so wirkt man, wenn man alles verloren hat“, brachte der Alte den Gedanken traurig zu Ende.
„Glaubst du, dass wir auch bald fliehen müssen, Vater?“, fragte Roman.
Der Bauer schwieg und setzte seine Mittagsruhe im sanften Rhythmus des wiegenden Schaukelstuhls fort.
Verdrossen schaute Roman zu Boden. Dann blickte er um sich. Er sah den Hof, das Bauernhaus aus Bruchstein mit dem weiten Strohdach, den Holzläden und dem Eschenzweig über der Tür. Dann kehrte sein Blick auf die gepflasterte Terrasse vor dem Haus zurück, auf der der alte Bauer saß. Romans Vater schaute zu der alten Eiche, die in der Mitte der Gebäudeanordnung stand und alles überragte.
Der Familienbaum, der vom Urahn gepflanzt und seitdem mit der Asche der Nachkommen gespeist worden war.
Romans Blick wanderte gedankenvoll über die Äcker und Felder, die sich an das Gehöft anschlossen und bis zu den südlichen Hügeln ausweiteten. Ein Hof, seine Scholle und die Nachbarschaft, so weit das Auge vom Schafsberg blickte. Heimat. Der Sommerwind strich über die Felder und Wiesen, und er roch den Duft nach Heu und Kräutern. Dann schaute Roman wieder zur Straße, die sich hundert Schritt nördlich des Guts am Fuße des Rietbergs entlang wand. Er betrachtete den grauen Flüchtlingszug. Was musste es bedeuten, das alles zu verlassen, die Geborgenheit und Selbstverständlichkeit jahrelanger Vertrautheit? Verzweiflung. Verzweiflung, und eine große Kraft, die sie hervorrief: Angst.
Die Gestalten um die Karren wirkten verloren vor den mächtigen Höhen der Hügel. Sie zogen westwärts und kamen aus den Küstengebieten. Vor zwei Tagen waren Kinder von der Landstraße gekommen und hatten um Nahrung gebettelt. Sein Vater hatte ihnen Brote und Rübenkraut mitgegeben.
Roman schaute auf seine Hände. Sie waren groß und schmutzig, wie seine Kleidung besudelt vom Dreck des Ackers und dem Schmutz der Ställe.
„Roman, komm zu mir und starre keine Löcher in die Äcker“, schreckte ihn der Ruf seines Vaters auf.
Gedankenversunken wandte er sich um und ging zu dem alten Bauern, aus dessen zerfurchtem Gesicht ein tröstendes Lächeln hervorbrach.
„Veränderung geht immer Angst voraus, mein Junge. Ob es nun gute Veränderung ist, oder schlechte.“
„Ja, Vater“, erwiderte Roman.
„Aber was für Veränderungen erwarten uns? Gute oder schlechte – ich meine, ist die Angst begründet?“
„Uns stehen dunkle Zeiten bevor – so viel ist offensichtlich. Aber das kann auch das Vorspiel zu einem goldenen Morgen danach sein.“ Der Alte hüllte sich in Schweigen und kaute auf seinem Grashalm.
Eine Weile schwiegen sie beide, dann wandte sich Roman zu den Ställen. „Ich muss noch ausmisten und die Schweine füttern.“
Der Alte nickte und murmelte: „Ja, das musst du.“
Der Falke am Himmel
Shintra döste auf dem ruckelnden Gefährt, das ein Bauernkarren gewesen sein mochte. Immer wieder schlug ihr Kopf auf den durch Zeltplanen kaum gedämpften Boden des Karrens, auf dem sie es sich so bequem gemacht hatte, wie es eben ging.
Ihr gegenüber kauerte Falo, an Händen und Füßen gefesselt.
Seine dunklen Haare fielen ihm ins Gesicht. Ein grauer Himmel stand über ihnen, graue, schwere Wolkenbäuche, die sich in Trägheit hüllten.
„Wie lange sind wir unterwegs?“, fragte Shintra leise.
„Nicht allzu lang – der Nachmittag neigt sich seinem Ende zu“, antwortete Falo missmutig.
Shintras Schmerzen hatten aufgehört. Das war gut, doch alles andere war zum Verzweifeln. Gefangene des Nordens und zu alledem ohne Erinnerung an ihr früheres Leben. Betrübt ließ sie ihren Blick schweifen. Ein Vogel stieß aus einer grauen Wolke herab, verharrte dann kurz flügelschlagend an einer Stelle, als starrte er auf sie hinab. „Was ist das für ein Vogel dort?“, fragte sie gedankenverloren.
Falo sah auf und erwiderte nach einer Weile stiller Beobachtung: „Ein Falke.“
„Er zieht so erhaben seine Kreise und schaut auf uns herab“, flüsterte sie.
Falo zuckte mit den Schultern und gab sich dem Dösen hin. Shintra richtete sich auf und stellte fest, dass der Schlaf gut getan hatte. Auf dem Kutschbock saßen zwei in Mäntel gehüllte Nordlinge.
Rings um sie herum liefen weitere Nordlinge in lockerer Formation. Weiter vorne konnte sie Berittene erkennen, wahrscheinlich war dort auch der Wolfsritter.
Den Abschluss machte die Horde Kroms, die dichter zusammen und geduckt liefen.
„Es muss wunderbar sein, so hoch zu fliegen. Frei von all der Schwere und der Niedertracht … “ Sie sprach in den Himmel, und als wollte er antworten, stieß der Falke einen Schrei aus und drehte ab nach Süden, dem Gebirge entgegen.
Das Gefälle des Weges wurde flacher, als sie sich dem Fluss näherten. Wie ein breites, silbernes Band weitete er sich zur Bucht aus. Tarlin, den Namen des Flusses hatte Falo ihr genannt, und sie erinnerte sich sofort an ihn. Vom Regen der letzten Tage angefüllt umspülte der Strom den Uferbewuchs und nahm Treibholz und Unrat mit hinaus in die Bucht.
Shintra erhob sich ächzend und blickte sich um. Sie fuhren nun auf der Uferstraße, die gepflastert war, was ihr Fortkommen beschleunigte. Die Straße führte durch Waldgebiete, die zum Fluss hin lichter wurden.
„Die Zwergenpforte mag nun vier Meilen hinter uns liegen“, sagte Falo unwirsch.
„Und mit jedem Schritt entfernen wir uns von ihr und rücken Ariond Findeon ein Stück näher“, ergänzte er.
„Ariond Findeon?“, wiederholte Shintra fragend, und in ihr klang etwas an, wie eine Geräuschkulisse aus einem dumpfen Traum.
„Die verlorene Stadt heißt sie nun, seit dem Überfall der Truppen des Nordens auf Benedor. Sie fiel als erstes, da ihr Magistrat die Bedrohung nicht ernst nahm. Ursprünglich hieß sie Ariond Naram, die Stadt des Meeres. Sie war das Tor zum Ozean und daher eine bedeutende Handelsstadt.“ Falo schaute nach Westen, doch die Bäume versperrten die Sicht.
„Du weißt viel über Benedor“, sagte sie, um die kleine Flamme ihres Gespräches nicht erlöschen zu lassen.
„Ich bin viel gereist und habe viele Orte Brindirions gesehen“, entgegnete er achselzuckend.
„Bist du auf eigene Faust hierher unterwegs gewesen, oder …?“ Sie entschied sich, die Frage offenzulassen.
Er sah sie einen Augenblick lang abschätzend an und setzte dann zu einer Antwort an, wurde aber von dem Herannahen des Wolfsritters unterbrochen.
„Morgen erreichen wird Habdurad oder Ariond Naram in Eurer Sprache. Dort residiert Isul von Goor, niemand, der für seine Geduld bekannt ist. Ich rate Euch, ihm gegenüber aufgeschlossener zu sein. Und dies nicht zuletzt aus Respekt vor dem guten Ruf des Hauses Alobahr, von dem Ihr mit Sicherheit abstammt“, wandte sich der Wolfsschädel an Shintra.
„Eure ritterliche Verehrung geht nicht so weit, mich meiner unangemessenen Einschränkungen durch Fesseln zu entledigen?“, fragte sie und versuchte sich an einem Lächeln, das ihre Verehrer einst hatte erröten lassen.
Meine Verehrer, dachte sie. Ich hatte Verehrer – zumeist ziemliche Gecken und Maulhelden, aber es gab sie.
„Galanterie muss sich der Befehlstreue beugen“, beschied der fremde Ritter und fuhr mit bedrohlichem Unterton fort.
„Was für Euch gilt, gilt aber keineswegs für diesen Streuner. Meine Kromkundschafter haben noch eine Rechnung mit ihm offen, und es würde mich nicht wundern, wenn sie diese heute Nacht zu begleichen trachten.“
Mit diesen Worten zog er an den Zügeln seines Rappen und preschte zurück an die Spitze des Zuges.
„Was meint er damit?“, fragte sie Falo leise.
Falos Gesichtszüge lächelten, obwohl seine Augen freudlos blickten.
„Ich habe zwei von ihnen erwischt, und je nach Ansehen dieser Krieger sind die restlichen um das Befinden der beiden im Jenseits besorgt. Also werden sie ihnen einen willigen Sklaven nachsenden wollen – mich.“
„Dabei bist du kein guter Diener, so wenig zuvorkommend und viel zu eigensinnig“, setzte sie spitz nach.
Er musste lächeln, und diesmal erreichte es seine Augen.
„Der Wolfsritter scheint dich für eine Adlige zu halten“, sagte Falo kurze Zeit später.
Shintra antwortete nicht. Auch ihr war der Wechsel der Anrede aufgefallen, allein sie wusste noch keinen Reim darauf. „Im Gegensatz zu dir“, entgegnete sie, um ihn zu necken. Doch Falo sah sie nur nachdenklich an.
Sie kamen um eine Biegung am Ende des Wäldchens, das sie seit geraumer Zeit durchquerten, als ein lauter Schlag und dann ein Zischen zu hören waren.
Ein gewaltiger Baum fiel krachend auf die Straße, und die Pferde der vorderen Reiter stiegen wild wiehernd. Die Führer ihres Wagens schrien auf und zogen die Zügel an. Dann ging alles sehr schnell. Das Knallen schwerer Armbrüste drang aus dem Wald, und surrende Geschosse schlugen in Pferde, Menschen, Kroms und Bäume. Schreie ertönten, und die Nordlinge wandten sich zu dem Gefährt, um einen Schildwall um es herum zu bilden.
Einige tote Kroms lagen auf dem Boden, die anderen sprangen hin und her, um schlechte Ziele abzugeben, und grunzten Flüche und Herausforderungen.
Dann erschallte eine tiefe Stimme aus dem Dickicht auf der linken Seite.
„Legt die Waffen nieder, ihr verdammten Talratten, oder meine Jungs veranstalten ‛ne Runde Zielschießen auf euch!“
Der Wolfsritter zischte einige Worte, und die Krieger im Schildwall gingen auf die Knie, um weniger Angriffsfläche zu bieten. Die Kroms setzten ihren bizarren Kriegstanz fort.
„Na schön“, ertönte die grollende Stimme wieder, „ganz wie ihr wünscht … schießt, Jungs!“ Und dann knallten die Armbrüste erneut.
Falo lag quer vor Shintra. Er hatte sie nach unten gerissen, als die ersten Bolzen durch die Luft schwirrten. Ein Bolzen war zwei Finger weit von ihrer Nase in das Geländer ihres Gefährts geschlagen, und sie hätte schwören können, dass sie ranziges Fett riechen konnte. Trotz des Schreckens brachte sie der Gestank kurz zum Grinsen. Die Burschen schossen wohl mit ihrem Kochbesteck. Ihre Freude währte allerdings nicht lang, als der nächste Bolzen zwischen ihre Handfesseln schlug und sie an den Bretterboden des Karrens nagelte.
„Bleib ruhig liegen!“, rief Falo unsinnigerweise.
Sie sah ihn nur entnervt an und sparte sich die Replik. Ein dritter Bolzen heftete das untere Ende ihres Wamses an das Geländer.
„Wenn das ein Rettungsversuch sein soll, möchte ich die Burschen nicht bei einem Vernichtungsangriff erleben“, murmelte Falo.
Ein wohlbekanntes Klicken ließ Falo schlagartig verstummen.
In dem Moment stürzten etliche gedrungene Gestalten aus dem Dickicht hervor. Die Nordlinge stimmten einen wütenden Kampfschrei an, froh, endlich jemanden vor sich zu haben, gegen den sie kämpfen konnten.
„Schildwall halten, vorwärts marsch!“, bellte der Wolfsreiter, der sogleich eine Antwort vom Anführer der Angreifer erhielt.
„Halt‛s Maul, Wolfsschnauze! Keilformation!“, brüllte er, und die Gestalten tummelten sich zu einem Keil.
Wieder erklang das Klicken, und Shintra wandte sich dem Geräusch zu. Der Anblick, der sich ihr bot, wischte ihre aufkommende Hoffnung fort. Ein riesiges, rot geädertes Auge starrte sie an, und darunter klaffte ein hässliches Maul mit haifischartigen Zahnreihen. Zwei dürre Arme mit kleinen Greifscheren erschienen, und die Scheren schlugen schnell aneinander.
„Schau nicht in das verdammte Auge!“, rief Falo und zog an ihrem Arm. Geschockt und zugleich fasziniert versuchte sie, seiner Aufforderung zu folgen, doch es war schon zu spät. Irgendetwas war im dunklen Grund des Auges, dessen Iris einer Teerpfütze mit öligen Farbschlieren glich, aus dem ein dumpfes Violett hervorkam, pulsierend in spiralförmigen Windungen. Sie folgte mit ihrem Blick dem violetten Schein und wurde unweigerlich ruhiger. Es tat gut, die Erregung aller Sinne hinter sich zu lassen. Ein Gedanke machte sich in ihr breit. Ein Gedanke, der sanft gesprochen durch ihren Kopf klang.
Bald, bald bist du in Sicherheit.
Sie starrte immer noch gebannt in das Auge des Orad Jha, dessen runzlige Lider sich nun halb senkten. Und im Halbmond seines Auges sah sie sich selbst, zum ersten Mal seit …
Zum ersten Mal seit dem Ball in Imbrath. Wie hatte sie das nur vergessen können? Der Prunk des Fürstensaals, die wunderschöne Braut und der Bräutigam. Es war die Hochzeit des Grafensohns von Brunn, Wigo aus dem Hause Brunn und Aylin der Schönen gewesen, der einzigen Tochter Fürst Tirlahns. Das Mitsommerlicht schien in tausend Farben durch die prächtigen Buntglasfenster, die Flötenmusik der Musiker, die allesamt Hirten waren, erfüllte die nach Akazien und Wacholder duftende Luft mit leichtem Klang, der die schweren Töne der Hörner umspielte, so wie Schmetterlinge die großen Feldlilien umschwirrten. Sie hatte getanzt mit ihrem Verehrer, mit Gelrond, in einem Saal voller Spiegel ...
Ein grässliches Kreischen riss sie abrupt aus ihren Erinnerungen, und das wohlige Gefühl verblasste mit dem Bild, das sich ihr bot: Das Auge des Orad Jha bestand nur noch aus einer blutenden seimigen Masse, aus der ein Armbrustbolzen ragte.
Das Biest verschwand aus ihrem Gesichtsfeld, und schlagartig kam ihr die bedrückende Wirklichkeit wieder zu Bewusstsein. Rings um sie herum tobte ein mörderischer Kampf, mehrere Nordlinge lagen tot auf dem Boden. Die Kroms waren ebenfalls tot oder geflohen. Nur noch eine Gruppe von acht Mann in Kreisformation um den Wolfsritter herum leistete den gedrungenen Kriegern erbitterten Widerstand.
„Legt die Waffen nieder, und wir verschonen euch!“, brüllte der Anführer der Angreifer. Auch sie hatten Verluste erlitten, wenngleich nur wenige Krieger.
Die verbliebenen Nordlinge hielten inne, und der Wolfsritter sprach keuchend und durch den Helm blechern: „Tut, was er sagt.“
Die Schwerter und Schilde fielen scheppernd zu Boden, und der Wolfsritter sank in die Knie. Er blutete aus mehreren Wunden, wenngleich nicht stark. Die Angreifer sammelten die Waffen ein und begannen die Nordlinge zu fesseln. Einer kniete sich neben den Wolfsritter und musterte dessen Wunden. Der Anführer blickte in die Runde, grollte ein paar Befehle in einer fremden Sprache und kam schließlich auf den Wagen zu.
„Es ist mir ein Vergnügen, Euch aus dieser misslichen Scheiße zu befreien, Teuerste.“ Ein bärtiges Gesicht mit wirrem Haupthaar und zwei strahlenden, nussbraunen Augen lugte über den Wagenrand.
„Arlin, Brom, kommt her und befreit die Dame und den Burschen“, rief das strahlende Gesicht seinen Mitstreitern zu. Rasch kamen zwei der Kerle herbei, sprangen auf den Wagen, lösten ihnen die Fesseln und zogen ein wenig verlegen die Bolzen aus dem Holz.
Shintra rieb sich die wunden Gelenke und stieg vorsichtig vom Wagen.
„Galaptinin, stets zu Diensten.“ Der Anführer machte eine tiefe Verbeugung vor ihr und offenbarte eine hübsche Glatze, die sich auf seinem Hinterkopf ausmachte wie eine von dichtem Urwald umstandene Hügelkuppe. Nun wurde Shintra auch der Größenunterschied bewusst, denn der kräftige Kämpfer ging ihr gerade bis zum Schlüsselbein. Zwerge, dachte sie mehr als verblüfft.
„Habt Dank“, brachte sie hervor, und einige Fragen gingen ihr durch den Kopf. Wer waren ihre Retter? Konnte sie ihnen trauen? Was sollte sie ihnen sagen?
„Auch ich danke Euch, Galaptinin, doch war Euer Einsatz umsonst, wenn wir nicht gleich aufbrechen und einen sicheren Ort aufsuchen“, meldete Falo sich zu Wort.
Eindringlich musterte Galaptinin ihn und nickte dann zustimmend. „Du hast Recht. Die verdammten Glupschaugen haben sich unser Kämpfchen angesehen. Schätze, dass schon jetzt ein Haufen Kroms auf dem Weg zu uns ist“, bestätigte Galaptinin mit Blick auf den Kadaver des Äuglers.
„Wir müssen auf dem schnellsten Weg zur Zwergenpforte. Bleibt auf dem Wagen, bis ihr wieder zu Kräften gekommen seid – nun heißt es, so rasch zu fliehen, wie wir zuvor erfolgreich gekämpft haben, bei Batur, mögen meinen räudigen Kazlir Flügel an den krummen Beinen wachsen.“
Rasch waren die Vorbereitungen getroffen. Es blieb nur zu überlegen, was mit dem Wolfsritter zu tun sei. Die Versuche, ihm den Helm abzunehmen, waren vergeblich gewesen. Ein Axthieb hatte den Nackenschutz in die Halsberge gedrückt. Also öffnete Galaptinin das Visier und grinste in das im Schatten liegende Gesicht.
„Die Wolfsschnauze hat mir besser gefallen. Hör zu, Wolfsritter. Sag deinem Herrn, dass die Hazlad Arrad der Dame zu Diensten stehen. Also lasst ihr sie besser in Ruhe.“
„Wir nehmen ihn mit! Er soll uns ein schönes Sümmchen Lösegeld bringen“, forderte ein mürrischer Zwerg aus den Schlitzen seines Topfhelms.
„Er ist zu schwer und hält uns nur auf. Das Lösegeld werden wir von seinen Verfolgern nicht kriegen!“, entgegnete ein anderer.
„Das stimmt. Nun, dann nehmt mit, was wir stattdessen tragen können und …“ Galaptinin wandte sich wieder an den verletzten Ritter. „Es bleibt keine Zeit für Höflichkeiten, Wolf. Dein Schicksal liegt in Garuns Hand.“ Er warf dem an einem Baumstamm lehnenden Ritter und den verbliebenen Nordlingen einen Beutel mit Proviant und einen Wasserschlauch hin.
„Abmarsch!“, dröhnte Galaptinin, und der Trupp setzte sich mit erstaunlicher Geschwindigkeit entlang der Straße nach Südosten in Bewegung. Zwei Pferde zogen den Wagen, auf dem Falo und Shintra neben Galaptinin saßen. Der Zwerg hielt die Zügel und rief seine Leute zur Eile.
Es zeigte sich, dass es etwas mehr als vierzig Krieger waren, die Galaptinin befehligte. Sie waren zäh und grimmig, mit langen Bärten und zu Zöpfen geflochtenem Haar. Ihre Ausrüstung bestand aus guten Kettenhemden, Helmen aus Stahl und Äxten, sowie eben jenen Armbrüsten, die ihnen den Sieg über die Nordlinge gebracht hatten.
„Was machen die Krieger der Hazlad Arrad so weit in Benedor?“, fragte Falo nach einer Weile.
„Wir sind ausgesandt worden!“
„Von wem und warum?“
„Von meinem Befehlshaber, dem ehrenwerten Kommandanten von Brahns Pforte. Er befahl mir, nach Überlebenden des Falles von Alobahrs Feste zu suchen“, erklärte Galaptinin grimmig. „Aber nicht, wer uns aussandte, ist wichtig, sondern wen wir finden sollten.“
„Und wen solltet ihr finden?“, stellte Falo nach einer Weile erwartungsvollen Schweigens die Frage, die beiden auf der Zunge brannte.
„Zaiella von Tuhr.“
„Wer soll das sein?“, fragte Shintra überrascht.
„Ihr, Verehrteste. Warum auch immer Ihr das nicht zu wissen vorgebt“, trällerte Galaptinin, offensichtlich um Contenance bemüht.
„Zaiella …“, sie probierte den Namen aus, als wäre er ein Schlüssel zur versperrten Kammer ihrer Erinnerung. Sie hörte den Klang, vernahm aber kein Echo aus dem Dunkel ihres Vergessens. Entweder war ihre Amnesie so stark, dass ihr Namensgedächtnis erloschen war, oder es stimmte etwas nicht mit diesem Namen. Unsicher sah sie zu Falo. Der nickte ihr wohlwollend zu und wandte sich dann wieder dem Hauptmann der Kriegerschar zu.
„Seltsam, woher wusstet Ihr, dass Zaiella hier zu finden sei?“
„Nicht dass Ihr beiden mich für maulfaul haltet, Kinder, aber Eure Fragerei beginnt mir leicht auf die Nerven zu gehen. Wir machen es so: Ich erzähle Euch jetzt, was ich weiß, und dann seid Ihr dran mit der Unterhaltung. Und unterbrecht mich nicht!“ Mürrisch blickte Galaptinin sie nacheinander an. Dann hob er die rechte Gesäßseite leicht an und ließ donnernd einen Wind fahren.
„Also, nachdem wir auf der Wache vom Unglück der letzten Festung Benedors gehört hatten, sandten wir Kundschafter aus, um die Lage zu überprüfen. Flüchtlinge brachten wir in die Sicherheit der Zwergenpforte, doch der Graf und seine Familie waren nicht darunter.
Also war klar, dass das Grafengeschlecht zu Benedor erloschen war. Die Kroms saßen nun auf Alobahrs Feste, und Nachrichten darüber wurden von uns zu unserem König nach Trondlund gesandt und ebenfalls zum König Brindirions, Heretorn, Eurem Regenten. Wir verschlossen die Zwergenpforte und ließen von Zeit zu Zeit Flüchtlinge passieren.
Tja, wie zu erwarten war, kam der Befehl von Trondlund, die Pforte auf einen Ansturm durch die Nordlinge vorzubereiten, jetzt, da das letzte Bollwerk Benedors gefallen war. Verstärkungen trafen ein, und die Wache wurde verdoppelt. Da tauchte wie aus dem Nichts jemand auf, und mir wurde aufgetragen, mit meiner Truppe nach einer gewissen Zaiella Ausschau zu halten.“ Er blickte sie scheel an.
„Dieser Jemand beschrieb Euch meinem Kommandanten und merkte noch an, dass Ihr in Gesellschaft eines … Waldläufers seid.“ Diesmal versah er Falo mit einem abschätzenden Blick.
„Und seht, Ihr Begriffsstutzigen, da sind wir“, beendete er seine Ausführungen.
„Danke Euch, Galaptinin, nun wissen wir, wie es zu unserer Rettung kam“, murmelte Zaiella und fühlte sich nicht viel klüger als zuvor.
Wenigstens habe ich jetzt einen Namen, nur dass er sich anhört, als gehöre er zu einer anderen Person…
Kerzenlicht
Es war Abend geworden.
Müde begab Roman sich zu Bett, seine Knochen schmerzten von einem langen Tag auf dem Feld. Mittlerweile war sein Vater zu alt für die Feldarbeit, es blieben also nur die beiden Knechte und er.
Roman nahm die große Talgkerze und entzündete sie am glimmenden Kaminfeuer. Er trug das Licht vorsichtig auf den Baumstumpf, der neben seiner Strohmatratze stand. Das warme Licht hüllte seine Schlafstätte ein, und mit einem Seufzer ließ er sich nieder, nachdem er seine verschwitzten Kleider abgelegt hatte. Die Fensterläden waren geöffnet, und die kühle, würzige Nachtluft strömte ein und brachte sein Licht zum Flackern. Also erhob er sich noch einmal grunzend und schloss die grob gezimmerten Läden.
Wieder im Bett sah er den Schatten bei ihrem Tanz zu, ein Lichtspiel, das er nie müde wurde zu beobachten. Da waren Tänzerinnen, die sich mal in fließenden, anmutigen Bewegungen bewegten, dann wieder ausbrachen zu zackigen, schnellen Sprüngen und Verrenkungen.
Die Kerze hatte seine Mutter gedreht und ihm wie jedes Jahr zum Geburtstag geschenkt. Die Mägde und anderen Leute auf dem Hof machten sich darüber lustig. Ein erwachsener Bursche im Glanze von Kraft und Jugend, und seine Mutter beschenkte ihn wie ein kleines Kind mit einer Jahreskerze.
Ihn wurmte das, doch wenn er abends im Schein des Lichtes lag, erkannte er die Größe dieses Geschenkes, und so wünschte er es sich von Jahr zu Jahr von Neuem.
Manchmal, so kam es ihm vor, waren auch Botschaften im Spiel der Schatten, Dinge, die geschehen würden. Allein, er verstand sie nicht, und ihm war es auch genug, dem Schauspiel bloß zuzusehen, ohne dass er ihm Sinn und Bedeutung verleihen musste.
Eine Zeit lang hatte er eine immer wiederkehrende Gestalt als großen Schatten zu erkennen geglaubt, doch als er beschlossen hatte, die Gestalt mit Kohle auf ein Buchenbrett zu zeichnen, war sie nicht mehr erschienen, hatte sich nicht mehr aus den Schattenformen herausgelöst. Das Brett und die Kohle lagen seitdem verstaubt neben dem Stumpf.
Auch heute erschien sie nicht, doch wirkten die Schatten heute anders, sie wurden größer, das Licht schwand. Roman blickte schläfrig zu der Kerze und sah, dass der Docht im flüssigen Wachs zu ersaufen drohte. Er goss das Wachs aus der Mulde, in die sich das Feuer gefressen hatte, und die Flamme wurde wieder größer.
Doch nicht für lange Zeit. Wieder wuchsen Schatten und Dunkelheit, und so wollte er schon abermals das Wachs abtropfen lassen, da sah er etwas Sonderbares. Der Docht war frei, das Licht hätte auflodern können, doch trotzdem wurde es kleiner und kleiner, bis nur noch ein Lichttropfen auf dem Docht glomm. Starr blickte er darauf, und alle Gedanken verließen ihn. In dem Leuchten war winzig klein ein Herz aus blauem Glimmen. Es hatte nur wenig Kraft und schien dem Ende entgegenzudämmern.
Roman starrte auf die sterbende Flamme und löste sich eine unbestimmte Zeit lang nicht mehr davon. Dann spürte er in sich den Wunsch, dass es nicht sterbe, das kleine Licht. Der Wunsch war mächtig wie ein reißender Strom, der das Becken, in das er schoss, schon bald überschwemmte.
Immer noch starrten seine geweiteten Pupillen auf das winzige Glimmen, das nunmehr von Dunkelheit erdrückt wurde.
Da sprudelte der Wunsch nach Licht aus ihm heraus, und ohne ein Wort dafür zu kennen, öffnete er den Mund. Ein Laut formte sich, ungestalt und keinem Worte gleich, löste sich von seinen Lippen, während seine Augen immer noch starr auf den letzten Funken stierten.
Das Licht erstarb, und Rauch zog auf, doch im nächsten Augenblick stieg klein und zögernd das Flämmchen wieder empor und wuchs zum Kerzenlicht heran. Immer weiter stieg die Flamme, bis sie eine flackernde Lohe war und wuchs, bis dass sie eine Elle hoch schlug. Das Wachs an ihrem Grunde zischte und kochte, und das Licht war strahlend und hell.
Mit einem Mal wandte Roman den Blick ab und rieb sich die Augen, sein Denken kehrte zurück, und er erschrak und wollte die Flamme ersticken.
Doch als sich die Augen wieder ans Licht gewöhnt hatten und er die Hand nach dem Nachtbecher streckte, sah er, dass die Flamme ganz gewöhnlich auf dem Docht hüpfte, vielleicht einen Zoll hoch, und nichts erinnerte mehr an die Flammensäule. Roman blinzelte und dachte, dass die Müdigkeit ihn wohl genarrt hatte. Er blies die Kerze aus, wühlte sich in sein Strohbett und schlief erschöpft vom Tage ein. Alle Schatten wuchsen zu einem Großen an, und dieser nahm kurz die Form an, die Roman auf sein Buchenbrett hatte zeichnen wollen, bevor die Dunkelheit alle Schatten verband.
Der Morgen graute, als Roman aufwachte und sich den Schlaf aus den Augen rieb. Die Träume der Nacht waren wirr gewesen, keine Bilder, die ein Muster ergeben könnten, eher sich abwechselnde, zufällig aufeinanderfolgende kurze Einblicke. Roman erinnerte sich, im Traum mit seinem Vater auf den Feldern gewesen zu sein, dann wieder an eine hektische Flut aus vorbeiziehenden Bäumen und Sträuchern, wie bei einer schnellen Reise zu Pferde, bloß dass er eine solche noch nie unternommen hatte. Das Panorama des Südtals, in dem ihr Hof lag, wurde abgelöst von Flammensäulen am hügeligen Horizont. Dann waren Flüchtlingsscharen zu sehen, die mit Wagenzügen die Straße nach Westen entlang zogen. Gefolgt vom karminrot beschienenen Bild der tanzenden Gestalten beim Jurlefest im letzten Sommer.





























