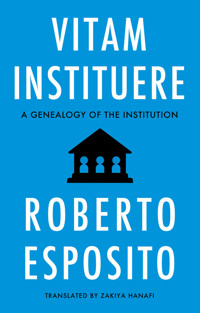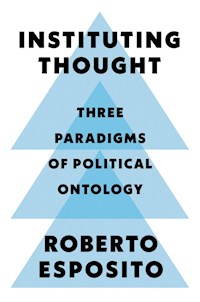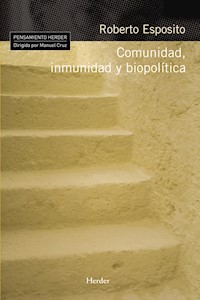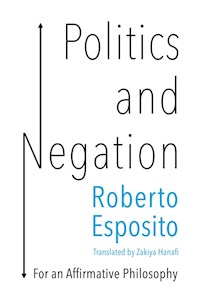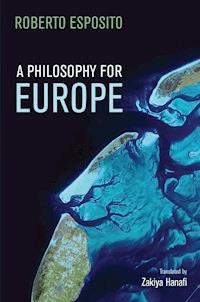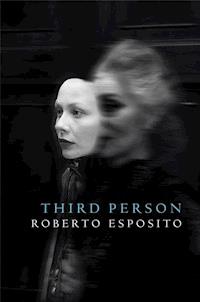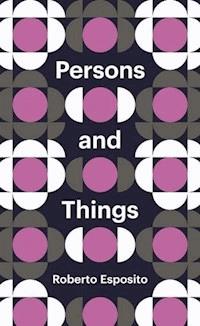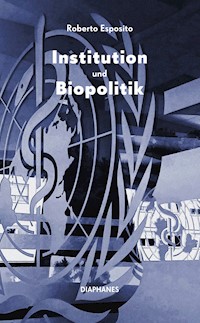
14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diaphanes
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
In Zeiten von Pandemie und Klimawandel, da die Weltbevölkerung von volatilen Nationalregierungen und transnationalen Konzernen nur auf sehr unzuverlässige Weise repräsentiert und geschützt wird, müsste Institutionen eigentlich eine bedeutende Rolle zukommen. Zu allem Überfluss aber scheint alles Institutionelle an seinen eigenen, schon lange diagnostizierten Unzulänglichkeiten zu laborieren und eher Teil des Problems zu sein, als zur Lösung der vielfältigen Menschheitsherausforderungen beitragen zu können.
In seinem neuesten Buch geht Roberto Esposito dem bedrohlich schwindenden Vertrauen in das Wesen von Institutionen auf den Grund und plädiert für eine radikale Revision der Auffassung, wonach scheinbar starre Institutionen und soziale Bewegungen in notwendigem Widerstreit zueinander stünden. Vielmehr gilt es, das Verhältnis von Leben und Politik gänzlich neu zu denken und mit einem affirmativen Blick auf die Kraft des Instituierens die daraus neu erwachsenden Handlungsmöglichkeiten zu erschließen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 137
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Institution und Biopolitik
Roberto Esposito
Institution und Biopolitik
Aus dem Italienischen von Marie Glassl
DIAPHANES
Titel der Originalausgabe:Istituzione
© 2021, Società editrice il Mulino, Bologna
Questo libro è stato tradotto grazie ad un contributo alla traduzione assegnato dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale italiano.
Die Übersetzung dieses Buches wurde durch das italienische Ministerium für auswärtige Angelegenheiten und internationale Zusammenarbeit gefördert.
© DIAPHANES, Zürich 2022
Alle Rechte vorbehalten
eISBN 978-3-0358-0456-0
Satz und Layout: 2edit, Zürich
Druck: Steinmeier, Deiningen
www.diaphanes.net
Inhalt
In Form eines Prologs
Die Verdunkelung
Von der Pandemie
Institutionen und Bewegungen
Die Erfindung der Natur
Souveräne Institutionen
Die Wiederkehr
Soziologie
Recht
Philosophie
Politik
Produktivität des Negativen
Ende der Vermittlung
Prothesen des Menschlichen
Instinkte und Institutionen
Soziales Imaginäres
Jenseits des Staates
Institution ohne Souverän
Das Recht der Privaten
Subversive Gerechtigkeit
Jenseits des Staates?
Institutionen und Biopolitik
Biopolitik
Doppelte Geburt
Unpersönliches Recht
Die Instituierung des Lebens
Epilog
»Die Institutionen sind die Garantie der Regierung eines freien Volkes gegen die Verderbnis der Sitten, und die Garantie des Volkes und der Bürger gegen die Korruption der Regierung.«
Louis Antoine de Saint-Just
In Form eines Prologs
»Vitam instituere«
In einer entlegenen, aber entscheidenden Ecke unserer Tradition stellt das Lemma vitam instituere, das die humanistische Kultur mit einem Text des römischen Juristen Marcianus verbunden hat, eine noch ungelöste Frage. In ihrem Mittelpunkt steht die rätselhafte Beziehung zwischen Institution und menschlichem Leben.1 Es gilt der wiederkehrenden Versuchung zu widerstehen, diese als zwei divergierende Polaritäten zu betrachten, die nur kollidierend aufeinandertreffen. Vielmehr müssen wir in ihnen die beiden Seiten einer einzigen Figur erkennen, welche sowohl den vitalen Charakter der Institutionen wie auch die instituierende Potenz [potenza istituente] des Lebens umfasst. Was sonst ist das Leben, wenn nicht kontinuierliche Instituierung, also die Fähigkeit, sich auf unbekannten und unerforschten Wegen immer wieder neu zu erschaffen? In diesem Sinne ist Hannah Arendts Ausspruch zu verstehen, dass die Menschen nie aufhören etwas Neues zu beginnen: Durch den Akt der Geburt in die Welt gekommen, sind sie selbst die Verkörperung eines Anfangs.
Auf diesen ersten Beginn folgt ein zweiter, begründet im Vermögen zur Sprache, die als zweite Geburt betrachtet werden kann. In ihr hat die Stadt ihren Ursprung sowie das politische Leben, das den Horizont der Geschichte eröffnet, ohne jedoch jemals den Faden zu kappen, der sie an ihre biologische Wurzel bindet. So sehr sie sich auch unterscheiden, die Ordnung des nomos hat sich dochnie völlig von der des bios getrennt. Im Gegenteil, die Beziehung zwischen beiden ist stetig enger geworden, sodass es heute unmöglich ist, von »Politik« zu sprechen, ohne Bezug auf das Leben zu nehmen. Die Institutionen stehen im Mittelpunkt dieser Entwicklung, sie bilden die Verbindung, durch die Recht und Politik verschiedene Gesellschaften formen, sie unterscheiden und zwischen ihnen vermitteln.
Noch unter dramatischsten Umständen hören Menschen nicht damit auf, das Leben zu instituieren, seine Grenzen und Ziele, Gegensätze und Möglichkeiten neu zu definieren. Und zwar von dem Moment an, da das Leben selbst sie eingesetzt hat; eingeschrieben in eine geteilte Welt, die völlig in eins fällt mit den Symbolen, die sie beschreiben. Diese symbolische Dimension, welche die Institutionen nicht weniger formt als sie von ihnen geformt wird, ist nichts, was dem menschlichen Leben von außen hinzugefügt würde, sondern gerade dasjenige, was es zu einem ebensolchen macht und es von jeder anderen Art von Leben unterscheidet.
Nach einer berühmten Formulierung von Walter Benjamin ist kein menschliches Leben jemals reduzierbar auf das reine Überleben, auf ein »nacktes Leben« oder »bloßes Leben«. Es gibt immer einen Punkt, an dem dieses über die reinen Grundbedürfnisse hinausragt und eintritt in das Reich der Wünsche und Entscheidungen, der Leidenschaften und Projekte. Als immer bereits instituiertes ist das menschliche Leben nie bloß einfache biologische Materie, selbst wenn es von der Natur oder der Geschichte bis auf seinen Grund zertrümmert wird. Noch in diesem Fall offenbart das Leben, solange es ein solches ist, eine Seinsform, die – wie sehr sie auch verformt, geschändet, mit Füßen getreten wird – immer bleibt, was sie ist: Lebensform. Was dem Leben diese Qualität verleiht, ist seine Zugehörigkeit zu einem historischen Kontext, der aus sozialen, politischen und kulturellen Beziehungen besteht. Was uns von Anfang an bestimmt und was wir selbst immer wieder neu etablieren, ist das Beziehungsgeflecht, in dem unsere Handlungen für uns und für andere Bedeutung erlangen.
Vorausgesetzt natürlich, man bleibt am Leben. Um sich entfalten zu können, setzt das Leben mit anderen den Erhalt des biologischen Lebens, die Möglichkeit des Überlebens, voraus. Es gibt keinen reduktionistischen Beiklang im Begriff des »Überlebens«, der in den aktuellen Ängsten und Hoffnungen so präsent und zugleich tief in der gesamten Menschheitsgeschichte verankert ist. Die Frage der conservatio vitae steht imZentrum der gesamten klassischen und modernen Kultur. Sie schwingt in der christlichen Forderung nach der Heiligkeit des Lebens ebenso mit wie in der von Hobbes eingeführten politischen Philosophie und den Problemen der zeitgenössischen Biopolitik. Am Leben zu bleiben ist die vorrangige Aufgabe, zu der die Menschen aller Gesellschaften aufgerufen sind, in einem Kampf, der nicht immer gewonnen, sondern in der Tat regelmäßig verloren wird und der manchmal mit unerwarteter Gewalt wiederkehrt.
Diese Verteidigung geht jeder anderen Möglichkeit voraus, ist deren Bedingung und Voraussetzung. Doch nach diesem ersten Leben, gemeinsam mit diesem, müssen wir auch das zweite Leben verteidigen, dasjenige, das instituiert wurde und das fähig ist, zu instituieren. Deshalb können wir, um am Leben zu bleiben, nicht auf das andere Leben, das Leben mit anderen, verzichten – hierin liegt der tiefste Sinn der communitas. Dies gilt auf der horizontalen Ebene der Gesellschaft ebenso wie auf der vertikalen Linie der Generationen. Die primäre Aufgabe der Institutionen besteht nicht nur darin, einer sozialen Gemeinschaft das Zusammenleben in einem bestimmten Gebiet zu ermöglichen, sondern auch darin, Kontinuität im Wandel zu gewährleisten und das Leben der Eltern in dem der Kinder fortzusetzen. Auch auf diese Notwendigkeit lässt sich die Bedeutung der institutio vitae zurückführen. Noch vor ihrem funktionalen Gebrauch antworten die Institutionen auf das Bedürfnis der Menschen, etwas von sich selbst über das eigene Leben – den eigenen Tod – hinaus zu projizieren und so die erste Geburt in der zweiten zu verlängern.
_______________
1 Yan Thomas: Les opérations du droit, Paris 2011.
Die Verdunkelung
Von der Pandemie
Es ist dieses tiefe Band zwischen Institution und Leben, das die Corona-Pandemie mit unerwarteter Gewalt zu zerreißen droht. Über ihre Phänomenologie ist bereits viel geschrieben worden, mit Absichten und Argumenten, die hier nicht wiederholt werden müssen. Wir wollen unsere Aufmerksamkeit vielmehr auf die Beziehung zwischen dem Auftauchen des Virus und der Reaktion der Institutionen richten. Wenn es uns gelingt, den Blick von den tiefen Wunden zu lösen, welche die Pandemie dem Körper der Welt zugefügt hat, ist die Aufgabe, die jetzt vor uns liegt, jene, das Leben neu zu etablieren oder vielmehr: ein neues Leben zu instituieren. In dieser Aufgabe liegt eine Dringlichkeit, die jeder anderen – wirtschaftlichen, sozialen und politischen – Notwendigkeit vorausgeht, denn sie bildet den materiellen und symbolischen Horizont, aus dem alle anderen ihre Bedeutung ableiten. Nachdem das Leben monatelang vom Tod herausgefordert und zeitweise überholt worden war, scheint es ein instituierendes Prinzip zurückzufordern, das seine Intensität und Kraft wiederherzustellen vermag.
Doch dies ist nicht möglich, ohne zunächst die grundsätzliche Frage zu stellen, wie die Institutionen, insbesondere in Italien, auf die Herausforderung des Virus reagiert haben. Um darüber gerecht urteilen zu können, müssen Verallgemeinerungen vermieden und verschiedene Diskursebenen dargestellt und unterschieden werden. Sicherlich hat es in den Bemühungen regionaler, nationaler und internationaler Institutionen, das Übel einzudämmen, nicht an negativen Aspekten gefehlt – man kann sogar behaupten, dass diese zu bestimmten Zeiten überwogen. Es ist unmöglich, die Unzulänglichkeiten, Mängel und Verzögerungen zu vergessen, welche die ersten Interventionen kennzeichneten und teils irreparable Schäden, nicht nur auf sozialer, sondern – besonders in einigen Regionen – auch auf gesundheitlicher Ebene verursachten. Zu diesem Mangel an Entschlossenheit traten manchmal übermäßige – und nicht immer unabdingbare – Eingriffe in den individuellen Lebensstil hinzu, die mit erheblichen politischen, wirtschaftlichen und sozialen Kosten verbunden waren. Die Verschiebung der Grenzen zwischen Legislative und Exekutive zu Gunsten der Letzteren – bestimmt durch den nicht immer notwendigen, manchmal willkürlichen Einsatz von Notstandsdekreten – hat bisweilen zur Bedrohung des demokratischen Charakters jener politischen Systeme geführt, die sich in einem aussichtslosen Unterfangen bemühten, mit der Effizienz der drastischeren Prozeduren autoritärer Regime Schritt zu halten. In der zweiten Welle der Pandemie zeigten sich Fehlkalkulationen und Versäumnisse noch deutlicher, mit Auswirkungen, die wir erst später werden ermessen können. Ganz zu schweigen von der erschreckenden Zahl der Opfer in Italien, höher als in jedem anderen vergleichbaren europäischen Land.
Es ist jedoch nötig, die Frage nach der Rolle der Institutionen von der anderen Seite her zu stellen. Wie hätten wir den Angriff des Virus ohne diese überstanden? Was wäre in Italien und anderswo geschehen, ohne einen institutionellen Rahmen, um unser Handeln zu leiten? Unter diesem Gesichtspunkt muss man anerkennen, dass der Beitrag der Institutionen lange Zeit die einzige uns verfügbare Ressource zu sein schien. Ich beziehe mich dabei nicht nur auf die regionalen und nationalen Verwaltungen, sondern auf alle Institutionen der vom Virus befallenen Gebiete – von sozialen Einrichtungen bis zu Berufsverbänden und nichtstaatlichen Vereinigungen –, welche die letzte Bastion des Widerstands gegen die Pandemie gebildet haben. Wenn der Virus nicht alle Grenzen überschritten und sich völlig ungestört ausgebreitet hat, so liegt es im Wesentlichen an ihnen.
Natürlich wurde wie gesagt in einer Notstandssituation [stato di emergenza] gehandelt und damit, auch wenn die beiden Konzepte nicht deckungsgleich sind, in einem Ausnahmezustand [stato di eccezione] in Bezug auf die institutionelle Normalität. Aber dabei handelte es sich um einen nicht beizubehaltenden, erst nachträglich vom Parlament legitimierten Zustand. Dieser wurde nicht durch den souveränen Wunsch nach Ausweitung der Kontrolle über unser Leben verursacht, sondern durch eine Mischung aus Notwendigkeit und Zufälligkeit, völlig unvorhersehbar und gänzlich verschieden von einem Projekt, das auf die Versklavung der Bevölkerung abzielte. Wie die Juristen uns lehren, gehört die Notwendigkeit, neben dem Gewohnheitsrecht und den geschriebenen Rechtsnormen, zu den primären Quellen des Rechts. Es ist offensichtlich, welche Rolle in unserem Fall eine tragische Kontingenz und die daraus entstandene Notwendigkeit, diese einzudämmen, spielten. Es ist richtig, dass die Ausrufung des Notstands und die prophylaktische Reaktion auf diesen immer die subjektive Entscheidung derer ist, die dazu ermächtig sind. Aber in diesem Fall ist es schwierig, den Grad an Objektivität in Bezug auf ein Ereignis zu leugnen, das in seiner Entstehung und seinen Auswirkungen kaum etwas Vorsätzliches oder Geplantes an sich hatte.
Es ist unbestreitbar, dass in unseren zutiefst biopolitischen Regimen die Gesundheitsversorgung an der beunruhigenden Schnittstelle zwischen Politisierung der Medizin und Medikalisierung der Politik zu einer unmittelbar politischen Angelegenheit geworden ist. Ebenso wie die Sensibilisierung für Gesundheit im Vergleich zu allen früheren Gesellschaftstypen deutlich zugenommen hat. Aber dies scheint mir nichts Negatives zu sein. Dass das Recht auf Leben als die nicht zu hinterfragende Voraussetzung gilt, auf der alle anderen Rechte basieren, bezeichnet eine zivilisatorische Errungenschaft, hinter die wir nicht zurückgehen können. In jedem Fall darf das aktuelle biopolitische Regime nicht mit einem System verwechselt werden, in dessen Zentrum die Souveränität steht und von dem es eine entscheidende Modifikation darstellt. Die Vorstellung, dass wir einer unbegrenzten Macht ausgeliefert sind, die darauf abzielt, unser Leben zu kontrollieren, lässt außer Acht, dass die zentralisierte souveräne Entscheidungsmacht schon länger in tausende, von nationalen Regierungen weitgehend unabhängige und im transnationalen Raum angesiedelte Fragmente zersprengt ist.
Nun kann man sagen, dass die Institutionen in Italien – im Großen und Ganzen und mit allen oben genannten Einschränkungen – dem Angriff des Virus standgehalten haben, indem sie die ihnen eigenen immunitären Antikörper aktiviert haben. Wir wissen, dass jede immunitäre Reaktion, wenn sie über ein bestimmtes Maß hinaus verstärkt wird, Gefahr läuft, eine Autoimmunerkrankung auszulösen. Ebendies geschieht, wenn die Gesellschaft einer übermäßigen Entsozialisierung ausgesetzt wird. Das Problem unserer politischen Systeme ist es, ein kontinuierliches Gleichgewicht zwischen Gemeinschaft und Immunität, Schutz und Beschränkung des Lebens zu finden. Die spezifische Stärke und Flexibilität der Institutionen bemisst sich an ihrer Fähigkeit, den Grad der Verteidigung an die jeweilige Bedrohung anzupassen und diese dabei weder über-noch zu unterschätzen.
In den letzten Monaten waren die Institutionen Opfer unzähliger, häufig gegensätzlicher und einander widersprechender Polemiken und Argumentationen. Sie wurden einerseits für exzessive und andererseits für mangelnde Entscheidungskraft kritisiert. Von den einen wegen illegitimer Einschränkungen der individuellen Freiheit angeklagt, erschienen sie anderen unfähig, individuelle und kollektive Verhaltensweisen mit harter Hand zu verwalten. Ich möchte nicht die Legitimität solcher Kritiken anzweifeln, die sich in mehr als einem Fall bewahrheitet haben. Aber wir dürfen nicht aus den Augen verlieren, dass sich noch die schärfste Kritik an den Institutionen nur innerhalb derselben entwickeln kann. Was sonst sind Medien, Webseiten, Zeitungen und sogar Schrift und Sprache, wenn nicht ebenfalls Institutionen? Sicherlich von anderer Art als jene politischen und manchmal in explizitem Gegensatz zu diesen. Dennoch ist der Konflikt demokratischen Institutionen nicht fremd, er ist vielmehr die Grundlage ihrer Wirkungsweise.
Die instituierende Logik der Institution1 – oder vielmehr dessen, was wir als »instituierende Praxis« bezeichnen wollen – impliziert eine ständige Spannung zwischen Innen und Außen. Das, was außerhalb der Institutionen liegt, modifiziert die bestehende institutionelle Ordnung – fordert sie heraus, dehnt sie aus und verformt sie –, bevor es sich ebenfalls institutionalisiert. Die Schwierigkeit, diese Dialektik zu erkennen, gründet auf einer doppelt falschen Voraussetzung, auf welche die Polemik dieses Buches abzielt: die Tendenz, Institutionen allein mit staatlichen Institutionen zu identifizieren und sie zudem in statischen Begriffen und Zustandsbeschreibungen [termini statici, di »stato«] zu erfassen, statt in einem kontinuierlichen Werden.2 Vielmehr existieren, wie das Denken des juristischen Institutionalismus lehrt, nicht nur außerstaatliche, sondern auch antistaatliche, mit andersartigen Organisationsformen ausgestattete Institutionen wie beispielsweise Protestbewegungen. Diese äußern eine instituierende Kraft, welche auch die Institutionen in sich selbst am Leben erhalten müssten, um sich »mobilisieren« und in gewisser Weise über sich selbst hinausgehen zu können.
Institutionen und Bewegungen
Dieser doppelte Anspruch von Institutionalisierung und Mobilisierung verdunkelte sich vor allem während der 1960er und 1970er Jahre, als sich ein starrer Gegensatz zwischen Institutionen und Bewegungen etablierte. In der Debatte der letzten Jahrzehnte, sehen wir sie in zwei scheinbar unversöhnliche Pole gespalten, die sich in radikalem Gegensatz zueinander befinden. Auf der einen Seite die Rückkehr eines konservativen Institutionenmodells, das gegen jede Transformation resistent ist, auf der anderen die Profilierung anti-institutioneller Bewegungen, die sich nicht auf die Einheit eines gemeinsamen Projekts reduzieren lassen. Ergebnis einer ähnlichen Spaltung ist die immer deutlicher werdende Kluft zwischen Politik und Gesellschaft. Einer in sich geschlossenen institutionellen Logik, unfähig, mit der sozialen Welt in Verbindung zu treten, stellt sich ein Sammelsurium unterschiedlichster Proteste entgegen, ihrerseits nicht in der Lage, sich zu einer politisch wirkmächtigen Front zusammenzuschließen.
Symptomatisch für diese zugleich theoretische und praktische Schwierigkeit sind die negativen Folgen beider Tendenzen. Während die selbstreferenzielle Abschottung der Institutionen drastische anti-institutionelle Reaktionen provozierte, bewirkten diese wiederum eine weitere Erstarrung der Institutionen. Durch den prinzipiellen Ausschluss jedes vermittelnden Begriffs verstärkten sich konservative Institutionen und anti-institutionelle Praktiken wechselseitig und verhinderten somit jede politische Dialektik der Erneuerung. Nur wenige Denker waren in der Lage, dieser binären Logik zu widerstehen und einen Diskurs zu etablieren der es erlaubte, institutionelle Stabilität und gesellschaftlichen Wandel zu integrieren.
Selbst Michel Foucaults herausragende genealogische Überlegungen zur Kritik der Gefängnis- und Psychiatrieapparate setzten ein geschlossenes und repressives Konzept der Institution voraus. Nicht umsonst galt ihm dasjenige der »Einschließung« als generatives Paradigma jedes institutionellen Dispositivs. Trotz ihrer singulären analytischen Kraft schließen Foucaults Untersuchungen mit der Reproduktion eines Institutionenbegriffs, ähnlich dem der »totalen Institution«, den Erving Goffman zeitgleich in seinem berühmten Buch Asyle3entwickelte. Anders als Franco Basaglia – der einen ganz spezifischen Typus psychiatrischer Institutionen kritisierte und zu deren Abschaffung beitrug – neigte Foucault dazu, allen Institutionen einen repressiven Wert zuzuschreiben. In ihrer Gesamtheit stellten sie für ihn einen kompakten Block dar, bestimmt dazu, das Leben in überwachte und streng unterteilte Räume einzuschließen und natürliche Instinkte und Veranlagungen zu unterdrücken.
p>Foucaults Perspektive, obwohl reich an fruchtbaren hermeneutischen Einblicken, muss so in einen interpretativen Rahmen gestellt werden, der von einem breiten intellektuellen Spektrum geteilt wird. Diese geschlossene und defensive Konzeption der Institution vertreten in jenen Jahren rechte wie linke Autoren, wenn auch mit völlig gegensätzlichen Absichten: Die einen, um sie zu stärken, die anderen, um sie anzufechten und letztlich zu zerstören. Autoren wie Sartre, Marcuse und Bourdieu auf der einen, und Schmitt oder Gehlen auf der anderen Seite stimmen in ihrem statischen und hemmenden Verständnis der Institution subtil überein.