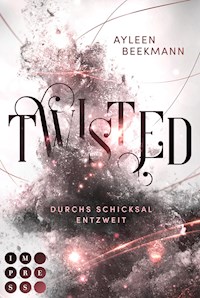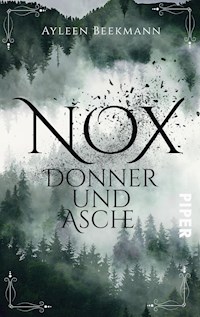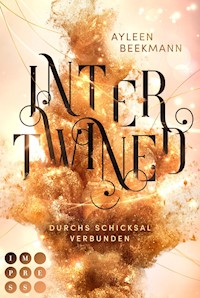
5,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Carlsen
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
**Wenn die Liebe nur ein versehentlich gesponnener Schicksalsfaden ist** Nichts wünscht sich die Londoner Schülerin Willow mehr, als das gewöhnliche Leben einer Teenagerin zu führen. Stattdessen ist sie als Tochter einer Schicksalsgöttin seit Kurzem dazu verdammt, das Schicksal der Menschen zu spinnen, und keineswegs gut darin. Gerade als sie sich mit ihrer Rolle abzufinden beginnt, spinnt sie versehentlich einen Liebesfaden zwischen sich und dem Hades-Sohn Maverick und verstößt damit gegen jede Regel ihrer Welt. Der einzige Ausweg aus dem Schlamassel ist eine Zusammenarbeit. Widerwillig lässt der attraktive Hades-Sohn sich darauf ein, doch er fordert einen hohen Preis. Willow bleibt keine Wahl, als darauf einzugehen, denn schließlich steht ihr Leben auf dem Spiel – und vielleicht auch ihr Herz … Londons verborgene Götterwelt – absolut lesenswert! //Der Götterroman »Intertwined. Durchs Schicksal verbunden« ist ein in sich abgeschlossener Einzelband, zu dem ein Spin-off in Planung ist. Alle Romane der Fantasy-Serie bei Impress: -- Intertwined. Durchs Schicksal verbunden -- Twisted. Durchs Schicksal entzweit Jeder Roman der Serie ist in sich abgeschlossen und kann eigenständig gelesen werden.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Impress
Die Macht der Gefühle
Impress ist ein Imprint des Carlsen Verlags und publiziert romantische und fantastische Romane für junge Erwachsene.
Wer nach Geschichten zum Mitverlieben in den beliebten Genres Romantasy, Coming-of-Age oder New Adult Romance sucht, ist bei uns genau richtig. Mit viel Gefühl, bittersüßer Stimmung und starken Heldinnen entführen wir unsere Leser*innen in die grenzenlosen Weiten fesselnder Buchwelten.
Tauch ab und lass die Realität weit hinter dir.
Jetzt anmelden!
Jetzt Fan werden!
Ayleen Beekmann
Intertwined. Durchs Schicksal verbunden
**Wenn die Liebe nur ein versehentlich gesponnener Schicksalsfaden ist**
Nichts wünscht sich die Londoner Schülerin Willow mehr, als das gewöhnliche Leben einer Teenagerin zu führen. Stattdessen ist sie als Tochter einer Schicksalsgöttin seit Kurzem dazu verdammt, das Schicksal der Menschen zu spinnen, und keineswegs gut darin. Gerade als sie sich mit ihrer Rolle abzufinden beginnt, spinnt sie versehentlich einen Liebesfaden zwischen sich und dem Hades-Sohn Maverick und verstößt damit gegen jede Regel ihrer Welt. Der einzige Ausweg aus dem Schlamassel ist eine Zusammenarbeit. Widerwillig lässt der attraktive Hades-Sohn sich darauf ein, doch er fordert einen hohen Preis. Willow bleibt keine Wahl, als darauf einzugehen, denn schließlich steht ihr Leben auf dem Spiel – und vielleicht auch ihr Herz …
Wohin soll es gehen?
Buch lesen
Vita
Danksagung
© privat
Ayleen Beekmann wurde 1998 in Ostfriesland geboren und fand zwischen Disney-Filmen und Lego-Steinen schnell die Liebe zu Geschichten. Sie liest Bücher und schreibt selbst, seit sie das Alphabet beherrscht. Ihre Protagonisten schubst sie gerne in fantastische Abenteuer und lässt sie dabei über die Liebe stolpern. Wenn sie gerade nicht schreibt, hat sie wahrscheinlich eine große Tasse Tee in der Hand und plant ihren nächsten Kurztrip nach London.
Für Doreen, Lisa und Viktoria.
Und für die Moiren-Töchter, die euch in mein Leben gebracht haben.
Eins
Die Schicksalsfäden werden mich eines Tages noch in den Wahnsinn treiben. Oder zum Schulabbruch zwingen. Sich auf eine Geschichtsklausur zu konzentrieren, ist nämlich verdammt schwierig, wenn alles um einen herum miteinander verwoben ist. Wortwörtlich. Blinzelnd reibe ich mir die Schläfen und versuche mich wieder auf Churchill und den Zweiten Weltkrieg zu konzentrieren. Ohne Erfolg.
Denn jeder einzelne Nerv meines Körpers findet den zarten Faden viel interessanter, der zwischen Adam und Robin wabert, jeweils an ihren kleinen Fingern befestigt. Keiner von beiden bemerkt ihn. Niemand außer mir kann ihn überhaupt sehen. Bis zu meinem sechzehnten Geburtstag konnte ich das genauso wenig. Aber jetzt ist er für mich ebenso real wie das Ticken der Uhr oder der Duft von Miss Prestons Kaffee, der sich vom Lehrerpult aus im Klassenraum verteilt.
Trotz der durchscheinenden Substanz des Fadens schimmert er schon leicht rot, obwohl er erst wirklich Farbe annimmt, sobald sich zwischen den Jungs Gefühle entwickeln. Das wird allerdings noch etwas dauern, schließlich habe ich den Liebesfaden erst gestern gesponnen. Wovon ich noch immer Kopfschmerzen habe.
Innerlich fluchend wende mich wieder meinem Test zu, doch es ist, als würde jede einzelne Schnur in diesem Raum an meinen Fingerspitzen kitzeln. Das Erwachen meiner Fähigkeiten habe ich mir wirklich einfacher vorgestellt. Großtante Holly hat nie irgendetwas von Kopfschmerzen oder kontinuierlicher Unkonzentriertheit erwähnt. Ganz im Gegenteil – sie hat behauptet, eine Moira zu sein, wäre wunderbar magisch. Eine Schicksalsgöttin oder eher gesagt eine ihrer Nachfahrinnen.
Pustekuchen. Fürchterlich anstrengend trifft es um einiges besser. Vermutlich erinnert sie sich mit ihren vierundachtzig Jahren bloß nicht mehr gut daran, wie sich ihre Kräfte kristallisiert haben.
Ich schrecke hoch, als ein Schicksalsfaden unerwartet über meinen Handrücken streicht und dabei all meine Nerven zum Schwingen bringt. Mir fällt der Füller aus der ohnehin schon zittrigen Hand. Einen Augenblick sehe ich noch, wie er über den zerkratzten Schultisch rollt, im nächsten kommt er klackernd auf dem Boden auf.
Das Geräusch klingt zwischen all dem leisen Papierrascheln unglaublich laut und lässt mich kurz resigniert die Augen schließen. Ich habe nicht die geringste Ahnung, wie ich Schule und Moiren-Dasein unter einen Hut bekommen soll.
Als ich die Lider wieder hebe, sieht mich ausgerechnet Maverick Bennington an, die Mundwinkel wie immer selbstgefällig verzogen. Ich werfe ihm einen bösen Blick zu, doch das hindert ihn nicht daran, mich weiterhin zu mustern. Ganz im Gegenteil, er legt sogar noch den Kopf schief, als wäre ich irgendein interessantes Zirkustier.
Seit meinem Geburtstag vor drei Wochen macht er das ständig. Denn obwohl er die ganzen feinen Schnüre im Klassenzimmer nicht selbst sehen kann, weiß er doch, dass ich es tue. Wie ich gehört er zu den Mythischen. Nur muss er sich nicht mit dem Spinnen von Schicksalen herumschlagen. Und er lässt keine Sekunde verstreichen, in der er mir nicht irgendwie unter die Nase reibt, dass ich bloß eine unscheinbare Moiren-Tochter bin und er ein ach-so-toller Hades-Sohn. Was auch immer daran toll sein soll, ein Nachkomme des Unterweltgottes zu sein. Außer vielleicht, dass sein Erbe nicht so nervige Pflichten mit sich bringt wie meines.
Ich verdrehe die Augen und wende den Blick ab. Zurück zu Churchill und den Alliierten. Nur mit Mühe kann ich ein Seufzen unterdrücken. Das hat doch so keinen Sinn. Die letzten Wochen habe ich mit so ziemlich allem verbracht außer Lernen. Oder zumindest nicht mit Lernen für die Schule. Stattdessen waren meine Tage gefüllt mit Silberschnüren und dem zögerlichen Spinnen der ersten Schicksale. Für Churchill blieb da beim besten Willen keine Zeit.
Resigniert starre ich eine Weile auf die Klausur, erwische mich jedoch wenig später dabei, einen Blick auf die Uhr zu werfen. Zehn Minuten vor Abgabe. Obwohl mich zu Hause wohl kaum eine bessere Alternative erwarten wird, kann ich einfach nicht länger hier sitzen und verzweifeln. Deshalb hoffe ich, mein bisher Geschriebenes reicht, und schiebe meinen Stuhl zurück.
Metall quietscht über Linoleum, als ich aufstehe und mir meinen Rucksack, den Blazer meiner Schuluniform und den Stift vom Boden schnappe.
Finn scheint mein Aufstehen zu bemerken. Er sieht in meine Richtung und wirft mir unter seinen wilden blauen Haarsträhnen hervor einen besorgten Blick zu, was ich mit dem Versuch eines Lächelns erwidere. Für einen Moment legt er den Kopf schief, ehe er sich wieder seiner Klausur zuwendet. Von allen Leuten hier ist Finn der, den ich am meisten ins Herz geschlossen habe. Echte Freundschaften zu schließen ist mit der ganzen Götter-Sache am Hals ziemlich schwer, immerhin ist es strengstens verboten, normalen Menschen von all dem zu erzählen. Doch Finn ist für mich das, was einem guten Freund am nächsten kommt.
Ich bemühe mich so zu tun, als würde ich nicht den einzelnen Schicksalsfäden ausweichen, die sich als silbrig scheinendes und dennoch buntes Netz zwischen meinen Mitschülern ausgebreitet haben. Zwar passiert nichts, wenn ich die Schnüre berühre – ich kann sie, bis auf meine eigenen, ja nicht einmal spüren –, aber das will mein Unterbewusstsein wohl nicht verstehen.
Links und rechts von mir schreiben meine Mitschüler mit jeder Sekunde, die vergeht, noch eifriger weiter als zuvor. Von ihnen wird sicher niemand eine allzu schlechte Note kassieren – allerdings muss sich auch keiner damit herumärgern, von irgendwelchen mythischen Wesen abzustammen, die er höchstens aus dem Kino kennt. Oder eher gesagt keiner bis auf einen.
Maverick lehnt sich auf seinem Stuhl zurück und wirft mir einen Seitenblick zu, als ich an ihm vorbeitrotte. Während er so tut, als würde er sich bloß das schwarze Haar aus der Stirn streichen, zwinkert er mir überheblich zu.
»Vielleicht kannst du ja ein wenig was am Ergebnis drehen, wenn du deine Fäden richtig legst, kleine Moira«, murmelt er so leise, dass nur ich es hören kann, und schafft es trotzdem, tonnenweise Spott in seine Stimme zu legen.
Es kostet mich all meine Selbstbeherrschung und mein letztes bisschen Besonnenheit, nicht auf ihn loszugehen. Stattdessen rücke ich nur wie rein zufällig meinen Rucksack zurecht, wodurch dieser um Haaresbreite Mavericks Gesicht verpasst. Normalerweise ignoriere ich ihn und sein überhebliches Gehabe einfach. Aber jetzt, mit meinem dünnen Fell? Keine Chance. Deshalb beeile ich mich Miss Preston meine Klausur auf das Pult zu werfen und aus dem Klassenraum zu stürmen.
Überdramatischer Abgang? Check.
Ich ziehe die Tür hinter mir ins Schloss und lege für einen Moment den Kopf in den Nacken, ehe ich mich in Bewegung setze. Noch mehr als sonst genieße ich die Ruhe um mich herum. In den sonnengefluteten Fluren ist keine Menschenseele zu sehen und das Gemurmel, das durch die geschlossenen Klassenzimmertüren dringt, ist nur eine sanfte Bestätigung dessen, kurz durchatmen zu können. Zumindest ein paar Minuten, bis sich die Schüler zum Schulschluss auf die Gänge drängen – und mit ihnen ihre Schicksalsfäden, so unzählig, dass ich kaum den Boden erkennen werde. Jetzt allerdings habe ich freie Sicht auf die alten Muster auf dem Steinboden der Schulflure, kann verfolgen, wie sich Wirbel und Ornamente um das Schulwappen herum ausbreiten, das auch auf die Jacke meiner Schuluniform gestickt ist.
Doch ich nehme mir keine Zeit, das Muster genauer zu betrachten, und nutze stattdessen die Möglichkeit zur Flucht. Draußen ist es wesentlich einfacher, die Schicksalsfäden der anderen zu ignorieren, auch wenn ich sie nie ganz aus meiner Wahrnehmung verdrängen kann. Großtante Holly hat behauptet, mit dem richtigen Bewusstsein und ein wenig Übung könne ich die Schnüre ganz ausblenden, bisher ist mir das allerdings nicht gelungen. Ganz sicher: Entweder hat Großtante Holly einfach vergessen, wie schwierig der Beginn ihrer Fähigkeiten gewesen ist, oder ich bin eine absolute Niete als Moiren-Tochter. Vielleicht beides.
Ich stoße die gläserne Eingangstür der Schule auf und werfe dabei einen Blick auf meine Spiegelung in der Scheibe. Was ich besser nicht hätte tun sollen – es führt mir nur allzu deutlich vor Augen, dass ich so elendig aussehe, wie ich mich fühle. Der Stress hat meiner Haut ihren kupferfarbenen Glanz geraubt und lässt mich ungewohnt fahl wirken. Von meinen Haaren mal ganz zu schweigen: Während ich die schwarzen Locken schon an guten Tagen kaum bändigen kann, scheint heute jede einzelne Strähne ein Eigenleben zu führen. Möglicherweise bin ich ja gar keine Nachkommin einer Moira, sondern der Medusa.
Der Gedanke bringt mich zum Schmunzeln, während ich mich auf die Kante einer der wuchtigen Blumenkästen setze, die den Vorhof der Saint Paul Academy schmücken. Vielleicht habe ich es im direkten Vergleich doch gar nicht so schlecht getroffen. Obwohl die Silberschnüre ziemlich nerven, sind sie auf jeden Fall besser als Schlangen.
»Erde an Willow«, höre ich eine vertraute Stimme neben mir flöten, ehe Junipers Gesicht direkt vor mir auftaucht. Wie so häufig zieht meine Schwester die letzte Silbe meines Namens in die Länge und macht eine Melodie daraus. Ihre sprunghaften Bewegungen bringen ihre kurzen Locken zum Hüpfen, was ihre zahlreichen Creolen in der Sonne funkeln lässt. »Will ich überhaupt wissen, wo du mit deinen Gedanken gerade steckst?«
In dem Moment, in dem ich zu einem Kopfschütteln ansetze, tritt Sage – die Dritte in unserem Bunde – zu uns und mustert uns prüfend. Ihr Blick bleibt an mir hängen, während sie sich einige ihre langen Strähnen hinter die Ohren schiebt, die sich aus ihrem Dutt befreit haben. »Alles in Ordnung?«
Ich zucke mit den Schultern.
»Das Übliche«, erwidere ich über das Läuten der Schulklingeln hinweg und springe auf die Füße. »Mein liebstes Geburtstagsgeschenk.«
Die Zwillinge verziehen die Lippen zu einem mitleidigen Lächeln, sagen aber nichts. Was vermutlich nicht nur an den nichtsahnenden Menschen um uns herum liegt, die pünktlich zum Unterrichtsende den Vorhof füllen, sondern auch daran, dass sie wissen, wie wenig Worte in meiner Situation helfen. Sage und Juniper sind fast ein Jahr älter als ich und schlagen sich deshalb schon etwas länger mit dem Moiren-Sein herum. Jede von uns auf ihre eigene Art und Weise im Dreieck aus Spinnerin, Zuteilerin und Zerstörerin.
Gemeinsam überqueren wir den Vorhof. Überall stehen unsere Mitschüler in Grüppchen herum, tippen auf ihre Smartphones ein und unterhalten sich aufgeregt darüber, wie sie diesen Frühsommertag verbringen wollen. Vermutlich nicht so wie wir. Wobei mir ein Nachmittag an den Hampstead Ponds, den Badeseen im Norden Londons, wesentlich lieber wäre als einer auf der Götter-Ebene.
Aber was macht man nicht alles, um das Schicksal der Menschen in die richtigen Bahnen zu lenken? Wobei, vielleicht sollte ich ja ganz aus Versehen mal vergessen nach den Regeln zu spielen und Maverick ein wenig Pech einspinnen. Wenn Sage mich lange genug aus den Augen lässt, kann ich vielleicht … nein. Zu riskant. Ich sollte die Regeln vermutlich doch besser erst beherrschen, bevor ich anfange sie zu brechen.
Sobald wir die Saint Paul Academy hinter uns lassen, löst sich ein Teil meiner Anspannung. Hier auf den Straßen, wo die Menschen sich nicht dicht an dicht drängen, sind die Schicksalsfäden weniger aufdringlich, sondern eher ein unauffälliger Nebeneffekt.
Doch das Aufatmen ist nur von kurzer Dauer: Schon wenige hundert Meter später betreten wir die U-Bahn-Station und kämpfen uns gemeinsam mit Dutzenden von Menschen die Treppen hinunter. Auch wenn mein Verstand weiß, dass ich nicht über die Silberschnüre stolpern kann, unterdrücke ich mit Mühe den Drang, jedem einzelnen von ihnen auszuweichen.
»Wie haltet ihr das aus?«, frage ich meine Schwestern, als wir am richtigen Gleis angekommen sind. »Die ganze Zeit diese Dinge zu sehen?«
»An einigen Tagen gar nicht.« Sages Gesichtszüge verfinstern sich. Von uns dreien hat das Schicksal sie am härtesten getroffen: Als Älteste von uns ist sie eine Atropos, die Zerstörerin. Diejenige, die den Lebensfaden abschneiden muss, wenn es so weit ist – und die, die das Ende eines jeden Menschen sieht. Jeden Tag aufs Neue, sobald sie ihm ins Gesicht blickt. Ich habe sie nie nach meinem gefragt.
Juniper zieht ihre Unterlippe zwischen die Zähne.
»Insgesamt wird es leichter. Man gewöhnt sich daran.«
Mit einem lauten Rattern, bei dem meine Kopfschmerzen sich sofort beschweren, unterbricht uns die einfahrende U-Bahn. Wir entscheiden uns für einen Waggon, in dem der Türbereich tatsächlich noch frei ist.
Sobald sich die U-Bahn wackelnd wieder in Bewegung setzt, lehnt Juniper sich an die Plexiglasscheibe neben der Tür.
»Mit den Dingen«, sagt sie mit gedämpfter Stimme, »war das bei mir ein wenig wie mit einer Sonnenbrille. Wenn man sie eine Weile trägt, vergisst man ab und zu anders zu sehen, als man es ohne sie tun würde.«
Sage schnaubt, doch das Funkeln in ihren Augen nimmt dem Laut seine Härte. »So kann man das natürlich auch beschönigen.«
Obwohl ich hoffe, dass in Junipers Worten ein Funken Wahrheit liegt, kann ich Sage nur zustimmen. Als Lachesis, alias die Zuteilerin, ist Juniper diejenige von uns, die die Länge eines Lebens kennt und bei jedem Menschen in ihrer Umgebung sieht, wie viel Zeit ihm noch bleibt. Das mit einer Sonnenbrille zu vergleichen ist wohl etwas unpassend, doch das wundert mich nicht wirklich. So war Juniper schließlich schon immer – was Sage und ich an Pessimismus mit uns herumschleppen, gleicht sie mit ihrem Optimismus wieder aus.
Ich betrachte meine Schwestern und kann nicht anders, als zu lächeln. Obwohl die jahrelange theoretische Vorbereitung mich nicht dafür wappnen konnte, mit dieser neuen Rolle als Moira klarzukommen, bin ich froh, wenigstens nicht allein zu sein. Zwei Felsen in der Brandung inmitten der Sturmflut meines Lebens zu haben.
Mein Blick wandert zu meinem kleinen Finger, um den sich mehrere Silberschnüre wickeln. Zwei davon sind weniger durchscheinend als die anderen, fast schon vollständig rot. Während der Rest des Bahninneren ein Chaos aus Fäden zwischen den Menschen ist, von denen ich Anfang und Ende kaum ausmachen kann, weiß ich bei diesen beiden genau, zu wem sie führen: zu meinen Schwestern.
Die mechanisch-blecherne Stimme des Mannes, der die U-Bahn-Stationen durchsagt, holt mich aus meinen Gedanken.
»Vielleicht habe ich heute die Geschichtsklausur verkackt«, sage ich, einfach nur, um ein normales Gespräch zu führen. Eines, welches sich nicht um Mythen und Schicksale und Götter-Ebenen dreht.
Juniper beißt die Zähne aufeinander und weicht einem Mann mit Aktentasche aus, der sich an ihr vorbei durch die Tür drängt. »Ah, verdammt. Englands Rolle im Zweiten Weltkrieg, oder?«
»Jap. Ich konnte mich einfach nicht konzentrieren.«
Ganz kurz spüre ich, wie Sage mir eine Hand auf die Schulter legt, ehe sie sie wieder zurückzieht. »Für die nächste Klausur lerne ich mit dir.«
»Danke.«
»Aber nur, wenn du bis dahin auch deine Fähigkeiten trainierst.«
Juniper versteckt ihr Lachen hinter einem vorgetäuschten Husten.
»Ich hätte wissen müssen, dass die Sache einen Haken hat«, stöhne ich und verziehe das Gesicht. Obwohl ich so gut wie keine Chance habe, schenke ich Sage eine Sekunde später mein süßestes Lächeln. »Können wir nicht wenigstens einen Tag Pause machen?«
»Nein.« Entschieden schüttelt sie den Kopf. In ihren Augen liegt ein Glanz, der eindeutig nicht menschlich ist. »Die Götter-Ebene erwartet uns.«
Zwei
Vom Eintritt in die Götter-Ebene wird mir jedes Mal schlecht. Dabei bleibt logisch betrachtet in diesem Zustand nicht mal viel von mir übrig, dem schlecht werden könnte. Wenn ich alles richtig gemacht habe, sitzen meine Organe an Ort und Stelle in meinem wie von Medusa versteinerten Körper. Direkt neben Juniper und Sage, die ebenso wie ich mit ihren Geistern die Menschenwelt verlassen haben und jetzt in ihren Seelengestalten neben mir stehen.
Wie immer ist die Götter-Ebene in ein seltsames Licht getaucht – nicht ganz Tag, nicht ganz Nacht. In der unnatürlichen Dämmerung sehen auch meine Schwestern wie Mysterien aus – nicht ganz irdisch, nicht ganz überirdisch. Die sonst so schwarzen Haare schimmern silbern. Auf ihrer Haut liegt ein nebeliger Schleier, der die Ecken und Kanten ihrer Körper weichzeichnet. Verschwunden sind die Sweatshirts und Jogginghosen, in denen wir uns es gerade noch auf unserem Sofa gemütlich gemacht haben. Stattdessen tragen wir weiße Togen, die lediglich von einem breiten goldenen Gürtel an unseren Hüften verziert werden.
Das sanfte Streicheln des Stoffes auf meiner Götter-Ebenen-Gestalt, kombiniert mit den Schicksalsfäden, die vor uns schweben, führt mir nur allzu deutlich vor Augen, was wir gleich tun werden. Obwohl man meinen sollte, ich hätte mich inzwischen daran gewöhnt, überläuft mich ein Schauer.
Seit ich an meinem sechzehnten Geburtstag die Fähigkeit erhalten habe, mit meiner Seele auf die Götter-Ebene zu wechseln, ist mir hier außer meiner Schwestern noch nie jemand begegnet. Gleiches gilt für Juniper und Sage. Auch wenn sie ohne mich die Arbeit als Moiren-Töchter nie gänzlich vollrichten konnten, sind sie seit ihrem Geburtstag häufiger in der Götter-Ebene gewesen. Was bestimmt einer der Gründe ist, weshalb sie weniger wackelig auf den Beinen sind als ich.
Ich werde mich ebenso daran gewöhnen müssen. Die Schicksale der Menschen werden von einer Kraft eingeteilt, die wir höhere Macht nennen. Jetzt, da sie weiß, dass meine Schwestern und ich bereit sind, unsere Aufgabe zu erfüllen, müssen wir die Schicksale spinnen, die uns zugeteilt werden.
Natürlich könnten wir unsere Pflicht einfach ignorieren, doch das würde die anderen weltweit verstreuten Moiren-Töchter nur noch mehr belasten und uns auf kurz oder lang den Olymp – sozusagen die göttliche Aufsichtsbehörde – auf den Hals hetzen. Von den Nebenwirkungen mal ganz zu schweigen: Je länger wir das Spinnen ignorieren, desto unnachgiebiger werden die Dinge, die wir sehen. Ganz zu schweigen von den höllischen Kopfschmerzen, die wir bekommen würden.
Mit einem kaum hörbaren Seufzen macht Sage einen Schritt nach vorne.
»Bereit?« Sie greift nach der großen gläsernen Schere, die vor ihr auf dem marmornen Boden liegt.
Vor uns erstrecken sich Abertausende Fäden über die gesamte sichtbare Fläche. Mal ehrlich: Welcher antike Maler auch immer auf die Idee gekommen ist, die göttlichen Schicksalsschwestern mit einer einzigen Schnur darzustellen, war sicherlich zu faul zum Zeichnen.
Hier auf der Götter-Ebene tanzen zusätzlich zu den Schicksalsfäden unsere silbrigen Lebensfäden um unsere Hände. Sie sind quasi die Hauptschicksalsfäden, die selbst ich nur in der Götter-Ebene sehen kann und an die die einzelnen Schicksalsfäden gewoben werden.
Zu unseren eigenen Lebensfäden kommen unzählige weitere Schicksale hinzu, die uns von allen Seiten umgeben. Der Teil der Londoner Leben, der seit gut drei Wochen unsere Aufgabe ist und den wir abschnittsweise immer weiter in die Zukunft spinnen.
Ich brumme widerstrebend, trete jedoch gemeinsam mit Juniper neben unsere älteste Schwester. Während Juniper zum Vorrat an wollähnlichen Fasern greift, strecke ich meine Finger nach der Handspindel vor mir aus. Ein einfacher gläserner Stab, der in einer goldverzierten Glaskugel endet, die der ganzen Spindel ihr Gewicht verleiht.
In dem Moment, in dem meine Fingerspitzen das Glas berühren, sind wir nicht mehr wir selbst.
Mum hat gesagt, sie hat kurz nach meiner Geburt gespürt, dass meine Schwestern und ich die nächsten aktiven Moiren-Töchter in unserer Blutlinie sein würden. Deshalb hat sie uns von Kindesbeinen an so gut wie möglich auf alles vorbereitet. Zusammen mit Großtante Holly hat sie uns regelmäßig all die griechischen Sagen und Mythen erzählt, die für uns quasi zum Grundwissen gehören, und uns das Spinnen beigebracht. In der Hoffnung, uns unsere Bürde damit wenigstens ein bisschen leichter zu machen.
Aber der Moiren-Arbeit nachzugehen ist ein überaus seltsames Gefühl und nicht ansatzweise mit normaler Spinnerei zu vergleichen. Sobald wir unsere göttlichen Attribute in die Hand nehmen, fühlt es sich an, als würde mich jemand bei vollem Bewusstsein fernsteuern. Meine Finger wissen einfach, was sie tun müssen. Wie sie in diesem Augenblick nach den blauen Fasern greifen, die Juniper mir reicht. Wie sie die Fasern aus reiner Einsamkeit zu einer Schnur verdrehen und sie mit dem silbrigen Schicksalsfaden verknoten, für den das Gefühl vorgesehen ist. Sobald das Gefühl mit dem Lebensfaden einer Person verbunden ist, wird es mindestens für eine Weile das Leben dieser Person bestimmen. Mal mehr, mal weniger ausgeprägt und jedes Mal auf diese individuelle Art und Weise, die ich beim Spinnen kurz vor meinem inneren Auge sehe. Einer der Gründe, warum ich wesentlich lieber Freude in ein Leben spinne oder zwei Schicksale mit einem Liebesfaden verwebe und so dafür sorge, dass sich zwei Menschen ineinander verlieben. Wobei ich ohnehin keine Wahl habe. Obwohl ich die Nachkommin einer Schicksalsgöttin bin, die das Leben in ihren Händen hält, darf ich rein gar nichts selbst entscheiden.
Denn die höhere Macht steuert uns Moiren-Töchter wie Marionetten. Oder eher gesagt sollte sie uns steuern, denn ich habe von Anfang an versucht all meine Bewegungen immerhin noch bewusst auszuführen.
Auf diese Eventualität scheint sich die höhere Macht eingestellt zu haben: Selbst wenn ich meine Hände eigenständig bewege, weiß mein Kopf noch, was er tun muss. Vermutlich würde die höhere Macht eingreifen, sobald ich mich ihren Anweisungen bewusst widersetzen würde. Immerhin lässt sie keine Fehler zu. So oder so, ich will es auf jeden Fall nicht riskieren.
Seite an Seite spinnen Sage, Juniper und ich die Londoner Schicksale. Gefühlte Stunden lang, ehe mir – oder besser meiner Seele – für einen Sekundenbruchteil die Lider zufallen.
Sofort stößt Sage mir mit ihrem Ellenbogen in die Rippen. »Nicht einschlafen«, mahnt sie mit dem strengen Blick einer Göttin. »Sonst machst du nachher noch was falsch.«
»Ich kann nicht mehr.« Ich seufze und verknote einen Liebesfaden mit dem Schicksal einer alten Frau. Den letzten für heute. »Ich brauche meinen Körper, was zu essen und eine heiße Dusche. In dieser Reihenfolge.«
Gesagt, getan: Mit der Hilfe meiner Schwestern gelingt es mir sogar beinahe ohne Übelkeit, mein Bewusstsein und meine Seele aus der Götter-Ebene zurückzuziehen und wieder in meinen Körper zu stecken. Jeder meiner Nerven kribbelt, als mein Geist sich zurück in seine Hülle drängt.
Wie bei unserem Eintritt in die Götter-Ebene sitzen wir noch immer auf der Couch in der Wohnung am Außenrand Londons, in der wir mit Mum und Großtante Holly wohnen. Ich wackele probehalber mit den Zehen und seufze erleichtert auf, als sie sich bewegen. An dieses ständige Rein und Raus aus dem Körper werde ich mich wohl nie gewöhnen.
Juniper neben mir lacht, als sie meine Bewegung bemerkt.
»Na, noch alle da?«
»Die Götter-Ebene wird dir schon nicht deine Füße klauen, Kindchen.« Großtante Hollys Stimme klingt wie immer kratzig und amüsiert zugleich. Ein Zeugnis dessen, dass in ihrem Leben nicht nur Zigaretten, sondern auch Scherze stets eine große Rolle gespielt haben.
Ich hebe meinen Kopf und lächele sie an. Ihre ergrauten Locken hat sie heute mit einem bunten Haarband zurückgebunden, was sie jünger aussehen lässt, als sie tatsächlich ist – zumindest, wenn man von ihren Falten einmal absieht. Mit einer Tasse Tee in den Händen sitzt sie in ihrem Ohrensessel gegenüber dem Sofa und hat die ganze Zeit ein Auge auf uns gehabt. Was tatsächlich nur eine Stunde gewesen ist, verrät mir ein schneller Blick auf meine Armbanduhr.
»Die Götter haben mir schon mein ganz normales Leben genommen.« Ich grinse, um meinen Worten die Schärfe zu nehmen. »Wer weiß, ob sie nicht noch ein paar Körperteile gebrauchen können.«
»Jetzt übertreibst du.« Juniper gibt mir einen sanften Stups gegen die Schulter.
Sage hingegen sieht mich nur an, ohne etwas zu sagen. Ich wende mich ab und schaue wieder zu Großtante Holly.
»Wart ihr erfolgreich?« Sie beugt sich vor und stellt ihre Tasse auf dem Sofatisch ab. Ihre Finger sind mit Schicksalsfäden umschlungen, die sich sowohl zu uns dreien ausstrecken als auch durch die Wände verlaufen, um sich dahinter vermutlich quer durch England zu verteilen.
Für einen Moment fällt ihr Blick ebenfalls auf die göttlichen Fäden zwischen uns. Wie ich ist sie eine Klotho – diejenige der Schicksalsschwestern, die für das eigentliche Spinnen der Schnüre verantwortlich ist. Und obwohl sie seit dem Tod ihrer Schwestern keine Schicksale mehr spinnt, sind die Silberschnüre nie aus ihrem Leben verschwunden.
Juniper nickt. »So langsam haben wir den Dreh raus.«
»Das ist gut.« Großtante Holly sieht mir direkt in die Augen und lächelt. »Mit der Zeit wird es einfacher.«
Bevor Sage oder ich etwas dazu sagen können, zieht das Geräusch der sich öffnenden Wohnungstür unsere Aufmerksamkeit auf sich. Im nächsten Moment weht der unwiderstehliche Duft von heißem mongolischem Essen ins Wohnzimmer, dicht gefolgt von meiner Mutter.
Mum lehnt sich an den Türrahmen und betrachtet uns mit einem müden Lächeln. Das Make-up, das sie heute Morgen mühevoll aufgetragen hat, ist inzwischen leicht verschmiert.
»Da sind ja meine vier Lieblingsmoiren«, begrüßt sie uns und hebt die Tüte vom Asiaten zwei Straßen weiter an, wobei die zahlreichen Armbänder an ihrem Handgelenk gegeneinander klimpern. »Ich mag zwar keine göttlichen Kräfte haben, aber irgendwie hatte ich trotzdem im Gefühl, ihr könntet das hier gebrauchen.«
»Und damit liegst du goldrichtig. Du bist die Beste!« Mit einem Grinsen steht Juniper auf und nimmt ihr die Tüte aus den Händen, um sie an ihr vorbei in die Küche zu bringen.
Mum schlüpft aus ihrem Sommermantel und fährt sich mit der Hand durch ihr raspelkurzes, dunkles Haar. »Das klingt, als hättet ihr einen genauso anstrengenden Tag gehabt wie ich. In der Praxis war die Hölle los.«
Sage und ich sehen uns an und brummen nur zustimmend, während Großtante Holly bekräftigend nickt.
»Sind fleißig ihrer Bestimmung nachgegangen, die drei.«
Mum lächelt warm. Wenn es nach ihr gegangen wäre, hätte uns das Moiren-Schicksal niemals getroffen. Dann wären wir genau wie sie: Eine ganz normale Frau in der Mitte einer Blutlinie aus göttlichen Nachkommen, die zwar um das ganze Drama Bescheid weiß, selbst darin jedoch keine Rolle spielt – außer vielleicht, indem sie ihren Töchtern zur Seite steht. Aber nein, das wäre ja zu einfach.
»Na, dann habt ihr euch das Essen verdient«, sagt Mum.
»Ja, und zwar am liebsten heiß und nicht kalt!«, ruft Juniper aus der Küche.
»Die Liebe zum Essen hat sie eindeutig von mir«, murmelt Großtante Holly und hievt sich mit einem beinahe stolzen Grinsen aus ihrem Sessel.
Schon unser ganzes Leben lang ist sie für meine Schwestern und mich wie eine Großmutter gewesen. Kein Wunder, immerhin sieht Mum in ihr eher Mutter als Tante, weil ihre Eltern bei einem Unfall ums Leben kamen, als Mum in meinem Alter war. Unseren Vater haben Sage, Juniper und ich nie kennengelernt, laut Mum ist er bloß eine gelegentliche Liebschaft gewesen. Seit ich denken kann, sind es immer nur Mum, Großtante Holly, meine Schwestern und ich gewesen. Und das ist auch okay so.
Ich sehe in die Runde und lache. »Die liegt eindeutig in der Familie.«
Die nächsten Minuten bestätigen meine Behauptung: Obwohl wir anfangs nur über blöde Themen sprechen – Mums stressigen Arbeitstag, meine vermutlich verhauene Churchill-Klausur –, hebt sich unsere Laune mit jedem Bissen. Bald schon ist die Küche erfüllt von Lachen über ungeschickte Lehrer und witzige Internetvideos. Zumindest, bis Mum beim Abräumen plötzlich still wird. Eine Weile versuchen wir ihren Stimmungswechsel einfach mit weiteren Scherzen zu überdecken, doch mit jeder Minute wird ihr Schweigen lauter.
»Was ist los, Mum?«, fragt Sage, während sie so tut, als würde sie nicht bemerken, wie Juniper ihren Glückskeks klaut.
Mit einem Seufzen dreht Mum sich zu uns um, das Geschirrhandtuch über die Schulter gelegt. »Es geht um Willow.«
Wir sehen uns an, aber Mum sagt nichts.
Auffordernd hebe ich eine Augenbraue. »Raus damit.«
»Wir sollten dich morgen endlich dem Olymp vorstellen. Das hätten wir immerhin schon an deinem sechzehnten Geburtstag tun müssen.«
Meine Finger, mit denen ich gerade den Zettel aus meinem Glückskeks geknibbelt habe, erstarren. Mein Blick fällt auf den Spruch, der darauf gedruckt ist.
Jetzt ist eine gute Zeit, etwas Neues anzufangen.
Ich schnaube. Vielleicht sollte ich tatsächlich etwas Neues anfangen. Oder mir am besten gleich eine neue Identität zulegen und irgendwo dorthin auswandern, wo weder Schicksalsfäden noch Mythische existieren. Ja, das wäre doch eine ganz gute Alternative.
Drei
Obwohl meine Familie mir alles Wissenswerte über den Olymp erzählt hat, bin ich nervös, als wir am nächsten Morgen in das Taxi steigen, das uns zum Treffpunkt mit dem Hermes-Sohn bringen wird. So nervös, dass mir der Anschnaller beim ersten Versuch aus den Fingern rutscht, was mir einen besorgten Blick meiner Mum einbringt.
»Zum British Museum, bitte«, weist sie den Fahrer an und schiebt die Scheibe zwischen ihm und uns zu, ehe sie sich zurücklehnt. Das Lächeln auf ihren Lippen ist warm, während sie nach meiner Hand greift und sie drückt. »Du brauchst nicht aufgeregt zu sein. Sie werden dir nicht wehtun.«
Ich presse die Lippen aufeinander. »Können wir ihnen nicht einfach eine Mail schreiben, dass ich jetzt sechzehn bin und Kräfte entwickelt habe?«
Mum lacht. »Der mächtigste Zeus-Sohn schlägt sich wohl kaum damit herum, E-Mails zu lesen«, sagt sie. »Und seinem großen Ego würde es wohl ganz schön schaden, wenn du ihn nicht persönlich treffen willst.«
Obwohl ich den Nachkommen der Olympischen Götter noch nie selbst begegnet bin, habe ich genug Geschichten über sie gehört, um zu wissen, dass Mum vermutlich recht hat. Allen Erzählungen nach scheint der Zeus-Sohn – der mächtigste aller Nachkommen des Olymps – ähnlich arrogant wie sein Urahn zu sein. Hervorragende Aussichten. Wenn ich es mir recht überlege, würde ich den Vormittag wohl lieber in der Schule verbringen.
Doch ich kann mich nicht länger drücken. Der Olymp führt über jede Nachfahrenfamilie Buch, höchstwahrscheinlich werde ich also seit gut drei Wochen zu meiner Vorstellung erwartet.
»Meinst du, das wird lange dauern?«, frage ich Mum, als der Hyde Park neben uns auftaucht. Immerhin hat sie das ganze Spektakel schon mit Juniper und Sage durchgemacht. Obwohl sie selbst nicht über Kräfte verfügt, unterstützt Mum uns, wo sie kann.
Wenn das Wetter so bleibt und mein olympischer Termin nicht den ganzen Tag in Anspruch nimmt, kann ich Sage vielleicht dazu überreden, mal keine Schicksale zu spinnen. Gestern haben wir genug geschafft, um uns zumindest heute eine kleine Pause gönnen zu dürfen.
Mum schüttelt den Kopf und lässt meine Hand los. »Bestimmt nicht.«
Einige Minuten lang weiß anscheinend keine von uns, was sie sagen soll. Ich streiche mein Shirt glatt und frage mich, ob ich vielleicht etwas Eleganteres hätte anziehen sollen. Was halten der mächtigste Göttliche der Welt und sein Gefolge wohl von Ringelstreifen?
»Muss ich eigentlich heute Nachmittag …«
»In die Schule?«, beendet Mum meine Frage. »Ja. Ich möchte, dass euch alle Türen offenstehen. Und dafür brauchst du nun mal einen Schulabschluss.«
Ich widerspreche ihr nicht – halb, weil sie recht hat, halb, weil wir uns bereits dem British Museum nähern. Offenbar lässt mich der Londoner Dauerstau ausgerechnet dann im Stich, wenn ich ihn mal gut gebrauchen könnte.
Mum bezahlt den Fahrer und wirft mir ein aufmunterndes Lächeln zu. »Bereit?«
»So bereit wie für meine Hinrichtung«, murmele ich, aber da schließt sie schon die Autotür hinter sich.
Ich zögere, was mir einen ungeduldigen Blick vom Taxifahrer beschert. Seufzend folge ich meiner Mutter ins Freie. Sofort empfangen mich sonnig-warme Luft und zahlreiche Touristen mit noch mehr Schicksalsfäden, die sich ins Unendliche verlaufen. Vielleicht kann mir ja jemand auf dem Olymp verraten, wie ich diese Special-Effect-Sicht ausschalten kann.
»Wie sollen wir ihn erkennen?«, frage ich Mum, sobald ich mich durch die Touristengruppe zu ihr gekämpft habe. »Den Hermes-Sohn?«
Vor uns ragt das British Museum in die Höhe und erinnert mich heute irgendwie an einen antik-griechischen Tempel. Kein Wunder, dass der Hermes-Sohn ausgerechnet diesen Ort als Treffpunkt ausgewählt hat. Selbst in meinem Herzen, das für diese ganze Göttersache vergleichsweise ziemlich wenig übrighat, bewegt sich bei diesem Anblick etwas. Als würden mich die massiven Säulen willkommen heißen, die das Dach des Eingangsbereiches stützen und Platz für die Statuen schaffen, welche den Giebel zieren.
»An seiner Basecap«, sagt Mum und deutet auf die Stufen, die ins Museum hinaufführen, als wäre das das normalste Erkennungsmerkmal der Welt. »Er wartet direkt vor dem Eingang auf uns.«
Ich bin noch nie mit einem Hermes-Sohn gereist und habe nicht wirklich eine Ahnung, was mich erwartet. Hermes-Sohn-Sprünge sind ein wenig wie Teleportieren, hat Juniper gesagt, als ich sie heute Morgen im Bad danach gefragt habe.
Als ich hinter Mum die Stufen erklimme und meinen Blick über die Menschen hier schweifen lasse, kann ich den Hermes-Sohn einfach nicht übersehen.
An einer der massiven Säulen lehnt ein Typ, der so schlaksig ist, dass er beinahe in der so wuchtig erbauten Umgebung verschwindet. Mit seiner Collegejacke und der Jeans sieht er ganz unscheinbar aus, wäre da nicht die schwarze Basecap, die er sich tief ins Gesicht gezogen hat, was den Aufdruck nur noch besser zur Geltung bringt: ein weißer Flügel wie der eines Engels – oder eines Götterboten.
Ein Grinsen zuckt auf meinen Lippen. »Captain Obvious«, murmele ich und tippe Mum auf die Schulter, um sie auf den Kerl aufmerksam zu machen, der in sein Smartphone vertieft ist. Von ihm geht ein leichtes Vibrieren der Luft aus, das wir Mythischen immer spüren, wenn wir auf einen anderen unserer Art treffen.
Auch über ihr Gesicht huscht ein Lächeln, als sie auf ihn zugeht. »Entschuldigung?« Ihr Ton ist beiläufig. »Pánta chorei.«
»Kaì oudèn ménei«, erwidert der Hermes-Sohn sofort und schaut hoch. Seinen feinen, jugendlichen Gesichtszügen nach zu urteilen kann er nur ein paar Jahre älter sein als ich.
Was für einige so klingen mag, als wäre Mum gerade aus Versehen ins Altgriechische gerutscht, um alte Philosophen zu zitieren, ist viel mehr als das – nämlich die Erkennungsphrase der Mythischen.
Alles fließt und nichts bleibt. Eine ständige Erinnerung daran, dass wir zwar von Göttern abstammen mögen, jedoch trotzdem nicht ewig leben werden, genauso wenig wie die Götter selbst. Und gleichzeitig ein einfaches Erkennungszeichen, falls man mal auf einen anderen Mythischen trifft und sichergehen will, dass das Vibrieren von ihm ausgeht.
Man kann schließlich schlecht in aller Öffentlichkeit fragen, ob man mal eben Hermes’ Teleportiertaxi in Anspruch nehmen darf, wenn man nicht schief angeschaut werden möchte. Dann doch lieber Philosophen zitieren und sich notfalls rausreden, sollte man mal jemand nicht-mythischen erwischen.
Der Typ lässt sein Smartphone in seine Tasche gleiten und sieht zwischen Mum und mir hin und her. »Calla und Willow Fynch?«
Wir nicken.
»Lasst uns reingehen.«
Wir reihen uns hinter einem Pärchen in die Schlange des Museums ein. Verwundert ziehe ich die Stirn in Falten. Irgendwie habe ich erwartet, nicht durch den Haupteingang gehen zu müssen, sondern eine versteckte Nebentür nutzen zu können. Doch der Hermes-Sohn macht keine Anstalten, vom Verhalten eines ganz normalen Museumsbesuchers abzuweichen. Zumindest, bis wir an der großen Eingangstür angekommen sind und er jeweils eine Hand um Mums und meinen Oberarm legt, ehe er in das Museum tritt.
Mit einem Mal verliere ich den Boden unter den Füßen. Ich sehe nichts, nur ein graues Licht, das dem aus der Götter-Ebene ähnelt. All meine Muskeln prickeln, ein wenig wie damals, als Juniper mich in diese fürchterliche Achterbahn gezerrt hat. Ich habe das Gefühl, gleichzeitig nach links und rechts gezogen zu werden, und muss das Bedürfnis unterdrücken, mich am Hermes-Sohn festzuklammern. Im nächsten Moment ist es schon wieder vorbei und ich stehe auf ebenem Boden. O Götter. Hätte der Typ mich nicht vorwarnen können? Oder Mum?
Blinzelnd sehe ich zum Hermes-Sohn, aber ihm scheinen die Turbulenzen nichts ausgemacht zu haben. Ganz im Gegenteil: Er wirft uns einen kurzen Blick zu, als würde er prüfen, ob wir beide noch aus einem Stück bestehen, dann tritt er einen Schritt nach hinten und ist verschwunden. Beneidenswert. Für diese Fähigkeit würde ich jetzt sogar noch mal das ekelige Gefühl in Kauf nehmen.
Stattdessen bin ich hier – wo auch immer genau hier ist – und werde von all den Eindrücken um mich herum beinahe erschlagen. An den Seiten und hinter uns schließen helle, mächtige Mauern den Raum ein, die über und über mit feinsten Mustern verziert sind und sich hoch über unseren Köpfen zu einer Kuppel vereinen. Das Fresko dort oben zeigt einen Himmel. Die Wolken darin sehen so realistisch aus, dass ich mir nicht sicher bin, ob sie wirklich Malerei oder viel eher Magie sind.
Ein Stück vor uns steht ein Tresen, der aus dem gleichen Stein gehauen ist wie die Wände und doch modern wirkt. Von dort blickt uns eine hübsche Frau in Mums Alter entgegen, deren dunkle Haare zu einem ordentlichen Dutt hochgesteckt sind. Sie lächelt, aber die Freundlichkeit erreicht ihre Augen nicht.
»Guten Tag«, sagt sie. Der Olymp ist ähnlich magisch wie die Götter-Ebene und obwohl ich keine Ahnung habe, welche Sprache sie tatsächlich spricht, verstehe ich sie. Eine Magie, die das Ganze hier wesentlich einfacher macht. Immerhin ist der Olymp für die ganze Welt zuständig. »Familie Fynch, nehme ich an?«
Mit einem höflichen Lächeln erwidert Mum ihren Gruß und nickt. Ich hingegen bringe keinen Ton heraus, während ich ihr zum Tresen folge.
Verärgert über mich selbst beiße ich mir auf die Unterlippe. Ich dachte wirklich, Sages und Junipers Erzählungen hätten mich ausreichend auf diesen Termin vorbereitet, aber irgendwie ist all das hier in der Realität noch viel eindrucksvoller. Allein die massiven Steinwände geben mir das Gefühl, klein und unbedeutend zu sein. Was ich im Machtspiel der Götter auch bin. Ich meine, was bringt mir das Schicksale-Spinnen schon, wenn ich dabei keine eigene Entscheidung treffen darf? Und nichtsdestotrotz muss ich heute Zirkustier spielen und mich für die großen Olympier auf den Präsentierteller setzen. Oh, wie ich das hasse.
»Sehr schön. Ich bin Olivia.« Wieder lächelt die Frau. Ich sehe mich verstohlen um, finde jedoch nichts, was mir einen Hinweis auf ihre Abstammung geben könnte. »Die Olympier freuen sich schon, dich kennenzulernen, Willow.«
»Hm«, mache ich und zwinge mich dazu, wenigstens einen Mundwinkel zu heben, weil ich keine Ahnung habe, was ich sagen soll.
»Na gut, dann lasst uns keine Zeit verlieren. Miss Fynch, Sie können so lange gerne hier warten.« Sie deutet auf eine Sitzecke gegenüber dem Tresen, die aus mehreren petrolfarbenen Sofas besteht und mit großen Pflanzen dekoriert ist. Ich hatte keine Ahnung, wie einschüchternd luxuriös eine Kombination aus modernen und antiken Möbeln aussehen kann. »Und du folgst mir einfach, Willow, ja?«
Ehe ich überhaupt darauf reagieren kann, stolziert sie schon in den breiten Gang, der vom Foyer abgeht. Mir bleibt nichts anderes übrig, als Mum einen hilflosen Blick zuzuwerfen und Olivia hinterherzuhasten.
»Du bist sicher aufgeregt, oder?« Obwohl ich Olivias Gesicht nicht sehen kann, höre ich das Lächeln in ihrer Stimme.
Ich brumme nur zustimmend, bin viel zu fasziniert von den Malereien an den Wänden, um ihr wirklich zu antworten. Sie erzählen vom Ursprung der Nachkommen. Wie die antiken Götter und Helden vor Hunderten von Jahren gestorben sind, nicht aber ihre Blutlinien. Wie ihre Nachkommen ihre Rollen einnahmen und seit jeher wieder und wieder das Schicksal ihrer Urahnen durchleben, um die Vorherbestimmung zu erfüllen und dem höheren Gleichgewicht der Welt gerecht zu werden.
Eine Geschichte, die Mum uns schon unzählige Male als Gute-Nacht-Geschichte erzählt hat, als wir noch zu jung waren, um sie als Wirklichkeit zu begreifen. Und wegen all dem bin ich jetzt überhaupt hier.
Wobei ich noch immer nicht den blassesten Schimmer habe, wo dieses Hier ist. Wohl kaum in der Eingangshalle des British Museum. Als ich Mum und Großtante Holly danach gefragt habe, haben sie gelacht. Anscheinend kennen den Ort des Olymps nur die Olympier selbst – und die Hermes-Söhne. Fest steht lediglich, dass sich der Olymp längst nicht mehr auf dem namensgebenden griechischen Berg befindet.
Ich reiße meinen Blick von den Wänden los und sehe stattdessen zu Olivia. Hinten ist ein Zipfel ihrer Bluse aus dem Bund ihres Bleistiftrocks gerutscht. Ein Patzer, der sie direkt sympathischer macht.
»Ich muss erst mal zu Protokoll geben, dass ich eine aktive Nachkommin bin, oder?«
Olivia scheint erleichtert zu sein, dass endlich etwas über meine Lippen gekommen ist, das über ein Brummen hinausgeht. Über ihre Schulter hinweg lächelt sie mich an.
»Ganz genau. Ich bringe dich jetzt zu einer Nachkommin Aletheias, der Wahrheitsgöttin«, sagt sie. »Sie erkennt Wahrheit und Lüge in den Worten eines anderen und wird mir bestätigen können, dass du ehrlich bist, was deine Fähigkeiten betrifft.«
»Okay.«
»Du hast also Fähigkeiten entwickelt?«, versucht sie das Gespräch aufrechtzuerhalten.
»Jap.«
Ich folge ihr um eine Biegung und mehrere Treppenstufen hinauf. Der Gang wird wieder breiter, macht Platz für Statuen antiker Helden und Gottheiten, die links und rechts von uns den Korridor verzieren. Auf den ersten Blick kann ich keine Moiren erkennen. Gut so. An den steinernen Abbildern seiner Vorfahren vorbeizulaufen muss seltsam sein.
»Das ist bestimmt ein wunderbarer Tag für dich und deine Schwestern gewesen.«
Unweigerlich betrachte ich die Schicksalsfäden an Olivias Händen. Einige von ihnen laufen die Gänge vor und hinter uns entlang, andere verlieren sich in den Mauern und enden wer weiß wo.
»Es ist …« Ich suche nach dem richtigen Wort, während ich ihr eine weitere Treppe hinauf folge. »… gewöhnungsbedürftig.«
»Das glaube ich dir sofort.« Olivia bleibt vor einer dunklen Tür stehen, die zwischen all dem Prunk ziemlich unscheinbar aussieht. »So, da wären wir.«
Der Raum, in den sie mich führt, ist wesentlich schlichter, als ich erwartet habe. Ein wenig sieht er aus, wie ich mir den Raum einer Psychotherapeutin vorstelle: Links von mir steht ein moderner Schreibtisch, an der Wand gegenüber reihen sich einige Bücherregale aneinander. Die Wand vor mir wird von zwei großen Fenstern unterbrochen, von denen aus helles Sonnenlicht auf zwei einander gegenüberstehende weiße Sessel fällt.
An einem der Fenster steht eine Frau und schaut hinaus. Welche Aussicht man wohl daraus hat? Ich wette, man sieht nur Himmel und Wolken, wie aus dem Fenster eines Flugzeugs.
Jetzt dreht sie sich zu uns um und mustert mich ausgiebig. Ich tue es ihr gleich, lasse meinen Blick über ihr scharfkantiges Gesicht und die rotbraunen Locken gleiten, bis er am Anhänger ihrer Kette hängen bleibt: einem kleinen Saphir.
»Da bist du ja«, sagt die Nachkommin Aletheias mit kehliger Stimme und deutet auf einen der Sessel. »Setz dich.«
Während ich ihrer Anweisung nachkomme, schließt Olivia die Tür und lehnt sich an die Wand daneben.
Die Aletheia-Tochter setzt sich auf den Sessel gegenüber von mir. »Willow Fynch?«
Ich nicke und frage mich, wie sie merkt, ob ich die Wahrheit sage. Sieht sie Lügen, so wie ich die Silberschnüre, die um ihre Finger gewickelt sind?
»Sprich deine Antworten bitte laut aus«, fordert sie mich auf. »Du gehörst zur Blutlinie der Moiren?«
Wieder nicke ich. »Ja.«
»Verfügst du über Kräfte, die denen deiner Urahnen entsprechen?«
»Ja«, murmele ich und grabe meine Finger in den weichen Stoff des Sessels. »Ich bin eine Moiren-Tochter. Seit meinem sechzehnten Geburtstag spinne ich die Schicksale der Menschen und Mythischen in London.«
Eine Weile lang sieht sie mich schweigend an. Mich beschleicht das Gefühl, dass sie direkt in meine Seele schaut, und ich kann gar nicht anders, als nervös auf dem Polster herumzurutschen.
Dann endlich durchbricht sie ihr Schweigen. »Sie sagt die Wahrheit.«
Vier
Mit einem Mal geht alles ganz schnell. Kaum hat die Aletheia-Tochter meine Aussage über meine Fähigkeiten bestätigt, bugsiert mich Olivia schon wieder die Flure entlang. Vorbei an Statuen, Gemälden und Türen. Und schließlich unzählige Treppen hinauf. Ehrlich, dagegen sind die Treppen in den U-Bahn-Stationen ein Witz.
Als wir endlich oben ankommen, fühlen sich meine Beine an wie Wackelpudding und mein Rücken ist von einem Schweißfilm benetzt. Wir bleiben vor einer riesigen, doppelflügeligen Tür stehen, in deren Holz zwölf kleine Figuren geschnitzt sind – die olympischen Götter. Ernsthaft? Ausgerechnet so verschwitzt soll ich den mächtigsten Nachfahren überhaupt entgegentreten?
»Bereit für die Olympier?« Olivia lächelt.
Ehrlich gesagt nein.
Anscheinend war das ohnehin eine rhetorische Frage. Ohne meine Antwort abzuwarten, stößt Olivia die Tür auf und schiebt mich mit ihrer Hand auf meinem Rücken in den Raum. Obwohl Saal die Größe wesentlich besser beschreibt.
Außer der Wand mit der Tür, durch welche ich gerade gestolpert bin, sind wir von allen drei Seiten von Glasfronten umgeben, die lediglich durch einige Säulen unterbrochen werden. Mein Blick scheint das gleiche Fluchtbedürfnis zu haben wie ich: Kurz bleibt er am Blau hinter den Scheiben hängen, in dem vereinzelte Wolkenfetzen zu erkennen sind, ehe ich ihn zwingen kann, zu dem zu schauen, was diesem Raum seine eigentliche Macht verleiht: Den Olympiern. Auf den verschiedensten Stühlen sitzen sie auf der U-förmigen Empore vor mir, in der Mitte von ihnen der wohl mächtigste. Der Zeus-Sohn. Selbst auf die Entfernung kann ich das Sturmgrau seiner Augen erkennen, die mir abwartend entgegensehen. Genau wie die Augenpaare aller anderen elf Olympier.
Ich schlucke und zwinge mich zu einem Lächeln.
»Ähm … hallo?«
Meine ohnehin schon unsicheren Worte werden förmlich von der Leere des Raumes verschluckt. Verdammt.
Ich lasse meinen Blick über die Nachkommen der Götter schweifen. Auf der einen Seite des Zeus-Sohns sitzen die jeweils mächtigsten Nachfahren von Hera, Ares, Athene, Aphrodite und Hermes. Auf der anderen Seite die von Poseidon, Demeter, Hestia, Hephaistos, Apollon und Artemis. Bei ihren unnachgiebigen hoheitlichen Mienen bin ich mir gar nicht mehr so sicher, ob ich wirklich Sterblichen gegenüberstehe. Das sind sie also – die Mächtigsten der olympischen Blutlinien.
Im Laufe der Zeit sind die einzelnen Blutlinien so sehr auseinandergeflossen, dass die Nachkommen verschiedener Götter jetzt nicht mehr wirklich miteinander verwandt sind. Bei Beziehungen zwischen Mythischen setzt sich immer nur eine der Blutlinien durch. Keiner der Olympier ist also direkt miteinander – oder mit mir – verwandt. Doch das ändert natürlich nichts daran, dass zwischen ihnen unzählige Schicksalsfäden durch die Luft wabern. Einer von ihnen – fast vollständig transparent – verbindet den Zeus-Sohn und mich.
Mir schwirrt jetzt schon der Kopf, dabei hat noch nicht mal jemand etwas gesagt – abgesehen von meiner kläglichen Begrüßung. Sage hat mir gestern Abend geraten, mich einfach nur auf den Zeus-Sohn zu konzentrieren, falls ich das Gefühl bekommen sollte, den Boden unter den Füßen zu verlieren. Also mache ich genau das.
Er betrachtet mich ebenfalls, den Ellenbogen auf die Armlehne seines Throns gestellt, das Kinn in eine Handfläche gestützt. An seinem Finger prangt ein Siegelring, in den ein Blitz graviert ist. Wenn ich mich richtig erinnere, ist sein Name Zayn. Er ist wesentlich jünger, als ich erwartet habe, ungefähr Anfang dreißig. Sein aschblondes Haar ist so hell, dass es eher weiß wirkt, und bildet einen angenehmen Kontrast zu seiner sonnengebräunten Haut.
»Willow Fynch.« Seine Stimme ist reinstes Donnergrollen und verursacht mir eine Gänsehaut. Es fällt ihm sicher nicht schwer, mit dieser Stimme Frau um Frau um den kleinen Finger zu wickeln, genau wie sein Urahn. »Moiren-Tochter. Schicksalsspinnerin.«
Weil ich keine Ahnung habe, was ich dazu sagen soll, nicke ich einfach. Ich trete von einem Fuß auf den anderen.
»Wieso stellst du dich erst so spät hier vor?« Seine Augen funkeln interessiert, ein kurzer heller Blitz im Sturmgrau. »Was hast du in den letzten drei Wochen seit deinem Geburtstag getrieben?«
»Ich … ähm …« Ich suche nach einer Ausrede, um ihm nicht gestehen zu müssen, dass ich auf diese ganze Göttersache absolut keine Lust habe. »Ich musste für die Schule lernen.«
Sein Lachen lässt absolut keinen Zweifel daran, dass er mir nicht glaubt. Einige der anderen Nachfahren stimmen leise mit ein, doch ich zwinge mich, meinen Blick nicht von ihrem Anführer zu lösen.