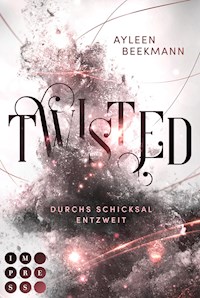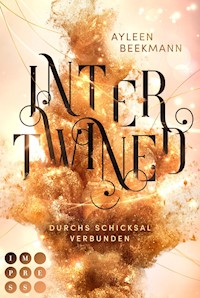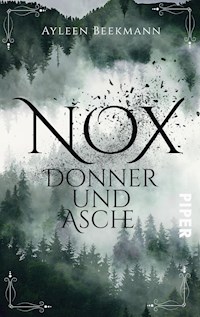
5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper Wundervoll
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
GÜNSTIGER EINFÜHRUNGSPREIS NUR FÜR KURZE ZEIT! Er wahrt die Ordnung. Sie stürzt alles ins Chaos. Ein stürmisches Romantasy-Abenteuer in Ostfriesland für Leser*innen von Jennifer L. Armentrout und Maggie Stiefvater "›Die Schattenwesen können jederzeit hinter dir auftauchen. Überall.‹ Ich will ihn unterbrechen, aber er legt mir seinen Zeigefinger auf die Lippen. Seine Berührung ist ein Feuer auf meiner Haut, wärmend und brennend zugleich. ›Jetzt halt doch mal für ein paar Sekunden die Klappe und hör mir zu.‹" Annikas Leben wird auf den Kopf gestellt, als sie plötzlich von finsteren Schattenwesen verfolgt wird. So gerne sie über Fantasy-Abenteuer liest, im echten Leben möchte sie einfach nur ihre Ruhe haben und die Wesen so schnell wie möglich wieder loswerden. Blöd nur, dass sie dafür ausgerechnet mit Elias zusammenarbeiten muss, der nicht nur ziemlich viel über Magie weiß, sondern mit arroganten Sprüchen nur so um sich wirft. Mit einem Mal stolpert sie in eine völlig neue Welt – und über ein Geheimnis, das ihr Leben in Gefahr bringt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 465
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Mehr über unsere Autoren und Bücher:
www.piper.de
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, schreiben Sie uns unter Nennung des Titels »Nox – Donner und Asche« an [email protected], und wir empfehlen Ihnen gerne vergleichbare Bücher.
© Piper Verlag GmbH, München 2021
Redaktion: Uwe Raum-Deinzer
Konvertierung auf Grundlage eines CSS-Layouts von digital publishing competence (München) mit abavo vlow (Buchloe)
Covergestaltung: Annika Hanke
Covermotiv: Bilder unter Lizenzierung von Shutterstock.com und Pexels genutzt
Alle Rechte vorbehalten. Unbefugte Nutzungen, wie etwa Vervielfältigung, Verbreitung, Speicherung oder Übertragung können zivil- oder strafrechtlich verfolgt werden.
In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich der Piper Verlag die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
Inhalt
Cover & Impressum
Widmung
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Epilog
Danksagung
Für meine Familie, die mir den Mut schenkt, gegen jedes Monster dieser Welt zu kämpfen.
Und für alle, die den Mut dazu suchen.
Kapitel 1
Zuerst ist es nur ein vages Gefühl, ein Prickeln in meinem Nacken. Wie eine Warnung breitet es sich bis über meine Arme aus, als ich meinen Wagen auf dem Kiesparkplatz zum Stehen bringe. Schaudernd halte ich einen Moment inne.
Meine Schwester Sophie hingegen ist längst aus dem Auto gesprungen und in Richtung Deich gerannt, um das Meer mit ausgebreiteten Armen zu begrüßen. In ihrem Übereifer hat sie vergessen, die Beifahrertür wieder zu schließen, weshalb der Wind jetzt nicht nur ihr Jauchzen, sondern auch das Geschrei von Möwen zu mir herträgt. Frischsalzige Seeluft mischt sich unter den Geruch der Pizza auf dem Rücksitz und erinnert mich daran, warum wir hier sind.
Ich schließe für einen Moment die Augen und zwinge mich, das ungute Gefühl wieder zurückzudrängen. Immerhin ist es heute nicht das erste Mal, dass mich irgendein blöder Instinkt innehalten lässt – vollkommen unbegründet. Es ist, als hätte man mir für kritische Situationen einen kaputten Kompass verpasst, dessen wahrer Zweck es ist, mich zu beunruhigen. Was blöderweise funktioniert.
»Erde an Nika!«
Sophies Stimme direkt neben meinem Ohr lässt mich zusammenzucken. Blinzelnd drehe ich mich nach ihr um.
Sie hat die Fahrertür aufgerissen, und obwohl ihre Augen vor Freude und Abenteuerlust strahlen, kann ich die Skepsis in ihren zusammengeschobenen Brauen erkennen. »Kommst du, oder bist du da drinnen festgewachsen?«
Mit einem liebevollen Kopfschütteln löse ich den Sicherheitsgurt. Ich strecke mich über den Beifahrersitz, um die Tür zu schließen, bevor ich aus meinem Polo steige – im Gegensatz zu meiner Schwester allerdings mit den Pizzakartons in den Händen. Sofort reißt der Seewind an meinen Haaren und peitscht kupferrote Strähnen in mein Gesicht. Was aber nichts daran ändert, dass sich wie von selbst ein Lächeln auf meinen Lippen ausbreitet, sobald ich die salzige Luft auf meiner Haut spüren kann. Ich habe fast vergessen, wie schön das ist.
»Also«, sage ich mit einem Grinsen, »bereit für das Abenteuer?«
Auch Sophies Mundwinkel wandern in die Höhe. »Jederzeit.«
Keine von uns beiden weist die andere darauf hin, dass unser Ausflug an die Nordsee wohl kaum einem wirklichen Abenteuer gleichkommt. Wo sich in Sagen Hexen und Drachen tummeln, haben wir nur dicke Schals, unsere Pizzakartons und eine Küste, die dank der späten Uhrzeit so gut wie verlassen daliegt. Wenn man von den ganzen Möwen einmal absieht. Und statt eines prächtigen Ritters zu Pferd ist da nur ein Jogger, der mit seinem Labrador an uns vorbeiläuft, als wir oben auf dem Deich angekommen sind. Aber das ist nicht schlimm. Ganz im Gegenteil – Sophies Strahlen in diesem Moment bedeutet mir mehr als jedes echte Abenteuer dieser Erde.
Sie sieht jünger aus, so wie sie da steht, mit den von der Kälte geröteten Wangen und den mahagonifarbenen Haaren, die wild in alle Richtungen fliegen. Für einen Moment vergesse ich, dass sie morgen schon sechzehn wird, doch dann schnappt sie sich einen der Pizzakartons in meinen Händen, und der Augenblick ist vorbei. Natürlich wird sie morgen sechzehn – deshalb sind wir ja hier. Genau wie in jeder ihrer letzten acht Geburtstagsnächte, seit unsere Mutter anscheinend gemerkt hat, dass ihr zwei Töchter zu viel Verantwortung sind.
Lächelnd folge ich Sophie zu einer der Steinbänke, die genau dort stehen, wo die Pflastersteine dem Sand weichen, und lasse mich neben sie fallen. Kurz stelle ich die Pizza zur Seite und binde mir unter Sophies ungeduldigem Blick einen Dutt, der vermutlich eher wie ein Vogelnest aussieht. Dann ziehe ich den Pappkarton auf meinen Schoß und nehme mir ein Stück heraus. Wir prosten uns mit den Pizzaschnitten zu, als wären es Biergläser.
»Auf dich«, sage ich feierlich, aber Sophie hat sich bereits ihr Stück in den Mund gestopft und murmelt nur irgendetwas Unverständliches.
Eine Weile sitzen wir bloß da und essen. Irgendwann rutscht Sophie näher zu mir, um das vorletzte Stück meiner Pizza zu klauen.
»Hey!« Ich schlage spielerisch nach ihren Fingern, reiche ihr allerdings im nächsten Moment schon den ganzen Karton.
»Was denn?«, bringt sie zwischen zwei Bissen hervor und grinst mich an, was Entschuldigung genug ist. »Es ist immerhin meine Geburtstagsnacht.«
»Und ich kann trotzdem allein nach Hause fahren, wenn du mich nervst.« Bedeutungsvoll ziehe ich meinen Autoschlüssel aus der Tasche und klimpere damit herum, kann mir das Grinsen aber nicht verkneifen. »Also wäre ich an deiner Stelle lieber nett zu mir.«
Lachend stößt Sophie ihre Schulter gegen meine. Uns beiden ist klar, dass das niemals passieren würde. Mal ganz abgesehen davon, dass ich sie dafür ohnehin viel zu sehr lieb habe, ist es unsere Tradition, am Abend vor ihrem Geburtstag irgendetwas zu tun, das sie gerne macht. Ans Meer fahren zum Beispiel. Oder beim Muffins backen so viel Teig essen, bis uns schlecht wird und wir den Harry-Potter-Marathon quasi komatös erleben. Hauptsache, Sophie ist glücklich.
Deshalb steige ich jetzt auch nicht in mein Auto und fahre zurück nach Attenafehn, sondern schnappe mir die Pizzakartons und stopfe sie in den nächsten Mülleimer. Ich strecke meine Hand nach Sophies aus. »Komm, Zwerg. Dein Strandspaziergang wartet.«
Sie verschränkt ihre Finger mit meinen und lässt sich von mir auf die Füße ziehen. Ihre weißen Sneaker sinken so weit in den Boden, dass sich garantiert zwei Handvoll Sand in ihre Schuhe und Socken ergießen, um es sich später in ihrem Bett gemütlich zu machen. Aber das scheint Sophie gar nicht zu stören. Voller Energie zieht sie mich von den Bänken weg und hin zum Ufer. Die Wellen begrüßen uns mit einem reißenden Krachen, als teilten sie Sophies energische Wiedersehensfreude.
Als das Wasser um ihre Sohlen tanzt, macht sie einen Satz rückwärts und schlüpft nun doch aus ihren Sneakern, ihre Socken folgen dichtauf. Paps wird es ihr danken. Einen Moment lang steht Sophie etwas orientierungslos da, dann knotet sie die Schuhe an den Schnürsenkeln zusammen, stopft ihre Socken hinein und wirft sie sich über die Schulter. Mit einem beinahe schon stolzen Grinsen erwidert sie meinen Blick, ehe sie wieder ins Meer tapst – und quiekt.
»O Gott, ist das kalt!«
Ich lache und vergrabe meine Hände in den Taschen meiner Jacke. Sogar mit meinen Boots kommt es mir ziemlich kühl vor. Wie es ihr barfuß geht, will ich gar nicht wissen. »Es ist September – was hast du erwartet?«
Sie zieht eine Schnute, macht aber keine Anstalten, wieder aus dem Wasser zu kommen. Ganz im Gegenteil: Zielsicher überquert sie das kleine Stück Watt, das das wiederkommende Wasser noch übrig gelassen hat, und tänzelt auf die dunklen Steine, die aus dem Meer ragen wie ein naturgebauter Steg. Wasser quillt von beiden Seiten auf die Felsen und spielt um ihre Füße, ihre bunt lackierten Nägel leuchten wie eine Boje in einem Meer aus Schmutzigblau. Mit jedem Blinzeln kämpft sich die Flut weiter voran, schwappt um Sophies Knöchel.
»Mann, warum hab ich nicht im Sommer Geburtstag?«
»Weil du dann nicht Paps’ weltberühmte heiße Schokolade bekommen würdest?«, schlage ich vor, was meine Schwester mit einem Nicken quittiert.
»Das ist ein Argument«, murmelt sie und kämpft sich noch weiter auf die Steine vor. Schwunghaft dreht Sophie sich zu mir um und kommt ein paar Schritte zurück Richtung Ufer. »Komm her.« Sie macht eine halbherzige Handbewegung in Richtung der nass glänzenden Steine unter ihr. »Das macht Spaß.«
Lachend gehe ich über den matschigen Boden bis hin zu den Felsen. Als ich gerade dazu ansetze, zu Sophie zu tänzeln, schleicht sich wieder das ungute Gefühl in meine Glieder und bringt mich dazu innezuhalten. Mein Nacken ist trotz meines Schals eiskalt. Mit der Hand fahre ich darüber, aber das ändert nichts am Prickeln. Ich beiße die Zähne zusammen und schüttle den Kopf, aber auch das bewirkt nichts.
Als sich Sophies Kreischen im nächsten Moment mit dem der Möwen vermischt, weiß ich mit einem Mal, dass das ungute Gefühl doch mehr als ein kaputter Kompass ist.
Sophie rudert mit den Armen, als wäre es nur noch eine Frage der Zeit, bis sie unfreiwillig Bekanntschaft mit der Nordsee macht. Schneller, als ich überhaupt darüber nachdenken kann, stehe ich neben ihr, schnappe mir ihre Hände und lasse sie erst los, nachdem das Zittern in ihren Gliedern wieder verschwunden ist.
Sofort breitet sich ein Grinsen auf ihrem Gesicht aus. »Da bist du ja endlich.«
Ich brauche einen Moment, um ihre Worte richtig zu deuten. Als ich es verstanden habe, kostet es mich alles an Willenskraft, was ich aufbringen kann, Sophie nicht doch noch baden gehen zu lassen. Stattdessen verschränke ich die Arme vor der Brust und bemühe mich vergeblich, das Prickeln in meinem Nacken wieder zurückzudrängen. »Ist das dein Ernst? Du hast mir einen ganz schönen Schrecken eingejagt!«
»Sorry! Aber du musst zugeben …« Ihre Mundwinkel wandern weiter in die Höhe, als sie ein paar Schritte rückwärts tanzt, direkt auf das Ende des Felspfades zu. »… es macht –«
Sie gerät ins Stolpern, doch dieses Mal falle ich nicht darauf rein. Denke ich zumindest. Für einen viel zu langen Moment. Als ich endlich realisiere, dass es jetzt kein blöder Scherz ist, schlägt ihr Körper an den Steinen vorbei schon auf dem Wasser auf. Bei meinem nächsten Herzschlag kann ich sie nicht mehr sehen. Scheiße!
Ich rufe Sophies Namen, aber natürlich antwortet sie nicht. Und während es um mich herum plötzlich still wird – viel zu still –, schrillen alle Alarmglocken in meinem Kopf, viel zu laut, um noch einen vernünftigen Gedanken fassen zu können.
Mein Blick huscht über den Strand, ich schreie um Hilfe, aber da ist keiner. Niemand, der mir helfen kann. Verdammt, wieso zur Hölle sind wir mutterseelenallein?
Von meinen Instinkten getrieben sinke ich auf den nassen Steinen auf die Knie, will Sophie wieder aus dem Meer zerren, kann sie jedoch nirgends sehen. Da ist nur Wasser, viel zu viel Wasser, das um mich herum schwappt und mit jeder Welle meine Panik vermehrt. Seit wann ist diese blöde Nordsee schon hier so tief? Und was, wenn Sophie sich unter Wasser den Kopf angestoßen hat?
Da! Ein Ende ihres Schals! Ich bekomme es zu fassen, rosa Wolle, die nassschwer und eiskalt an meinen Fingern klebt. Im nächsten Moment ist Sophies Hand da, dann ihr Arm. Ich komme jedoch nicht an sie heran, strecke mich, strecke mich noch mehr. In dem Augenblick, in dem ihr Kopf die Wasseroberfläche durchbricht, schaffe ich es, nach ihrem Handgelenk zu greifen. Ich packe sie fest, hieve sie hoch, ziehe sie an mich.
»Sophie. O Gott, Sophie!« Ich drücke sie so fest an mich, dass sie auf gar keinen Fall zurück ins Wasser fallen kann. Obwohl all das nur wenige Sekunden gedauert hat, sitzt der Schreck tief in meinen Knochen.
In meinen Armen hustet Sophie, immer und immer wieder. Und wenn das Husten kurz verstummt, bringt das Zittern ihren Körper zum Beben. Sie krächzt irgendetwas Unverständliches und lässt zu, dass ich sie aus ihrer vor Nässe triefenden Jacke schäle. Ich werfe sie hinter uns, hole ihre Sneaker aus dem Wasser und befördere sie ebenfalls nach hinten. Dorthin, wo das Wasser, das um unsere Beine schwappt, sie nicht erreichen kann. Mit meinen Handflächen reibe ich eine Weile über Sophies Gliedmaßen, ehe ich aus meiner Jacke schlüpfe und sie ihr überziehe. Danach wickle ich meinen Schal um sie. Sofort kriecht die Kälte unter meine Kleidung, aber das ist mir egal.
Ich beiße die Zähne zusammen und hieve meine Schwester auf die Füße. Einen Arm um ihren Oberkörper gelegt schnappe ich mir ihre Sachen und führe Sophie Richtung Auto. Der Wind reißt noch stärker an uns, als er es vorhin getan hat. Es dauert eine Ewigkeit, bis wir bei meinem Wagen ankommen.
»Geht es dir gut?«, frage ich zum gefühlt zwanzigsten Mal, als ich Sophie schließlich auf den Beifahrersitz helfe. Ihre Jacke und die Schuhe werfe ich hinten in den Fußraum. Dann hocke ich mich vor sie und streiche ihr eine Haarsträhne hinters Ohr.
Sophie nickt, die Lippen fest aufeinandergepresst – aber die Tränen, die in ihren Augen schimmern, beweisen mir das Gegenteil. Ich hoffe, dass es nur der Schreck ist und sie sich nicht ernsthaft verletzt hat.
»Hey … warte einen Moment, okay?« Ich streiche mit der Hand über ihr Haar und drücke sie kurz an mich. Nachdem ich mich ein weiteres Mal vergewissert habe, dass alles okay – na ja, eher den Umständen entsprechend okay – ist, gehe ich zum Kofferraum. Bevor wir losgefahren sind, habe ich zwei Wolldecken eingepackt, genau wie frische Socken und Jeans für jeden. Nur für den Fall, dass wir nass werden sollten – wenngleich ich dabei nicht im Traum an so etwas gedacht habe.
Mit den Wolldecken und Sophies Kleidung kehre ich zurück zu ihr. Ich helfe ihr dabei, sich aus ihren klammen Sachen zu schälen, und kontrolliere dreimal, ob sie warm genug eingepackt ist, ehe ich das Auto umrunde und mich auf den Fahrersitz fallen lasse.
»Wir sind gleich zu Hause.« Ich sehe zu meiner Schwester und stecke den Autoschlüssel ins Zündschloss. »Dann wird alles wieder gut, versprochen.«
Brummend erwacht der Motor zum Leben. Als ich den Gang einlege und vom Parkplatz hinunterjage, erfassen meine Scheinwerfer etwas.
Für einen Moment bin ich wie gebannt, kann nur diese Silhouette anstarren, die wenige Meter vor uns steht. Erst halte ich sie für einen Menschen und verfluche den Schatten dafür, dass er nicht ein paar Minuten eher aufgetaucht und mir zu Hilfe gekommen ist. Doch dann wird mir bewusst, dass das dort vorn alles andere als menschlich ist. Und auch kein gewöhnliches Tier. Viel eher ist es eine pechschwarze, seltsame Mischung aus Wolf und … Hirsch? Was zur Hölle ist das?
In der nächsten Sekunde sind wir schon an dem Ding vorbeigefahren. Einzig das kalte Prickeln in meinem Nacken bleibt. Kopfschüttelnd konzentriere ich mich auf die Straße und drücke aufs Gas. Ich sollte dringend meinen Konsum an Fantasyromanen runterschrauben. Das rede ich mir zumindest ein.
Bis Sophie in meine Richtung sieht und ihre noch immer belegte Stimme mein Herz zum Donnern bringt. »Hast du das auch gesehen?«
Kapitel 2
»Vielleicht hätte ich doch auf Paps hören und zu Hause bleiben sollen.« Sophie dippt überdramatisch eine Pommes in ihren Ketchup, als obläge es ihr, Julius Caesar den Todesstoß zu versetzen. »Dann hätte ich jetzt wenigstens kein Chemie.«
»Aber auch keine Luftballons am Rucksack«, kommentiere ich mit einem Schmunzeln. Normalerweise essen wir in der Schule nicht gemeinsam, aber heute ist ohnehin alles anders als normal. Oder besser gesagt: seit gestern.
Die Erlebnisse vom Vortag sitzen uns noch in den Knochen. Vor allem dieses seltsame Schattending. Deshalb habe ich mir heute meine kleine Schwester geschnappt, sobald sie in den Menschenmengen der Mensa in Sichtweite gekommen ist. Was angesichts der bunten Ballons an ihrer Schultasche wesentlich schneller ging, als ich erwartet hatte.
Sophie stößt einen von ihnen an und verdreht die Augen, aber auf ihre Lippen schleicht sich ein Lächeln. »Die Mädels haben nicht lockergelassen, bis ich mich ergeben habe.«
»Ist doch süß.« Ich hebe einen Mundwinkel und klaue mir eines ihrer Chicken Nuggets.
»Hm.« Wieder tunkt Sophie eine Pommes so heftig in den Ketchup, dass das obere Ende abknickt. Sie selbst scheint das gar nicht wahrzunehmen, doch das wundert mich kaum – physisch ist sie hier bei mir, in Gedanken allerdings … vermutlich ebenfalls bei mir, aber nicht hier. Sondern auf dem Kiesweg beim Parkplatz, nur wenige Dutzend Meter vom Strand entfernt. Und damit bei diesem seltsamen Wesen.
Alles in mir schreit danach, das Ding als Einbildung abzutun und in die hinterste Ecke meines Gehirns zu schieben. Dorthin, wo ich auch die Erinnerung an Horrorfilme verwahre – Dinge, an die ich im Normalfall nicht denken möchte. Aber mein eigener Kopf macht mir einen Strich durch die Rechnung. Diese Gestalt kann keine Einbildung gewesen sein. Nicht, wenn Sophie sie auch gesehen hat und sich alle paar Minuten bei mir vergewissert, ob sie für mich ebenfalls wie eine skurrile Fantasyfigur ausgesehen hat. Wie etwas, das es gar nicht geben dürfte.
Unsere lahmen Versuche, Small Talk zu betreiben, sind seit gestern Nacht allesamt gescheitert. Genau wie jetzt.
Sophie sieht sich um, bevor sie spricht, und beäugt die leeren weißen Plastikstühle neben uns skeptisch, doch selbst danach ist ihre Stimme leise. »Was ist das gestern gewesen, Nika?«
Hilflos schüttle ich den Kopf. »Ich weiß es nicht.«
Sie beißt sich auf die Unterlippe und dreht den diademförmigen Ring an ihrem Finger, den ich ihr heute Morgen zum Geburtstag geschenkt habe.
»Hör mal.« Ich wedle mit einer Pommes vor ihrer Nase herum. »Das war bestimmt nur eine Sinnestäuschung. Ein Baum oder Busch, der im Dämmerlicht seltsam aussah. Immerhin hatten wir Panik. Wir waren ja in dem Moment nicht ganz bei der Sache.«
Trotz ihres Nickens sieht sie nicht überzeugt aus. Verübeln kann ich es ihr nicht – ich glaube mir ja nicht einmal selbst. Wir beide wären miserable Schauspieler.
Wie aus dem Nichts legt ein blondes Mädchen die Hand auf die Schulter meiner Schwester, die vor Schreck förmlich hochhüpft und sich mit einem dumpfen Knall die Knie an der Tischplatte stößt. Auch mir rutscht das Herz in die Hose – was albern ist. Doch die Blonde spricht uns nicht auf unser Geheimnis an, sondern gratuliert Sophie zum Geburtstag und zieht nach ein wenig Geplauder wieder davon.
Natürlich. Solange wir uns nicht plötzlich in Hogwarts befinden, gibt es niemanden außer uns, der an die Existenz irgendwelcher bizarren Mischwesen glaubt. Selbst wenn uns jemand belauschen sollte, würden wir nicht kurz darauf von dunklen Sekten entführt und mit schwarzer Magie zum Schweigen gebracht werden. Man würde uns höchstens in Zwangsjacken stecken und in die nächste Gummizelle schaffen. Was auch nicht viel erstrebenswerter ist.
»Okay, nur mal so fürs Protokoll«, sage ich und vergewissere mich, dass niemand zuhört. »Wir dürfen mit niemandem darüber reden. Die Leute würden uns für verrückt halten.«
»Und was ist mit Paps?«
Entschieden schüttle ich den Kopf. »Es gibt keinen Grund, ihn zu verunsichern, nur weil unsere Fantasie ein bisschen mit uns durchgegangen ist.«
»Und wenn das nicht der Fall ist?« Sie nestelt an der Haut neben ihrem Daumennagel herum und senkt beinahe ehrfürchtig die Stimme. »Wenn wir uns das Ding nicht nur einbildet haben? Wenn es vielleicht sogar wiederkommt?«
Ich bemühe mich, diesen Gedanken aus meinem Kopf zu verjagen, ehe er sich dort einnisten kann, und sage schnell: »Wird es nicht.«
»Wird was nicht?«
Jetzt sind es meine Schultern, auf denen mit einem Mal Hände liegen. Eine honigblonde Strähne kitzelt mein Gesicht und lässt mich die Nase krausziehen. Gleich darauf taucht das Mädchen neben mir auf, das mir neben Sophie am vertrautesten ist. Marleen. Meine beste Freundin, seit sie im Kindergarten gemerkt hat, dass ich Fuchs mit Nachnamen heiße – was hervorragend zu ihrem damaligen Lieblingsstofftier gepasst hat.
Sie geht um den Tisch herum und schließt meine Schwester in die Arme. »Happy Birthday, Sophie!«, ruft sie mit einem Strahlen. »Hübsche Ballons.«
Sophie hebt einen Mundwinkel. »Danke!«
Marleen lässt sich auf den Stuhl neben mir fallen, stützt die Ellenbogen auf den Tisch und umschließt ihr Gesicht mit ihren flachen Händen. »Sag mal, hast du die Mathehausaufgaben schon gemacht?«, fragt sie mich. Ihrem amüsierten Blick nach zu urteilen kennt sie die Antwort darauf längst.
»Dreimal darfst du raten.« Ich wackle mit den Brauen. »Aber wir haben doch erst morgen wieder Mathe, oder?«
Nickend schnappt sie sich eine Pommes von Sophie. »Jap.« Sie beißt genussvoll ab. »Aber Steve und ich wollen später noch nach Oldenburg und schon mal Deko für seine Halloweenparty kaufen.«
Sophie hebt eine Braue. »Ist die nicht erst Ende Oktober? Das ist doch noch Wochen hin.«
»Tja, man kann nie früh genug gruselig sein, oder? Außerdem kann ich das als Ausrede benutzen, um danach shoppen zu gehen. Und keine Hausaufgaben zu machen.« Mit einem breiten Grinsen wickelt Marleen sich eine Strähne um den Finger. Wenn es zwei Dinge gibt, denen sie mit Leidenschaft nachgeht, sind das Shoppen und Halloweenpartys. Und die ihres Freunds sind sozusagen berühmt-berüchtigt. »Apropos gruselig …« Sie nickt mit ihrem Kopf in Richtung Mensaausgang. »Habt ihr bemerkt, dass Elias und Xenia die ganze Zeit zu euch schauen?«
Nahezu gleichzeitig drehen Sophie und ich uns zu den Tischen links von uns. Und tatsächlich – gerade noch rechtzeitig sehe ich, wie Elias den Kopf senkt und sein dunkelbrauner Haarschopf seine Gesichtszüge versteckt. Der Ärmel der Jeansjacke an Xenias Stuhllehne wackelt. Vermutlich hat auch sie gerade herübergesehen. Das ist durchaus merkwürdig, da sich die Zwillinge normalerweise überhaupt nicht für uns interessieren.
Ich runzle die Stirn und fange Sophies ebenso verwirrten Blick auf. Haben sie uns etwa zugehört? Als wir über … dieses Wesen gesprochen haben?
»Wahrscheinlich liegt es an meinen schicken Luftballons.« Meine Schwester setzt ein Grinsen auf.
»Genau.« Ich nicke kraftvoll. »Elias ist schon ganz grün vor Neid, seht ihr? Nicht, dass er sonst besser aussehen würde.«
Marleen verzieht das Gesicht. »Ach Quatsch. Das sagst du nur, weil du ihn nicht leiden kannst.«
Womit sie nicht ganz unrecht hat: Zwar haben Elias Steinbach und ich nur wenig miteinander zu tun, aber wenn wir diese Regel ab und an brechen, dann nicht im Positiven. Zum Beispiel, wenn wir in Unterrichtsdiskussionen vollkommen gegensätzliche Standpunkte vertreten – was aus Zufall begonnen hat, ist mittlerweile schon fast zur Tradition geworden. Auch wenn ich mich normalerweise ungern am Unterricht beteilige – bei Wortgefechten gegen Elias bin ich schon aus Prinzip dabei.
Dabei haben wir nicht mal einen speziellen Grund dafür, uns nicht ausstehen zu können. Zumindest wenn man davon absieht, dass sein Onkel, bei dem Elias und seine Schwester wohnen, regelmäßig mit meinem Vater aneinandergerät. Anscheinend haben die beiden vor Jahren einen heftigen Streit gehabt und halten noch immer nichts voneinander. Genauso wie Elias nichts von mir zu halten scheint – welchen Grund kann es also haben, dass er uns gerade ganz genau beobachtet hat?
Eine helle Mädchenstimme reißt mich aus meinen Gedanken. »Sophie!« Ein Mädchen mit dunklem Pferdeschwanz legt die Arme um Sophies Schultern, während es die letzte Silbe ihres Namens in die Länge zieht. Sophie begrüßt sie mit einem Lächeln. Ich weiß, dass sie zu ihren Freundinnen gehört, aber ihr Name will mir partout nicht einfallen. War es Lara? Oder Laura?
»Kommst du mit zu uns rüber?«, fragt Lara-Laura jetzt. »Dann können wir überlegen, welchen Film wir Samstag angucken. Aber bitte nicht diese seltsame Schnulze. Wie wär’s mit dem neuen Hai-Film?«
Sophie wirft ein Lächeln in unsere Richtung, ehe sie ihren Stuhl zurückschiebt, sich den Luftballon-Rucksack schnappt und mit ihrer Freundin zu den anderen Mädchen geht. Soweit ich weiß, möchte meine Schwester tatsächlich »diese seltsame Schnulze« sehen. Nach gestern kann ich mir zumindest nicht vorstellen, dass sie sich freiwillig neunzig Minuten lang irgendwelchen mordgierigen Monsterhaien aussetzt.
Grinsend zieht Marleen sich Sophies Teller rüber, auf dem noch einige einsame Pommes liegen. Sie hält mir auch eine hin, aber ich lehne ab und sehe wieder in die Richtung, aus der Elias und Xenia uns vorhin beobachtet haben. Obwohl ich damit hätte rechnen können, trifft mich sein Blick vollkommen unerwartet. Ganz ruhig liegt er auf mir, als wäre es ihm vollkommen egal, dass ich ihn gerade beim Starren erwischt habe. Ist es wahrscheinlich auch. Er sieht nicht aus, als hätte er irgendwelche großartigen Geheimnisse – im Gegensatz zu mir. Nur mit Mühe kann ich ein Schaudern unterdrücken.
Marleen knufft mich in die Seite und bringt mich so dazu, unseren Blickkontakt als Erste zu unterbrechen. »Hab ich was verpasst?«, fragt sie grinsend. »Irgendwie sah das gerade verdächtig nach Flirten aus.«
»Blödsinn.« Hastig schüttle ich den Kopf. »Das war … nichts. Ich war nur in Gedanken versunken.«
»Na, wenn du das sagst.« Sie sieht nicht gerade überzeugt aus, lässt aber von dem Thema ab und schiebt sich die letzte Pommes in den Mund. »Hör mal, ich muss noch mal eben was mit Steve klären. Treffen wir uns gleich in der Umkleidekabine?«
Ich zucke mit den Schultern. »Klar.«
»Du bist die Beste.« Im nächsten Moment ist sie bereits an den Tisch ein paar Meter in Richtung Fensterfront verschwunden, an dem Steve mit seinen Kollegen aus der Basketballmannschaft sitzt. Ich sehe zu, wie Marleen ihm von hinten die Hände über die Augen legt und etwas flüstert. Er dreht sich zu ihr um und drückt ihr einen Kuss auf die Lippen. Auf ihrem Gesicht breitet sich ein Strahlen aus, das selbst auf die Distanz ansteckend ist.
Lächelnd schultere ich meinen Rucksack und schnappe mir die beiden Essenstabletts vom Tisch, um sie in die dafür vorgesehenen Ablagen zu schieben. In Gedanken versunken bahne ich mir danach meinen Weg durch die Smartphone-Zombies, die auf zurückgeschobenen Stühlen an ihren Tischen hängen, und die Mädchen, die aufgeregt über irgendetwas tuscheln. Keiner von ihnen nimmt Notiz von mir. Bis auf einen.
Als ich schon fast aus der Mensa verschwunden bin, baut sich mit einem Mal eine große Gestalt vor mir auf. Perplex hebe ich den Kopf und blinzle direkt in Elias’ Gesicht. Na klasse!
Ich bemühe mich, ruhig zu bleiben, und sehe ihn einfach nur abwartend an.
Er erwidert meinen Blick. Auf seinen Lippen liegt dieses typisch selbstsichere Lächeln, als hätte er keinen Zweifel daran, dass ihm die Welt zu Füßen liegen wird, sobald er auch nur mit den Fingern schnippt. Normalerweise schüttle ich den Kopf darüber – heute aber macht es mich irgendwie nervös. Hat er doch etwas von unserem Gespräch mitbekommen?
»Annika«, sagt er jetzt. Obwohl seine Stimme vor Desinteresse trieft, schwingt etwas darin mit, das ich nicht so recht deuten kann.
In dem Versuch, meine Aufregung zu verstecken, recke ich das Kinn vor. »Elias.«
Und entgegen all meinen Erwartungen war es das schon. Im nächsten Moment macht er einen Schritt beiseite und lässt mich durch. Ich ziehe die Stirn in Falten und will ihm irgendetwas an den Kopf knallen, muss mich aber widerstandslos geschlagen geben, weil mein Hirn plötzlich wie leer gefegt ist. Da sind keine coolen Sprüche, nur noch Verwirrung und Nervosität. Also gehe ich an ihm vorbei, wage es jedoch erst wieder, auszuatmen, als sein dunkelgrüner Kapuzenpullover aus meinem Blickfeld verschwunden ist.
Okay, das war seltsam. Mehr als seltsam.
Alles in mir drängt danach, einfach weiterzugehen, aber ich kann nicht. Ganz automatisch drehe ich mich um. Noch immer steht Elias da, die Hände in der Tasche seines Pullovers vergraben, und starrt mich an. Er zuckt nicht mal mit der Wimper. Fast bin ich mir sicher, selbst auf diese Distanz das Gewitter in seinen Augen aufziehen zu sehen, vertreibe den Gedanken aber mit einem Kopfschütteln und wende mich ab.
Doch auch als die Glastür schon hinter mir zugefallen ist, brennt Elias’ Blick noch in meinem Nacken und frisst sich unter meine Haut. Ich werde das Gefühl nicht los, dass er tatsächlich weiß, worüber Sophie und ich gerade geredet haben.
Dass er unser Geheimnis kennt.
Kapitel 3
»Brr!« Marleen schlingt die Arme um ihren Oberkörper und verzieht das Gesicht. »Es ist echt Quälerei, bei dieser Kälte draußen Sport zu machen. Typisch Herr Naumann.«
»Hm.« Ich nicke abwesend und komme nicht umhin, schon wieder über meine Schulter zu sehen. Wenn man mich fragt, ist es Quälerei, im gleichen Sportkurs wie Elias zu sein. Erst recht, weil der zu allem Überfluss nicht aufhört, meinen Blick aufzufangen und mit einer gehobenen Augenbraue zu erwidern. Als hätte er mich nicht vorhin in der Mensa schon nervös genug gemacht. Vollidiot.
»Meinst du, ich kann mich einfach davonschleichen?« Mit funkelnden Augen schielt Marleen zum Gebäudeeingang, wobei sie in ihrer engen schwarzen Sportkleidung beinahe wie eine Geheimagentin aussieht. Wäre da nicht die triste Rennbahn um uns herum, gleich neben dem Basketballplatz. »Wenn ich Steve frage, schwänzt er bestimmt auch Chemie.«
Ich grinse. »Einen Versuch ist es ja we-«
»Gibt es hier ein Problem?«, fällt mir unser Sportlehrer Herr Naumann ins Wort. Seine Stimme poltert, was ein Indiz dafür ist, dass man seine Geduld gerade nicht überstrapazieren sollte.
Deswegen schütteln Marleen und ich synchron den Kopf.
»Kein Problem«, presse ich knapp hervor.
»Genau.« Aus dem Kopfschütteln meiner besten Freundin wird ein Nicken. »Ich musste mir nur schnell meine Schuhe binden. Wir wollen hier ja keinen Unfall haben. Sport ist Mord, so sagt man doch?«
Herr Naumanns sonnengegerbtes Gesicht zieht sich in Falten, während er irgendetwas Unverständliches murmelt. Im nächsten Moment stolpert ein Mitschüler in unserer Nähe, was unseren Lehrer dazu bringt, auffordernd in seine Hände zu klatschen und »Weitermachen!« in unsere Richtung zu donnern, ehe er zu dem Schüler läuft.
Weitaus weniger energiegeladen, als er es sich vermutlich wünschen würde, trotten wir davon. Wobei wir nicht viel verpasst haben – immerhin besteht unsere einzige Aufgabe, seit der Kurs gemeinschaftlich beim Handball versagt hat, darin, um die Sportplätze zu joggen und uns Ausdauer anzutrainieren. Von der man laut Herr Naumann nie genug haben kann. Niemals. Und die laut Marleen unnötig ist. Vollkommen unnötig.
»Ich kann diesen Kerl nicht ab. Das einzige Problem ist ja wohl er. Und seine lächerlich alten Turnschuhe«, schnaubt sie jetzt und weicht vor einem Mitschüler zurück, der besonders engagiert an uns vorbeisprintet. »Weitermachen!«
Über ihre Imitation lachend lege ich ein wenig an Tempo zu. »Wir haben schon den Großteil hinter uns. Die letzte Viertelstunde schaffen wir locker.«
»Was hältst du davon, wenn wir uns einfach dort verkriechen?« Marleen deutet auf eine Stelle neben der graffitibeschmierten Schulwand, die halb hinter Bäumen und halb hinter dem Geräteschuppen verborgen ist. »Da bemerkt uns doch keiner. Angeblich haben Merle und Adrian da letztens rumgemacht.«
Ich verziehe das Gesicht. »Das ist jetzt nicht unbedingt ein Pluspunkt.«
»Ach, jetzt tu nicht so.« Unter ihre Stimme mischt sich ihr angestrengtes Atmen. »Ich habe genau gesehen, wie Elias und du euch gerade angeschaut habt. In der Mensa, meine ich. Und jetzt kann er seinen Blick immer noch nicht von dir lassen.«
Ich folge ihrer wegwerfenden Handbewegung mit meinem Blick – und muss feststellen, dass sie recht hat. Wie auf Kommando beginnt mein Magen zu flattern. Ich werde das Gefühl einfach nicht los, dass er Sophie und mich belauscht haben könnte.
»Also. Gibt es da vielleicht doch etwas, das du mir erzählen möchtest?«
Sofort schüttle ich den Kopf. »Blödsinn«, schnaube ich. »Wer weiß, was der Typ hat.«
Mit fahrigen Fingern nestle ich am Bund meiner Trainingsjacke und streiche eine verirrte Strähne hinter mein Ohr. Doch selbst anschließend finden meine Hände keine Ruhe, sodass ich bei meinem nächsten Schritt stolpere und beinahe mit der Nase auf dem Boden lande. Wütend über mich selbst verdrehe ich die Augen. So geht das nicht. Wenn ich so weitermache, glaubt bald jeder, dass mit mir irgendwas nicht stimmt. Auch wenn keiner ahnen dürfte, dass mir nur ein gruseliger Schatten im Kopf herumspukt.
Ich spüre Marleens Blick auf mir und hebe den Kopf in ihre Richtung. Ihr ist deutlich anzusehen, dass ihr die nächste Frage schon auf der Zunge liegt. Doch irgendetwas scheint sie dazu zu bringen, es sich anders zu überlegen, und so ist ihre gerunzelte Stirn das einzige Indiz für ihre Skepsis. Ich hebe einen Mundwinkel, um sie zu beruhigen, merke jedoch selbst, wie meine Lippen zittern. Verdammt! Ich brauche unbedingt einen Moment für mich, sonst drehe ich wirklich noch durch.
»Ich bin gleich wieder da«, stoße ich hervor und drehe mich auf dem Absatz um. Ich steuere den Hintereingang der Recha-Freier-Gesamtschule an und mache einen Bogen um Elias, wobei ich mich zwinge, nicht in seine Richtung zu sehen. Ich will gar nicht wissen, ob er mich noch immer beobachtet. Und vor allem will ich nicht wegen eines bescheuerten Hirngespinsts verrückt werden.
Als die Türklinke schon in Reichweite ist, ändere ich kurzerhand mein Ziel und biege in die Ecke hinter den Geräteschuppen, die Marleen gerade schon als Fluchtort vorgeschlagen hat. Jetzt ist es mir völlig egal, dass dieser Ort regelmäßig für irgendwelche Knutschereien missbraucht wird. Das Einzige, was zählt, ist, dass mich hier keiner beobachten kann.
Niemand bemerkt, wie ich mich auf den viel zu kalten Boden sinken lasse, mich an die Graffitimauer der Sporthalle lehne und den Kopf in den Händen vergrabe. Geschweige denn, wie ich leise zu fluchen beginne.
Ich habe keine Ahnung, was überhaupt mit mir los ist. Vermutlich bilde ich mir all das bloß ein – nicht nur den seltsamen Schatten auf dem Parkplatz gestern, sondern auch das Verhalten der Zwillinge, insbesondere das von Elias. Ganz bestimmt hat er mir nur durch einen blöden Zufall angemerkt, dass ich heute ein besonders dünnes Fell habe, und nutzt das jetzt zu seiner eigenen Belustigung. So ist er einfach.
Aber das ist es nicht, was mich stresst. Es ist diese eine, winzige Möglichkeit, dass ich mich gerade in falscher Sicherheit wiege. Und so unwahrscheinlich sie auch ist – sie macht mir Angst. Verursacht ein ungutes Gefühl in meinem Magen und lässt meine Kopfhaut prickeln.
»Ist das eine neue Sportart? In der Ecke zu sitzen und in Selbstmitleid zu baden?«
Eine viel zu bekannte Stimme lässt mich aufschrecken. Nur wenige Schritte von mir entfernt steht Elias. Er hat die Hände in den Taschen vergraben und betrachtet mich nur abwartend, eine seiner kräftigen Augenbrauen gehoben. So lässig, als wäre es völlig normal, aufgebrachten Mädchen in irgendeine Ecke zu folgen, um sie aufzuziehen. Was es, nur so fürs Protokoll, definitiv nicht ist.
Er verzieht seine Lippen zu einem Halbgrinsen. »Hat es dir etwa die Sprache verschlagen?«
»Du …«, bringe ich hervor und ärgere mich selbst darüber, dass ich keinen vernünftigen Satz zustande bringe. Hastig rapple ich mich auf. Zwar muss ich so immer noch zu ihm hochsehen, aber wenigstens nur noch ein paar Zentimeter. »Was willst du?«
»Das Gleiche habe ich mich bei dir gefragt.«
Wie von selbst krallen sich meine Hände in den Stoff meiner Sportleggins. »Ich habe keine Ahnung, wovon du sprichst.«
»Da bin ich mir nicht so sicher.« Ohne sich beirren zu lassen, tritt er ein paar Schritte an mich heran. Aus dieser Nähe sehe ich direkt vor mir die schon etwas verblassten Sommersprossen, die sich auf seinem Nasenrücken verteilen und mir bisher nie aufgefallen sind. Und das stürmische Grau seiner Augen, die mich ebenso unverblümt beobachten wie ich sie.
»Ich weiß wirklich nicht, wovon du sprichst«, wiederhole ich.
Elias hebt eine Braue und kommt noch näher. »Na, wenn du das sagst.«
»Das sage ich«, erwidere ich lahm und ärgere mich selbst über meinen unsicheren Ton, den auch Elias zu bemerken scheint. Der Ausdruck in seinen Augen, so selbstsicher und überlegen, bringt etwas in mir zum Brodeln. Genau diese Wut ist es, die mich jetzt den Mund aufmachen lässt, statt zu hoffen, dass er aus Langeweile einfach wieder verschwindet. »Nur falls du das nicht verstanden hast: Das war gerade dein Signal, dass du dich wieder verziehen sollst.«
Was er anders zu sehen scheint – er zuckt nicht einmal mit der Wimper, bleibt einfach stehen, direkt vor mir. »Und ich dachte schon, du hast etwas zu verbergen. Ein nettes kleines Geheimnis.«
Jetzt bin ich es, die eine Augenbraue hochzieht, wenn auch, um meine Nervosität hinter dieser Geste zu verstecken. »Dass ich dich nicht leiden kann, ist nun wirklich kein Geheimnis und absolut nichts Neues«, sage ich. »Und alles andere geht dich überhaupt nichts an.«
Ich habe damit gerechnet, dass Elias meine Abneigung zu mir zurückschleudern würde wie einen Tennisball, aber das tut er nicht. Stattdessen stützt er sich mit der Hand an der Wand neben meinem Kopf ab und kommt mit seinem Gesicht noch ein wenig näher, ehe er einen Mundwinkel hebt. Wieder auf diese geheimnisvoll wissende Art und Weise wie vorhin in der Mensa.
»Komm schon«, raunt er. »Du kannst dich vor mir nicht verstecken. Ich durchschaue dich.«
Seine Worte bringen mein Herz dazu, nervös über den nächsten Schlag zu stolpern. In meinem Kopf taucht ein Gedanke auf, aber ich schiebe ihn genauso schnell wieder weg, wie er gekommen ist. Doch das ändert nichts. Mit einem Mal ergreift Nervosität von meinem ganzen Körper Besitz, bringt jeden Muskel in mir zum Schwingen. Ein Prickeln beißt in meinen Nacken, breitet sich bis über meine Arme aus und lässt mich erschaudern. Ich grabe meine Finger in den Stoff meines Shirts, obwohl ich sie vor plötzlicher Kälte kaum spüren kann.
Elias’ Mundwinkel hebt sich. »Du kannst mir vertrauen.«
Die Antwort darauf liegt mir auf der Zunge – denn ganz ehrlich, abgesehen davon, dass das so ungefähr der dümmste Satz ist, den man sagen kann, um jemandes Vertrauen zu wecken, ist es noch viel dümmer, dass er das zu mir sagt. Wir mögen uns ja nicht einmal. Aber ich komme nicht dazu, ihm das zu erklären – denn mit einem Mal gerät meine Welt ins Wanken.
Auch wenn Elias noch immer direkt vor mir steht, ist es jetzt etwas anderes, das meine Aufmerksamkeit auf sich zieht. Etwas Dunkles, Schattenartiges.
Auf einmal setzen meine Gedanken aus. Ich kann nichts tun, außer hier zu stehen und die Kreatur anzustarren, die sich zwischen den Bäumen hinter Elias aufgebaut hat. Im ersten Moment halte ich es für ein Hirngespinst, ein Trugbild meiner flatternden Nerven. Doch spätestens, als das Wesen den Kopf hebt und mich anblickt, schlägt die Gewissheit wie Thors Hammer auf mich ein. Es sieht anders aus als die Gestalt von gestern, aber aus irgendeinem Grund habe ich trotzdem keinen Zweifel daran, dass die beiden Kreaturen zusammengehören.
Sie richtet sich auf ihre schlanken Hinterbeine auf, öffnet ihr schnabelartiges Maul, das so gar nicht in das wolfsähnliche Gesicht passen will, und stößt ein Klickern aus. Das Geräusch bringt Elias dazu, sich nach dem Wesen umzudrehen.
Ich weiß nicht genau, was ich erwartet habe. Vielleicht, dass Elias vor Angst davonrennt oder dass er eine Waffe aus seinem Hosenbund zückt und sich diesem schattenartigen Ding mutig entgegenstellt. Aber er tut nichts von alledem. Stattdessen spannt sich jeder Muskel unter seiner Haut an, ohne dass er sich von der Stelle rührt.
»Du hättest es mir auch einfach sagen können«, zischt er, ohne das Wesen aus den Augen zu lassen, das uns regungslos gegenübersteht.
Auch wenn seine Worte für mich keinen Sinn ergeben, nimmt die Tatsache, dass er die pechschwarze Kreatur offenbar ebenfalls sieht, mir eine ungemeine Last von den Schultern. Ich bin nicht verrückt geworden. Das Ding ist echt – was die Sache allerdings nicht viel besser macht. Wenigstens verdecken die Bäume und der Geräteschuppen das Wesen vor den Blicken der anderen.
Ich beobachte, wie die aufgestellten Ohren der Schattengestalt zucken, und warte mit angehaltenem Atem einen Moment, ehe ich es wage zu antworten. »Was sagen?«
»Dass du ein Haustier hast.«
»Das gehört nicht zu mir!« Diesmal verlassen die Worte meinen Mund, bevor ich meinen Verstand anschalten kann. Der Klang bringt das Wesen dazu, zwischen Elias und mir hin und her zu sehen, die Augen komplett schwarz, als hätten die Pupillen alles darin einfach verschluckt. Sofort stellen sich die feinen Härchen in meinem Nacken auf. Verflucht, was ist das für ein Ding?
Irgendwie schafft Elias es, seinen Blick von dem Wesen zu lösen, und er sieht über seine Schulter zu mir. »Das da –«
Er bricht ab, als links von uns etwas knackt. Im nächsten Moment wirbelt er wieder zu mir herum. Hastig blicke ich von ihm zu dem Ding und wieder zurück, will ihn anherrschen, dass er es nicht aus den Augen lassen darf, doch da begreife ich. Was gerade noch ein harmloses Knacken gewesen ist, entpuppt sich als einer unserer Mitschüler. Ein blonder Junge in Fußballtrikot, der anscheinend keine Ahnung hat, in was er hier hineinstolpert.
Zischend ziehe ich Luft ein. Wenn’s schiefläuft, dann aber richtig.
Während ich noch überlege, wie zur Hölle wir unseren Mitschüler von diesem Wesen ablenken können, ist Elias mir schon einen Schritt voraus. Wieder stützt er sich mit dem Arm an der Mauer neben mir ab, drängt sich diesmal allerdings so nah an mich, dass er mir die Sicht auf das Schattenwesen raubt. In einem Augenblick beobachte ich noch, wie die Muskeln unter der wachsartigen Haut der Kreatur zucken, im nächsten sehe ich nur noch Elias groß vor mir.
Der beugt sich zu mir herunter, bis sein Atem an meinem Ohr kitzelt. »Spiel mit«, sagt er leise und wickelt sich eine meiner verirrten Haarsträhnen um den Finger. Wäre nicht alles in mir vor Angst erstarrt, würde ich ihn spätestens jetzt wegschubsen. Doch ich kann nicht. Zu groß ist meine Furcht vor ruckartigen Bewegungen. Geschweige denn davor, von jemandem mit einem Monster erwischt zu werden.
Zitternd schließe ich die Augen, als das klickernde Geräusch der Gestalt mir ein weiteres Mal durch Mark und Bein fährt, und öffne sie erst wieder, nachdem Elias von mir abgelassen hat. Er wirft einen Blick in Richtung der Sportfelder, doch da ist niemand mehr, der uns Beachtung schenkt. Vermutlich hat der Typ gedacht, wir würden die berüchtigte Ecke hier für … gewisse Aktivitäten nutzen. Nahezu synchron sehen wir zurück zu – nichts.
Ich blinzle, aber das ändert nichts. Dort, wo eben noch diese Kreatur gestanden hat, ist jetzt nur noch die altbekannte Leere zwischen Hausmeisterschuppen und halb toten Bäumen. Ich kann gar nicht anders, als noch mal zu blinzeln. Aber das Ding scheint sich in Luft aufgelöst zu haben.
»Was zur Hölle …« Elias’ Murmeln fasst meine Gedanken in Worte zusammen.
Ich will etwas sagen, doch als hätten meine Nerven noch nicht registriert, dass die Kreatur verschwunden ist, kommt kein Ton über meine Lippen. Eine Weile stehen wir nebeneinander und betrachten in stillem Einvernehmen das Nichts im Gebüsch, dann reißt uns das blecherne Läuten der Schulklingel aus der Starre.
Elias dreht sich zu mir um. Als er mir auffordernd seine Hand entgegenstreckt, ist der überlegene Ausdruck in seine Augen zurückgekehrt. »Gib mir mal dein Handy.«
Etwas in mir protestiert, aber ich schiebe das Gefühl beiseite und hole mein Smartphone aus der Tasche meiner Sportjacke. Jetzt gerade habe ich weitaus größere Probleme als meine Abneigung gegen Elias. Ich entsperre mein Handy und gebe es ihm. »Was war das gerade für ein Ding?«
Sein Blick hebt sich nicht einmal vom Display, während er spricht. »Ich habe nicht die geringste Ahnung.«
»Und warum –«
»Hör mal, Prinzessin«, unterbricht er mich und drückt mir mein Smartphone zurück in die Hand.
»Prinzessin?«, wiederhole ich fassungslos. Was ist das denn für ein bescheuerter Spitzname?
»Ja, Prinzessin in der Not. Die, die Hilfe vom Ritter braucht. Die gerettet werden muss.«
»Und dieser Ritter wärst dann du, oder was?« Ich schnaube. Das kann doch nicht sein Ernst sein.
Er hebt abwehrend die Hände. »Ist ja auch egal. Allem Anschein nach weiß ich mehr als du. Und ich habe ein schlechtes Gewissen, wenn ich dich einfach so ins offene Messer laufen lasse. Ruf mich an, okay?«
Mit diesen Worten dreht er sich um und lässt mich allein an dem Ort stehen, an dem mein Weltbild vor wenigen Minuten in sich zusammengebrochen ist. Mein Herz hämmert gegen meine Rippen, während mein Verstand nach einer Lösung sucht, aber keine findet.
Kapitel 4
Fast schaffen es Ovids Metamorphosen, mich abzulenken. Aber eben nur fast. Spätestens, als Sophies Kopf sich durch den Spalt meiner angelehnten Zimmertür schiebt, brechen die Ereignisse der letzten beiden Tage wieder über mir zusammen. Sophies Sturz ins Meer, dieser seltsame Schatten auf dem Parkplatz, die zweite dieser Kreaturen hinter den Sporthallen und – als wäre das alles nicht schon absurd genug – Elias. Und ich dachte am Anfang der Woche noch, die bald anstehende Politikklausur wäre meine größte Sorge.
Genau das scheint Sophie mir anzumerken. Sobald sie meinen Gesichtsausdruck sieht, lässt sie den Muffin in ihrer Hand sinken und zieht die Augenbrauen zusammen. »Kann ich deine Laune mit einem Muffin verbessern, oder ist es was Schlimmeres?«
Ich zucke mit den Schultern und sehe dabei zu, wie sie einige Kissen von meinem Sofa zusammensucht und zu einem Turm stapelt. Nachdem sie sich neben mich fallen lassen und sich mit den Schultern in ihren Kissenhaufen gekuschelt hat, schiebe ich das Lateinbuch von meinem Schoß und atme einmal tief durch. Dann erkläre ich: »Wir brauchen einen Plan.«
Wieder lässt sie den Muffin sinken, ohne davon abzubeißen. »Hm?«
Mit einem Seufzen presse ich die Lippen aufeinander. Gestern Nachmittag habe ich es nicht mehr über mich gebracht, ihr von der zweiten Kreatur zu erzählen. Zumal das zwischen Geburtstagskuchen, Geschenken und guter Laune ohnehin kaum Platz gefunden hätte. Womit ich allerdings nicht gerechnet habe, ist, dass mir die Worte auch jetzt noch am Gaumen kleben, ohne meine Lippen verlassen zu wollen. Dabei ist das eigentlich Blödsinn: Dass ich es ausspreche, ändert nichts – und gleichzeitig doch irgendwie alles.
Aber wie auch immer. Es muss sein. Und so lasse ich die Bombe platzen: »Es ist schon wieder passiert.«
Blinzelnd erwidert Sophie meinen Blick. In ihren Augen blitzt die gleiche Angst auf, die in mir alles zum Rumoren bringt. »Scheiße!« Sie stellt den Muffin auf dem kleinen Tisch vor meinem Sofa ab und zieht ihre Knie zu sich heran, um sich komplett mir zuzuwenden. »Sah es wieder so gruselig aus?«
»Ja, und gleichzeitig auch irgendwie total anders.« Ich muss ein Schaudern unterdrücken, als ich an das Wesen zurückdenke. »Wie eine Mischung aus Wolf und Krähe … und es stand aufrecht, fast wie ein Mensch. Aber irgendetwas sagt mir, dass die beiden Dinger zusammengehören.«
»Ja, das kann kein Zufall sein.« Nachdenklich legt sie den Kopf schief. »Wann ist es passiert?«
»Gestern in Sport, kurz vor –«
»Hat dich jemand gesehen?«, fällt Sophie mir ins Wort.
»Nein«, antworte ich, korrigiere mich allerdings im nächsten Augenblick selbst. »Doch. Aber nur einer. Elias.«
Sophie verzieht den Mund, als könnte sie sich nicht entscheiden, ob sie genervt oder panisch sein soll. Verständlich. Ich gebe ihr einen Moment, um genau die Gefühlsachterbahn zu durchlaufen, in der ich schon seit gestern ständig Loopings fahre: eine Kombination aus Verwirrung, Panik und Ärger über die Ironie, dass es ausgerechnet Elias sein muss.
»Ich glaube, er weiß mehr als wir.«
»Wie jetzt?« Wo gerade noch das Gefühlschaos war, stehen jetzt eindeutige Fragezeichen in der Miene meiner Schwester.
Ich zucke mit den Schultern und erzähle ihr alles. Von Elias’ Blicken in der Mensa und auf dem Sportplatz, über meine Nervosität bis zu dem Auftauchen der Kreatur und Elias’ abruptem Verschwinden.
Erst als ich meine Ausführungen beendet habe, hört Sophie auf, auf ihrer Unterlippe herumzukauen. Aber auch das nur für einen kurzen Moment, um »Hast du ihn schon angerufen?« zu fragen, ehe sie wieder damit anfängt.
Ich schüttle den Kopf. Auch in der Schule bin ich Elias heute konsequent aus dem Weg gegangen. »Noch nicht. Meinst du, man kann ihm vertrauen?«
»In Filmen geht es selten gut aus, wenn man dem mysteriösen Typen vertraut.« Sophie knabbert am Nagel ihres Daumens. »Entweder endet man tot im Wald, oder einem wird das Herz gebrochen. Schöne Aussichten, wenn du mich fragst.«
Ich schnaubte. Keine Ahnung, welche dieser beiden Optionen mir abwegiger erscheint.
»Und was machen wir jetzt?«
»Keine Ahnung – das Risiko eingehen, tot im Wald zu landen?«
Sophie stößt ein Brummen aus, das nicht allzu überzeugt klingt. Übel nehmen kann ich es ihr nicht. »Wir müssen es Paps sagen.«
»Und wenn er uns nicht glaubt?«
»Das wird er. Er hat damals jeden Abend unter mein Bett geguckt, als ich dachte, da wäre ein Monster. Dann muss er uns einfach glauben, wenn da wirklich eins ist.«
»Da warst du vier.«
»Trotzdem.« Sophie hebt das Kinn. »Er kann ja schlecht so tun, als würden wir uns die Dinger einbilden, wenn wir ihm eins zeigen.«
»Tja, und wie stellst du dir das vor? Die kommen ja nicht angerannt, wenn wir sie rufen«, entgegne ich schnaubend.
»Jetzt mal ehrlich – wieso tauchen diese Wesen auf? Irgendetwas muss sie doch dazu bringen.«
»Frag mich was Leichteres.« Ich zucke mit den Schultern und denke mit einem Schaudern an die zwei Kreaturen zurück. »Vermutlich wollen sie irgendetwas.«
»Aber was?« Sophie legt den Kopf schief. »Bisher haben sie uns ja genau genommen nichts getan – wenn man von dem Schrecken mal absieht, den sie uns eingejagt haben. Sie stehen einfach nur herum und sehen gruselig aus.«
»Ich hab irgendwie die Befürchtung, dass sich das noch ändern wird. Die Dinger jagen mir eine Heidenangst ein. Ich meine – sie sind groß, schwarz und unheimlich. Das kann ja gar nicht gut gehen. Tut es in Horrorfilmen auch nicht.«
Sophie presst die Lippen aufeinander. »Mir machen sie auch Angst.«
»Egal, was sie wollen. Ich will, dass sie wieder verschwinden.« Ich seufze. »Sie kommen jedenfalls immer dann, wenn man sie überhaupt nicht gebrauchen kann. Als wären wir im wahrsten Sinne des Wortes vom Pech verfolgt.«
»Ich glaube, sie verfolgen dich, nicht mich. Immerhin ist das zweite Ding bei dir aufgetaucht, nicht bei mir.« Sophie kaut einen Moment lang geistesabwesend auf ihrem Nagel herum. Bei ihren nächsten Worten kann sie das Beben nicht aus ihrer Stimme verdrängen. »Obwohl sie auch bei mir die Gelegenheit gehabt hätten – Herr Bernard hat mich gestern in Chemie in den Abstellraum geschickt, um Dreihalskolben zu holen.«
Um ihrem intensiven Blick auszuweichen, nestle ich am Saum meines Pullovers herum. »Fakt ist, dass wir nicht wissen, woher die Dinger plötzlich kommen – geschweige denn, was sie wollen«, sage ich. »Aber wir wissen mit ziemlicher Sicherheit, dass diese Wesen jeden Moment wiederauftauchen könnten. Und dass wir keine Ahnung haben, was wir dann tun sollen.«
»Wir überlegen uns einen richtig guten Schlachtplan. Einen, mit dem wir sogar das antike Rom erobert hätten.« Sie versucht sich an einem Lächeln, doch es wirkt eher wie eine gequälte, ängstliche Maske.
Wir wissen beide, dass das mit dem Schlachtplan ziemlich aussichtslos ist. Da sind riesige schwarze Wesen, die höchstwahrscheinlich nicht unsere Freunde werden wollen – und wir sind bloß zwei hilflose Teenager, die Horrorgestalten nur aus irgendwelchen Filmen kennen. Was auch immer hier gerade passiert, ist eindeutig eine Nummer zu groß für uns.
Seufzend massiere ich mir die Schläfen. »Jetzt gerade raucht mein Kopf so sehr, dass ich nicht einmal die nächste Kuhweide erobern könnte.«
»Meiner auch.« Sophie schmunzelt. »Wie wär’s mit folgendem Schritt eins bei unserem Plan: Wir sehen uns einen guten Film an und vergessen für einen Abend dieses ganze Chaos. Und morgen starten wir dann mit neuer Energie.«
»Das klingt nach einem hervorragenden Plan.« Ich schnappe mir die Fernbedienung vom Beistelltisch und mache den Fernseher an. »Aber bloß keine Fantasy. Und auch nicht Stranger Things. Im Moment gibt es für meinen Geschmack genug absurde Wesen in meinem echten Leben.«
Irgendwann zwischen der Beste-Freundinnen-Szene und dem Ausflug ins Skilager bei To All the Boys I’ve Loved Before müssen Sophie und ich eingeschlafen sein. Doch so niedlich die beiden Protagonisten auch anzusehen sind, haben sie es nicht geschafft, die Dämonen aus meinem Kopf zu vertreiben.
Trotz des weichen Polsters unter und Sophies Wärme neben mir haben mich die schwarzen Schatten verfolgt, kaum dass meine Lider zugefallen sind. Auch jetzt, als ich gegen das Dämmerlicht in meinem Zimmer anblinzle, sitzt das ungute Gefühl mir noch immer in den Knochen.
Und auf meinem Schreibtisch.
Im ersten Moment halte ich das Wesen für ein albernes Hirngespinst, ein Überbleibsel meiner Albträume. Dennoch kann ich nicht umhin, wie von einer Tarantel gestochen hochzuschnellen und den Blick des geflügelten schwarzen Wesens zu erwidern. Auch nach mehrmaligem Blinzeln verschwindet es nicht. Mein Magen flattert nervös, meine Finger suchen blind nach der Schulter meiner Schwester. Ich rüttle sie wach. Mit einem genervten Brummen regt Sophie sich, fährt sich mit der Hand durch das zerzauste Haar und setzt sich auf. Ich drehe mich nicht zu ihr um, traue mich nicht, meine Aufmerksamkeit von der Kreatur abzuwenden.
Als auch ihr Blick den Eindringling erfasst, spricht sie mit zittriger Stimme das aus, was ich denke. »Scheiße!«
Kapitel 5
»Wir müssen hier raus.« Meine Worte sind ein kaum hörbares Zischen in Richtung meiner Schwester, aber trotzdem bringen sie das Wesen dazu, ein Klickern auszustoßen und die rehartigen Ohren zu bewegen. Wie seine Vorgänger ist es komplett schwarz, eine groteske Mischung aus verschiedenen Tieren. Obwohl der Rest meines Körpers ganz warm ist, sind meine Hände mit einem Mal eiskalt, als das Ding sein Maul öffnet und erneut ein Geräusch macht, diesmal lauter. Mein ganzes Zimmer vibriert, als hätte ich die Bässe meiner Anlage viel zu stark eingestellt. Doch selbst als der Laut verstummt ist, hört mein Nacken nicht auf zu prickeln.
Auch wenn alles in mir danach schreit, einfach wegzurennen, habe ich mich so gut unter Kontrolle, dass ich nicht einmal mit dem kleinen Finger zucke. Mein Blick zuckt wie wild durch den Raum und sucht nach etwas, das wenigstens halbwegs zur Verteidigung geeignet ist. Aber da ist nichts. Klar, mit dem Mathebuch auf dem Boden neben meinem Bett könnte ich locker jede Menge Käfer erschlagen, aber für ein Wesen dieser Größe ist es eindeutig zu mickrig. Nicht, dass ich das überhaupt in Erwägung zöge – ein kurzer Seitenblick auf die Zähne der Kreatur genügt, damit mein Mut zusammenschrumpft und sich in die hinterste Ecke meines Bewusstseins verzieht.
Innerlich fluchend umfasse ich Sophies Finger und drücke sie sanft. Einmal. Zweimal. Dreimal. Wie damals, wenn unsere Mutter sich mit Paps gestritten hat und wir in unsere Zimmer geflüchtet sind.
Mehr braucht es nicht. Dem stummen Kommando folgend setzen wir uns beide in Bewegung. Sobald wir den schmalen Spalt zwischen Sofa und Beistelltisch hinter uns gelassen haben, schiebe ich Sophie einfach raus, bilde den menschlichen Schild hinter ihrem Rücken und kann nicht anders, als immer wieder über meine Schulter zu sehen. Das Ding auf meinem Schreibtisch hat den Kopf schief gelegt und erwidert meinen Blick ruhig. Viel zu ruhig.
In dem Moment, in dem ich über meine Kleiderstange stolpere, wird mir klar, dass dieses Wesen vermutlich um einiges intelligenter ist als wir. Dass es nichts tut, weil es uns durchschaut hat. Dass es uns längst einen Schritt vor-
Nein. Keine Zeit für solche Gedanken. Ich vertreibe sie mit einem Kopfschütteln und konzentriere mich lieber auf unseren Pseudoplan, schubse Sophie aus meinem Zimmer, stolpere ihr hinterher und pfeffere die Tür hinter uns in den Rahmen.
Einen Augenblick lang stehe ich einfach da, Rücken und Handflächen nur durch eine dünne Platte Holz von dem wahr gewordenen Albtraum in meinem Zimmer getrennt. Obwohl plötzlich alles ganz still und ruhig ist, donnert mein Herz so laut, dass ich das Gefühl habe, beim Konzert einer Rockband direkt vor dem Bassverstärker zu stehen. Ich brauche Sophie nur anzusehen, um zu wissen, dass es ihr genauso geht.
Im Gegensatz zu mir fasst sie sich allerdings schneller wieder. »Die Kommode«, sagt sie und deutet auf das alte Erbstück unserer Oma, das an der Wand neben meiner Zimmertür steht, direkt unter den Familienfotos aus zahlreichen Jahren. »Schieben wir sie vor die Tür. Damit dieses Vieh nicht so leicht durchkommt.«
Ich schätze, wir denken dasselbe: Dass ein wenig Holz und Leim und Erinnerung dieses Wesen nicht aufhalten werden, sollte es uns verfolgen wollen. Aber das hindert uns nicht daran, es trotzdem zu versuchen. Also schieben wir die Kommode mit vereinten Kräften vor meine Tür. Es kostet uns mehrere Minuten und einiges an Ächzen und Poltern, bis wir das Möbelstück endlich in eine Barrikade verwandelt haben.
Erschöpft lehne ich mich dagegen und werfe einen Blick auf die Wanduhr. Es ist halb sechs, und das an einem Samstagmorgen. Garantiert haben wir unseren Vater mit unserer Möbelrückaktion geweckt, doch Sophie geht auf Nummer sicher. »Paps!«, ruft sie. »Paps!«