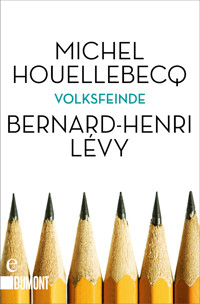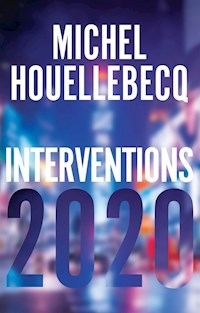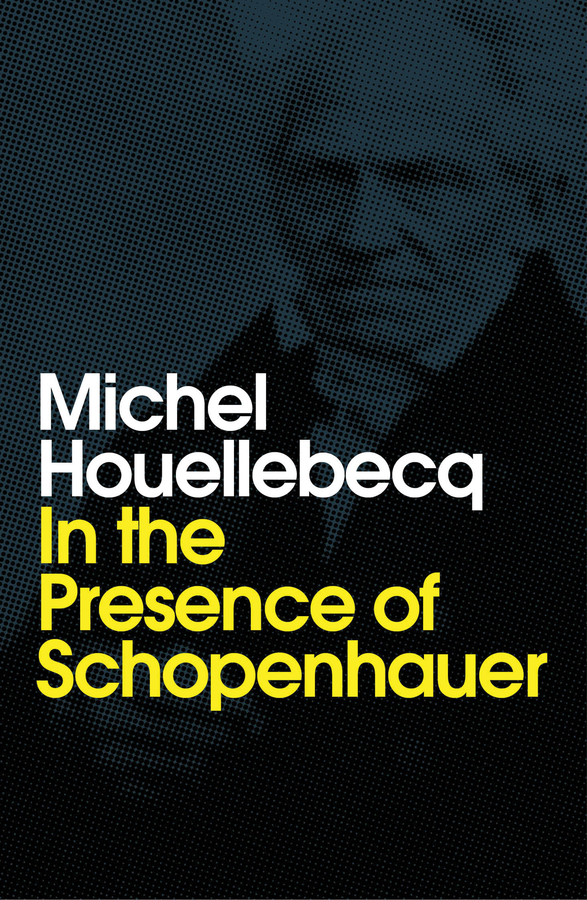12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: DUMONT Buchverlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Vielen seiner Bewunderer gelten Michel Houellebecqs Essays als sein eigentliches Hauptwerk: Sie sind Houellebecq pur, die Essenz seines Schaffens. Literatur, Religion, Glaube, Meinungsfreiheit, Konservatismus, Liebe – das sind die Themen, mit denen sich Michel Houellebecq seit jeher beschäftigt. In diesen Texten, die mal provozieren, immer intellektuell anregen, führt er uns wie so oft die Mittelmäßigkeit und Absurdität des menschlichen Daseins vor Augen. Was Houellebecq in seinen Essays betreibt, ist keine Sozial- und Kulturkritik – es ist nicht weniger als Weltkritik. Das Kompendium verbindet die Einzelbände ›Die Welt als Supermarkt‹ (2000), ›Ich habe einen Traum. Neue Interventionen‹ (2010) und ›Ein bisschen schlechter‹ (2020). Letzterer ist damit erstmals als Taschenbuch erhältlich.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 396
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Vielen seiner Bewunderer gelten Michel Houellebecqs Essays als sein eigentliches Hauptwerk: Sie sind Houellebecq pur, die Essenz seines Schaffens. Literatur, Religion, Glaube, Meinungsfreiheit, Konservatismus, Liebe – das sind die Themen, mit denen sich Michel Houellebecq seit jeher beschäftigt. In diesen Texten, die mal provozieren, immer intellektuell anregen, führt er uns wie so oft die Mittelmäßigkeit und Absurdität des menschlichen Daseins vor Augen. Was Houellebecq in seinen Essays betreibt, ist keine Sozial- und Kulturkritik – es ist nicht weniger als Weltkritik.
Das Kompendium verbindet die Einzelbände ›Die Welt als Supermarkt‹ (2000), ›Ich habe einen Traum. Neue Interventionen‹ (2010) und ›Ein bisschen schlechter‹ (2020). Letzterer ist damit erstmals als Taschenbuch erhältlich.
© Philippe Matsas. Flammarion
Michel Houellebecq wurde 1958 geboren. Er gehört zu den wichtigsten Autoren der Gegenwart, seine Bücher werden in über 40Ländern veröffentlicht. Für den Roman ›Karte und Gebiet‹ (2011) erhielt er den renommiertesten französischen Literaturpreis, den Prix Goncourt. Sein Roman ›Unterwerfung‹ (2015) stand wochenlang auf den Bestsellerlisten und wurde mit großem Erfolg verfilmt und für die Theaterbühne adaptiert. Zuletzt erschien sein Roman ›Vernichten‹ (2022).
MICHELHOUELLEBECQ
INTERVENTIONEN 1992–2020ESSAYS
Aus dem Französischen von Hella Faust und Stephan Kleiner
eBook 2022
DuMont Buchverlag, Köln
Alle Rechte vorbehalten
›Interventionen 1992 – 2020‹ verbindet die Bände ›Die Welt als Supermarkt‹, ›Ich habe einen Traum und ›Ein bisschen schlechter‹.
›Die Welt als Supermarkt‹
© Flammarion 1998
Die französische Originalausgabe erschien 1998 unter dem Titel ›Intervention‹ bei Flammarion, Paris.
© 1999 für die deutsche erweiterte Ausgabe: DuMont Buchverlag, Köln
›Ich habe einen Traum‹
© Michel Houellebecq/Flammarion 2009
Die französische Originalausgabe erschien 2009 unter dem Titel ›Intervention 2‹ bei Flammarion, Paris.
© 2010 für die deutsche Ausgabe: DuMont Buchverlag, Köln
›Ein bisschen schlechter‹
© Michel Houellebecq and Flammarion, Paris, 2020
Die französische Originalausgabe erschien 2020 unter dem Titel ›Interventions 2020‹ bei Flammarion, Paris.
© 2020 für die deutsche Ausgabe: DuMont Buchverlag, Köln
Übersetzung: Hella Faust, Stephan Kleiner
Umschlaggestaltung: Lübbeke Naumann Thoben, Köln
Umschlagabbildung: © plainpicture/Anja Bäcker
Satz: Angelika Kudella, Köln
eBook-Konvertierung: CPI books GmbH, Leck
ISBN eBook 978-3-8321-8241-0
www.dumont-buchverlag.de
DIE WELT ALS SUPERMARKT.
INTERVENTIONEN
Der Roman, von gleicher Gestalt wie der Mensch, sollte normalerweise alles von ihm enthalten können. Man glaubt beispielsweise zu Unrecht, dass die Menschen ein rein materielles Leben führen. Gewissermaßen parallel zu ihrem Leben stellen sie sich unentwegt Fragen, die man in Ermangelung eines besseren Ausdrucks philosophisch nennen muss. Ich habe diesen Zug in allen Klassen der Gesellschaft, von den einfachsten bis in die gebildetsten hinein, beobachten können. Physischer Schmerz, Krankheit und Hunger machen es unmöglich, diese existenziellen Fragestellungen vollständig zum Verstummen zu bringen. Dieses Phänomen hat mich schon immer beschäftigt und mehr noch die Tatsache, dass man es verkennt. Es steht in so lebhaftem Kontrast zu dem zynischen Realismus, der seit einigen Jahrhunderten in Mode ist, will man über die Menschheit reden.
Die »theoretischen Überlegungen« scheinen mir folglich ein genauso guter Romanstoff zu sein wie alle anderen auch, ja ein besserer als die meisten anderen. Das Gleiche gilt für Diskussionen, Gespräche, Debatten … Es gilt noch offensichtlicher für die Literatur-, Kunst- oder Musikkritik. Im Grunde müsste man alles in ein einziges Buch verwandeln können, an dem man bis zu seinem Tod schriebe. Es scheint mir eine vernünftige, glückliche Lebensweise zu sein und eine, die sich bis auf wenige Dinge vielleicht sogar in die Praxis umsetzen lässt. Die einzige Sache, von der ich in Wirklichkeit glaube, dass sie sich schwierig in einen Roman einfügen lässt, ist die Poesie. Ich sage nicht, dass es unmöglich ist, ich sage, dass es mir sehr schwierig vorkommt. Es gibt die Poesie, es gibt das Leben. Zwischen den beiden gibt es Ähnlichkeiten, mehr nicht.
Der offensichtlichste gemeinsame Nenner der hier versammelten Texte ist, dass man mich gebeten hat, sie zu schreiben. Sie sind in verschiedenen Zeitschriften veröffentlicht und dann unauffindbar geworden. Im Sinne des oben Gesagten hätte ich in Erwägung ziehen können, sie in einem größeren Werk weiterzuverwenden. Ich habe es versucht, es ist mir aber nur selten gelungen. Mir liegt jedoch noch immer an diesen Texten. Das ist, kurz gesagt, der Grund dieser Veröffentlichung.
JACQUES PRÉVERT IST EIN ARSCHLOCH
Dieser Artikel erschien in der Nummer 22 (Juli 1992) der Zeitschrift Lettres françaises.
Jacques Prévert ist jemand, dessen Gedichte man in der Schule lernt. Aus ihnen geht hervor, dass er Blumen mochte, Vögel, die alten Stadtviertel von Paris usw. Die Liebe schien ihm in einer Atmosphäre der Freiheit zu erblühen. Er war allgemein eher für die Freiheit. Er trug eine Schildmütze und rauchte Gauloises. Man verwechselt ihn zuweilen mit Jean Gabin. Er war es übrigens, der die Drehbücher für Hafen im Nebel, Pforten der Nacht usw. schrieb. Er schrieb auch das Drehbuch für Die Kinder des Olymp, das man für sein Meisterwerk hält. All das sind genügend gute Gründe, um Jacques Prévert zu hassen, vor allem, wenn man die nie verfilmten Drehbücher liest, die Antonin Artaud zur gleichen Zeit schrieb. Es ist traurig festzustellen, dass dieser widerwärtige poetische Realismus, dessen wichtigster Vertreter Jacques Prévert war, noch immer verheerende Auswirkungen hat. Man glaubt, Leos Carax ein Kompliment zu machen, wenn man ihn dazuzählt (genau wie man Rohmer wahrscheinlich für einen neuen Guitry hält usw.) Das französische Kino hat sich vom Aufkommen des Tonfilms in Wirklichkeit nie erholt. Es wird zum Schluss daran zugrunde gehen, was nicht weiter schlimm ist.
Jacques Prévert hatte in der Nachkriegszeit, ungefähr zur gleichen Zeit wie Jean-Paul Sartre, ungeheuren Erfolg. Man ist wider Willen vom Optimismus dieser Generation verblüfft. Heute wäre der einflussreichste Denker eher jemand wie Cioran. Damals hörte man Vian, Brassens … Verliebte, die sich auf öffentlichen Parkbänken abknutschen, Babyboom, der massenhafte Bau von Sozialwohnungen, um all diese Leute unterzubringen. Viel Optimismus, Glaube an die Zukunft und ein wenig Idiotie. Wir sind unbestreitbar viel intelligenter geworden.
Bei den Intellektuellen ist Prévert weniger gut weggekommen. Und das, obwohl seine Gedichte nur so strotzen von stupiden Wortspielen, die bei Bobby Lapointe so gefallen. Aber es ist wahr, dass das Chanson, ein wie man sagt, minderwertiges Genre ist und dass auch der Intellektuelle sich entspannen muss. Wenn man den geschriebenen Text, seinen wirklichen Broterwerb, unter die Lupe nimmt, wird der Intellektuelle unerbittlich. Die »Textarbeit« bleibt bei Prévert dürftig. Er schreibt schlicht und wirklich ungezwungen, mitunter sogar gefühlvoll. Er interessiert sich weder für den Stil noch für die Unmöglichkeit zu schreiben. Seine große Inspirationsquelle ist eher das Leben. Den Dissertationen ist er daher im Wesentlichen entkommen. Heute hingegen zieht er in die Pléiade ein, was einem zweiten Tod gleichkommt. Sein Werk liegt vor uns, komplett und erstarrt. Ein ausgezeichneter Grund, sich zu fragen, weshalb die Poesie von Jacques Prévert so mittelmäßig ist, dass man sich bei ihrer Lektüre manchmal schämt. Die klassische Erklärung (es fehle seinem Stil an »Strenge«) ist völlig falsch. Seine Wortspiele, sein leichter und klarer Rhythmus bringen Préverts Weltanschauung in Wirklichkeit perfekt zum Ausdruck. Die Form passt zum Inhalt, wohl das Höchste, was man von einer Form verlangen kann. Wenn ein Dichter zudem bis zu diesem Grad ins Leben eintaucht, in das wirkliche Leben seiner Zeit, wäre es eine Beleidigung, ihn mit rein stilistischen Kriterien zu bewerten. Wenn Prévert schreibt, dann deshalb, weil er etwas zu sagen hat. Das gereicht ihm ganz zu seiner Ehre. Was er zu sagen hat, ist leider von grenzenloser Dummheit. Es wird einem manchmal übel. So gibt es hübsche nackte Mädchen, Spießer, die wie Schweine bluten, wenn man ihnen den Hals aufschlitzt. Die Kinder sind sympathisch unsittlich, die Strolche verführerisch und potent, denen die hübschen nackten Mädchen ihre Körper hingeben. Die Bürger sind alt, fett, impotent, mit der Ehrenlegion geschmückt und ihre Frauen frigide. Priester sind widerwärtige alte Ekel, die die Sünde erfunden haben, um uns das Leben zu vergällen. All das ist bekannt. Man kann dem Baudelaire vorziehen. Oder gar Karl Marx, der sich wenigstens nicht in der Zielscheibe irrt, wenn er schreibt, dass »der Triumph der Bourgeoisie die heiligen Schauer der religiösen Extase, des ritterlichen Enthusiasmus und der Dreigroschensentimentalität in den eiskalten Wassern des egoistischen Kalküls ertränkt hat«.1 Intelligenz ist beim Schreiben von Gedichten keine Hilfe. Sie kann jedoch verhindern, dass man schlechte Gedichte schreibt. Jacques Prévert ist ein schlechter Dichter, vor allem deshalb, weil seine Weltsicht platt, oberflächlich und falsch ist. Sie war schon zu seiner Zeit falsch, heute aber springt seine Unbegabtheit so sehr ins Auge, dass das gesamte Werk die Darlegung eines gigantischen Klischees zu sein scheint. Philosophisch und politisch gesehen ist Jacques Prévert vor allem ein Libertin, das heißt im Wesentlichen ein Dummkopf.
»In den eiskalten Wassern des egoistischen Kalküls« plätschern wir seit unserer zartesten Kindheit. Man kann sich daran gewöhnen, versuchen, zu überleben. Man kann auch darin versinken. Aber es ist unmöglich, sich vorzustellen, dass allein die Freisetzung von Lustgefühlen in der Lage sein soll, eine Erwärmung herbeizuführen. Die Anekdote will, dass es Robespierre war, der darauf bestand, der Losung der Republik das Wort Brüderlichkeit hinzuzufügen. Heute sind wir imstande, diese Anekdote angemessen zu würdigen. Prévert hielt sich mit Sicherheit nicht für einen Anhänger der Brüderlichkeit. Robespierre jedoch war alles andere als ein Gegner der Tugend.
DIE FEIER
Das Ziel der Feier ist es, uns vergessen zu machen, dass wir einsam, elend und dem Tode geweiht sind. Anders gesagt, es ist das Ziel der Feier, uns in Tiere zu verwandeln. Deshalb hat der Primitive ein hoch entwickeltes Gespür fürs Feiern. Eine gute Dosis halluzinogener Pflanzen, drei Tamburins und die Sache geht in Ordnung: Ein Nichts amüsiert ihn. Im Gegensatz dazu gerät der durchschnittliche Westeuropäer erst am Ende endloser Rave-Parties, aus denen er taub und mit Drogen vollgepumpt herauskommt, in eine unzulängliche Ekstase: Er hat überhaupt kein Gespür mehr fürs Feiern. Sich seiner zutiefst bewusst, den anderen vollkommen fremd, terrorisiert vom Gedanken an den Tod, ist er wirklich unfähig, zu welcher Fusion auch immer zu gelangen. Trotzdem bleibt er eigensinnig. Der Verlust seiner tierischen Kondition betrübt ihn, er empfindet darüber Scham und Verdruss. Er wäre gern ein Lebemann oder würde zumindest gern als ein solcher gelten. Er befindet sich in einer scheußlichen Lage.
WAS HABE ICH MIT DIESEN ARSCHLÖCHERN ZU TUN?
»Wenn sich zwei von Euch in meinem Namen vereinen, werde ich in ihrer Mitte sein« (Matthäus, 17,13). Das ist genau das Problem: vereint in wessen Namen? Was rechtfertigt es im Grunde, miteinander vereint zu sein?
Vereint, um sich zu amüsieren. Das ist der schlimmste der Fälle. Unter diesen Umständen (Nachtclubs, Volksfeste, Feiern), die sichtlich nichts Amüsantes an sich haben, gibt es nur eine einzige Lösung: anbaggern. Man verlässt sodann die Gattung Feier, um in einen rauen narzisstischen Wettbewerb – mit oder ohne Option »Penetration« – hinüberzuwechseln. (Gewöhnlich geht man davon aus, dass der Mann die Penetration braucht, um die gewünschte narzisstische Befriedigung zu erlangen. Er spürt dann etwas, das dem Klappern der Freispiele bei alten Flipperautomaten entspricht. Die Frau begnügt sich zumeist mit der Gewissheit, dass man in sie einzudringen wünscht.) Wenn Sie sich von dieser Art Spielchen abgestoßen fühlen, wenn Sie sich außerstande fühlen, dabei eine gute Figur abzugeben, dann gibt es nur eine Lösung: so schnell wie möglich aufzubrechen.
Vereint, um zu kämpfen (Studentendemos, Umweltschützertreffen, Talkshows über die Banlieue). Die Idee ist a priori genial: Das fröhliche Bindemittel einer gemeinsamen Sache kann tatsächlich einen Gruppeneffekt hervorrufen, ein Zugehörigkeitsgefühl, ja, sogar eine echte kollektive Trunkenheit. Leider folgt die Massenpsychologie unwandelbaren Gesetzen: der Herrschaft der dümmsten und aggressivsten Bestandteile. Man befindet sich also inmitten einer lautstark grölenden, ja, gefährlichen Bande. Man ist folglich vor die gleiche Wahl gestellt wie im Nachtklub: aufbrechen, bevor es zu Handgreiflichkeiten kommt, oder anbaggern (in einem hier günstigeren Umfeld: das Vorhandensein gemeinsamer Überzeugungen, die diversen, vom Ablauf der Protestveranstaltung hervorgerufenen Gefühle haben den narzisstischen Panzer womöglich leicht erschüttert).
Vereint, um zu vögeln (Swingerklubs, private Orgien, bestimmte New-Age-Gruppen). Eine der einfachsten und ältesten Formeln: die Menschheit in dem zu vereinen, was sie in der Tat zutiefst gemeinsam hat. Geschlechtsakte finden statt, selbst wenn der Genuss nicht immer zur Stelle ist. Es ist immerhin etwas, aber auch schon alles.
Vereint, um zu zelebrieren (Messen, Pilgerfahrten). Die Religion bietet eine ganz und gar originelle Formel an: Trennung und Tod werden kühn geleugnet, indem man bekräftigt, dass wir wider allen Anschein in göttlicher Liebe baden und uns gleichzeitig auf eine glückliche Ewigkeit zubewegen. Eine religiöse Zeremonie, an die die Teilnehmenden glauben, bietet das einzigartige Beispiel einer gelungenen Feier. Bestimmte agnostische Teilnehmer fühlen sich während der Dauer der Zeremonie möglicherweise sogar von einem Gefühl des Glaubens übermannt; sie laufen dann jedoch Gefahr, schmerzlich ernüchtert zu werden (ein wenig wie beim Geschlechtsakt, nur schlimmer). Eine Lösung: von der Gnade berührt zu sein.
Die Pilgerfahrt, die die Vorteile der Studentendemonstration mit denen der Nouvelles-Frontières-Reisen kombiniert, all das in einem von der Müdigkeit noch verschärften Ambiente der Geistigkeit, bietet darüber hinaus die idealen Bedingungen für die Anbaggerei, die darüber fast unfreiwillig, ja aufrichtig wird. Der beste Fall am Ende einer Pilgerfahrt: Heirat und Konversion. Im entgegengesetzten Fall kann die Ernüchterung schrecklich sein. Sehen Sie vor, eine UCPA-Reise zum Thema »Gleitsportarten« anzuschließen, die Sie immer noch rechtzeitig stornieren können (informieren Sie sich im Voraus über die Stornierungsbedingungen).
DIE TRÄNENLOSE FEIER
In Wirklichkeit reicht es aus, Amüsement vorgesehen zu haben, um sicherzugehen, dass man sich langweilt. Ideal wäre es daher, völlig aufs Feiern zu verzichten. Leider ist der Lebemann eine in solchem Maße respektierte Persönlichkeit, dass dieser Verzicht eine starke Minderung des sozialen Images zur Folge hat. Die wenigen folgenden Ratschläge dürften ermöglichen, das Schlimmste zu vermeiden (bis zum Schluss allein bleiben, in einem Zustand der Langeweile, der sich zur Verzweiflung hin entwickelt, mit dem irrtümlichen Eindruck, dass sich die anderen amüsieren).
•Sich im Voraus klarmachen, dass die Feier zwangsläufig misslingen wird. Sich die Beispiele früherer Misserfolge vor Augen halten. Es geht nicht darum, deswegen eine zynische und blasierte Haltung anzunehmen. Im Gegenteil, das bescheidene und von einem Lächeln begleitete Akzeptieren des allgemeinen Desasters ermöglicht den Erfolg, eine misslungene Feier in einen Augenblick angenehmer Banalität zu verwandeln.
•Stets vorsehen, allein und im Taxi nach Hause zu fahren.
•Vor der Feier: trinken. Alkohol in moderater Dosierung erzeugt eine sozialisierende und euphorisierende Wirkung, die nach wie vor keine wirkliche Konkurrenz hat.
•Während der Feier: trinken, aber die Dosierung verringern (der Cocktail Alkohol plus vorherrschende Erotik verleitet schnell zur Gewalttätigkeit, zum Selbstmord und zum Mord). Es ist geschickter, im passenden Moment eine halbe Lexomil zu nehmen. Da der Alkohol den Effekt der Beruhigungsmittel verstärkt, beobachtet man umgehend Schläfrigkeit: der richtige Zeitpunkt, um ein Taxi zu rufen. Eine gute Feier ist eine kurze Feier.
•Nach der Feier: anrufen, um sich zu bedanken. Friedlich auf die nächste Feier warten (einen monatlichen Abstand einhalten, der sich in der Ferienzeit auf eine Woche verkürzen kann).
Zum Schluss eine tröstliche Aussicht: Mit zunehmendem Alter nimmt die Verpflichtung zu feiern ab, der Hang zur Einsamkeit nimmt zu. Das wirkliche Leben gewinnt wieder die Oberhand.
FATA MORGANAvon Jean-Claude Guiguet
Dieser Artikel erschien in der Nummer 27 (Dezember 1992) der Zeitschrift Lettres françaises.
Eine Familie aus dem Bildungsbürgertum am Ufer des Genfer Sees. Klassische Musik, kurze Sequenzen mit intensiven Dialogen, dazwischen Schnitte mit Blick auf den See: All das vermittelt möglicherweise den schmerzlichen Eindruck eines Déjà-vu. Die Tatsache, dass die Tochter malt, vergrößert unsere Unruhe noch. Aber nein, es handelt sich nicht um den fünfundzwanzigsten Klon von Eric Rohmer. Es handelt sich seltsamerweise um weit mehr.
Wenn ein Film unentwegt Nervendes neben Magisches stellt, ist es selten, dass das Magische zum Schluss die Oberhand gewinnt; genau das aber geschieht hier. Die recht ungenau spielenden Schauspieler haben sichtlich Schwierigkeiten, einen Text zu interpretieren, dem man zu sehr anhört, dass er geschrieben ist, und der mitunter ans Lächerliche grenzt. Sagen wir, dass sie nicht immer den richtigen Ton treffen, was vielleicht nicht ausschließlich ihre Schuld ist. Was ist der richtige Tonfall für einen Satz wie »Das schöne Wetter ist mit von der Partie«? Nur die Mutter, Louise Marleau, ist von Anfang bis Ende perfekt, und es ist ohne Zweifel der von ihr gesprochene wunderbare Monolog einer verliebten Frau (eine erstaunliche Sache im Film, der Monolog einer verliebten Frau), der ausschlaggebend dafür ist, dass wir uneingeschränkt Anteil nehmen. Einige fragwürdige Dialoge, gewisse, etwas schwerfällige musikalische Zeichensetzungen lassen sich wohl entschuldigen; in einem gewöhnlichen Film blieben sie übrigens unbemerkt.
Ausgehend von einem tragisch einfachen Thema (es ist Frühling, das Wetter ist schön; eine fünfzigjährige Frau wünscht sich sehnlichst, eine letzte sinnliche Leidenschaft zu erleben; die Natur ist schön, aber sie ist auch grausam) ist Jean-Claude Guiguet das größte Risiko eingegangen: das der formalen Perfektion. In diesem Film, der vom Werbeclip wie vom auftrumpfenden Realismus meilenweit entfernt ist, meilenweit entfernt auch von willkürlicher Experimentiererei, gibt es keine andere Suche als die nach Schönheit pur. Die klassische, geläuterte Zerlegung in Sequenzen von zartem Wagemut findet ihre exakte Entsprechung in der unerbittlichen Geometrie der Bildeinstellungen. Das alles ist präzise, nüchtern, angelegt wie die Facetten eines Diamanten: ein seltenes Werk. Es ist auch selten, einen Film zu sehen, in dem das Licht sich mit solcher Klugheit der emotionalen Stimmung der Szenen anpasst. Die Beleuchtung und die Ausstattung der Innenaufnahmen treffen den richtigen Ton, sind von unendlichem Taktgefühl. Wie eine diskrete und intensive Orchesterbegleitung bleiben sie im Hintergrund. Das Licht bricht nur in die Außenaufnahmen ein, in die sonnigen, an den See grenzenden Wiesen, nur dort spielt es eine zentrale Rolle. Auch da herrscht vollkommene Übereinstimmung mit der Aussage des Films. Sinnlich und gewaltig leuchtende Gesichter. Die flimmernde Maske der Natur, hinter der sich, wie man weiß, ein abstoßendes Gewimmel verbirgt, eine Maske, die abzureißen jedoch unmöglich ist. Nie ist, ganz nebenbei gesagt, der Geist von Thomas Mann mit solcher Tiefe erfasst worden. Von der Sonne haben wir nichts Gutes zu erwarten, den Menschen aber kann es bis zu einem gewissen Grad vielleicht gelingen, einander zu lieben. Ich erinnere mich nicht, jemals eine Mutter gehört zu haben, die zu ihrer Tochter auf so überzeugende Weise »Ich liebe dich« gesagt hätte. In keinem Film, noch nie. Fata Morgana will vehement, nostalgisch, fast schmerzhaft ein kultivierter, ein europäischer Film sein. Und merkwürdigerweise gelingt ihm das, indem er Tiefe, ein echt germanisches Gespür für den Riss mit einem zutiefst französischen Leuchten, einer klassischen Reinheit der Beleuchtung verbindet. Ein wirklich seltener Film.
DER VERLORENE BLICKLob des Stummfilms
Dieser Artikel erschien in der Nummer 32 (Mai 1993) der Zeitschrift Lettres françaises.
Der Mensch spricht, manchmal spricht er nicht. Ist er bedroht, krümmt er sich, seine Blicke durchsuchen hastig den Raum. Ist er verzweifelt, zieht er sich zurück, wickelt sich ein in Angst. Ist er glücklich, verlangsamt sich seine Atmung. Sein Leben hat einen gleichmäßigeren Rhythmus. Es hat in der Geschichte der Welt zwei Kunstformen (die Malerei, die Bildhauerei) gegeben, die versucht haben, die menschliche Erfahrung mithilfe von bewegungslosen Darstellungen, von angehaltenen Bewegungen zusammenzufassen. Manchmal entschieden sie sich dafür, die Bewegung in ihrem Gleichgewicht, ihrer größten Anmut (in ihrer Unsterblichkeit) anzuhalten: Man denke an all die Jungfrauen mit Kind. Manchmal entschieden sie sich dafür, die Handlung in ihrer höchsten Spannung, ihrem intensivsten Ausdruck anzuhalten – so der Barock, aber auch zahlreiche Gemälde von Caspar David Friedrich, die an eine gefrorene Explosion erinnern. Sie haben sich jahrtausendelang entwickelt; sie hatten die Möglichkeit, Werke hervorzubringen, die im Sinne ihres verborgensten Ehrgeizes – die Zeit anzuhalten – vollendet waren.
Es hat in der Geschichte der Welt eine Kunst gegeben, die sich das Studium der Bewegung zum Inhalt gemacht hatte. Diese Kunst hat sich in dreißig Jahren entwickeln können. Zwischen 1925 und 1930 hat sie einige Einstellungen – in einigen Filmen – hervorgebracht (ich denke vor allem an Murnau, Eisenstein, Dreyer), die ihr Dasein als Kunst belegten. Dann verschwand sie, offensichtlich für immer.
Die Dohlen geben Zeichen der Warnung und des gegenseitigen Erkennens aus. Man hat mehr als sechzig Zeichen entziffern können. Die Dohlen bleiben eine Ausnahme: Im Großen und Ganzen arbeitet die Welt in einer schrecklichen Stille. Sie drückt ihr Wesen durch die Form und die Bewegung aus. Der Wind fegt über das Gras (Eisenstein), eine Träne läuft über ein Gesicht (Dreyer). Der Stummfilm sah, wie sich ein unermesslicher Raum vor ihm auftat: Er untersuchte nicht nur die menschlichen Gefühle, er untersuchte nicht nur die Bewegungen der Welt. Sein größter Ehrgeiz war es, die Bedingungen der Wahrnehmung zu untersuchen. Die Unterscheidung zwischen Hintergrund und Figur bildet die Grundlage unserer Darstellungen; aber unser Geist sucht auf geheimnisvolle Weise auch zwischen der Gestalt und der Bewegung, zwischen der Form und ihrem Entstehungsprozess seinen Weg durch die Welt – daher das fast hypnotische Gefühl, das uns überfällt, wenn wir vor einer starren Form stehen, die von einer ununterbrochenen Bewegung hervorgebracht wurde, wie etwa die stehenden Wellen an der Oberfläche einer Pfütze.
Was hat sich nach 1930 davon erhalten? Einige Spuren, vor allem in Werken von Regisseuren, die zur Zeit des Stummfilms zu drehen begonnen hatten (Kurosawas Tod war mehr als nur der Tod eines Mannes); einige Augenblicke in Experimentalfilmen, in wissenschaftlichen Dokumentarfilmen, ja, sogar in Serienproduktionen (die vor wenigen Jahren entstandene Serie Australia ist dafür ein Beispiel). Diese Augenblicke erkennt man unschwer daran, dass Sprechen in ihnen unmöglich ist, dass selbst die Musik in ihnen etwas Kitschiges, Schwerfälliges, Vulgäres bekommt. Wir werden zu reiner Wahrnehmung, die Welt erscheint in ihrer Immanenz. Wir sind überaus glücklich, ein Glück, das seltsam ist. Verliebtsein kann diese Art Effekte ebenfalls erzeugen.
LEERER HIMMEL
In dem Film, den Pasolini über das Leben des heiligen Paulus zu drehen gedachte, hatte er die Absicht, die Mission des Apostels auf die heutige Welt zu übertragen; sich die Form auszumalen, die sie inmitten der Geschäftsmoderne annehmen könnte; und das, ohne den Text der Briefe zu verändern. Er hatte jedoch den Plan, Rom gegen New York auszutauschen, und gibt dafür einen naheliegenden Grund an: Wie damals Rom ist heute New York das Zentrum der Welt, der Sitz der Mächte, die die Welt beherrschen (er schlägt im gleichen Sinne vor, Athen gegen Paris und Antiochia gegen London auszutauschen). Nach einigen Stunden Aufenthalt in New York merke ich, dass es wahrscheinlich einen anderen, verborgeneren Grund gibt, den nur der Film hätte ans Licht bringen können. In New York wie in Rom spürt man trotz der scheinbaren Dynamik eine eigenartige Verfalls- und Todesstimmung, eine Endzeitstimmung. Ich weiß wohl, dass »die Stadt brodelt, dass sie ein Schmelztiegel ist, dass in ihr eine wahnsinnige Energie pulsiert« usw. Dennoch war mir seltsamerweise eher danach, in meinem Hotelzimmer zu bleiben, die Möwen anzuschauen, die quer über die verlassenen Hafenanlagen an den Ufern des Hudson River flogen. Ein sanfter Regen fiel auf die Lagerhäuser aus Ziegelstein; es war sehr besänftigend. Ich konnte mir durchaus vorstellen, mich unter einem dreckig braunen Himmel in einer riesigen Wohnung zu verschanzen, während am Horizont letzte sporadische Kämpfe verglühen würden. Später würde ich ausgehen, durch endgültig verödete Straßen laufen können. So wie im buschigen Unterholz Pflanzenschichten übereinanderliegen, stehen in New York unterschiedliche Höhen und Stile in einem unvorhersehbaren Wirrwarr nebeneinander. In mehr als einer Straße hat man das Gefühl, durch einen Canyon, zwischen Felsburgen hindurchzulaufen. Ein wenig wie in Prag (aber eingeschränkter: Die New Yorker Gebäude decken nur ein Jahrhundert Architektur ab) hat man manchmal den Eindruck, in einem Organismus umherzulaufen, den Gesetzen des natürlichen Wachstums unterworfen. (Dagegen erstarren Burens Säulen in den Gärten des Palais Royal in einem albernen Gegensatz zu ihrer architektonischen Umgebung; man spürt deutlich die Gegenwart eines menschlichen Willens und sogar die eines recht dürftigen menschlichen Willens, in der Art eines Gags.) Es ist möglich, dass die menschliche Architektur den Gipfel ihrer Schönheit erst dann erreicht, wenn sie durch Brodeln und Aneinanderreihungen an ein natürliches Gebilde zu erinnern beginnt; genau wie die Natur den Gipfel ihrer Schönheit erst dann erreicht, wenn sie durch Lichtspiele und formale Abstraktion den Verdacht eines voluntaristischen
DIE SCHÖPFERISCHE ABSURDITÄT
Dieser Artikel erschien in der Nummer 13 der Zeitschrift Les Inrockuptibles anlässlich der Neuauflage.
Jean Cohen, Theoretiker der Poesie, ist Autor zweier Werke: Structure du langage poétique (Die Struktur der poetischen Sprache) (Flammarion/Champs, 1966)und Le haut langage (Die hohe Sprache) (Flammarion, 1979). Letzteres wurde 1995 kurz nach dem Tode des Autors bei José Corti neu aufgelegt.
Structure du langage poétique wird den ernsthaften Kriterien der Universität gerecht. Das ist nicht unbedingt eine Kritik. Jean Cohen macht in seinem Buch darauf aufmerksam, dass sich die Poesie im Vergleich zur gewöhnlichen Sprache der Prosa, die dazu dient, Informationen zu übermitteln, erhebliche Abweichungen erlaubt. Sie benutzt immer wieder Epitheta, die nicht zwingend sind (»weiße Dämmerungen«, Mallarmé; »schwarze Parfüme«, Rimbaud). Sie erliegt der Versuchung des Evidenten (»Zerreißen Sie es nicht mit Ihren beiden weißen Händen«, Verlaine; der prosaische Geist feixt: Hat sie etwa drei?) Sie schreckt nicht vor einer gewissen Inkonsequenz zurück (»Ruth sann und Booz träumte, das Gras war schwarz«, Hugo; eine Aneinanderreihung von zwei Aussagen, unterstreicht Cohen, deren logische Einheit nur schwer nachzuvollziehen ist). Sie findet Gefallen – und das mit Vergnügen – an der Redundanz, die die Prosa als Wiederholung ächtet. Ein Grenzfall ist Llanto por Ignacio Sanchez Mejias, ein Gedicht von Garcia Lorca, in dem die Worte cinco de la tarde in den zweiundfünfzig Versen dreißigmal wiederkehren. Zum Nachweis seiner Behauptung analysiert der Autor im statistischen Vergleich poetische Texte und Texte in Prosa (Höhepunkt des Prosaischen sind für ihn – bezeichnenderweise – die Schriften der großen Wissenschaftler des ausgehenden 19.Jahrhunderts: Pasteur, Claude Bernard, Marcelin Berthelot). Die gleiche Methode führt ihn zu der Feststellung, dass das Ausmaß der poetischen Abweichung bei den Romantikern weit größer ist als bei den Klassikern und bei den Symbolisten noch zunimmt. Auch wenn man das intuitiv bereits geahnt hat, es ist dennoch angenehm, das so klar nachgewiesen zu bekommen. Am Ende des Buches ist man sich einer Sache sicher: Der Autor hat tatsächlich bestimmte für die Poesie charakteristische Abweichungen gefunden. Wohin aber tendieren diese Abweichungen? Worin besteht ihr Ziel, wenn sie eins besitzen?
Nach mehreren Wochen Seefahrt meldete man Christoph Columbus, dass die Hälfte der Lebensmittel aufgebraucht sei. Nichts wies auf die Nähe von Land hin. Das ist genau der Augenblick, in dem sein Abenteuer ins Heldenhafte umschlug: der Augenblick, in dem er die Entscheidung traf, weiter nach Westen zu segeln, obwohl er wusste, dass es nach menschlichem Ermessen keine Möglichkeit der Rückkehr mehr gab. Jean Cohen deckt seine Karten bereits in der Einführung von Haut langage auf: Was die Frage des Wesens der Poesie betrifft, wird er von allen bestehenden Theorien abrücken. Was die Poesie ausmacht, sagt er, ist nicht die Tatsache, dass der Prosa (wie man lange Zeit geglaubt hat, zu jener Zeit, als ein Gedicht es sich schuldig war, in Versen abgefasst zu sein) eine bestimmte Musik hinzugefügt wird; es ist auch nicht die Tatsache, dass man einer unterschwelligen Bedeutung eine explizite Bedeutung hinzufügt (marxistische, Freudsche Deutungen etc.) Es ist noch weniger die Tatsache, dass sich hinter der ersten Bedeutung noch andere Bedeutungen verbergen (polysemische Theorie). Kurz gesagt, Poesie ist nicht Prosa plus etwas anderes: Sie ist nicht mehr als Prosa, sie ist anders. Structure du langage poétique endete mit der Feststellung: Die Poesie weicht von der gewöhnlichen Sprache ab, und sie tut es immer mehr. Dabei kommt einem natürlich eine Theorie in den Sinn: Ziel der Poesie sei es demnach, eine maximale Abweichung festzumachen, alle bestehenden Kommunikationscodes aufzubrechen, zu dekonstruieren. Auch diese Theorie weist Jean Cohen zurück. Jede Sprache, versichert er, übernimmt eine Funktion von Intersubjektivität, und auch die Poesie entgeht dieser Regel nicht: Die Poesie spricht anders, aber sie spricht von der Welt, so wie die Menschen sie wahrnehmen. Genau an diesem Punkt geht er ein nennenswertes Risiko ein: Denn wenn die abweichenden Strategien der Poesie nicht ihr eigentliches Ziel sind, wenn die Poesie wirklich mehr ist als eine Suche nach oder ein Spiel mit der Sprache, wenn sie wirklich anstrebt, eine andere Sprache über dieselbe Realität zu begründen, dann hat man es mit zwei unversöhnlichen Weltanschauungen zu tun.
Die Marquise ging um fünf Uhr siebzehn fort; sie hätte auch um sechs Uhr zweiunddreißig fortgehen können. Das Wassermolekül setzt sich aus zwei Wasserstoffatomen und einem Sauerstoffatom zusammen. Der Umfang der Geldgeschäfte hat 1995 beträchtlich zugenommen. Um die Erdanziehungskraft zu überwinden, muss eine Rakete beim Start eine Schubkraft entwickeln, die zu ihrer Masse direkt proportional ist. Die Sprache der Prosa gliedert Überlegungen, Argumente, Fakten; im Grunde gliedert sie vor allem Fakten. Willkürliche, aber mit großer Präzision beschriebene Ereignisse kreuzen sich in einem neutralen Raum und einer neutralen Zeit. Aus unserer Weltanschauung verschwindet jeder qualitative oder emotionale Aspekt. Es handelt sich um die vollkommene Verwirklichung von Demokrits Ausspruch: »Das Zarte und das Bittere, das Warme und das Kalte sind nur Meinungen; es gibt an Wahrem nur die Atome und die Leere.« Ein Text von wirklicher, aber begrenzter Schönheit, bei dem man unwiderstehlich an den Stil der Autoren des Nouveau Roman erinnert wird, deren Einfluss sich seit ungefähr vierzig Jahren fortsetzt, eben weil dieser Stil einer demokritischen Metaphysik entspricht, die noch immer überwiegt; in einem Maße, dass man sie mitunter mit dem wissenschaftlichen Programm insgesamt verwechselt, während dieses nur ein Gelegenheitsbündnis mit ihr eingegangen ist – selbst wenn dieses Bündnis mehrere Jahrhunderte gehalten hat –, dazu bestimmt, das religiöse Denken zu bekämpfen.
»Wenn tief und schwer der Himmel wie ein Deckel drückt …« Dieser wie so viele Verse von Baudelaire schrecklich schwerfällige Vers strebt etwas ganz anderes an als die Weitergabe einer Information. Es ist nicht nur der Himmel, sondern die ganze Welt, das Wesen dessen, der spricht, die Seele dessen, der zuhört, die von einem Ton der Angst und Beklemmung befallen werden. Die Poesie ereignet sich; Pathetik überflutet die Welt.
Jean Cohen zufolge strebt die Poesie danach, einen von Grund auf alogischen Diskurs zu erzeugen. Für die Sprache, die informiert, ist es möglich, dass das, was ist, nicht oder anders ist, anderswo oder in einer anderen Zeit. Die Abweichungen der Poesie dagegen streben nach einem »Effekt der Unumschränktheit«, bei dem das Bejahende die gesamte Welt überflutet, ohne dass sich ein äußerlicher Widerspruch behaupten könnte. Dies rückt das Gedicht in die Nähe von primitiveren Ausdrucksformen wie Wehklagen oder Geschrei. Das Register ist zugegeben von beachtenswertem Umfang, aber die Wörter sind ihrem Wesen nach dem Schrei gleich. In der Poesie beginnen sie zu schwingen, sie finden ihre ursprüngliche Schwingung wieder. Diese aber ist nicht nur musikalischer Natur. Es ist die von ihnen bezeichnete Realität, die durch die Worte zu ihrer gräulichen oder zauberischen Macht, zu ihrem ursprünglichen Pathos zurückfindet. Azurblau ist eine unmittelbare Erfahrung. Genauso fühlt sich der Mensch allein auf der Welt, wenn die Helligkeit des Tages abnimmt, wenn die Dinge ihre Farben und Konturen verlieren und langsam in einem Grau verschmelzen, das dunkler wird. Das war der Fall seit seinen ersten Tagen auf der Welt, das war der Fall, noch bevor er Mensch war. Es ist älter als jede Sprache. Die Poesie versucht, zu diesen aufwühlenden Wahrnehmungen zurückzufinden, wozu sie natürlich die Sprache, den »Signifikanten«, benutzt. Die Sprache ist für sie jedoch nur ein Mittel. Eine Theorie, die Jean Cohen in folgendem Satz zusammenfasst: »Die Poesie ist der Gesang des Signifikats.«
Man versteht sodann, dass er davon ausgehend eine andere These entwickelt: Bestimmte Wahrnehmungsweisen der Welt sind in sich poetisch. Alles, was dazu beiträgt, Grenzen aufzulösen, aus der Welt ein homogenes und undifferenziertes Ganzes zu machen, ist von poetischer Kraft durchdrungen (so verhält es sich mit Nebel oder der Dämmerung). Bestimmte Dinge haben eine poetische Auswirkung, nicht als Dinge, sondern weil sie, indem sie einzig durch ihre Präsenz die Begrenzung des Raumes und der Zeit rissig machen, einen besonderen psychologischen Zustand herbeiführen (und die Analysen über den Ozean, die Ruine, das Schiff sind zugegebenermaßen verwirrend). Die Poesie ist nicht nur eine andere Sprache, sie ist ein anderer Blick. Eine Art, die Welt, alle Dinge der Welt zu sehen (Autobahnen genau wie Schlangen, Blumen genau wie Parkplätze). In diesem Abschnitt des Buches gehört Jean Cohens Poetik in keiner Weise mehr der Linguistik an; sie knüpft direkt an die Philosophie an.
Jede Wahrnehmung baut auf einer doppelten Unterscheidung auf: der zwischen dem Objekt und dem Subjekt und der zwischen dem Objekt und der Welt. Die Klarheit, mit der diese Unterschiede gesehen werden, hat weitreichende philosophische Implikationen, und ohne willkürlich zu sein, lassen sich die bestehenden Metaphysiken längs dieser beiden Achsen verteilen. Jean Cohen zufolge bewirkt die Poesie eine allgemeine Auflösung der Markierungen: Objekt, Subjekt und die Welt verschmelzen in ein- und derselben pathetischen und lyrischen Stimmung. Demokrits Metaphysik dagegen treibt die Klarheit dieser beiden Unterscheidungen bis zum Äußersten (eine Klarheit, die blendet wie die Sonne auf weißen Steinen an einem Augustnachmittag: »Es gibt nichts anderes als die Atome und die Leere.«).
Im Prinzip scheint man sich in der Sache einig, die Poesie – als sympathisches Überbleibsel einer prälogischen Mentalität, der Mentalität des Primitiven oder des Kindes – zu verurteilen. Das Problem besteht darin, dass Demokrits Metaphysik falsch ist. Sie stimmt, um genauer zu sein, nicht mehr mit den Erkenntnissen der Physik des 20.Jahrhunderts überein. Die Quantenmechanik macht in der Tat jede Möglichkeit einer materialistischen Metaphysik zunichte und führt dazu, dass die Unterscheidungen zwischen Objekt, Subjekt und der Welt von Grund auf neu überdacht werden müssen.
Bereits 1927 unterbreitete Niels Bohr einen Vorschlag, die sogenannte »Kopenhagener Deutung«. Die Kopenhagener Deutung, Ergebnis eines mühsamen und mitunter tragischen Kompromisses, betont die Instrumente, die Messprotokolle. Sie stellt den Akt der Erkenntnis auf neue Grundlagen und zeigt damit die ganze Dimension von Heisenbergs Unschärferelation: Wenn es unmöglich ist, alle Parameter eines physikalischen Systems gleichzeitig mit Präzision zu messen, dann nicht nur, weil sie »durch die Messung gestört werden«, sondern weil sie nicht unabhängig von ihr existieren. Von ihrem früheren Zustand zu sprechen, hat folglich keinen Sinn. Die Kopenhagener Deutung befreit den wissenschaftlichen Akt, indem sie das Paar Beobachter – Beobachtetes an den Ort und Platz einer hypothetischen realen Welt stellt. Sie ermöglicht es, die Wissenschaft allgemeingültig als zwischenmenschliches Kommunikationsmittel über »das, was wir beobachtet haben, das, was wir gelernt haben«, um Bohrs Worte zu verwenden, neu zu begründen.
Die Physiker dieses Jahrhunderts sind der Kopenhagener Deutung insgesamt treu geblieben, was keine sehr bequeme Position ist. Denn in der tagtäglichen Praxis der Forschung ist das beste Mittel voranzukommen natürlich, sich an einen streng positivistischen Ansatz zu halten, der sich wie folgt zusammenfassen lässt: »Wir begnügen uns damit, Beobachtungen zu sammeln, Beobachtungen von Menschen, und sie mit Gesetzen in Einklang zu bringen. Die Idee der Wirklichkeit ist nicht wissenschaftlich, sie interessiert uns nicht.« Nichtsdestotrotz muss es unangenehm sein, sich mitunter darüber klar zu werden, dass die Theorie, die man gerade aufstellt, nicht in einer klar verständlichen Sprache formulierbar ist.
Und das in einem Maße, dass sich merkwürdige Annäherungen andeuten. Seit Langem verblüfft mich die Feststellung, dass die Theoretiker der Physik, wenn sie die Spektralzerlegungen, die Hilbert-Räume, die hermitischen Operatoren usw. hinter sich gelassen haben, die das Gros ihrer Publikationen ausmachen, die poetische Sprache jedes Mal nachdrücklich würdigen – wenn man sie dazu befragt. Weder den Kriminalroman noch die serielle Musik: nein, was sie interessiert und verwirrt, ist bezeichnenderweise die Poesie. Bevor ich Jean Cohen gelesen hatte, verstand ich wirklich nicht, weshalb. Als ich seine Poetik entdeckte, wurde mir bewusst, dass wirklich etwas im Gange war und dass dieses Etwas im Zusammenhang mit den Vorschlägen von Niels Bohr stand.
In der begrifflichen Katastrophenstimmung, die die Entdeckung der ersten Quanten bewirkt hatte, hat man mitunter nahegelegt, dass es angebracht wäre, eine neue Sprache zu schaffen, eine neue Logik – oder gar beides. Es war klar, dass die alte Sprache und Logik für die Darstellungen des Universums der Quanten nicht geeignet war. Bohr war dennoch zurückhaltend. Die Poesie, betonte er, beweise, dass der subtile und zum Teil widersprüchliche Gebrauch der Umgangssprache es ermöglicht, ihre Grenzen zu überwinden. Das von Bohr eingeführte Prinzip der Komplementarität ist eine Form, mit dem Widerspruch subtil umzugehen: Man führt zur Betrachtung der Welt simultan zwei komplementäre Blickwinkel ein, von denen sich jeder unzweideutig in einer klar verständlichen Sprache ausdrücken lässt und die beide, voneinander getrennt, falsch sind. Ihre gemeinsame Präsenz schafft eine neue, für die Vernunft unbehagliche Situation. Aber nur mit diesem konzeptuellen Unbehagen wird es uns gelingen, zu einer korrekten Darstellung der Welt zu gelangen. Darüber hinaus bekräftigt Jean Cohen, dass der absurde Gebrauch, den die Poesie von der Sprache macht, nicht ihr eigentliches Ziel ist. Die Poesie bricht die Ketten des Kausalen und spielt unentwegt mit der Explosivkraft der Absurdität; aber sie ist nicht die Absurdität. Sie ist die Absurdität, die zur Schöpferin gemacht wurde; zur Schöpferin eines anderen, seltsamen, aber unmittelbaren, unbegrenzten, emotionalen Sinnes.
GESPRÄCH MIT JEAN-YVES JOUANNAIS UND CHRISTOPHE DUCHÂTELET
Das Gespräch erschien in Art Press, n° 199, Februar 1995.
Was macht die wenigen Schriften, deren Autor du bist – vom Essay über H.P. Lovekraft über den Band Rester vivant (Am Leben bleiben) mit der Gedichtsammlung La poursuite du bonheur (Die Verfolgung des Glücks) bis zum letzten Roman Ausweitung der Kampfzone –, zu einem Werk? Welche Einheit, welcher Grundgedanke, welche Besessenheit liegt ihm zugrunde?
Ich glaube, ihm liegt vor allem die Ahnung zugrunde, dass das Universum auf der Trennung, dem Leiden und dem Bösen basiert; der Entscheidung, diesen Sachverhalt zu beschreiben und ihn möglicherweise zu überwinden. Die Frage der – literarischen oder nicht literarischen – Mittel ist nebensächlich. Am Anfang steht die radikale Verweigerung der Welt im Zustand, in dem sie sich befindet, sowie der Glaube an die Begriffe von Gut und Böse. Der Wille, diese Begriffe zu ergründen, ihren Wirkungsbereich – mich selber einbegriffen – abzustecken. Dann erst kommt die Literatur. Der Stil kann variieren; das ist eine Frage des inneren Rhythmus, des persönlichen Befindens. Ich sorge mich nicht sonderlich um Fragen der Kohärenz; mir scheint, dass sich das von selbst ergibt.
Ausweitung der Kampfzone ist dein erster Roman. Wie kam es nach einem Gedichtband zu dieser Entscheidung?
Ich wünschte, es gäbe keinen Unterschied. Man müsste einen Gedichtband hintereinanderweg, von Anfang bis Ende, lesen können. Genauso müsste sich ein Roman auf einer x-beliebigen Seite aufschlagen lassen und unabhängig vom Kontext gelesen werden können. Es gibt keinen Kontext. Es ist angebracht, dem Roman zu misstrauen, man darf sich weder von der Geschichte hereinlegen lassen noch vom Tonfall noch vom Stil. Genau wie man im Alltag vermeiden muss, sich von seiner eigenen Geschichte hereinlegen zu lassen – oder, noch heimtückischer, von der Persönlichkeit, von der man annimmt, dass es die eigene ist. Man sollte sich eine gewisse lyrische Freiheit erkämpfen; ein idealer Roman sollte Versdichtung und Gesangspassagen enthalten können.
Er könnte auch wissenschaftliche Diagramme enthalten.
Ja, das wäre perfekt. Man sollte alles hineinstecken können. Novalis und die deutschen Romantiker allgemein zielten auf eine totale Erkenntnis ab. Es war ein Irrtum, diese Ambition aufzugeben. Wir zappeln wie zerquetschte Fliegen. Was der Tatsache keinen Abbruch tut, dass wir zur totalen Erkenntnis bestimmt sind.
Deine Texte sind eindeutig von einem schrecklichen Pessimismus gekennzeichnet. Könntest du zwei oder drei Gründe nennen, die deiner Meinung nach dem Selbstmord Aufschub gewähren?
Kant hat den Selbstmord 1797 in seinen Metaphysischen Anfangsgründen der Tugendlehre rundweg verurteilt. Ich zitiere ihn: »In seiner eigenen Person das Subjekt der Sittlichkeit zu vernichten, heißt, die Sittlichkeit, soweit es von einem selbst abhängt, aus der Welt zu schaffen.« Das Argument scheint wie oft bei Kant naiv und in seiner Unschuld ziemlich pathetisch; dennoch glaube ich, dass es das einzig gültige ist. Nur das Pflichtgefühl kann uns wirklich am Leben erhalten. Konkret gesagt: Will man sich mit einer praktischen Pflicht versehen, muss man es so einrichten, dass das Glück eines anderen von der eigenen Existenz abhängt; man kann zum Beispiel versuchen, ein kleines Kind großzuziehen, oder man kann zur Not einen Pudel kaufen.
Kannst du dich zu der soziologischen Theorie äußern, derzufolge der für den Kapitalismus typische Kampf um den sozialen Erfolg mit einem perfideren und brutaleren, diesmal sexuellen Kampf gekoppelt ist?
Das ist ganz einfach. Jede tierische und menschliche Gesellschaft richtet ein hierarchisches Differenzierungssystem ein, das sich auf Geburt (aristokratisches System), auf Reichtum, auf Schönheit, auf Körperkraft, auf Intelligenz, auf Begabung gründen kann. Diese Kriterien halte ich übrigens alle für gleich verachtenswert, ich lehne sie ab. Die einzige Überlegenheit, die ich anerkenne, ist die Güte. Gegenwärtig bewegen wir uns in einem zweidimensionalen System: dem der erotischen Attraktivität und dem des Geldes. Alles andere, das Glück und das Unglück der Leute, leitet sich daraus ab. Für mich handelt es sich in keiner Weise um eine Theorie. Wir leben tatsächlich in einer simplen Gesellschaft, für deren komplette Beschreibung diese wenigen Sätze ausreichen.
Eine der brutalsten Szenen des Romans spielt in einem Nachtklub in der Vendée. Dort finden rein sexuelle Begegnungen statt, Szenen misslungener Verführung, Misserfolge, die Ursache für Rachegefühle und Bitterkeit sind. Dieser Ort erscheint in deinen Texten wie das Pendant zu einem Supermarkt. Wird an ihm auf die gleiche Weise konsumiert?
Nein. Man könnte eine Parallele ziehen zwischen der Werbung für Hühner und der für Miniröcke. Aber mit der Hervorhebung des Angebots hört die Analogie auch auf. Der Supermarkt ist das wahre Paradies der Moderne. Der Kampf hört an seiner Tür auf, die Armen beispielsweise betreten ihn nicht. Man hat woanders Geld verdient, jetzt wird es ausgegeben für ein sich ständig erneuerndes und abwechslungsreiches Angebot, dessen guter Geschmack meist zuverlässig und dessen Nährwert gut dokumentiert ist. Nachtklubs bieten einen ganz anderen Anblick. Trotz fehlender Aussichten werden sie weiterhin von zahlreichen Frustrierten besucht. Sie haben somit Gelegenheit, sich Minute für Minute ihre eigene Erniedrigung vor Augen zu führen. Wir stehen der Hölle hier viel näher. Nebenbei gesagt, gibt es Supermärkte des Sex, die einen nahezu kompletten Pornokatalog anbieten. Das Wesentliche aber fehlt ihnen. Denn das, was beim Sex hauptsächlich gesucht wird, ist nicht der Genuss, sondern die narzisstische Befriedigung, die Huldigung, die der begehrte Partner der eigenen erotischen Geschicklichkeit erweist. Das ist übrigens auch der Grund, weshalb Aids nicht viel verändert hat. Das Kondom verringert den Genuss, aber im Gegensatz zu Lebensmitteln ist nicht der Genuss das gesuchte Ziel: Ziel ist die narzisstische Trunkenheit der Eroberung. Der Pornokonsument verspürt nicht nur nicht diese Trunkenheit, sondern ein oft geradezu entgegengesetztes Gefühl. Will man das Bild vervollständigen, könnte man abschließend hinzufügen, dass manche Leute, solche mit abweichenden Wertmaßstäben, Sexualität weiterhin mit Liebe gleichsetzen.
Könntest du dich zu dem Informatikingenieur äußern, den du den »vernetzten Menschen« genannt hast? Worauf verweist diese Art von Figur in der heutigen Welt?
Man muss sich darüber klar werden, dass die Fertigwaren dieser Welt – Stahlbeton, elektrische Lampen, Metrozüge, Taschentücher – gegenwärtig von einer kleinen Klasse von Ingenieuren und Technikern entworfen und produziert werden. Sie sind imstande, sich entsprechende Apparaturen auszudenken und umzusetzen, sie allein sind wirklich produktiv. Sie stellen vielleicht 5% der berufstätigen Bevölkerung dar – und dieser Prozentsatz ist ständig am Sinken. Der soziale Nutzen des restlichen Unternehmenspersonals – kaufmännische Angestellte, Werbeleute, Büroangestellte, Verwaltungskader, Designer – ist viel weniger einsichtig: Sie könnten verschwinden, ohne dass der Produktionsprozess dadurch wirklich beeinträchtigt würde. Ihre Rolle besteht offensichtlich darin, verschiedene Informationsklassen aufzustellen und zu manipulieren, das heißt verschiedene Pausverfahren für eine Realität, die ihnen aus den Händen gleitet. Die gegenwärtige Explosion von Informationsübertragungsnetzen muss in diesen Zusammenhang gestellt werden. Eine Handvoll Techniker – in Frankreich sind das höchstens fünftausend Personen – ist für das Definieren der Protokolle und das Realisieren der Apparaturen verantwortlich, die in den kommenden Jahrzehnten den sofortigen Transport jeglicher Form von Information – Text, Ton, Bild, möglicherweise auch taktile und elektrochemische Stimuli – auf weltweiter Ebene ermöglichen sollen. Einige von ihnen entwickeln zu ihrer Tätigkeit einen positiven Diskurs, demzufolge der Mensch, von dem man annimmt, er stünde im Zentrum der Produktion und verarbeite die Informationen, seine volle Größe erst in der Vernetzung mit einer größtmöglichen Anzahl analoger Zentren finden werde. Die Mehrzahl dagegen entwickelt keinen Diskurs; sie begnügt sich damit, ihre Arbeit zu tun. Damit verwirklicht sie voll und ganz das Techniker-Ideal, das den Gang der Geschichte der westlichen Gesellschaften seit dem Ende des Mittelalters steuert und das sich in einem Satz zusammenfassen lässt: »Wenn es technisch realisierbar ist, wird es technisch realisiert werden.«
Man kann deine Geschichte einer zunächst psychologischen Lesart unterziehen, es ist jedoch die soziologische Lesart, die nachhaltig prägt. Handelt es sich womöglich um ein Werk, das eher wissenschaftliche als literarische Ambitionen hat?
Das ginge nun doch zu weit. Als Jugendlicher war ich in der Tat von der Wissenschaft fasziniert – insbesondere von den neuen Konzepten, die in der Quantenmechanik entwickelt wurden. Diese Fragen bin ich in meinen Schriften jedoch noch nicht wirklich angegangen. Die realen Überlebensbedingungen dieser Welt haben mich wahrscheinlich zu sehr in Anspruch genommen. Dennoch bin ich ein wenig überrascht, wenn man mir sagt, dass mir psychologische Porträts von Individuen, von Personen gelingen. Vielleicht ist es wahr, aber auf der anderen Seite habe ich oft den Eindruck, dass die Individuen in etwa identisch sind, dass das, was sie ihr Ich nennen, nicht wirklich existiert, und dass es in gewissem Sinne einfacher ist, den Gang der Geschichte zu definieren. Vielleicht liegen hier die Prämissen einer Komplementarität à la Niels Bohr vor: Welle und Teilchen, Position und Geschwindigkeit, Individuum und Geschichte. Was das mehr Literarische angeht, so spüre ich deutlich die Notwendigkeit zweier komplementärer Herangehensweisen: das Pathetische und das Klinische. Auf der einen Seite das Sezieren, die kaltblütige Analyse, der Humor; auf der anderen die emotionale und lyrische Anteilnahme, lyrisch im Sinne eines unmittelbaren Lyrismus.
Du hast dir das Genre des Romans ausgesucht, trotzdem scheinst du die Poesie von Natur aus vorzuziehen.
Die Poesie ist das natürlichste Mittel, um die reine Intuition eines Augenblicks zu vermitteln. Es gibt wirklich einen Kern reiner Intuition, der sich direkt in Bilder oder Wörter übertragen lässt. Solange man bei der Poesie bleibt, bleibt man bei der Wahrheit. Die Probleme fangen erst an, wenn es darum geht, diese Fragmente zu gliedern, eine sowohl inhaltliche als auch musikalische Kontinuität herzustellen. Dabei hat mir wahrscheinlich die Erfahrung der Montage sehr geholfen.
Du hast in der Tat einige Kurzfilme gedreht, bevor du mit dem Schreiben begonnen hast. Wer hat dich beeinflusst? Und welchen Bezug gibt es zwischen diesen Bildern und deiner Literatur?
Ich mochte Murnau und Dreyer sehr; ich mochte auch all das, was man deutschen Expressionismus genannt hat – auch wenn der wichtigste bildliche Bezugspunkt dieser Filme wahrscheinlich mehr die Romantik als der Expressionismus ist. Sie studieren die Faszination der Reglosigkeit, die ich versucht habe, in Bilder, später in Worte umzusetzen. Es gibt noch etwas anderes, das tief in mir sitzt, eine Art ozeanisches Gefühl. Es ist mir nicht gelungen, es in Filmen zu umschreiben. Ich hatte nicht einmal wirklich Gelegenheit, es zu probieren. Es in Worte umzusetzen, ist mir mitunter gelungen, in einigen Gedichten. Aber ich werde mich sicherlich eines Tages auf die Bilder besinnen müssen.
Kann man sich zum Beispiel vorstellen, deinen Roman zu verfilmen?
Ja, durchaus. Im Grunde handelt es sich um ein Drehbuch, das dem von Taxi Driver recht nahekommt. Die visuelle Seite muss jedoch verändert werden. Es hat nichts mit New York zu tun: Die Filmkulisse würde sich hauptsächlich aus Glas, Stahl, reflektierenden Oberflächen zusammensetzen. Büros von Landschaftsarchitekten, Bildschirme; das Universum einer neuen Stadt, die ein in seiner Art einmaliger, erfolgreich geregelter Verkehr durchquert. Gleichzeitig ist die Sexualität in diesem Buch eine Folge von Misserfolgen. Man sollte vor allem jede Verherrlichung des Erotischen vermeiden; die Ermüdung filmen, die Masturbation, das Erbrechen. Aber all das in einer durchsichtigen, kunterbunten, fröhlichen Welt. Wenn man schon einmal dabei ist, könnte man auch Diagramme und grafische Darstellungen einführen: sexuelle Hormonwerte im Blut, Gehalt in Kilofrancs … Man darf nicht zögern, Theoretiker zu sein; man muss auf allen Fronten angreifen. Eine Überdosis Theorie erzeugt eine eigenartige Dynamik.
Du beschreibst deinen Pessimismus als etwas, das nur eine Etappe sein dürfte. Was kann danach kommen?
Ich würde gern der beklemmenden Gegenwart der modernen Welt entkommen; in ein Universum à la Mary Poppins