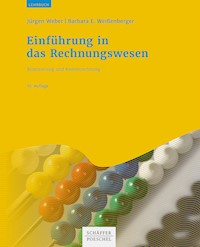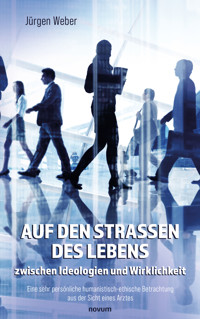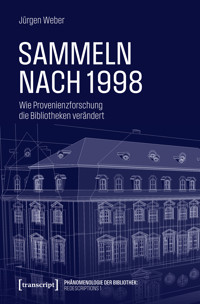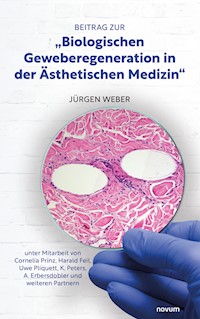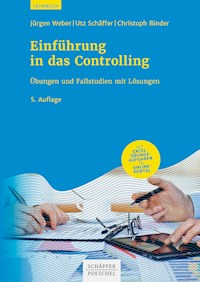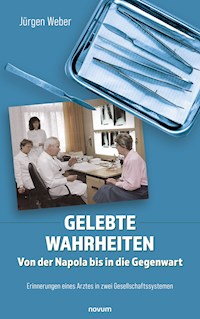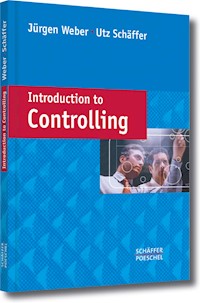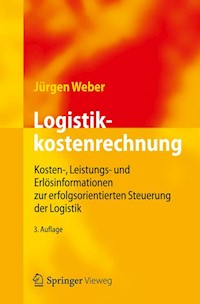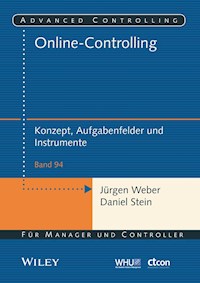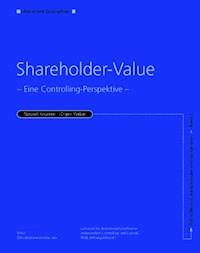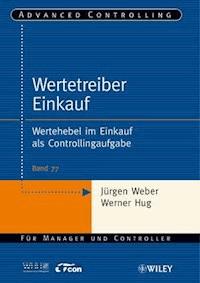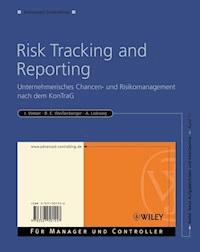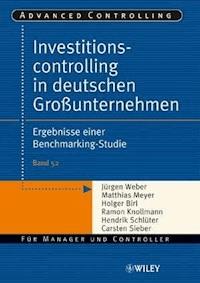
21,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Wiley-VCH
- Kategorie: Fachliteratur
- Serie: Advanced Controlling
- Sprache: Deutsch
Investitionsentscheidungen zählen zu den wichtigsten Entscheidungen der Unternehmensleitung. Entscheidend für den Erfolg von Investitionen ist jedoch nicht nur die eigentliche Investitionsentscheidung, sondern der gesamte Investitionsprozess von der Investitionsbudgetierung bis hin zur Kontrolle in der Nutzungsphase. Vor diesem Hintergrund wird in diesem Band die aktuelle Praxis in den einzelnen Phasen des Investitionsprozesses untersucht. Grundlage der Untersuchung bildet ein Benchmarking in deutschen Großunternehmen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 95
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Inhalt
In eigener Sache
Vorwort
1 Investitionscontrolling
2 Konzeptioneller Hintergrund zur Investitionsplanung und Investitionskontrolle
Festlegung des Investitionsbegriffs
Formen von Investitionen
Grundlagen der Investitionsbudgetierung
Grundlagen der Investitionsplanung
Grundlagen der Investitionskontrolle
Zwischenfazit
3 Ergebnisse der Benchmarking-Studie
Zielsetzung und Ablauf der Studie
Der Investitionsprozess
Charakteristika der Investitionstätigkeit
Investitionsbudgetierung
Investitionsanbahnung
Investitionsrealisierung und -nutzung
Vergleichende Bewertung von Investitionsanbahnung, -realisierung und -nutzung
Einflussfaktoren des Kontrollprozesses
4 Fazit
5 Anmerkungen
6 Literaturverzeichnis
Professor Dr. Jürgen Weber lehrt Controlling an der WHU – Otto Beisheim School of Management in Vallendar. Seine Devise ist: »Nichts ist so gut für die Praxis wie eine gute Theorie.« Jürgen Weber ist Herausgeber der Zeitschrift für Controlling & Management. Er ist Autor vieler Bücher, z. B. Einführung in das Controlling, und darüber hinaus einer der Gründungspartner der Managementberatung CTcon.
Dr. Matthias Meyer ist wissenschaftlicher Assistent am Lehrstuhl für Controlling und Telekommunikation von Prof. Jürgen Weber und ehemaliger Geschäftsführer des Center for Controlling and Management (CCM).
Seine Forschungsschwerpunkte liegen in den Bereichen Controlling, agentenbasierte Computersimulationen, der Prinzipal-Agenten-Theorie sowie der Steuerung von Kooperationen.
Dipl.-Kfm. Holger Birl, Dipl.-Kfm. Ramon Knollmann, Dipl.-Oec. Hendrik Schlüter und Dipl.-Kfm. Carsten Sieber sind wissenschaftliche Mitarbeiter am Center for Controlling and Management (CCM) des Lehrstuhls für Controlling und Telekommunikation von Prof. Jürgen Weber an der WH U – Otto Beisheim School of Management.
1. Auflage 2006
Bibliografische Information Der Deutschen Bibliothek
Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über <http://dnb.ddb.de> abrufbar.
Alle Bücher von Wiley-VCH werden sorgfältig erarbeitet. Dennoch übernehmen Autoren, Herausgeber und Verlag in keinem Fall, einschließlich des vorliegenden Werkes, für die Richtigkeit von Angaben, Hinweisen und Ratschlägen sowie für eventuelle Druckfehler irgendeine Haftung.
© 2006 WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim
Alle Rechte, insbesondere die der Übersetzung in andere Sprachen, vorbehalten. Kein Teil dieses Buches darfohne schriftliche Genehmigung des Verlages in irgendeiner Form – durch Fotokopie, Mikroverfilmung oder irgendein anderes Verfahren – reproduziert oder in eine von Maschinen, insbesondere von Datenverarbeitungsmaschinen, verwendbare Sprache übertragen oder übersetzt werden. Die Wiedergabe von Warenbezeichnungen, Handelsnamen oder sonstigen Kennzeichen in diesem Buch berechtigt nicht zu der Annahme, dass diese von jedermann frei benutzt werden dürfen. Vielmehr kann es sich auch dann um eingetragene Warenzeichen oder sonstige gesetzlich geschützte Kennzeichen handeln, wenn sie nicht eigens als solche markiert sind.
Gedruckt auf säurefreiem Papier.
Satz Kühn & Weyh, Freiburg
Druck und Bindung Ebner & Spiegel GmbH, Ulm
Umschlaggestaltung init GmbH, Bielefeld
ISBN-13: 978-3-527-50261-5
ISBN-10: 3-527-50261-0
mobi ISBN: 978-3-527-66641-6
ePub ISBN: 978-3-527-66642-3
In eigener Sache
Ein zentraleSs Ziel des Lehrstuhls besteht darin, neueste theoretische Erkenntnisse in die Praxis zu tragen. Dies erfolgt in Vorträgen, Workshops, Arbeitskreisen und im CCM (Center for Controlling & Management), in dem namhafte Großunternehmen mit wissenschaftlichen Mitarbeitern und Studenten eng zusammenarbeiten. Über die Ergebnisse dieser Arbeit wird regelmäßig in der Schriftenreihe Advanced Controlling berichtet.
Seit 1992 arbeitet der Lehrstuhl eng mit CTcon, einem Spin-off der WHU, zusammen. CTcon ist ein auf Unternehmenssteuerung und Controlling spezialisiertes Beratungs- und Trainingsunternehmen. Seit Jahren setzen führende Konzerne und bedeutende öffentliche Organisationen erfolgreich auf die kompetente Unterstützung von CTcon. Dabei werden die theoretischen Erkenntnisse des Lehrstuhls konsequent in innovative Lösungen für die Unternehmenspraxis umgesetzt. Eine gemeinsame praxisbezogene Forschung und ein ständiger fachlicher Gedankenaustausch sind ebenso selbstverständlich wie die Zusammenarbeit in der Hochschulausbildung sowie in maßgeschneiderten Inhouse-Seminaren.
Vorwort
Liebe Leser,
Investitionsentscheidungen richtig zu treffen, gehört zu den wichtigsten Aufgaben des Managements. Entsprechend beschäftigt sich jeder Student der BWL intensiv mit den diversen Verfahren der Investitionsrechnung und dieses Thema fehlt auch in keiner betriebswirtschaftlichen Zusatzqualifikation von »BWLFachfremden«. Die Kapitalwertmethode hat zwar knapp dreißig Jahre gebraucht, um sich in der Praxis durchzusetzen, ist heute aber als Standardverfahren in praktisch jedem Unternehmen vorzufinden.
Auch für Controller bilden Investitionen einen Aufgabenschwerpunkt. Die Investitionsplanung steht als projektbezogene Planung neben den periodischen Planungskreisen operative Planung, Mittelfristplanung und strategische Planung und ist mit diesen zu verknüpfen. Die Unterstützung einzelner Investitionsprojekte und deren Integration in die Gesamtplanung sind die wesentlichen Herausforderungen, die Controller zu bewältigen haben.
Darüber, wie sie diesen Herausforderungen gerecht werden, gibt es erstaunlicherweise wenig empirische Erkenntnis. Hier hilft der neue Band der ACSchriftenreihe weiter. Wir stellen Ihnen die Ergebnisse vor, die wir in einem umfassenden Benchmarking-Projekt im Center for Controlling & Management (CCM) gewonnen haben. Wir haben in der AC-Reihe schon häufig aus der Arbeit dieser innovativen Einrichtung berichtet, die an der WHU einen repräsentativen Querschnitt der DAX 30-Unternehmen zusammenführt.
Der nun vorliegende AC-Band gibt Ihnen einen detaillierten Einblick in den Stand der Investitionsplanung und -kontrolle in Großunternehmen, der für Unternehmen jeglicher Größenordnung hohe Relevanz besitzt. Es zeigt sich, dass die Controller im Bereich der Investitionsplanung in aller Regel einen sehr guten Job machen, dass allerdings im Bereich der Investitionskontrolle noch Defizite bestehen. Wir wissen aus vielen empirischen Studien, dass eine verhaltensmäßig verträglich gestaltete Kontrolle einen wesentlichen Einfluss auf das Unternehmensergebnis nimmt. Insofern lohnt es sich, das erkannte Defizit konsequent anzugehen. Aber das war nur eines von vielen interessanten Ergebnissen – lassen Sie sich überraschen!
Ihr Jürgen Weber
1
Investitionscontrolling
Investitionen haben für die Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen eine zentrale Bedeutung und nehmen daher im Rahmen ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten einen hohen Stellenwert ein. Mit Investitionen werden die Weichen für die Positionierung des Unternehmens im Markt- und Wettbewerbsumfeld gestellt und eine Vorentscheidung über die zukünftige Kosten- und Ertragslage getroffen. Investitionsentscheidungen zeichnen sich zudem dadurch aus, dass sie eine hohe Kapitalbindung mit sich bringen (es geht also stets um viel Geld) und dass diese Kapitalbindung langfristig besteht (bereits getroffene und umgesetzte Investitionsentscheidungen lassen sich kurzfristig nicht problemlos revidieren). Fehlinvestitionen können folglich eine nachhaltige Verschlechterung der Profitabilität nach sich ziehen und zu Kapitalvernichtung von erheblichem Ausmaß führen.
Vor diesem Hintergrund ist unmittelbar einsichtig, dass Investitionsentscheidungen zu den wichtigsten Entscheidungen gehören, die die Unternehmensleitung in ihrem Aufgabenspektrum fällen muss.
Darüber hinaus sind Investitionsentscheidungen mit zahlreichen Interdependenzen verbunden: Von einer Entscheidung, eine bestimmte Investition durchzuführen, werden meistens Folgewirkungen für andere Bereiche ausgelöst, wie beispielsweise für die Finanzabteilung (adäquate Deckung des mit der Investition verbundenen Kapitalbedarfs) oder die Produktion (zum Beispiel Abstimmung der einzelnen Produktionsprogramme und Produktionskapazitäten bei Erweiterung der Produktion an einem neuen Standort).
Entsprechend diesen Charakteristika sind Investitionsentscheidungen und -projekte im Vorfeld sorgfältig zu planen und vorzubereiten. Ziel ist es, die zu späteren Zeitpunkten auftretenden Konsequenzen und Auswirkungen bereits im Vorhinein genau abzuwägen und zu beurteilen.1 Darüber hinaus muss eine getroffene und eventuell bereits teilweise umgesetzte Investitionsentscheidung weiterhin nachgehalten und kontrolliert werden.
Dabei spielen Controller eine wichtige Rolle. Die Begleitung von Investitionsvorhaben ist ein wesentlicher Bestandteil der Aufgaben von Controllern. In ihrer Rolle als Berater und kritischer Sparringspartner des Managements leisten sie einen wichtigen Beitrag zur Vorbereitung und Kontrolle von Investitionsentscheidungen. So werden im Vorfeld von Investitionsentscheidungen Investitionsrechnungen durchgeführt und die Investitionsvorhaben detailliert geprüft, um schließlich dem Management ein solides Fundament für eine ökonomisch sinnvolle Entscheidung liefern zu können.
Der Prozess, nach dem Investitionsentscheidungen vorbereitet, getroffen und letztlich kontrolliert werden, lässt sich dabei in mehrere Phasen unterteilen. Wirft man einen Blick in die relevante Literatur, so fällt auf, dass die frühen Phasen, die zur Investitionsentscheidung führen, theoretisch weitaus besser durchdrungen sind als die nachfolgenden Phasen. Während somit die Investitionsplanung in der Literatur sehr detailliert behandelt wird, wird die Investitionskontrolle oft nur oberflächlich oder als »Anhängsel« der Investitionsplanung thematisiert. Und auch für die Praxis lässt sich feststellen, dass der Kontrolle meist keine große Aufmerksamkeit geschenkt wird. Gerade die Investitionskontrolle stellt jedoch eine wichtige Phase im Investitionsprozess dar. Drei Punkte sind in diesem Zusammenhang von besonderer Bedeutung: Erstens kann die Ankündigung einer Kontrolle bereits ex ante rationalitätssichernd auf die Investitionsentscheidung wirken. Zweitens kann man im Rahmen der Investitionskontrolle Fehlentwicklungen oft erkennen und diesen noch rechtzeitig entgegensteuern. Drittens kann man aus den Ergebnissen des Kontrollprozesses für die Zukunft lernen.
Entscheidend für den Erfolg von Investitionen ist damit nicht nur die eigentliche Investitionsentscheidung, sondern der gesamte Investitionsprozess von der Investitionsbudgetierung bis hin zur Kontrolle in der Nutzungsphase. Vor diesem Hintergrund wird im vorliegenden Band die aktuelle Praxis in den einzelnen Phasen des Investitionsprozesses untersucht. Grundlage der Untersuchung bildet ein Benchmarking des Investitionscontrollings in zehn deutschen Großunternehmen sowie die beiden folgenden Leitfragen:
Welche Tätigkeiten und Aufgaben nehmen Controller in den einzelnen Phasen des Investitionsprozesses wahr?
Durch welche Merkmale lassen sich die einzelnen Phasen des Investitionsprozesses und ihre jeweiligen Elemente charakterisieren?
Ziel der Analyse ist es damit, die einzelnen Phasen des Investitionsprozesses mit ihren jeweiligen Ausprägungen und Elementen sowie die Rolle der Controller im Investitionsprozess zu beleuchten. Damit möchten wir einen aktuellen Stand darüber liefern, wie das Investitionscontrolling in der Praxis konkret ausgestaltet ist und wo etwaige Schwachstellen im Investitionsprozess liegen. Vor diesem Hintergrund können unsere Ergebnisse Praktikern auch als Basis dienen, um Verbesserungsmaßnahmen für das Investitionscontrolling in ihrem eigenen Unternehmen abzuleiten. Durch einen Vergleich der hier präsentierten Ergebnisse mit den Investitionsprozessen in dem eigenen Unternehmen lassen sich hierzu wertvolle Anregungen gewinnen.
Die weiteren Ausführungen gliedern sich wie folgt. Zunächst stellt das nachfolgende zweite Kapitel die theoretischen Grundlagen für unsere Benchmarking-Studie vor. Im dritten Kapitel werden zunächst die einzelnen Phasen des Investitionsprozesses untersucht. Dabei wird im ersten Schritt jede Investitionsphase für sich betrachtet, um in einem zweiten Schritt die einzelnen Phasen gegenüberzustellen und miteinander zu vergleichen. Im dritten Schritt folgt eine detaillierte Betrachtung des Kontrollprozesses und eine Analyse der Einflussfaktoren dieser Prozessphase. Im vierten Kapitel werden dann die Kernergebnisse unserer Untersuchung zusammengefasst.
2
Konzeptioneller Hintergrund zur Investitionsplanung und Investitionskontrolle
Sowohl zum Investitionsbegriff selbst als auch zur Investitionsplanung und Investitionskontrolle existieren in der Literatur unterschiedliche und teilweise widersprüchliche Darstellungen. Um den Stand der Investitionsplanung und Investitionskontrolle in Unternehmen in der Praxis richtig wiedergeben zu können, wollen wir in einem ersten Schritt erläutern, was mit dem Begriff einer Investition in diesem Band gemeint ist. Im Anschluss werden die theoretischen Grundlagen der Investitionsbudgetierung, die den Rahmen für die Einzelinvestitionen eines Unternehmens bildet, dargestellt. Abschließend werden wir in diesem Kapitel die konzeptionellen Bezugspunkte der Planung und Kontrolle einzelner Investitionsprojekte erörtern, die der Benchmarking-Studie zugrunde liegen.
Festlegung des Investitionsbegriffs
Investitionsentscheidungen gehören gemeinhin »zu den wichtigsten unter den zahllosen Entscheidungen, die die Unternehmensleitung treffen muss.«1 In Theorie und Praxis ist gleichermaßen anerkannt, dass Investitionen oftmals mit der Inanspruchnahme erheblicher finanzieller Ressourcen einhergehen. Dennoch ist in der Literatur und der betrieblichen Praxis häufig unklar, was unter einer Investition überhaupt zu verstehen ist. Daher wollen wir zur Konkretisierung unseres Untersuchungsgegenstandes zunächst erläutern, wie der Investitionsbegriff überhaupt definiert werden kann.
In Anlehnung an Lücke (1991) lassen sich in der Literatur insgesamt vier unterschiedliche Gruppen von Definitionen Investitionsbegriffs unterscheiden:2
Die erste Gruppe vertritt einen kombinationsorientierten Investitionsbegriff. Eine Investition zeichnet sich hiernach durch die »Kombination von (materiellen) Anlagegütern«3 aus. Der eigentliche Beschaffungsvorgang von Investitionsgütern wie beispielsweise ein Anlagenkauf fällt nach dieser Auffassung nicht unter den Investitionsbegriff.
Der zweite Ansatz beinhaltet rechnungswesen- und bilanzorientierte Auffassungen des Investitionsbegriffs. Investitionen lassen sich nach diesem Verständnis »als die Umwandlung von Geldkapital in andere Formen von Vermögen«4 definieren. Nicht-bilanzierungsfähige Investitionsvorgänge wie beispielsweise Forschung und Entwicklung zählen hingegen nicht zu den Investitionen.
In der dritten Gruppe sind dispositionsbestimmte Investitionsverständnisse zusammengefasst. Das heißt, dass der Investitionsbegriff auf eine »langfristige Festlegung von finanziellen Mitteln im Anlagevermögen«5 beschränkt ist.
Der vierte Definitionsansatz grenzt schließlich Investitionen anhand eines zahlungsorientierten Blickwinkels ab. Investitionen lassen sich nach diesem Verständnis als »eine vollständige Geschichte von Zahlungen zu verschiedenen Zeitpunkten auf (Einzahlungen) und von (Auszahlungen) einem Konto (definieren), wobei zuerst eine oder mehrere Auszahlungen und später eine oder mehrere Einzahlungen erfolgen«.6 Dieses Verständnis findet sich heute in nahezu allen gängigen Investitionsrechenverfahren wieder und soll deshalb auch den folgenden Ausführungen und unserer Untersuchung zugrunde gelegt werden.
Formen von Investitionen
Neben alternativen Begriffsdefinitionen existieren zudem unterschiedliche Strukturierungen zur Untergliederung von Investitionen. Wie aus Abbildung 1