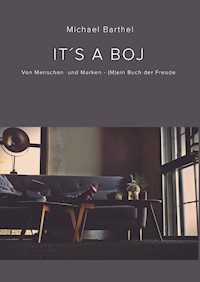
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Auf der Suche nach Inspiration für sein erstes Buch, läuft der Journalist Michael ein paar unverwechselbaren Typen über den Weg. Da ist Mitch, der Strandphilosoph, der das Schlechte auf der Welt gesehen hat und an das Gute im Menschen glaubt. Da ist Henry, der mit der Schule hadert und die Welt erobern will oder Cap, der Tierpfleger mit Teamführerqualitäten, der sich Fische und andere Tiere zum Vorbild nimmt. Da ist der Blogger Junis, der zu Bildern Geschichten erfinden lässt, oder Chandika der Maler, der aus realen Geschichten Bilder macht. Und dann ist da Mona-Lisa, die toughe Brand Managerin, die all diese Charaktere zu einem Think Tank zusammenführt. Sie stößt Michael auf die Fragen, von denen das Buch handelt: Was treibt Menschen an, Spuren zu hinterlassen? Was macht ihre Identität aus? Mona-Lisas Blick auf Menschen als Marken ist kein oberflächlicher, sondern dringt zum Kern einer jeden Persönlichkeit vor. So wird Michaels Buch statt einer Autobiografie eine Sammlung von Lebensgeschichten – und doch eine Entdeckungsreise zur eigenen Identität. Vor den Lesern entfaltet sich ein unterhaltsames und eigenwilliges Generationenporträt der nach 1980 Geborenen, der Digital Natives, der Millennials. Ein provokantes und witziges Buch voller Lebensfreude, eine Ode an die Individualität und an das produktive Miteinander zugleich.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 299
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
(M)ein Buch der Freude
Love Brand
Baywatch
Freibeuter
Mensch und Tier
Tapetenwechsel
Netzwerke
Kindsköpfe
Think-Tank
Runde Tafel
Göttlich
Love Is All You Need
Denkmal
Epilog: Mona-Lisa – Enterprise Architect
In erster Linie für mich
(M)ein Buch der Freude
Wie beginnt man eigentlich damit, ein Buch zu schreiben? Indem man es hält wie Hemingway? Karibik, Cocktails, Weiber und sonstige Drogen? Ich habe es ernsthaft auf diesem Wege versucht … So viel vorweg.
Es gibt Menschen, die behaupten, die größten Kunstwerke seien unter dem Einfluss der Syphilis entstanden. Beethoven oder Schubert soll das geradezu beflügelt haben. Ich aber bin kein Komponist. Künstler ja – Komponist nein. Ich bin Lebenskünstler. Alleinerziehend, von mir selbst. Ich halte es daher einfach. Ich lese und lebe, spreche und schreibe. Meistens ohne Drogen. Manchmal wegen Weibern.
Im Labyrinth der Gedanken zeichnete sich dann bei mir ein Weg ab. Hin zu einem Buch. Zu meinem. Das war Anfang 2005.
Mein Lieblingsbuchladen war damals ein sehr kleines Schmuckkästchen in einer relativ hässlichen Kreisstadt. Ich saß gerne bei meinem Freund, dem Buchhändler. Politisch war der so rot wie ein Engländer nach dem Sonnenbad. Nicht ganz meine Welt, aber ein Stückchen davon teile ich sehr gerne mit ihm. Weil er mich gelehrt hat, die richtigen Bücher zu lesen. Nicht Nietzsche oder Schopenhauer. Und auch nicht Hemingway. Keine Bücher, für die es in der Oberstufe am Gymnasium noch mindestens je einen Begleitband braucht, weil sonst selbst die, die sie unterrichten, sie nicht verstehen. Mein Buchhändler zeigte mir Literatur, die mich inspiriert und mir Spaß macht.
Als ich einmal bei ihm war, erschrak ich vor einem Trinkwasserspender, der gerade Luft holte. Ein anderer Gast hatte soeben den letzten verfügbaren Becher gefüllt. Irgendwie passte dieses Bild für mich: in einer Buchhandlung, umgeben von so viel Wissensdurst auf der einen und noch mehr Wissen auf der anderen Seite. Ich unterstelle jetzt mal, dass in den Regalen meist mehr Wissen steht als davor. Ich wurde nachdenklich. Denn wie eignet man sich, mit begrenztem Speicherplatz, am besten Wissen an? Als Autor oder als Konsument? Bin ich Wasser oder Becher?
Der erste Blick ins Regal offenbarte mir die Autorenseite: Dieter Bohlen, Boris Becker, Stefan Effenberg, Verona Pooth … Das sind wahrlich keine Aphoristiker. Dennoch, sie alle haben geschrieben. Oder für sich schreiben lassen. An Cordula Stratmann blieb ich erst recht hängen. Längst wieder so gut wie von den Fernsehschirmen verschwunden, wohnte sie damals in der Schillerstraße. Woher ich das weiß? Wir durften alle hin und wieder an ihrem Leben teilhaben, wenn sie Besuch von anderen Schauspielern bekam und ein sich komisch findender Regisseur über ein Mikrofon den einzelnen Darstellern, für die anderen nicht hörbar, Aufgaben zuflüsterte. Das Fernsehen zeigte dieses Schauspiel und verkaufte es als Comedy – viele Deutsche griffen zu, denn die Sendung hielt sich solide.
Die Stratmann hat also ebenfalls ein Buch geschrieben. Weshalb? Ich versuche wiederzugeben, wie sie es erklärt hat: Sie saß eines Tages zu Hause auf ihrem Sofa, als ihr dieser maßlos bizarre Gedanke kam, Buchstaben zu Silben aneinanderzureihen, Wörter daraus zu bilden, Sätze entstehen zu lassen und die fast leere Menge an Wissen in den Orbit der Literatur zu schicken. Jedenfalls, so sagt sie, wusste sie zu dem Zeitpunkt noch nicht einmal, welchen Inhalt das Buch haben sollte. Das erschien ihr unwichtig. Sie ging durch ihre kleine Bibliothek und machte sich kundig, was andere Autoren so geschrieben hatten. Nein, nicht die Titel oder Inhalte interessierten sie, schreibt sie. Sondern der jeweilige Umfang der Bücher.
Ihr wollt wissen, an wem sie sich letztlich orientierte und wie dick ihr Buch wurde? Offen gesagt, ich habe es vergessen. Für mich war nur eines klar: An dieser Vorgehensweise mochte ich mich nicht orientieren. Ich denke, jeder Mensch erfüllt einen Bildungsauftrag. In Sachen deutscher Comedy und semikreativer Ideenfindung ist meiner hiermit bereits erledigt. Zeit, dass ich mich auf das Wesentliche konzentriere. Auf mich.
Als ich meinen Lieblingsbuchladen wieder verlassen hatte, war ich um ein Buch reicher: »Tiger fressen keine Yogis«, von Helge Timmerberg, einem 1952 in Hessen geborenen Globetrotter mit unfassbarem Sprachgefühl. Er wurde als ein Enfant terrible des deutschen Journalismus bekannt. Er ist in der Welt zu Hause, auch wenn er für sie nie geschrieben hat. »Süddeutsche Zeitung«, »Die Zeit«, »Stern«, »Der Spiegel« oder aber – in dieser Auflistung nicht ganz passend, dennoch in meinen Augen überzeugend – im »Playboy« fand er sich als Autor von Reportagen und Kolumnen wieder.
Über ihn bin ich eigentlich auf die Idee gekommen, mit Anfang/ Mitte 20 ein paar erste Lebensgeschichten für die Nachwelt festzuhalten. Lebensgeschichten, nicht Lebensweisheiten. Danke, Frau Stratmann, zu der Erkenntnis, dass man mit Letzteren vorsichtig sein sollte, haben mir bereits die ersten Seiten Ihres Buchs verholfen. Es war also bestimmt kein Zufall, dass ich gerade zu Ihrem gegriffen habe, um Orientierung zu erhalten.
Timmerberg dagegen gibt mir keine Orientierung, oder maximal geografische. Nein, er gibt mir Inspiration, was mir viel mehr bedeutet. Er schreibt hervorragende Geschichten. Reportagen, Berichte, Gedichte, Romane, Märchen, Fabeln. Jede einzelne Geschichte ist lesenswert, witzig, lehrreich und erweitert, ja erschließt gar Horizonte.
Ob das bei mir genauso wird? Findet es für euch heraus. Timmerberg ist nicht mein Maßstab. Er ist lediglich mein gedanklicher Vater, während ich Zeile für Zeile zu Papier bringe und damit mich und die Welt zum Lächeln bringen möchte.
Ebensolche Inspiration erfuhr ich an anderer Stelle durch Heinz Nußbaumer. Er war früher Pressechef zweier österreichischer Staatspräsidenten und Außenpolitik-Chef beim Wiener »Kurier«. Er hat Margaret Thatcher, Ronald Reagan oder den Dalai-Lama interviewt.
Letzterer nahm sich übrigens auch Zeit für Helge. Irgendwann einmal in Indien. Und was machte der Timmerberg daraus? Die Begegnung mit dem spirituellen Oberhaupt der Buddhisten war am Ende nicht mehr als eine Randerscheinung in einer Reportage, die den Titel trägt: »Seit 20 Jahren ohne Sex«. Es ging in ihr darum, wie man das wahre Glück erlangt. Der Dalai-Lama wusste keine Antwort auf diese Frage. Er wusste jedoch, wie man das wahre Glück verliert: »Wer zu viel an sich selbst denkt, bekommt es mit der Angst zu tun.« Punkt.
Und Heinz Nußbaumer? Was für einen Gedankenaustausch er mit dem Dalai-Lama hatte, habe ich bis heute nicht gelesen. In dem Gespräch mit dem Österreichischen Rundfunk erzählte er jedenfalls der Moderatorin, er sei einmal gefragt worden, was er machen würde, um ein besseres Österreich zu schaffen. Mir gingen in dem Moment viele, angebrachte wie unangebrachte, Impulse durch den Kopf. Er dagegen sagte: Steuernachlässe für alle, die ihre Lebensgeschichte aufschreiben. Weil jeder Mensch vom anderen lernen könne.
Ich ärgerte mich kurz über mich und meine unangebrachten Gedanken – und just in dieser Sekunde ebenso ein wenig über meine Vorverurteilung von Frau Stratmanns Buch.
Das Nußbaumer-Interview wurde gesendet, als ich gerade über den Reschenpass Richtung Italien fuhr. Das war der finale Anstoß, meinen Wunsch wahr werden zu lassen und endlich mit meinem eigenen Buch zu beginnen: Lern dich selbst kennen, und nimm so viele Menschen wie möglich mit auf diese Reise. So entsteht Spaß, so entsteht ein Buch der Freude.
Ich habe einiges erlebt und zu oft nur darüber nachgedacht. Ich habe viel gesehen, aber zu wenig davon beschrieben. Das möchte ich ändern. Ich will erzählen und dabei mitfühlen und mitdenken lassen. Und ich will mich erinnern. Erinnern an Situationen, in denen ich war und an denen leider zu wenige teilhatten.
Macht ihr es bitte besser: Redet, erzählt, teilt. Und bitte unterdrückt dabei den Drang, Emotionen ausschließlich in der neumedialen Welt freien Lauf zu lassen. Posts, Blogs, Chats, E-Mails – das ist alles zu einfach für uns Menschen. Das ist einsilbig – und das passt zu einzellig. Zu Amöben, für die es andererseits allerdings wieder zu kompliziert ist, ein Smartphone oder einen Computer zielführend zu bedienen. Versteht ihr den Konflikt?
Wir Menschen haben uns weiterentwickelt. Die meisten zumindest. Gerade deshalb bringen wir uns mit rein digitaler Artikulation in Schwierigkeiten. Unsere Kommunikation leidet massiv. Der Spaßfaktor geht meiner Ansicht nach verloren. Vielmehr lässt er sich oftmals nur noch auf ein Symbol beschränken. Ein Daumen nach oben, ein Smiley, ein GIF – also eine Animation –, das war’s.
Früher war Animation noch lustig. Früher hat der Animateur am Pool noch alles geben müssen, um mich zur Wassergymnastik zu bewegen. Früher war Animation noch ein Job, der auf ganz eigene Art Spaß vermittelte. Gut, die Emojis müssen auch gestaltet werden, und die Zahl derer, die das tun, wächst stetig. Nur werden am Ende trotzdem immer die gleichen verwendet, um doch so Unterschiedliches auszudrücken. Kein Mensch steht heute zur Morgengymnastik auf, um nur einen Muskel zu trainieren, wenn er weiß, dass der Rest dadurch verkümmert. Ich will, dass Animation also wirklich wieder animiert.
*
Ich bin vom Sternzeichen Löwe. Deshalb vielleicht manchmal ein wenig zu heroisch. Ich neige gerne zu Überzeichnungen. Einer meiner mir wichtigsten Menschen, Yvonne, hat mich bereits vor Jahren darauf aufmerksam gemacht. Ich solle öfter mal zur Ruhe kommen, die Tatzen übereinanderschlagen und der Savanne lauschen.
Ehrlich, ich habe das ausprobiert. Ich war sogar in Tansania, um mir anzusehen, wie das in der Tierwelt so läuft und was ich davon übernehmen kann. Die Kätzchen, die ich beobachtet habe, wirkten entspannter als ich, so viel ist sicher. Sie waren größer, schöner, dafür nicht so mitteilungsbedürftig wie ich.
Der Löwe, der König der Tiere. Bin ich dann der der Menschen? Ist meine Meinung damit nicht unweigerlich das Maß aller Dinge? Natürlich nicht. Es ist eine Meinung, aber eben nicht mehr als das.
Ihr werdet mich verstehen, wenn ihr für drei Dinge offen seid: 1. Die Vielfalt der Perspektiven eröffnet Horizonte. 2. Richtig ist, was ihr für richtig haltet. 3. Es sind die guten Geschichten, die es verdient haben, erzählt zu werden.
Sommer 2005 bis Sommer 2018
Love Brand
Sand. Überall. Links von mir, rechts von mir, hinter mir, vor mir, unter mir. Sand. Überall Sand. Ich mag Sand. Wie sich die Zehen in ihn eingraben, wie er zwischen den Fingern hindurchrieselt, wenn man versucht, ihn festzuhalten. Ob nass oder staubtrocken, Sand ist wunderbar sanft, rau, fein, grob, weiß, gelb – und überhaupt, Sand ist Rohstoff. Ein Material, aus dem sich Träume erbauen lassen. Dafür gibt es sogar Förmchen, Eimerchen, Schäufelchen.
Nur auf Sand sollte man seine Träume nicht bauen. Das geht schief, das weiß doch jedes Kind.
Wie gesagt, ich mag Sand. Den weißen Korallensand ganz besonders. Obwohl und gerade, weil ich weiß, wie er entsteht: Es lebe der Papageifisch. Er frisst die Korallen und bläht sie unverfroren und fein zerstäubt als Strand wieder aus. Ich hab das schon zig Male live gesehen. Ich kann bezeugen, wie Strand gemacht wird.
Bei jedem Besuch am Strand wird mir dadurch irgendwie bewusst: Wir Menschen haben eine Wahl. Wir entscheiden, in welchen Mist wir uns setzen und wie wir damit umgehen. Papageifisch-Aa ist meine erste Wahl. Und weil gelber Sand aber auch nicht bäh ist, sondern nur eben nicht zwingend vom Papageifisch, habe ich auch eine sehr gute zweite Wahl. Für mich bietet Sand traumhafte Perspektiven. Und es schärft mein Umweltbewusstsein: Schützt die Fische! Wir können deren Scheiß mehr gebrauchen als die unseren.
Wenn ich vom Strand aus aufs Meer blicke, dann tue ich das also mit allen Sinnen. Ich rieche das Salz, ich spüre die Brise, ich sehe das Blau, ich höre die Wellen, wie sie am Ufer brechen. Und ich erlebe, zumindest im Geiste, die Tiere, denen das Wasser Heimat gibt. Sobald alle Sinne wissen, dass sie sich mit dem Meer beschäftigen könnten, stundenlang, tagelang, wochenlang, ist alles gut. Das Meer lässt mich ankommen, egal, aus welcher Welt ich gerade komme oder welche Welt ich mir auch immer ausmale. Am Meer bin ich immer zu Hause, weil mein Herz daran hängt. So einfach ist das.
Und noch etwas: Dem Meer kann ich alles erzählen. Das tat ich gerade in dem Moment, als ich beginnen wollte, ein Buch zu schreiben. Ich unterhielt mich mit dem Meer. Es war so ein wenig wie »Der alte Mann und das Meer«, Hemingways letztes Werk, das zu seinen Lebzeiten veröffentlicht wurde. Und nun wartete ich auf die Eingebung zu meinem ersten, das zu meinen Lebzeiten veröffentlicht werden würde.
Ich schäme mich nicht für den Dialog mit ein paar Litern Salzwasser. Doch, zugegeben, grotesk wurde es, als das Meer antwortete. Schon einmal selbst erlebt, wenn der Ozean schäumt und vermeintlich wütend nach dem Festland schnappt? Könnte man auch einfach Brandung nennen, doch das wäre mir zu wenig metaphorisch. Wenn die See schäumt, reißt sie Felsen und selbst Fischkot mit sich zurück und verschluckt sie, ohne zu murren. Dieses Mal schien das Meer, wenn auch aufgepeitscht vom Wind, nicht wütend zu sein. Es war kein Beißen am Festland, mehr so ein Lecken. Im Sekundentakt wurden die Wellen zu unzähligen Zungen, die festeren Boden genießen. Es war nicht das zärtliche, behutsame Bacardi-Feeling-Lecken. Es war viel grober, wie bei einem Kind, das sich an einem Eis süchtig schleckt. Als hätte das Meer nie gelernt zu genießen und wollte sagen: »Ich will mehr.«
Na gut, dachte ich mir. Wenn du mehr wissen willst, erzähle ich dir mehr: »Ich bin hier, weil ich ein Buch schreiben will. Ja, ein Buch. ›IT’S A BOJ‹ wird es heißen, und glaube bitte nicht, dass mir der Fehler in dem Wort nicht schon aufgefallen wäre. Die Doppeldeutigkeit ist bewusst gewählt: Ich bin kein normaler Junge, das ist Fakt. Deshalb kann das auch kein normales Buch werden, logisch, oder? Also mache ich die Not zur Tugend, aus einem vermeintlich fehlerhaften Jungen wird ein Book Of Joy – ein Buch der Freude.
Kinder sind wieder im Trend. Kinder der Liebe, nicht der Steuervergünstigung. Da mache ich mit. Ich werde als Mann, biologisch bedingt, nie erfahren, wie es ist, ein Kind auszutragen. Mental habe ich es dafür selbst in der Hand.
»IT’S A BOJ« ist mein Baby, das ich auf die Welt bringe. Eines, mit dem ich seit Jahren schwanger gehe und was offenbar eine schwere Geburt werden wird. Deshalb erlaube ich mir, das Kind so zu benennen, wie es mir passt – zumal wir alle wissen, wie viele schwerwiegendere Fehler Eltern bei der Namensgebung ihrer Kinder tatsächlich begehen. Da erscheint mir meiner charmant – einzigartig.
Ein klein wenig mehr vom Hintergrund erkläre ich dir mit Vergnügen: Ich schreibe gerne. Ich bin Journalist und will mit diesem Buch mehr abliefern als nur 120 Zeilen und ein Bild wie für eine Tageszeitung. Ich will Spaß haben, Spaß machen. Mit Menschen. Und weil wir alle sehr, sehr gerne stereotyp entscheiden, nach schwarz und weiß, richtig und falsch unterscheiden, habe ich mir erlaubt, den Titel des Buchs schon vor der Niederschrift festzulegen, mit diesem klitzekleinen Fehler. Und einem klitzekleinen Lächeln im Gesicht, weil dieser Fehler pure Freude ist. Und auch ein bisschen, weil ich das Normale eben brutal langweilig finde.
Es gilt, die zweite Halbzeit des Lebens anzupfeifen, bevor wir in die Verlängerung gehen. Das Buch soll deshalb anders werden. Provokant, witzig, voller positiver Energie und Anstöße. Es wird in jedem Fall ein Buch über facettenreiche Menschen. Denn ein Buch über nur eine Persönlichkeit wäre eine Autobiografie, richtig? Nein, eine Autobiografie soll es nicht werden. Für die Memoiren haben wir noch Zeit.
Wenn der Abpfiff in Sicht ist. Wenn endgültig geklärt ist, für was ich da bin, was mein Auftrag ist und was ich wirklich kann – mein Buch wird der Anfang vom Ende, erst wird gerockt, dann geruht. In Frieden.
Plötzlich schien mich das Meer anzuspucken, böiger Wind prustete mir die Gischt ins Gesicht. Prustest du vor Lachen, liebes Meer? Hört sich das, was ich dir gerade gesagt habe, so lächerlich an? Dann wird es für mich jetzt Zeit zu gehen. Ich suche mir jemanden, der seriös antwortet, der mich unterstützt. Wen? Erst so aufführen und jetzt auch noch indiskret werden … Keine Sorge, ich komme bestimmt wieder, dann sag ich es dir.
Okay, prinzipiell war mir auch egal, in welcher Stimmung das Meer gerade war. Ich war auf der Suche nach einer geilen Geschichte. Einem Blind Date mit der Leidenschaft. Ich wusste zwar ebenso wenig, wo ich sie treffe, wie wann das geschehen wird. Ich wusste nur, dass ich loswollte, sonst würde das am Ende wohl ein sehr kurzes Buch über ein merkwürdiges Gespräch zwischen dem Ozean und mir.
Danke fürs Zuhören, du bist für mich meine absolute Love Brand. Eine, der ich vertraue. Eine, zu der ich mich hingezogen fühle. Eine, für die ich schon mehr Geld ausgegeben habe als für Weib und Gesang. Dir bin ich markentreu.
Schon drehte ich dem blauen Wasser eiskalt den Rücken zu.
Baywatch
Love Brand, wieder so ein neumodischer Marketing-Mist, den ich in einem Online-Newsletter aufgeschnappt hatte, der es am Spam-Ordner vorbeigeschafft hatte. Alle Welt spricht darüber, alle Welt will Teil davon sein. Alle Welt weiß besser, was und wie etwas oder jemand zu einer Love Brand wird. Oder besser noch, wie man am besten von ihr profitiert.
Ich für meinen Teil habe den Eindruck, gerade das Profitieren ist zuletzt vielerorts zu sehr in den Vordergrund gerückt, deshalb klingt Love Brand für mich überhaupt nicht stimmig. Wie kann ich etwas lieben, wenn ich mich daran bereichern will? Wäre ich so eine Love Brand, würde ich die Frage stellen: Liebst du mich oder die Gier? In einem kitschig-romantischen Film ginge der Dialog danach, musikalisch von Céline Dion untermalt, so weiter: »Natürlich liebe ich nur dich. Dich ganz allein, so wie du bist.« Dann ich, die Love Brand etwas skeptisch: »Das sagst du nur so. Was genau liebst du an mir?« Céline-Dion-Lied aus. Schweigen.
Ja, das Was ist immer so eine offene, teils unbequeme Frage. Neudeutsch heißt das Was auch USP, stand in dem Newsletter. USP (unique selling proposition) steht für Alleinstellungsmerkmal(e). Das, was mich unverwechselbar macht.
Und was ist das? Kommt darauf an, wen man fragt. In meinem Fall fragt ihr jemanden, der zum Ende des Kalten Krieges geboren wurde. Als Kapitalismus und Kommunismus ohne militärische Auseinandersetzung ein rein verbales oder auch mediales Armdrücken miteinander veranstalteten und die einzige bekannte Firewall mitten durch Berlin ging – und das seit mehr als 20 Jahren schon. Das beeinflusst einen, wenn im Kopf aller Menschen um einen herum Mauern zum Alltag gehören. Viel mehr noch, es schränkt ein.
Weiter westlich, der Wall, im Silicon Valley, wurde zur gleichen Zeit der Microchip entwickelt. So schaffte es die Menschheit, dass nur zwei Zahlen die ganze Welt veränderten: 0 und 1 machten aus dem Industriezeitalter das Informationszeitalter. Aus Produktion Konsum. Dank 0 und 1 löste die CD die Vinyl-Schallplatte und die Kassette ab. Der IBM-PC verdrängte Papas Schreibmaschine, das Motorola-Funktelefon den Fernmeldeapparat mit Wählscheibe und Kabel. Alles sofort Love Brands. Weshalb ich mir da so sicher bin? Nun, der Audio-Walkman hatte einen Einführungspreis von 200 US-Dollar, der Sony-CD-Player kostete schon 900 US-Dollar, und das erste Handy kam für 4000 US-Dollar auf den Markt. Wir Menschen lieben es, unsere eigenen Heldentaten individuell in einem intimen und privaten Moment musikalisch zu unterlegen, die großen Datenmengen an schönen Erinnerungen elektronisch zu archivieren – oder am Ende, eben noch besser: sie live mitzuteilen. Wo auch immer man selbst gerade ist. Das ist uns lieb und teuer. Sagt der Preis. Und wenn wir ihn zahlen, scheint er uns das wert zu sein. Der Mensch investiert nur in das, was er liebt. Egal wo.
Heutzutage wissen jedenfalls alle, die es interessiert, wo ich gerade bin, denn ich besitze ein Smartphone. Ebenfalls Marke Love Brand, weil es trotz Fortschritt noch genauso viel gekostet hat wie der CD-Player zum Einführungspreis – und ich artig bezahlt habe. Das Smartphone jedenfalls teilt allen, die meine Nummer haben, mit, wo ich mich befinde. Zur Not brauchen sie mich dafür nicht einmal mehr anrufen und fragen.
Heutzutage bist du bereits als Säugling überall auf der Welt präsent, hast ein Facebook-Profil und Hunderte von Likes und Posts, noch bevor du selbst lesen oder beurteilen kannst, was du an dir magst. Das war zu der Zeit, aus der ich stamme, ebenfalls noch ein wenig anders: Ich hatte drei Likes. In meinem Poesiealbum, dem Facebook der 80er. Einen von meiner Grundschullehrerin, einen von meiner Cousine und einen von meiner Schwester. Und ab und zu bekam ich von der netten Verkäuferin der Metzgerei Lang eine Scheibe Gelbwurst extra, wenn ich mit meiner Mutter zum Einkaufen dort war. I liked.
*
Vor lauter Sinnieren über liebe und teure Love Brands staunte ich auf einmal, wo ich auf meinem Weg vom Meer weg so entlanggekommen war. Die Dünen hoch, dahinter wieder ein paar Schritte runter. Ich war ein ganzes Stück von der immer noch keifenden Zicke entfernt und hatte einige Höhenmeter gemacht. Da kam ich an einen Pfad voller Muschelscherben, der, parallel zum in Luftlinie ungefähr 200 Meter entfernten Wasser, zwischen ein paar knochigen Hecken und Sträuchern zu einem kleinen Strandhaus führte. Dort oben, auf dem Gipfel der Düne, vor dem Haus, saß ein Mann. Er wirkte etwas einsam auf mich und schien umzingelt von einem Haufen Müll. Das Meer fest im Blick. So als wollte er ihm etwas sagen.
Ich hätte die anstrengende Variante querfeldein durch den Sand nehmen können oder den Muschelpfad zum Müllmann. Weil ich Lust auf Gesellschaft hatte, wählte ich letztere Option. Außerdem trieb mich die Neugierde – konnte durchaus sein, dass der Typ unhöflich zum Meer war und es deshalb so aufbrausend reagierte.
Etwas zögerlich und dennoch freundlich ging ich auf ihn zu. Er sah mich nicht an, aber ich wusste, dass er mich bereits aus sicherer Entfernung bemerkt hatte.
»Hallo«, sagte ich.
Er nickte, ohne zu mir herüberzublicken. Ich interpretierte das als ein Signal, dass ich vorerst bleiben durfte. Und so setzte ich mich neben ihn auf die Terrasse, umzäunt von haufenweise festgebundenem Strandabfall. Die Baywatch-Hütte hinter uns, den Ozean vor uns. Ja, ich war nicht weit gekommen, wenn ich den Fortschritt in Metern beziffern müsste. Aber ich hatte eine neue Perspektive – und wer wusste schon, wofür das gut sein konnte.
Eine Weile verging, und niemand sagte ein Wort. Männer machen das manchmal so, wenn sie miteinander warm werden.
»Weshalb bist du hier?«, fragte er mich so besonnen wie plötzlich.
»Ich mag Sandstrand und das Meer«, sagte ich. Das hörte sich in dem Moment für mich gut an und entsprach zudem der Wahrheit.
»Willst du wissen, weshalb ich das Meer so liebe? Es hat mich verändert. Das Meer verändert generell und ständig.«
Ein Träumer, dachte ich. Oder ein Philosoph.
»Ich tauche für mein Leben gerne, ich genieße die Schwerelosigkeit, die fremde Welt, die Farben und das Leben. Keiner redet dazwischen, wenn ich mich treiben lasse«, sagte er.
Okay, kein Träumer – eher ein Taucher in der Oberflächenpause. Ich akzeptierte die Situation, mit einer Art Mitch Buchannon vor einer Hütte zu sitzen und das Meer zu beschwören. Ein kleiner, aber bedeutender gemeinsamer Nenner, der uns zusammengebracht hatte und mich an seiner Seite hielt. Und weil wir uns nicht vorgestellt hatten, nannte ich meinen Nebensitzer von hier an im Stillen Mitch. Weil es für mich passte.
Nach einer Weile brach ich das Schweigen: »Ich erzähle dem Meer gerne etwas, wenn ich die Gelegenheit dazu habe. Du wärst überrascht, wenn du wüsstest, was es mir schon für Antworten gegeben hat.«
»Wer ein Warum hat, dem ist kein Wie zu schwer«, antwortete Mitch. Ich kannte dieses Zitat von Nietzsche, das er etwas zusammenhanglos einwarf, was ihn in meinen Augen nun doch eher zu einem Philosophen als zu einem Taucher machte.
Ich entschied, ihm noch ein wenig mehr Einblick in meine Karten zu gewähren: »Heute habe ich dem Meer erzählt, dass ich ein Buch schreiben werde. Dass mir allerdings der Impuls für den Anfang fehle. Ich habe so viele Ideen im Kopf, nur keine Ahnung, wie ich sie sinnvoll zu einer Geschichte zusammenbringen kann. Mich beschäftigt die Frage: Wie bringe ich mein Chaos im Kopf so sortiert, dass ich produktiv werden kann? Du siehst ja selbst, dass ich mit keiner behutsamen Antwort auf meine Fragen rechnen kann.« Ich zuckte mit den Achseln und zeigte mit beiden Händen zum Wasser hinunter.
»Du musst zerstören, damit du etwas Neues beginnen kannst«, sagte Mitch. »Sieh dir an, wie zerstörerisch das Meer sein kann. Es brachte schon so viel Elend, aber auch so viel Freude.«
»Du meinst diese Schwarz-Weiß-Sache? Wo Licht ist, ist auch Schatten?«, fragte ich.
»Nein«, sagte er umgehend, »wenn du ihm mit Freude begegnest, wird es dir Freude bringen.«
ZACK – das Gegenteil war passiert, denn bevor mich ein Moskito ins Bein stach, hatte ich zerstört. Und sofort erkannte ich, dass Mitch im Recht war, denn was folgte, war Erleichterung.
»Drei wichtige Dinge durfte ich bereits vom Meer lernen. Genauer, vom Indischen Ozean: Gelassenheit. Empathie. Die Härte der Realität. Interessiert dich die Geschichte?«, fragte er mich.
Ich hatte Ruhe vor den Moskitos, also stimmte ich gelassen zu. Er begann zu reden, ohne dabei den Blick vom Meer abzuwenden: »Ich erinnere mich noch genau« – er holte langsam ein wenig Luft und erzählte dann, als ob er die Geschichte so jeden Abend bei einem Glas Wein erzählen würde –, »der Krieg war noch nicht vorüber. Mit etwas Giftgas bewaffnet lag ich im Bett und jagte mit den Pupillen den kleinen Flieger am Horizont. Schweiß stand mir auf der Stirn. Es war nicht die Angst vor dem bevorstehenden Angriff der blutsaugenden Luftwaffe. Es waren die Temperaturen, die in Sri Lanka herrschten. Es war weit nach Mitternacht, die Luftfeuchtigkeit hatte noch immer ungesunde Prozentwerte, der Arak auch. Das Quecksilber hatte sich in einer Höhe festgesetzt, die nur zu erahnen war, so beschlagen war das Thermometer an der Wand. Das Autan stank höllisch. Wäre es nicht das penetrante Fluggeräusch der Moskitos gewesen, dann wäre der Grund meiner Schlaflosigkeit der Smog in meinem Zimmer. Bestialisch. So kam es zu Lektion Nummer 1 durch den Moskito: Gelassenheit.«
»Du sprichst von einem gepflegten Leck-mich-am-Arsch-Gefühl«, fasste ich zusammen.
»So kann man es auch ausdrücken … Also, Gelassenheit war wichtig. Auch im Schlaf. Und trotzdem: Hin und wieder war ich voll und ganz out of control. Am liebsten wollte ich das Moskitonetz wegreißen, das Zimmer anzünden und mich nackt auf die Terrasse setzen, um mein Inferno bei einem kühlen Bier zu feiern.«
»Bier. Ich kann dir folgen.«
Mitch überging diesen unqualifizierten Beitrag meinerseits: »An Streichhölzern mangelte es nicht. In dem einzigen Supermarkt an der einzigen Kreuzung in Marawila gab es kein einziges Feuerzeug. Dafür gab es die Hölzer im großzügigen Paket. 25.000 Stück lagen bei mir im Zimmer auf dem kleinen Holztisch, der sich als Brandherd somit prima geeignet hätte. Ja, das wäre ein wunderschönes Feuerwerk geworden, wäre da nicht noch das ceylonesische Qualitätsproblem gewesen: Es funktionierte am Ende nur in jeder zweiten Schachtel ein Streichholz. Als genussvoller Raucher und mit ständigem Wind wirst du sparsam und setzt Prioritäten.
Weil ich zudem auf südostasiatische Bürokratie und auf die übertriebene Nächstenliebe in Gefängnissen mit Guantanamo-Charakter ebenso gern verzichten wollte wie aufs Nichtrauchen, verwarf ich die Idee mit der Brandstiftung zügig. Ich dachte grün. Ich setzte auf den natürlichen Feind der Fliege und damit auf den natürlichen Freund von meinereinem, den Gecko. Aus Gründen der Diskretion hätte ich dazu aber wohl vorab mein Zimmer verlassen, das Licht innen aus-, draußen an- und die Tür aufmachen müssen. So hätte ich die niedlichen Echsen zum Einmarsch einladen sollen. Nicht anders. Ich war aber zu müde und hatte mich für den direkten Sprung ins Netzzelt entschieden, ohne die Nachtschicht zu mobilisieren. Das Knacken von der Zimmerdecke, das sonst so symptomatisch für die Unterstützung der Security an Decke und Boden war, blieb aus. Da ich ein sehr friedlicher Mensch bin, verbot ich mir weitere Schlachtpläne und ließ mir schließlich doch vom Wachdienst des Hotels noch drei kalte Bier bringen. Und weil ich sie schnell genug trank, schlief ich gut und bald ein.«
»Und schon hattest du es, das Stech-mich-am-Arsch-Gefühl. Du warst besoffen und entspannt, alles klar. Nur, worauf willst du hinaus – dass ich lieber ein Bier hätte holen sollen, als diese Mücke gerade zu töten?«
»Okay, okay, ich bemühe mich, etwas schneller auf den Punkt zu kommen. Am nächsten Morgen jedenfalls war das Meer genauso wie an den meisten Tagen. Etwas Brandung, immer noch einfach zu baden. Am Strand aber tobte das Leben: Polizei, Militär, etliche Passanten und ein Boot.«
»Feierte dich der Naturschutzbund für die geretteten Tierleben?« Ich konnte die Provokationen aufgrund meiner Ungeduld einfach nicht lassen.
»Keine Feier. Ich durfte erfahren, dass es wesentlich schlimmer kommen könnte, als mit ein paar Mückenstichen aufzuwachen. Am Strand lag ein Boot, das aus ebenso vielen Holzplanken zusammengezimmert war, wie das Wort Boot Buchstaben hat. Es war ein Flüchtlingsboot. Tatsächlich versuchten noch immer fast täglich Dutzende von Sri Lanka aus, zusammengepfercht auf einer Nussschale, den Weg über den großen Teich zu machen. Italien ist das gelobte Land, zumindest glaubten sie das. Die Flüchtlinge von besagtem Boot mussten allerdings noch ein wenig weiter glauben, denn sie hatten es nicht geschafft. Die Wellen und der Wind waren zu stark. Nach nur drei Stunden auf See wurde das Holzgerippe am Strand angespült. Alle überlebten, verschwanden aber sofort ins Landesinnere, aus Angst vor der Polizei. Die und das Militär bewachten das Mahnmal am Strand, falls die Schlepper zurückkämen, um zumindest den Motor auszubauen. Das hatten die Soldaten dann bis zum Abend selbst erledigt, als wir uns vor meinem ersten Hilfstransport in eines der Tsunami-Desaster-Camps zu Speck und Bohnen, in der Pfanne über offenem Feuer gebraten, am Strand trafen. Der Holländer unter uns war gut mit Gras versorgt und deshalb der Einzige, der ob der Militärpräsenz zehn Meter entfernt ein wenig unruhig war.
Die Wellen hatten inzwischen massiv zugenommen und schlugen jetzt heftig gegen die Seite des gestrandeten Flüchtlingsbootes. So wie diese Wellen da draußen.« Er zeigte auf die Brandung vor uns. »Jedenfalls, es war kein Wunder, dass das Boot dem gewaltigen Druck nicht bis zum nächsten Morgen standhielt. Wir verfolgten das Schauspiel auch nicht zu Ende. Na ja, irgendwie doch.«
Eine kurze Pause half Mitch sichtlich, sich noch genauer zu erinnern.
»Am nächsten Morgen, als ich wach wurde, stiegen Rauchschwaden vom Strand auf. Ich sah unseren Hotelmanager mit in die Hüften gestemmten Armen am Strand stehen und trat neben ihn. Vor ihm kohlten die letzten Balken des Bootes, die einer seiner Mitarbeiter mit Meerwasser ablöschte. ›Big Problem‹, sagte er immer wieder. Ich dachte nur, meint der das ernst? Zu den Flüchtlingen kein Wort. Dann verbrennt das Boot nicht so, wie er will, und er sagt: ›Big Problem‹?«
»Verkehrte Welt«, murmelte ich kopfschüttelnd.
Mitch löste seine Geschichte endlich auf: »Der buddhistische Sri Lanker wäre aber nicht Buddhist, könnte er nicht eine Weisheit anwenden: Wer etwas in den Sand setzt, macht am besten eine schöne Düne draus. Genau das passierte auch umgehend, man begrub den Rest des Wracks mit gelbem Sand.«
Bei allen versteckten Botschaften zwischen den Zeilen, mir gefiel die Geschichte sehr, denn ich mochte es, wenn Menschen von Reisen und Erlebnissen berichten konnten, ohne sich dabei auf die Qualität eines Robinson-Club-Büfetts zu beschränken. Ob mir ein derartiges »Big Problem« je selbst zustoßen wird? Werden da draußen ähnliche Geschichten auf mich warten? Oder werde ich mein Buch am Ende verbrennen und die Überreste im Sand vergraben können? Wird aus meinem Traum auch nicht mehr werden als eine Düne? Ich wollte mich dringend von diesem Horrorszenario lösen.
»Du hast von dem Tsunami erzählt. Warst du dort?«, fragte ich Mitch.
»Ich flog für drei Monate nach Sri Lanka, vier Wochen nachdem der Tsunami an Weihnachten wütete. Ursprünglich wollte ich dort ein Praktikum machen, dann wurde ich zum Helfer. Und jedes Mal, wenn ich aus einem Camp zurückkam, war diese Düne zwar noch da, nur die Geschichte dazu machte Platz für neue. Das erste Mal im Camp veränderte meine Sichtweise auf das, was schlimm ist, schlagartig. Der Trip dauerte zwei Tage und ging von der Westküste zehn Stunden mit dem Kleinbus übers Hochland in den stärker betroffenen Süden hinunter nach Matara.
Als wir zurück in unser Resort an der Westküste kamen, lief das so ab: Ich warf meine Sachen ins Zimmer, zog mir eine Badehose an und sprang ungeduscht in unseren mit Chlor verseuchten Pool. Ich schwamm zum Rand, blickte über das Volleyballfeld und die Düne hinweg, vorbei an ein paar herrenlosen Hunden aufs Meer.
Geheult hab ich. Der Dreck musste raus, von innen. Außen half das Chlor.
Es dauerte lange, bis ich mich etwas gesammelt hatte und in den kleinen Internet-Raum im Eingangsbereich der Hotelanlage ging. Außer mir war da noch eine Hotelangestellte. Sie saß in der Ecke vor der Klimaanlage und hatte Spaß mit der Langeweile. Ich wartete, bis der PC hochgefahren war, konnte das, was ich mitteilen wollte, immer noch nicht greifen und schrieb diese Mail nach Hause, nur damit du siehst, wie sehr das Meer dich verändern kann.«
Er griff unter seinen Stuhl, zog ein Tablet hervor, und drei, vier Fingerdrücke später erschien auf dem Display ein Text:
»Sri-lankisches Hochland. Teeplantagen links wie rechts. Dazwischen immer wieder ein Stück Dschungel. Ein paar Affen glotzen von den Bäumen desinteressiert ins Tal hinab. Tamilen, eine der zwei sri-lankischen Volksgruppen, die überwiegend aus Indien zur Arbeit auf den Teeplantagen auf die Insel übergesetzt haben, sitzen dagegen vor ihren Hütten und nehmen von dem kleinen Van mit den getönten Scheiben aufmerksam Notiz. Es geschieht nicht mehr allzu oft, dass sich Weiße in das abgelegene Bergland verirren – wenn es gerade hier überhaupt schon einmal der Zufall so wollte. Strahlende, ungläubige Gesichter ziehen an uns vorbei. Andere haben keine Zeit für uns. Zu schwer ist die Last aus Holz, die sie auf ihrem Rücken die schmale Straße hinaufschleppen – irgendwohin, nirgendwohin. Die Kinder spielen in der prallen Sonne mit kaputten Autoreifen oder waschen sich unter einem der dürftigen Wasserfälle, die sich hin und wieder entlang der Straße ihren Weg durch den Fels gebahnt haben. Wir befinden uns immerhin noch rund 2000 Meter über dem Meer, bei 24 Grad und einer schweißtreibenden Luftfeuchtigkeit. Ob diese Menschen hier wissen, was das Meer vor wenigen Wochen wenige Kilometer entfernt angerichtet hat? Ob sie vom Meer an sich wissen? Es sieht nicht immer danach aus.
Der Van sucht sich seinen Weg. Zehn Stunden dauert der knapp 100 Kilometer lange Serpentinenslalom hinab zur Küste. Eine Zumutung. Deutschlands Südautobahnen zu Sommerferienbeginn sind eine Erholung gegen das. Nein, wir haben keine Staus oder Baustellen. Wir haben nicht einmal Verkehr. Dafür haben wir aber auch keine richtige Straße.
Als wir unten angekommen sind, hat die Nacht bereits ihren dunklen Mantel über die Trümmerfelder gelegt. Der Mond verleiht zusammen mit Tausenden von funkelnden Sternen dem Ort Matara einen Hauch von Tausendundeiner Nacht. Wäre da nicht der Tsunami gewesen, der das Leid an- und etliche Menschenleben weggespült hat.
Neben der Hauptstraße türmen sich noch immer kleinere Müllberge, mit denen die Menschen gelernt haben zu leben. Die vielen Straßenhunde freuen sich darüber und huschen hin und wieder auf der Suche nach Futter über den noch warmen Asphalt. Es ist kurz nach 22 Uhr, immer noch weit jenseits der 20 Grad, die Luftfeuchtigkeit ist weiter gestiegen, je näher wir dem Meeresspiegel kommen, inzwischen auf knapp 90 Prozent. Vor dem Krankenhaus wartet ein einheimischer Journalist auf den kleinen Bus aus dem Hochland. Hinter seinem Pick-up hat bereits ein kleiner Lastwagen geparkt, um Hilfspakete für Babys in verschiedene Camps zu fahren. Verteilen sollen das jedoch die Leute aus dem Van, deshalb muss der Fahrer warten.
Nach kurzen Dialogen in holprigem Englisch macht sich der Konvoi auf den Weg zum ersten Lager. In dem Van hat die Klimaanlage ihren Geist längst aufgegeben. Die Ungewissheit vor dem, was im Camp auf uns wartet, reicht aus, um die stickige Luft ignorieren zu können.
Luft. Das ist eigentlich alles, was die Menschen in dem Camp noch zum Leben haben. Abgesehen natürlich von dem Camp selbst. Das ist es, was mir schon wieder die Luft zum Atmen raubt.
In einer Art Aufenthaltsraum sitzen, liegen, stehen vielleicht noch etwas über zehn Einheimische und starren wie paralysiert zu dem Röhrenfernseher. Es ist der einzige, den sie haben. Es läuft Bollywood.
Vor der Tür entladen wir den Lastwagen. Babyöl, Creme, Nahrung, Windeln und so weiter wurden zu Paketen zusammengepackt und eben jetzt dort verteilt, wo es helfen soll.





























