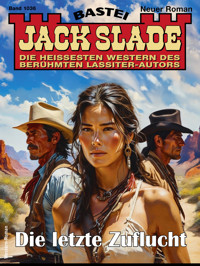
1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Lübbe
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Ein grausames Massaker an Indianern ruft den legendären Häuptling Cochise auf den Plan - schon bald tobt ein erbitterter Krieg in Arizona. Als der Schatzsucher Dex Harmond und seine beiden Gefährten von einem Überfall überrascht werden, kreuzen sich ihre Wege mit der jungen Lorna, die sie vor den Apachen retten. Doch in der flirrenden Hitze der Wüste entbrennt ein unerbittlicher Kampf ums Überleben, der in der Belagerung eines Forts durch Cochises Krieger seinen Höhepunkt findet.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 159
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Inhalt
Cover
Die letzte Zuflucht
Vorschau
Impressum
Die letzte Zuflucht
Ein grausames Massaker an Indianern ruft den legendären Häuptling Cochise auf den Plan – und schon bald tobt ein erbitterter Krieg in Arizona.
Als der Schatzsucher Dex Harmond und seine beiden Gefährten von einem Überfall überrascht werden, kreuzen sich ihre Wege mit der jungen Lorna, die sie vor den Apachen retten. Doch in der flirrenden Hitze der Wüste entbrennt ein unerbittlicher Kampf ums Überleben, der in der Belagerung eines Forts durch Cochises Krieger seinen Höhepunkt findet ...
Die Schöne tanzte nackt im Licht der untergehenden Sonne am rauchlosen Feuer. Neun Apachen saßen da und sabberten sie an. Anders konnte man es nicht nennen. Wilde Krieger, erbarmungslos wie das Land, in dem sie lebten – die Gila-Wüste mit ihrer glühenden Hitze und lebensfeindlichen Pracht und Schaurigkeit.
Ihre Blicke tasteten jeden Zoll der Reize der Tänzerin ab. Sie wirkten angespannt, denn schon in den nächsten Sekunden konnten sie die Kontrolle verlieren, sich auf die Tänzerin stürzen, über sie herfallen und ihrer Geilheit Genüge tun.
Noch hielten die Schönheit und der faszinierende Tanz sie in Schach. Die Tänzerin war bildschön, ein junges Weib, grazil und geschmeidig. Mit einem vollendeten Körper. Sie hatte langes goldblondes Haar, das ihr, wenn sie es nach vorn warf, bis über die Brüste fiel.
Diese konnte man nur als prachtvoll bezeichnen. Dazu noch die schlanken Glieder, weibliche Formen. Lange und feste Schenkel, ein flacher Bauch und zu einem schmalen Streifen ausrasierte Schamhaare.
Der Ansatz der Spalte zeichnete sich ab und verhieß Lust und Wonnen. Stramm war der Po. Das war ein Weib, das selbst ein Reiterdenkmal vom Sockel riss und ihm eine Erektion bescherte.
Dex Harmond, Kyle Stevens und Blade Donahue lagen ein Stück entfernt auf der Bodenwelle, zwischen den kargen Grasbüscheln und vereinzelten Mesquitebüschen verborgen. Hinter und über ihnen ragten Kakteen auf, und in der Ferne leuchteten die Kofa Mountains mit ihren vom Schein der Abendsonne rot angemalten Spitzen.
Rot wie das Blut der Kutschenbesatzung im Süden, anderthalb Meilen entfernt auf der Überlandstraße von Tucson nach Yuma. Der Kutscher, der Shotgun und drei Insassen der Concord-Kutsche waren von den Apachen beim Überfall aus dem Hinterhalt überrumpelt worden. Der Kutscher hatte es rasch hinter sich gehabt und war mit zwei Pfeilen in Brust und Kehle gestorben.
Auch einer der anderen hatte einen raschen und gnädigen Tod gefunden. Einer jedoch, es musste der Shotgun gewesen sein, war grausam gemartert worden. Das niedergebrannte Feuer und die schrecklichen Brandwunden kündeten von seinen Qualen.
Einen weiteren Mann – seinen heruntergerissenen Kleidern, einem am Boden liegenden Derringer und verstreuten Karten nach zu urteilen ein Spieler – hatten die Apachen mit dem Rücken an einem hohen Saguarokaktus gespießt und daran festgebunden. Dann hatten sie mit Pfeilen auf ihn geschossen und sich mit Messern an ihm zu schaffen gemacht.
Sein Skalp fehlte, und auch die anderen waren skalpiert worden. Von den sechs Zugpferden hatten die Apachen vier getötet und von ihrem Blut getrunken. Das galt bei ihnen als Delikatesse und sollte Kraft und Potenz verleihen.
Zwei Pferde hatten sie mitgenommen. Sie standen ein Stück von der Feuerstelle entfernt mit zusammengebundenen Vorderbeinen. Die Mescaleros hatten die Kutsche in Brand gesetzt; mittlerweile waren nur noch schwelende Überreste übrig. Die Gepäckstücke waren aufgerissen und verstreut worden.
Die Mescaleros am Feuer besaßen einen grotesken Humor oder einen seltsamen Geschmack. Einer hatte sich einen Petticoat über die Leggins gezogen, ein anderer trug einen Sonnenhut. Die Krieger – die Bemalung verriet sie als Mescaleros – waren entweder halbnackt, mit freiem, narbigem Oberkörper und von der Sonne gedörrt, oder sie trugen bunte Kalikohemden. Bewaffnet waren sie mit Pfeil und Bogen und zwei Sharps-Gewehren. Nur einer hatte eine moderne Winchester. Skalpmesser und Tomahawks oder eine Kriegskeule, der Schädelbrecher, kamen hinzu.
Es war klar, dass sie die Blonde bis zu diesem Platz verschleppt hatten. Sie waren zu Fuß unterwegs gewesen, trottende Wüstenwölfe in der Gila Wüste. Wenn es nichts anderes gab, konnten sie sich von Klapperschlangen und Kakteenfleisch ernähren, was kein weißer Mann je hinunterbrachte.
»Weshalb tanzt die Blonde so aufreizend?«, fragte Blade Donahue, ein Bulle von Mann mit klobigen Fäusten. Er war Preisboxer am Missouri gewesen und dort unter dem Namen Donnerfaust bekannt. »Es muss ihr doch klar sein, dass sie die Apachen damit zum Wahnsinn treibt.«
»Sie will Zeit gewinnen«, raunte Kyle Stevens.
Er war mittelgroß und breitschultrig. Braunhaarig und schnauzbärtig und mit einer Narbe im Gesicht. Man sah ihm an, dass er ein harter Knochen und Kämpfer war. Er war Sheriff im Südwesten gewesen, bis er den falschen Mann des Mordes überführte und an den Galgen brachte.
Der wahre Mörder war es schon gewesen, doch auch der Sohn eines mächtigen Mannes, der Gerüchte über Stevens in die Welt setzte und dafür sorgte, dass er davongejagt wurde. Fristlos und schmählich entlassen.
»Sie will Zeit gewinnen«, wiederholte Stevens.
»Wofür?«, fragte Dex Harmond, der dritte Mann des Trios, ein großer, sehniger, hagerer Texaner mit schrägen grauen Augen, sandfarbenem Haar und einem über die Mundwinkel herabgezogenen Sichelbart. Ohne ein Gramm Fett am Leib. »Für die Geier, die oben kreisen? Damit sie sich an ihr gütlich tun können, wenn die Horde mit ihr fertig ist? Habt ihr schon mal eine Frau gesehen, über die eine Horde Apachen herfiel?«
»Sei still, mir wird schlecht«, sagte Donahue. Krampfhaft ballte und schloss er die großen Fäuste.
»Ihr Tanz hat einen anderen Grund«, sagte Dex.
»Welchen?«
Der Texaner ließ sich Zeit mit der Antwort. Er schaute durchs Fernglas. Die Männer waren hundertfünfzig Meter von der tanzenden Frau und den Apachen entfernt. Sie konnten ihre Schönheit nicht aus der Nähe sehen, doch sie sahen genug.
Dex spähte nicht durch das Glas, um die nackte Blonde zu begaffen. Er schaute auf ihr Gesicht. Es war angespannt hinter dem Lächeln, das sie zeigte. Sie hoffte auf etwas, glaubte Dex; ihr Nacktheitstanz hatte einen besonderen Grund.
Dex leckte sich über die spröden, trockenen Lippen. Er war schon lange mit seinen beiden Partnern in der Wüste unterwegs.
»Sie hofft, dass einer von den Apachen sie für sich allein beansprucht, wenn sie ihm genug gefällt«, sagte er. »Ein Häuptling oder ein Unterhäuptling. Dann kann sie überleben. Ein Apache ist besser als neun, die über sie herfallen. Wenn sie ihn genügend reizt und er die anderen von ihr fernhält ...«
»Meinst du, das wird was?«, fragte Stevens, der davongejagte Sheriff. »Ich glaube das nicht. Eher hält ein Wolf alle anderen von einem saftigen Kadaver fern.«
»Yeah«, sagte Dex. »Aber sie hofft es. Verzweifelt hofft sie es.« Er setzte das Glas ab. »Die Hoffnung stirbt immer zuletzt.«
»Was machen wir nun?«, fragte der Boxer Donahue. »Wir können nicht einfach zusehen. Legt an, Jungs, wir halten dazwischen. Wir knallen die Horde ab.«
»Langsam«, verwehrte es ihm Dex. »Dazu müssen wir näher ran.«
»Hundertfünfzig Meter, das ist keine Entfernung für einen gezielten Gewehrschuss.«
»Bei Apachen schon. Die gehen schneller in Deckung als Präriehunde in ihren Bau schlüpfen, wenn es knallt. Wir können sie nicht alle auf einmal erwischen. Zudem sitzen sie im Kreis um das Feuer und die Tänzerin. Immer wieder verdeckt sie welche, wenn sie sich bewegt. Und noch was. Wenn wir sie retten wollen ...«
»Was sonst?«, fragte Donahue.
»... müssen wir dafür sorgen, dass sie am Leben bleibt. Wir können die Apachen nicht alle schnell genug töten. Einer wird sie als Geisel nehmen und ihr das Messer an die Kehle setzen.«
»Damit wir die Waffen niederlegen?«
»Nein. Er wird ihr die Kehle durchschneiden. Dann hält er die Leiche als Kugelfang vor sich. So machen sie das.«
Dex fuhr fort: »Wir müssen uns beeilen. Ich habe so eine Ahnung, dass dieser Schleiertanz – ohne Schleier – gleich zu Ende sein wird. Die Apachen schauen nicht mehr lange nur zu. Sie wollen etwas anderes. Wir kommen nicht viel näher heran, ohne dass sie uns bemerken. Apachen haben einen sechsten Sinn für Feinde und Gefahr.«
»Ich lenke sie zusätzlich ab«, bot Stevens sich an. »Ich schlage einen Bogen und nähere mich von der Seite. Ich lege meinen Revolvergurt ab und lasse das Gewehr bei euch. Einen Colt stecke ich hinten in den Gürtel. Dann werden sie mich für waffenlos halten und herankommen lassen. So lange fallen sie nicht über die Blonde her. Ihr könnt in der Zeit näher heranschleichen.«
»Darauf fallen sie nicht rein«, sagte Dex überzeugt. »Wenn du näher bist, noch bevor du Revolverschussweite erreichst, werden sie verlangen, dass du dich umdrehst und die Hosenbeine hochhebst, damit sie sehen, dass du keine Revolver in die Stiefel gesteckt hast. Nein, das muss anders gehen.«
»Wie?«
»Du musst das machen, Blade. Dich waffenlos zeigen, zum Feuer taumeln, scheinbar völlig erschöpft«, sagte Dex. »Sie werden dich rankommen lassen, wenn sie dich für waffenlos und völlig am Ende halten.«
»Wenn du dich nur mal nicht irrst«, erwiderte der Boxer. »Warum sollten sie mich nicht mit Pfeilen spicken, statt mich in ihre Nähe zu lassen?«
»Weil sie sich nicht um den Spaß bringen wollen, dich grausam zu Tode zu martern.«
»Hm. Und wenn sie mir, bevor ich bei ihnen bin, schon einen Pfeil ins Bein oder in jedes Bein jagen?«
»Ein wenig Risiko ist immer dabei, sagte der Puma, als er dem galoppierenden Mustang auf den Rücken sprang. Machst du es, oder machst du es nicht?«
Als Donahue schwieg, fügte er hinzu: »Wenn du bei ihnen bist und wir näher heran sind und zu schießen anfangen, kannst du was ausrichten. Sogar vorher schon mit deinen Boxerfäusten. Wir sind dann nahe genug heran, denke ich.«
»Du denkst«, grinste Donahue. »Mein Opa sagte immer: Der Cowboy dachte, er müsste nur einen Furz lassen. Dabei hat er sich voll in die Hose geschissen.«
»Ich kann dich nicht zwingen«, sagte Dex. »Denk an die Frau – an die Toten bei der Kutsche nach Yuma.«
Donahue antwortete: »Ich boxe nicht mehr, seit ich am Missouri bei meinem letzten Preiskampf einen Mann totschlug. Meinen Gegner, Bull Iron, einen Schwarzen. Er war ein guter Mann, ein fairer und anständiger Kämpfer. Er hatte eine Frau und drei Kinder. Ihnen habe ich den Vater und Ernährer genommen – und ihm das Leben. Ich habe mir geschworen, meine Fäuste nicht mehr zu gebrauchen.«
»Das ist kein Boxring.«
»Überhaupt nicht mehr. Meine Fäuste sind Waffen.«
»Wie schon gesagt«, erwiderte Dex. »Ich kann dich nicht zwingen. Dann gehe ich – waffenlos. Du bist ein guter Kämpfer, Kyle, aber ich bin mir sicher, im Nahkampf ohne Waffen bin ich eine Klasse besser als du. Ich gehe, ihr schleicht euch heran. Und du, Blade, siehst zu, dass du genau und schnell schießen kannst mit deinen Boxerfäusten, die keinem mehr ein Leid zufügen sollen.«
Donahue senkte den Blick.
»Okay, Dex, du hast mich überzeugt. Du hast eine Art, ich muss schon sagen. Ich gehe. Und ich haue zu, dass kein Gras mehr wächst, wo ich hinschlage.«
»Tu das, du Bulle. Und schauspielere gut. Sie müssen dir den Erschöpften abnehmen, der auf dem Zahnfleisch geht. Wir halten uns ran, Boxer.«
»Nenn mich nicht Boxer, du texanischer Strolch und ehemaliger Texas Ranger und Galgenstrick. Ich gehe los.«
Er legte die Waffen ab und zog einen Stiefel aus.
»Was soll das denn werden?«, fragte Stevens.
»Wonach sieht es denn aus? Wenn ich mit nur einem Stiefel heranstolpere, sieht es echter aus.«
»Wo sollst du denn einen Stiefel verloren haben?«
»Wie das zuging, werden sich die Apachen auch fragen. Und es von mir wissen wollen. Der Mensch ist neugierig und weiß gern Bescheid.«
Mit nur einem Stiefel huschte er geduckt zur Seite und schlug einen Bogen. Dex und Kyle Stevens warteten eine gewisse Zeit. Dann wollten auch sie sich in Bewegung setzen.
»Der Boxer mit seiner zwei Finger hohen Stirn ist intelligenter, als wir dachten«, sagte Stevens. »Und Sprüche hat er drauf!«
Dex küsste die Patrone, die er unterm Hemd an einer Lederschnur trug. Sie war sein Talisman. Ein Bandolero hatte sie ihm in den Kopf schießen wollen. Es wäre Dex' sicherer Tod gewesen; ihm blieb keine Chance zur Gegenwehr.
Doch der Revolver des Mexikaners hatte versagt. Ausgerechnet als er abdrückte, klemmte der Mechanismus. Dann waren Dex' Rangerkameraden zur Stelle gewesen und hatten den Bandolero erschossen.
Seitdem trug Dex diese Patrone um den Hals, eingekerbt, damit die Lederschnur hielt. Sie sollte ihm Glück bringen.
✰
Lorna Cabot hatte das Grauen erlebt und Todesangst ausgestanden, als die Apachen die Kutsche überfielen und sie herauszerrten. Den Revolver hatte sie nicht mehr aus der Handtasche holen können. Zu schnell war alles gegangen – ein im Handstreich ausgeführter Überfall, Schüsse und sirrende Pfeile.
Der Weg war blockiert gewesen.
»Brrrrr!«, schrie der Kutscher.
Das war das Letzte, was er jemals schrie. Den Shotgun sprang ein Apache mit einem wahren Tigersprung von einem hohen Stein aus an und riss ihn vom Bock. Heulende Apachen umringten die Kutsche.
Ein Fahrgast war bereits tot. Ein Pfeil hatte ihm die Gurgel durchbohrt. Der mitreisende Spieler schnickte seinen Derringer aus dem Ärmel, eine lächerliche Geste gegen eine Horde Apachen.
Damit konnte er am Spieltisch etwas erreichen, hier jedoch nicht. Er schoss, doch in seiner Panik traf er mit der kleinen und kurzläufigen Waffe nicht. Dann hackte ein Tomahawk ihm in die Hand. Er wurde ergriffen. Vier Zugpferde wurden getötet, zwei ausgeschirrt. Apachen aßen gern Pferdefleisch und verschmähten Maultiere nicht.
Die Legende besagte, dass sie sogar Gila-Echsen, Skorpione und Klapperschlangen verspeisten. Auch anderes noch; Gourmets waren sie nicht. Lorna wurde gefesselt, abgetastet und betatscht. Sie stand Todesängste aus beim Anblick der grausamen, brutalen, bemalten roten Gesichter.
Sie erlebte das grausame Ende des Shotguns und des Spielers mit. Er hatte sich ihr in Tucson gentlemanlike vorgestellt.
»Ike Turnshaw aus Baton Rouge in Louisiana.«
Er hatte von sich erzählt, ein charmanter und weltläufiger Mann, aus guter Familie stammend, auf einer Baumwollplantage mit einem Heer von Sklaven und mit einem goldenen Löffel und Mund geboren. Dann starb er schreiend und wimmernd an einem Saguaro, aufgespießt und gebunden, einen schrecklichen Tod.
Die Apachen steckten die Kutsche in Brand, nachdem sie das Gepäck geplündert hatten, und führten Lorna und zwei der Pferde weg. Der Rest blieb für Kojoten und Geier.
Lorna wurde weggeschleppt, ein ganzes Stück von der Überlandstraße und der Kutsche entfernt. Fratzenhaft verzerrte, bemalte Gesichter umgaben sie. Dann schlugen die Apachen ihr Lager auf, entzündeten ein rauchloses Feuer und verzehrten den mitgebrachten Proviant.
Lorna warfen sie ein paar Brocken zu. Sie aß nichts, trank aber Wasser. Über ihr Schicksal war sie sich gewiss. Sie wusste, was Apachen mit gefangenen weißen Frauen anstellten. Schaudernd sah sie die frischen, noch bluttriefenden Skalpe an den Gürteln der Apachen.
Sie bemerkte die lüsternen, gierigen Blicke, mit denen die Mescaleros sie anschauten. Lorna war vierundzwanzig Jahre alt und kein Kind von Traurigkeit. Sie hatte viel erlebt, sich als Spielerin und Saloon-Lady durchgeschlagen und war zuletzt aus Tucson fortgejagt worden. Die Tugendharpyen vom Frauenverein hatten Anstoß daran genommen, dass sie angeblich ihren Ehemännern die Köpfe verdrehte.
Dabei war Lorna mit keinem davon intim gewesen; im Gegenteil hatte sie reihenweise Zudringlichkeiten und Angebote abgelehnt. Doch gegen die Gerüchteküche kam sie nicht an.
Harriet Overstone, die damenbärtige Vorsitzende des Frauenvereins, und andere setzten sie persönlich in die Postkutsche. Der geplagte Sheriff von Tucson musste Beihilfe leisten.
Die Apachengefahr war in Tucson noch nicht so bekannt. Es gab Gerüchte, Cochise wäre von Mexiko herübergekommen und auf dem Kriegspfad. Doch man glaubte es noch nicht so recht; ein solches Gerücht hatte schon mehrmals die Runde gemacht.
Dass es diesmal anders aussah und der gefürchtete große Häuptling einen triftigen Grund hatte, wutschnaubend über den Rio Grande zu kommen und Mord und Totschlag zu entfachen, wurde in Tucson erst nach der Abfahrt der Kutsche nach Yuma bekannt.
»Euch soll alle der Teufel holen, ihr Gewitterziegen!«, hatte die temperamentvolle Lorna bei der Abfahrt aus dem Kutschenfenster gerufen. »Bei eurem Anblick wird ja die Milch sauer! Da braucht ihr euch nicht zu wundern, wenn eure Männer fremdgehen wollen. Ich habe keinen von diesen Böcken an mich rangelassen. Ihr solltet euch schämen, mich der Stadt zu verweisen.«
Die Tugendwächterinnen hatten ihr Schandweib und Ähnliches hinterhergerufen. Dann war die Kutsche nach vielen Meilen und ein paar Wechselstationen von Apachen überfallen worden. Die Ladies von Tucson hätten das, so weit es Lorna Cabot betraf, als gerechte Strafe des Himmels bezeichnet.
Was die anderen in der Kutsche anging, nicht. Lorna schaute sich die Apachen an. Sie beendeten ihre Mahlzeit; einen Skunk hatten sie auch gebraten, vorher die Stinkdrüse entfernt. Jetzt wischten sie sich die fettigen Finger ab und wollten zu dem Teil übergehen, auf den sie sich schon ungeheuer freuten und der sie erregte.
Lorna zu vergewaltigen. Sie wusste sich nur einen Rat. Den Anführer hatte sie mittlerweile erkannt; Enkimenzin hieß er. Ein mittelgroßer, stämmiger, etwas dickleibiger Apache.
Er hatte Lornas Sonnenhut aufgesetzt, den er dem geplünderten Gepäck entnommen hatte. Auch der Petticoat stammte aus Lornas Koffer. Die Reizwäsche indessen war für ein Modegeschäft in Yuma bestimmt. Die hatten sich die Apachen ebenfalls angeeignet, um sie ihren Squaws zu geben. Mal etwas anderes, um Stimmung in den Wigwam zu bringen.
Die Sonne stand tief. Ein milder und warmer Wind wehte. Lorna sah nur eine Chance, um der Massenvergewaltigung zu entgehen und zu überleben. Denn sobald sie sie mehrfach geschändet und übel gedemütigt und misshandelt hatten, würden ihr die Apachen die Kehle durchschneiden – wenn sie Glück hatte.
Sonst starb sie einen schlimmeren Tod. Mit ihrem langhaarigen blonden Skalp würde ein Krieger bei seiner Squaw prahlen.
Sie musste Enkimenzin für sich gewinnen, ihm derart in die Augen stechen und ihn reizen, dass er sie für sich allein haben wollte. Das war ihre einzige Chance.
Lorna präsentierte sich also, als die Apachen Anstalten machten, über sie herzufallen. Sie winkte ihnen zu, lächelte Enkimenzin an und schenkte dem Unterhäuptling heiße Blicke.
Die Apachen hielten inne, als Lorna sich reizvoll bewegte und strippte. Sie war mal bei einer Tanztruppe gewesen und verstand es, sich zu bewegen.
Die Indianer hockten sich also nieder, klatschten rhythmisch und gafften. Fast fielen ihnen die Augen heraus. Ihre Lendenschurze und Hosen beulten sich aus beim Anblick der nackten Reize.
Lorna tanzte und wand sich, wiegte sich hin und her. Wackelte mit dem Po und zeigte tiefe, intime Einblicke. Sie bewegte die Hüften vor und zurück, ging hin und her, bückte sich und spreizte die Beine.
Besondere Aufmerksamkeit widmete sie Enkimenzin und umschmeichelte ihn. Sie rieb sich sogar an ihm. Er fasste sie an, zeigte jedoch kein Interesse, sie für sich allein zu beanspruchen.
Lorna wurde immer verzweifelter. Sie nahm sich zusammen, um nicht in Panik zu verfallen. Sie überlegte, ob sie den Unterhäuptling aufstehen lassen sollte, ihm gar die Leggins herunterziehen und sich ihm mit dem Mund widmen sollte. Doch das versprach auch nicht viel.
Lornas Herz hämmerte. Enkimenzin schaute sich ihren heißesten Strip an. Doch er traf keinerlei Anstalten, alleinigen Anspruch auf sie zu erheben.
Ursprünglich war ein Wächter beim Camp aufgestellt worden. Doch der hatte sich den anderen hinzugesellt, um das Schauspiel zu genießen. Von den übrigen Apachen war nicht zu erwarten, dass einer Lorna für sich beanspruchte.
Dann war es so weit. Enkimenzin erhob sich und nestelte am Band, das seine Leggings um die Hüften hielt. Ein frischer Skalp hing daran. Er sagte etwas in der Sprache der Apachen.
Die Krieger standen alle auf und umringten Lorna. Jetzt bedeckte sie ihre Blöße.
In gebrochenem Englisch redete Enkimenzin zu ihr: »Jetzt bist du dran, weiße Squaw. Ich werde der Erste sein.«





























