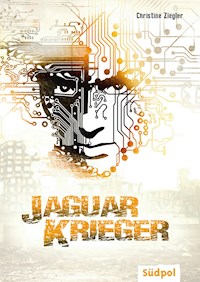
17,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Südpol Verlag
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
»Was für ein tolles Buch! ... Die Geschichte von Will hat mich tief berührt.« Karin, amazon-Rezension Der große Krieg liegt mehr als 20 Jahre zurück. Berlin ist weitgehend zerstört - bis auf das Areal von Sektor 1, das den Reichen vorbehalten ist. Der 16-jährige Will schlägt sich als illegaler Computerspieler durch. Als "Rückläufer" – genoptimiert und aussortiert, da er den Vorstellungen seiner Eltern nicht entsprochen hat – verfügt er über extrem schnelle Reflexe. Er ist der Anführer der Jaguarkrieger, einem Gamer-Clan, der vor allem von der armen Bevölkerung verehrt wird. In den Geisterhäusern der Vororte findet er zusammen mit seinen Freunden Unterschlupf. Als ihn die Sicherheitsbeamten aus Sektor 1 in die Enge treiben, muss Will in die aufgegebenen Gebiete fliehen, wo er auf Mia trifft. Kann Will ihr vertrauen? Ihm bleibt nicht viel Zeit, das herauszufinden, denn die Jagd auf ihn geht gnadenlos weiter … - Packender Jugendroman mit realistischem Zukunftsszenario: Zwischen illegalen Computerspiel-Wettkämpfen und täglichem Überlebenskampf - Aktuelles Thema Perfektionismus: Kinder werden auf Bestellung genetisch optimiert und bei Nichtgefallen zurückgegeben - Besonders hochwertige Ausstattung: Hardcover mit Schutzumschlag, Lesbändchen und Goldprägung Stimmen zu "Jaguarkrieger": »Ein toller dystopischer Jugendroman, der mir sehr viel Spaß gemacht hat. Etwas Liebe, etwas Spannung und eine super Idee.« Nichtohnebuch-Blog »Dieser Pageturner garantiert ein spannendes Leseabenteuer und lädt nebenbei zur Reflexion ethischer und gesellschaftspolitischer Fragen ein.« boys & books e.V. »Starke Identifikationsfigur für Jungs, unabhängig, stark, selbstbewusst; dazu Computer, Abenteuer, Action.« Jungenleseliste, MANNdat e.V. »eine spannende und vielseitige Geschichte schwungvoll und packend erzählt.« Claudia Kürten, Buchhandlung für ausgesuchte Literatur Ulrich Klinger
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 324
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Originalcopyright © 2018 Südpol Verlag, Grevenbroich
Autorin: Christine Ziegler
Umschlaggestaltung: Corinna Böckmann
E-Book Umsetzung: Leon H. Böckmann, Bergheim
ISBN: 978-3-943086-84-3
Alle Rechte vorbehalten.
Unbefugte Nutzung, wie etwa Vervielfältigung, Verbreitung, Speicherung oder Übertragung, können zivil- oder strafrechtlich verfolgt werden.
Mehr vom Südpol Verlag auf:
www.suedpol-verlag.de
1. Kapitel
„Will, du kennst die Firma. Die schrecken vor nichts zurück.“
Der Angesprochene kniff die Augen zu schmalen Schlitzen zusammen. Das war die einzige Reaktion, die er sich im Moment erlauben konnte. Er und sein Team waren in der entscheidenden Endschlacht. Jetzt war volle Konzentration gefragt. Jeder Fehler gefährdete den Erfolg der Mission.
Tom war in Wills Zimmer geplatzt und hatte ihm einen Stapel ungeöffneter Briefe auf den Schreibtisch neben die Computertastatur geworfen. Seitdem versuchte er, die Aufmerksamkeit seines Mitbewohners auf sich zu ziehen. Er scharrte mit den Füßen, räusperte sich und knackte mit den Fingerknöcheln.
„Will, könntest du jetzt mit diesem Schwachsinn aufhören und mir zuhören“, forderte er ungeduldig. Seine Stimme zitterte.
Ohne die Augen vom Bildschirm zu lösen, schüttelte Will leicht den Kopf. Die Finger seiner linken Hand flogen über die Tastatur. Mit der rechten Hand steuerte er die Maus präzise mit minimalen Bewegungen. Schussgeräusche und Detonationen waren nicht zu hören, nur das permanente Klackern der Tasten. In dem abgedunkelten Raum brannte eine einzelne Kerze. Will spielte nie ohne Kerzenlicht.
Dieser Schwachsinn, dachte Will, sichert euer Überleben. Schließlich lebt ihr von meinen Preisgeldern. Ohne Training kein Erfolg, kein Geld, kein Essen. So einfach war das. Außerdem konnte er seine Clanmitglieder nicht einfach im Stich lassen, nur weil Tom mit ihm ein Gespräch über die Firma und mögliche Gefahren führen wollte. Zu Optigenio war in seinen Augen alles gesagt. Er hatte sich mehr als ausgiebig mit dem Vorgehen der Biotechnologiefirma beschäftigt, die ihrer aller Leben ruiniert hatte. Er wusste, dass Rückläufer, wie sie es waren, auffallend oft unter ungeklärten Umständen ums Leben kamen. Das war seit Beginn des Programms so. Aber wen kümmerte das schon? Wer interessierte sich für Verlierer? Für sie gab es keinen Schutz. Daher versteckten sie sich in der aufgegebenen Zone und blieben soweit wie möglich unsichtbar.
Mit den Leuten von Optigenio wollte Will nichts mehr zu tun haben. Nie mehr. Je weniger er von ihnen erfuhr, desto besser. Sein altes Leben war Geschichte, verblassende Erinnerung, und das sollte so bleiben.
„Du musst tun, was die wollen. Sonst finden sie uns“, drohte Tom.
Wie ein quengelndes Kleinkind, dachte Will genervt und wechselte seine Bewaffnung. Er brauchte jetzt ein Präzisionsgewehr, eine Scharfschützenwaffe. Am besten wäre es, in Deckung zu bleiben. Jammern war alles, was Tom konnte.
„Kämpf endlich“, sagte Will leise.
„Gib mir Deckung!“, war aus seinem Headset zu hören.
„Wird gemacht“, erwiderte Will und folgte seinem Mitspieler. „Ich nehm den Linken. Knall du den Typen auf dem Dach ab. Dann holen wir uns die Kiste und ziehen uns über die Brücke zurück. Sonst geraten wir in einen Hinterhalt.“
Will war Clanführer und trainierte täglich mit seinem Team. So oft es ging, versuchten sie in einem LAN-Room gemeinsam zu spielen. Wenn das nicht möglich war, verabredeten sie sich online, so wie heute.
„Ich war bei der Post.“
„Mal wieder. Was du dort überhaupt willst. Wer soll dir schon schreiben?“ Will hielt den Atem an. Er hatte einen Gegner übersehen.
Post wurde schon lange nicht mehr persönlich zugestellt, sondern an eine mehr oder weniger nahegelegene Poststation adressiert. Dort holte man die Sendungen ab. Falls es überhaupt funktionierte. Manchmal brauchte ein Brief Wochen, bis er sein Ziel erreichte. Mit Paketen lief es noch schlechter. Sie wurden meist geplündert oder verschwanden spurlos.
„Ich mach das mit der Post nur, weil du dich nie um deine Angelegenheiten kümmerst.“
Will hatte einen Fehler gemacht. „Verzieh dich“, murmelte er angespannt.
Tom tat so, als hätte er ihn nicht gehört. „Dort habe ich Rainer, unseren ehemaligen Erzieher, getroffen“, berichtete er. „Aus dem Heim.“
Als ob ich nicht wüsste, wer Rainer ist, dachte Will und ärgerte sich gleichzeitig, weil er sich von Tom ablenken ließ. Gerade hatte er einen Treffer ins Bein kassiert. Seine Lebensanzeige war kürzer geworden. Rainer war in dem Kinderheim, in dem er mit Tom und den anderen drei Bewohnern dieses Hauses aufbewahrt worden war, einer der Sozialpädagogen gewesen, die für Ruhe und Ordnung sorgen sollten. Ein schleimiger Typ. Rainer hatte versucht, auf guter Kumpel und Vertrauter zu machen. Will hatte ihn noch nie ausstehen können.
„Will, verdammt, wo bleibst du? Ich bin gleich tot“, tönte die Stimme aus dem Kopfhörer.
„Dein Vater und die Firma suchen dich und die werden dich finden.“
Der Lüfter des Rechners brummte laut. Wills Lippen waren ein schmaler Strich. „Tom, halt einfach den Mund! Wenn ich jetzt sterbe, war die letzte Stunde umsonst.“
„Ja und?“, konterte Tom aufgeregt. „Wenn du mir nicht zuhörst, werden wir alle mit dir auffliegen und wer weiß, was dann mit uns passiert. Das kann dann wirklich unser Tod sein.“
Wo er recht hat, hat er recht, dachte Will. Wenn er sich noch länger ablenken ließ, wären sein Team und er verloren.
„Will, es geht um Optigenio. Wie du dich vielleicht erinnerst, sind das keine Freunde von uns.“
Der Feind hatte ihn erwischt. Sein Lebensbalken war verschwunden und seine Clanmitglieder beschwerten sich lautstark. Gereizt riss Will sich das Headset vom Kopf, knallte es auf den Schreibtisch, schaltete den Bildschirm aus und drehte sich mit dem Bürostuhl zu seinem ungebetenen Gast um. Im Zimmer war es jetzt still und dunkel. Nur die Kerzenflamme warf unruhige Schatten an die Wand.
„Warum konntest du nicht noch 15 Minuten warten, bis du mir deinen zusammenhanglosen Schwachsinn erzählst?“
Tom schaltete das Licht an und ließ sich auf das schmale Bett fallen, das neben dem Fenster stand.
„Wir haben verloren. Bist du jetzt zufrieden?“ Wills blaue Augen funkelten wütend. Er musterte seinen ältesten Freund, der vor Aufregung schwitzte. Tom war dick und unbeweglich. Mit seinem Pulloverärmel wischte er sich die fettig glänzenden Schweißperlen von der Stirn. Optigenio hin, Optigenio her. Es wurde Zeit, dass Tom sein Leben selbst in die Hand nahm und sich nicht länger von der Firma und den Erlebnissen seiner Vergangenheit abhängig machte. Er hatte noch vor seinem eigenen Schatten Angst. Ungeduldig wippte Will mit seinem linken Bein.
Optigenio war der Fluch ihrer Kindheit. Das Logo der Firma, eine Doppelhelix, war auf Toms Pullover gestickt. Will verachtete ihn dafür, dass er immer noch Firmenkleidung trug. In der Anstalt war jedes Kleidungsstück mit dem Zeichen der Firma und der persönlichen Objektnummer beschriftet gewesen. Wie sie selbst auch, dachte Will bitter. Alle Rückläufer bekamen bei der Ankunft im Kinderheim einen Ortungschip im linken Oberarm implantiert. Sorgfaltspflicht nannten sie es dort. Als ob sie hinter den hohen Sicherheitszäunen des abgesperrten Geländes hätten verloren gehen können. Es interessierte sowieso niemanden, ob sie lebten oder starben.
„Was ist passiert?“, fragte er, weil er wusste, dass Tom keine Ruhe geben würde, bis er ihm sein Erlebnis in allen Einzelheiten geschildert hatte. Das war schon immer so gewesen. Will kannte Tom, seit er selbst mit neun Jahren in das Kinderheim von Optigenio gebracht worden war. Tom lebte dort bereits seit seinem ersten Lebensjahr. Bei einer Vorsorgeuntersuchung war festgestellt worden, dass er an einer seltenen Stoffwechselstörung litt, einen angeborenen Herzfehler hatte und stark kurzsichtig war. Seine Eltern hatten ihn nach der Untersuchung nicht mehr abgeholt und so war das Kleinkind von der Arztpraxis direkt ins Kinderheim gebracht worden. Tom konnte sich nicht an seine Familie erinnern, hatte kein einziges Foto, wusste nicht einmal ihren Namen oder wo sie lebten, was in Wills Augen nicht das Schlechteste war.
Will hingegen erinnerte sich genau an seine Familie und hasste sie dafür. Wobei sich Wills Ablehnung auf seinen strengen Vater konzentrierte. Seine Mutter mit ihren wunderschönen roten Locken hatte er als liebevoll und gütig empfunden. Noch immer konnte er sich an ihren Geruch erinnern, süß wie blühende Rosen. Umso mehr hatte es ihn getroffen, dass seine Eltern ihn ohne Vorwarnung, wie einen kaputten Fernseher, an die Firma zurückgegeben hatten. Der Chauffeur des Vaters hatte ihn weggebracht. Will war damals arglos in die schwarze Limousine gestiegen, weil er gedacht hatte, er würde zum Schwimmunterricht gefahren. An der Kinderheimpforte musste er alle persönlichen Sachen aus seiner Herkunftsfamilie abgeben: eine goldene Halskette mit seinen Initialen, den Rucksack mit Handtuch und Badehose. Rainer hatte ihn am Eingang begrüßt und seine Hand geschüttelt. Wills bisheriges Leben war damit beendet. Sogar sein Nachname war ihm entzogen worden. Schnell hatte Will die Situation verstanden: Weil er den Qualitätsanforderungen seines Vaters nicht entsprochen hatte, war er entsorgt worden.
Vor über siebzehn Jahren hatten seine Eltern vermutlich ein Vermögen dafür bezahlt, dass Optigenio ihnen das fehlerlose Wunschkind, den perfekten Sohn produzierte. Offiziell hatte sich die Biotechnologiefirma auf Genveränderungen von Pflanzen und Tieren spezialisiert. Die Arbeit am menschlichen Erbgut war eine kleine, aber sehr lukrative Einnahmequelle der Firma. Ein exklusives Angebot für die Superreichen aus Sektor 1, das nicht nur medizinische Probleme löste. Alles war möglich. Sowohl Optigenio als auch die Kunden legten dabei größten Wert auf Geheimhaltung. Für jeden Kunden gab es ein maßgeschneidertes Angebot.
Will hatte nach der Lieferung Wilhelm von Krumm geheißen, benannt nach seinem Großvater väterlicherseits. Zumindest äußerlich hatte er sich prächtig entwickelt. Jedes Detail entsprach der umfangreichen Bestellliste: schwarze Haare, klare blaue Augen, ebenmäßige Gesichtszüge und ein sportlicher Körperbau.
Aber schon als Kleinkind war er überaus reizbar und sensibel gewesen. Der kleine Wilhelm hatte viel geweint, gelegentlich gestottert und hatte schwierige Worte bis zur Unkenntlichkeit verunstaltet. Während der Grundschulzeit war der Verdacht geäußert worden, Wilhelm sei Legastheniker. Außerdem war der Junge Bettnässer. Nicht einmal die strengsten Erziehungsversuche von Experten hatten ausgereicht, das Kind zurück in den Normbereich zu führen.
Christian von Krumm, Wills Vater, war enttäuscht. Der ehrgeizige, disziplinierte Mann duldete keine Mängel und Fehler. Er hatte gehofft, durch die Bestellung bei Optigenio seinen Traumsohn zu bekommen. Kurz nach Wilhelms zehntem Geburtstag reklamierte er das Kind. Erst im Nachhinein verstand Will, warum seine Eltern oft gestritten hatten. Es war um ihn gegangen. Seine Mutter hatte versucht, seine Reklamation zu verhindern. Doch Christian von Krumm war hart geblieben.
Auf Beschwerden und offensichtliche Qualitätsmängel reagierte die Firma stets äußerst kulant und diskret. Bis zum vollendeten zwölften Lebensjahr war es problemlos möglich, ein Kind zurückzugeben. Herr von Krumm hatte von dieser Vertragsoption Gebrauch gemacht. So war Will ein Rückläufer geworden.
„Rainer sagt, sie suchen dich schon seit Wochen. Aber da du nie deine Post holst oder einen Scheck der Firma einlöst, haben sie noch keine Spur von dir. Sie haben ein paar Leute vom Sicherheitsdienst auf dich angesetzt.“ Toms Stimme überschlug sich. „Profis! Will, das sind Profis.“
„Wenn bei Optigenio Profis arbeiten würden, würde es uns gar nicht geben“, gab Will sarkastisch zurück.
Tom wischte sich erneut den Schweiß von der Stirn.
Jetzt heult er gleich, dachte Will mitleidlos und wartete mit unbewegtem Gesichtsausdruck auf die Fortsetzung von Toms Bericht. Manchmal fragte er sich, warum er sich mit diesem Schwächling abgab.
„Dein Vater und die Firma brauchen dich. Wenn du dich meldest, wirst du eine großzügige Bezahlung erhalten, sagt Rainer.“
„Sagt Rainer“, äffte Will Tom nach. „Und das glaubst du? Weil Rainer immer die Wahrheit sagt und uns so lieb hat? Denkst du, die suchen mich, weil sie Sehnsucht nach mir haben? Weil sie mir was schenken wollen? Hast du dein bisschen Verstand mit der Post verschickt?“
„Rainer sagt, die tun dir nichts und zahlen gut.“
„Ihn vielleicht“, murmelte Will, der den Glauben an das Gute im Menschen längst verloren hatte. Moral war nur eine hohle Phrase. Die Realität war ein ständiger Überlebenskampf und dem musste sich jeder alleine stellen. Es gab nichts umsonst. Alles hatte seinen Preis.
Will war nicht käuflich. Geld lockte ihn nicht. Nie mehr würde er etwas von diesem Mann, der einst sein Vater gewesen war, oder der Firma annehmen und bestimmt würde er ihnen nie etwas geben. Das war vorbei. Als er das Kinderheim mit 15 verlassen durfte, hatte er nur die nötigste Kleidung, die er am Körper getragen hatte, mitgenommen. Er war gegangen, wie er gekommen war. Noch am gleichen Tag hatte er in Müllbergen andere Sachen gefunden und die milden Gaben von Optigenio verbrannt.
„Wenn die wollen, finden sie dich so oder so. Keiner kann sich vor ihnen verstecken. Nicht mal du.“ Tom hatte schicksalsergeben die Augen geschlossen und lehnte sich an die Wand.
„Bis jetzt haben sie mich in Ruhe gelassen.“ Intuitiv griff Will an seinen linken Oberarm, wo einst der Chip von Optigenio gewesen war. „Was wollen die plötzlich?“
„Sie haben sogar ein Kopfgeld auf dich ausgesetzt.“
Das war typisch, dachte Will. Optigenio war überzeugt, dass jeder und alles käuflich sei. Er gab Tom nur ungern recht, aber die Sache klang ernst.
„Und du meinst, ich soll da einfach mal vorbeischauen?“ Langsam bewegte Will seinen Zeigefinger durch die Kerzenflamme.
Tom nickte. „Wehr dich nicht. Du kannst nicht weglaufen. Die sind dir längst auf den Fersen. Geh hin. Mach, was sie wollen, und dann kommst du wieder zurück.“
Will ignorierte seinen Freund und dachte nach. Seit er sich erinnern konnte, kursierte im Kinderheim das Gerücht, dass die Firma immer wieder entlassene Rückläufer aufgriff und dabei über Leichen ging. Die Spekulationen wucherten wild. Manche behaupteten, dass Organspender gesucht wurden. Andere glaubten zu wissen, dass, sobald einer der Rückläufer über seine ehemalige Familie auspacken wollte, sein Leben keine 24 Stunden mehr dauerte. Von Unfalltod über Selbstmord bis zu allergischem Schock reichten die offiziellen Todesursachen. Will straffte die Schultern. Was auch immer die Firma tat oder wollte, keiner würde ihn finden. Er hatte sich von einem Arzt – wenigstens hatte der behauptet einer zu sein – am zweiten Tag in Freiheit den Chip von Optigenio aus seinem linken Oberarm entfernen lassen. Das kleine Implantat war übrigens eine der erfolgreichsten Entwicklungen der Biotechnologiefirma Optigenio und wurde sowohl Schwerverbrechern in Gefängnissen als auch Kindern von Privilegierten in Sektor 1 eingesetzt. Der Arzt hatte ewig gebraucht, bis er das winzige Teil gefunden hatte. Die örtliche Betäubung hatte nur unzureichend gewirkt. Aber der Schmerz während der improvisierten Operation war richtig gewesen, weil Will gefühlt hatte, dass die quälende Zeit seiner Abhängigkeit vorbei war. Er war nicht länger Eigentum der Firma oder eines Herrn von Krumm. Er gehörte nur noch sich selbst und war niemandem verpflichtet oder etwas schuldig. Keine fremden Erwartungen galt es mehr zu erfüllen, nur seine eigenen. Es war sein Leben. Darum würde er sich kümmern. Um nichts anderes. Mit einem notdürftigen Verband um seinen aufgeschnittenen Oberarm war er untergetaucht und hatte schnell die harte Realität außerhalb des Optigenio- Firmengeländes kennengelernt.
Der große Krieg lag zwar schon mehr als 20 Jahre zurück, aber die Welt war von der andauernden Wirtschaftskrise gezeichnet. Ganze Landstriche und Städte in Deutschland waren verödet. Die Bevölkerung hatte sich von den kriegerischen Auseinandersetzungen, die als namenlose Cyberattacke im Netz begonnen hatten, nicht erholt und schrumpfte beständig. Krankheiten, Arbeitslosigkeit und Armut prägten den Alltag der Überlebenden. Es gab mehr Wohnraum als benötigt wurde und das nutzte Will.
In den Geisterhäusern der Berliner Vorstädte fand er eine zeitweise Unterkunft. Alle paar Wochen zog er um, verwischte seine Spuren und richtete sich in einem neuen Haus wie in einem neuen Leben ein. Beim Computerspielen erreichte er schnell Profilevel. Er hatte im Heim fast jede freie Minute vor dem Bildschirm verbracht. Ab und zu nahm er an großen Wettbewerben teil, die eigentlich illegal waren, weil sie gegen das Versammlungsverbot verstießen. Aber wer sollte sie verhindern? Die Polizei schaffte es kaum, die Reichen zu beschützen. Trotzdem wurden immer wieder Wettkämpfe von der Polizei gestürmt. Daher waren die Spieler auf der Hut, schützten ihre Identität und traten nur maskiert auf. Und wenn Polizisten in die Halle einfielen, musste man schnell fliehen. Will war das bisher erst einmal passiert.
Von den gewonnenen Preisgeldern konnten er und seine Freunde sich mit Lebensmitteln und Computerzubehör versorgen. Das meiste bekamen sie auf dem Schwarzmarkt. Die Sachen dort waren entweder gestohlen oder auf Plünderungszügen in den unbewohnten Gebieten erbeutet worden. Bezahlt wurde cash.
Will führte ein einfaches, zurückgezogenes Leben. Er war diszipliniert und hart gegen sich selbst. Täglich ging er joggen und absolvierte ein umfangreiches Krafttraining, das er sich in einem amerikanischen Handbuch für Einzelkämpferausbildung abgeschaut hatte. Gut trainiert, fit und stark zu sein, war sein höchstes Ziel. Nie mehr wollte er schwach und abhängig leben. Über Gefühle, Ängste oder Befürchtungen sprach er nie. Dafür hatte er keine Zeit. Seit der Entlassung aus dem Heim war alles glatt gelaufen. Bis jetzt.
„Hast du Rainer gesagt, dass du Kontakt zu mir hast?“, fragte Will scharf.
Tom schüttelte den Kopf. „Natürlich nicht.“
Aber die Lüge war nicht nötig gewesen. Wo Will war, war auch Tom. Das war während ihrer ganzen Zeit im Kinderheim so gewesen. Tom hatte immer zu dem willensstarken, sportlichen Will aufgeschaut, der nur eine Woche älter war als er. Tom war auch der Erste gewesen, den Will bei sich aufgenommen hatte. Wochenlang hatte Tom nach Will gesucht, bis er ihn zufällig in einem staatlichen Supermarkt getroffen hatte. Dann waren andere Rückläufer aus dem Heim von Optigenio gefolgt. Inzwischen bestand ihre kleine Wohngemeinschaft aus fünf mangelhaften Ergebnissen der Genoptimierung.
Jeder hatte seine Aufgabe: Tom kümmerte sich um den täglichen Kram wie Kochen, Einkäufe und Ordnung halten. Der schwerhörige Lukas und Mark waren für die Technik zuständig. Sie suchten geeignete Häuser aus und reparierten sie soweit, dass sie kurzzeitig bewohnbar waren. Sie wussten, wo es genießbares Trinkwasser gab und wie man Stromleitungen anzapfte. Eine einigermaßen zuverlässige Stromversorgung war für den Computerspieler Will besonders wichtig. Die offizielle Versorgung war störanfällig und unzuverlässig. Manchmal funktionierte das Netz nur für wenige Stunden am Tag. Manchmal blieben ganze Regionen unversorgt. Für die Reichen und die Regierung galt das natürlich nicht.
Lukas war Energieprofi. Immer hatte er einen Satz Schraubenschlüssel in der Hosentasche und ölverschmierte Hände. Er schraubte alte Solar- oder Photovoltaikkollektoren von Dächern und baute sie wieder auf. Für Will hatte er ein ohrenbetäubend lautes Dieselaggregat besorgt. Seitdem war es für Will leichter, sein tägliches Übungspensum am Computer zu erfüllen. Alle professionellen Spieler waren in der Stromversorgung autark. Kraftstoff war zwar teuer, aber Will verdiente gut.
Mark hatte einen verkrüppelten Fuß. Er war wie Will ein begeisterter Spieler, hatte aber nicht Wills schnelle Reaktionsfähigkeit und Reflexe. Daher nahm er nicht an Wettkämpfen teil, sondern kümmerte sich um die notwendige Hardware und andere Computerfragen. Das frühere, globale Internet gab es nicht mehr. Der Datenverkehr im Netz wurde vom Staat überwacht und war stark eingeschränkt. Daher unterhielten die Spieler eigene Server und Netzwerke.
Sowohl Mark als auch Lukas hatten auf dem Schwarzmarkt einen Geigerzähler ergattert und konnten damit umgehen. Das war lebenswichtig. Immer noch gab es um Berlin stark verstrahlte Bereiche, wo radioaktiv verseuchtes Erdreich oder belasteter Schutt entsorgt worden waren. Die Regierung hatte darüber nie offizielle Daten veröffentlicht und so lebten viele Menschen inmitten der unsichtbaren Gefahr.
Henry war der Jüngste und erst vor wenigen Wochen entlassen worden. Er tat nichts. Tagsüber streifte er durch verlassene Häuser und Wohnungen, sammelte Bücher und Zeitschriften und las. Beim Abendessen erzählte er davon. Dann berichtete er von einer Welt, die sie alle nicht mehr kennengelernt hatten und die in ihren Ohren wie eine Zukunftsvision klang, obwohl sie längst vergangen war. Ihre Realität war nicht von Fort-, sondern von Rückschritt geprägt. Technische Entwicklung, medizinische Versorgung und Sicherheit gab es nur noch für die reiche Oberklasse, die in ihren eigenen Vierteln im Sektor 1 zurückgezogen lebte. Die soziale Schere war zerbrochen.
Will verbarg sein Gesicht in den Händen. Er fühlte sich müde. Was konnten die Firma und sein ehemaliger Vater von ihm wollen? Er hatte keine Ahnung, aber er war sich sicher, dass es nichts Gutes bedeuten konnte. Langsam richtete er sich auf, nahm die ungeöffneten Briefe von seinem Schreibtisch, riss sie auf und las einen nach dem anderen: 16 Schecks von Optigenio, die die Firma großzügigerweise ihren reklamierten Produkten spendierte und neun Aufforderungen, sich unverzüglich bei Herrn Dr. Hassler zu melden. Der Ton der Anschreiben steigerte sich von sachlich über fordernd bis drohend. Die erste Vorladung war vor fünf Wochen abgeschickt worden. Offensichtlich wollte Christian von Krumm mit ihm Kontakt aufnehmen. Über den Grund schwiegen sich die Briefe jedoch aus.
Will ordnete die Papiere, nahm ein Feuerzeug aus seiner Hosentasche und zündete Briefe und Schecks an.
„Das kannst du nicht machen“, schrie Tom. „Du musst wenigstens dort anrufen. Dein Vater will dich vielleicht treffen. Das sind doch gute Nachrichten.“
„Nichts muss ich. Nie mehr. Die Vergangenheit liegt hinter mir“, erwiderte Will und schaute zu, wie die Flammen das Papier auffraßen und seiner ruhigen Hand unersättlich näher und näher kamen. Dann ließ er die Briefe in einen alten Metalleimer fallen, wo das Feuer erlosch.
„Wenn der ehrenwerte Herr von Krumm etwas von mir will, wird er mich schon persönlich darum bitten müssen. Er kann nicht die Firma vorschicken.“ Seine Gesichtszüge waren hart und kalt wie die einer römischen Marmorstatue. „Aber dazu wird es nicht kommen. Er wird mich nicht finden. Ich werde nie mehr gehorchen und mich unterwerfen.“ Er betrachtete die Asche und fasste an seinen linken Oberarm, wo einst der Ortungschip gewesen war. Dort war in schwarzen Großbuchstaben sein Lebensmotto in die Haut gestochen: WILL RESIST.
Die wulstige Narbe war kaum verheilt gewesen, als er sich tätowieren ließ. So würde er nie vergessen, was er sich selbst geschworen hatte. Er würde nie aufgeben, nie nachgeben, nie mehr schwach, abhängig und hilflos sein.
„Ich hau ab“, stellte Will knapp fest.
„Was heißt hier, du haust ab?“ Tom schaute ihn fassungslos an.
„Genau das, was ich sage. Rainer und der ehrenwerte Dr. Hassler werden eins und eins zusammenzählen. Es war überaus schlau von dir, meine Post mitzunehmen und zu behaupten, du wüsstest nicht, wo ich bin. Vorher denken, dann reden!“
Beschämt schaute Tom auf seine großen Hände. „Aber außer dem bisschen Stromklau haben wir nichts angestellt. Was ist mit unserem Leben, das wir uns aufgebaut haben? Wir sind doch keine Verbrecher. Sie können uns nichts tun und außerdem ... Sie suchen nur dich“, flüsterte er leise.
„Und du führst sie mit deinem Ortungschip im Arm direkt zu mir. Mir ist egal, was die von mir wollen. Sicher ist nur, dass ich den Besuch nicht überleben würde. Ich mach mich aus dem Staub.“
„Wo willst du hin?“
„Weiß ich noch nicht. Erst mal weg.“
„Und was soll aus uns werden?“, fragte Tom. Bittend hob er die Hände.
„Das ist euer Problem und euer Leben. Ich rate euch, ebenfalls abzutauchen. Sucht euch eine andere Bleibe. Löst keine Optigenio-Schecks mehr ein. Du weißt es doch selbst, der Firma ist alles zuzutrauen und es ist egal, ob wir etwas angestellt haben oder nicht. Denen wäre es am liebsten, wir hätten nach der Heimentlassung ihre schäbigen Stellenangebote angenommen. Dann wären wir weiterhin kontrollierbar gewesen und früher oder später hätten sie uns unauffällig bei einem kleinen Betriebsunfall entsorgt. Bedauerlich. Aber kommt immer wieder vor.“
Will war aufgestanden und stopfte seine wenigen Besitztümer in eine Sporttasche. Über sein T-Shirt zog er ein schwarzes Kapuzensweatshirt. Will trug gerne dunkle, am liebsten schwarze Sachen. Dann startete er ein Eraserprogramm, um die Festplatte zu löschen. Er würde keine digitale Spur hinterlassen und seine Clanmitglieder gefährden.
Um absolut sicher zu gehen, baute er die Festplatte aus und zertrümmerte sie mit einem Hammer. Er war auf diese Situation vorbereitet. Zum Schluss blies er die Kerze auf dem Schreibtisch aus.
„Und ich dachte, wir wären Freunde“, brachte Tom mühsam hervor.
Will antwortete nicht. Freundschaften waren in seinen Augen etwas für Schwächlinge, die alleine nicht überleben konnten. Er zog die Schreibtischschublade auf und holte eine in ein schwarzes Tuch gewickelte Pistole heraus. Er lud sie und steckte sie in den Hosenbund. Dort, wo er hinwollte, war es gefährlich. Seinen Munitionsvorrat verstaute er zusammen mit einem Geigerzähler, gebündelten Geldscheinen und ein paar Goldmünzen in der Tasche.
Tom beobachtete ihn stumm. Tränen liefen über seine speckigen Wangen. Ohne Will würde er nicht lange durchhalten. Will war in seinem ganzen, bisherigen Leben der einzige Mensch gewesen, der ihn nie im Stich gelassen hatte. Bis jetzt.
„Mach’s gut. Mark und Lukas bekommen das schon hin. Ich lass euch die Hälfte des Bargeldes da. Damit kommt ihr die nächsten Monate über die Runden.“ Will vermied es, Tom anzuschauen. Eine Trennung war die einzige Möglichkeit, redete er sich ein und ging aus dem Zimmer. Die anderen würden auch ohne ihn zurechtkommen. Er war nicht ihr Kindermädchen. „Ihr lebt ohne mich sicherer. Wenn sie mich suchen, ist es besser für euch, wenn ich verschwinde.“
Will hatte die vergangenen eineinhalb Jahre gehofft, dass er die Schatten seiner Vergangenheit weit hinter sich gelassen hätte. Aber jetzt begannen sie, ihn einzuholen. Das würde er nicht zulassen. Niemals.
„Ich brauch dich aber“, flüsterte Tom. „Nicht nur, weil du das Geld verdient hast.“
Den letzten Satz hatte Will schon nicht mehr gehört und er hätte auch nichts an seiner Entscheidung geändert.
Siebzehn Jahre zuvor
„Das Produkt wird perfekt sein und Ihre Erwartungen bei weitem übertreffen“, versprach der wortgewandte Abteilungsleiter im grauen Anzug mit tadellos gebundener Krawatte und protzigen Manschettenknöpfen. Sein aufdringliches Aftershave roch für einen Mann ungewöhnlich blumig und lieblich. Das gestärkte Hemd mit dem steifen Kragen war strahlend weiß.
Wie wohl seine Weste und sein Gewissen ausschauen, dachte Leonie von Krumm und ließ ihren Blick auf dem abstrakten Gemälde ruhen, das hinter dem ausladenden Schreibtisch an der Wand hing.
Rote, blaue und gelbe Farbflächen kämpften um die Vorherrschaft auf der Leinwand und um die Gunst des Betrachters. Entschiedene schwarze Striche durchschnitten die Komposition, als wollten sie das Bild in kleine Teile zerlegen. Die klare Märzsonne erhellte das großzügige Büro unerbittlich und schuf harte Kontraste.
Mit leutseligem Blick beugte sich der Mann jetzt über den Schreibtisch und sah ihrem Mann Christian ernst in die Augen. „Sollten Sie wider Erwarten unzufrieden sein ...“
Leonie rutschte auf der Sitzfläche ihres unbequemen, kalten Ledersessels unwillkürlich so weit wie möglich zurück.
„... und das Produkt weist Mängel auf, scheuen Sie sich nicht, mit uns Kontakt aufzunehmen. Optigenio regelt diese Dinge für Sie.“
Christian nickte knapp. „Ich hoffe, das wird nicht nötig sein, Dr. Hassler.“
„Davon gehe ich aus“, bestätigte der graue Mann vor dem bunten Bild. „Aber manchmal, äußerst selten natürlich, treten kleine Störungen auf. Nennen wir es unvorhersehbare Komplikationen. Wir beschäftigen für solche Fälle ausgezeichnete Ärzte und Therapeuten, die Ihnen jederzeit zur Verfügung stehen. Rund um die Uhr.“
„Es wird alles gut gehen“, sprach sich Leonie selbst Mut zu.
Dr. Hassler faltete die Hände wie im Gebet und fuhr fort: „Unser Service geht weit über die vertraglich geregelte Gewährleistung hinaus. Wir wollen, dass Sie uneingeschränkt zufrieden sind. Unser Angebot bleibt einem kleinen, sehr exklusiven Kundenkreis vorbehalten und über die Geschäftsbeziehung zwischen Ihnen und Optigenio herrscht absolute Schweigepflicht. Vor allem wo wir doch alle wissen, dass das Thema in der Öffentlichkeit ... sagen wir mal kontrovers diskutiert wird.“ Sein Blick ließ von Christian ab und wanderte zu Leonie. Mit einem schmalen Lächeln versprach er ihr: „Sie werden mit Ihrem perfekten Wunschkind rundherum glücklich sein. Das ist unser oberstes Ziel.“
Leonies Gesichtszüge waren eingefroren, genauso wie ihr Herz.
„Schließlich geht es für Sie um einen perfekten Sohn, den optimalen Erben. Wer verstünde da nicht, dass man den Zufall so weit wie möglich eliminieren möchte. Immerhin steht die Leitung eines bedeutenden Familienunternehmens auf dem Spiel.“ Aufmunternd nickte er Christian von Krumm zu. „Umweltbelastungen und Kriegsfolgen wirken sich negativ auf das Erbgut aus. Die Zahl behinderter Kinder steigt stetig an. Dazu gibt es eindeutige Statistiken. Natürlich dürfen diese Zahlen nicht an die Öffentlichkeit gelangen. Das könnte zu Unruhen führen.“
Leonie hoffte immer noch, dass sie aus diesem Albtraum erwachen würde. Nervös spielte sie mit dem schimmernden Perlenanhänger an ihrer Halskette.
„Gehen wir die Bestellung noch einmal durch“, bot Dr. Hassler zuvorkommend an. Geschäftig schlug er eine dezent graue Aktenmappe auf und rückte die Blätter zurecht. „Ihre verehrte Gattin hat bereits im letzten Monat fünfundzwanzig wunderbare Eizellen gespendet, wenn ich das so sagen darf.“ Dabei strahlte er Leonie begeistert an, als hätte sie einen besonders leckeren Kuchen gebacken.
Leonie presste unbewusst ihre Handtasche an den Bauch und ihre Beine zusammen, weil sie nicht an den entwürdigenden Eingriff ihrer Eizellenernte erinnert werden wollte. Durch die Hormonbehandlung war sie aufgeschwemmt und gereizt gewesen, wie ein Zuchtlachs kurz vor der Eiablage.
„Sie, Herr von Krumm, haben vorgesorgt und Ihr Erbmaterial bereits kurz nach dem Krieg von uns einfrieren lassen. Eine weise Entscheidung. Ihr Sperma ist von ausgezeichneter Qualität, agil und gesund“, schmeichelte er ihrem Mann, der zufrieden nickte.
Das sagt er bestimmt noch zu einem 98-jährigen Greis, der einen Reaktorunfall aus nächster Nähe erlebt hat, dachte Leonie verbittert. Welcher Mann will schon hören, dass seine Spermien unbeweglich, geschädigt und träge sind?
„Das Labor hat bereits damit begonnen, Ihr ausgezeichnetes genetisches Material entsprechend Ihrer Bestellung zu optimieren. Wobei es bei Ihnen hauptsächlich darum geht, die gewünschten Eigenschaften zusammenzufassen. Oft sind ja im normalen Leben einige Versuche nötig, bis das Familienpotenzial ausgenutzt ist und dann verteilt es sich meist ungleich auf den Nachwuchs. Diese unerfreulichen Überraschungen werden Sie mit uns nicht erleben. Alle positiven und erwünschten Eigenschaften werden in einem Produkt zusammengefasst, somit wird das Kind das Beste aus Ihren Familien repräsentieren. Das ist das Wunderbare an unserem Verfahren. Gesundheitliche Risiken werden fast gänzlich ausgeschlossen.“ Er fixierte Leonie. „Gerade wo in Ihrer Familie doch eine bestimmte Veranlagung für Stoffwechsel- und Tumorerkrankungen vorliegt, ist das sehr empfehlenswert. Sie sind doch erheblich vorbelastet.“ Bedauernd schüttelte der Optigenio-Berater den Kopf.
Ungläubig schaute Leonie Dr. Hassler an. Wollte er damit sagen, dass ihr Erbgut ein Gesundheitsrisiko darstellte? Es stimmte natürlich, dass Katharina, Leonies jüngere Schwester an Diabetes litt. Und ihre Großmutter war mit 92 Jahren an Blasenkrebs erkrankt, jedoch an den Folgen eines Autounfalls gestorben. Über die gesundheitliche Konstitution ihrer restlichen Familienmitglieder konnte Leonie nur spekulieren, da sie im Krieg umgekommen waren.
Irgendetwas führt schließlich immer zum Tod, dachte sie trotzig.
Was sollte das hier werden? Christians Vater war mit fünfzig tot umgefallen, seine Mutter lebte wegen diverser psychischer Erkrankungen in einem Pflegeheim. Christians Bruder Richard hatte sich mit siebzehn Jahren erhängt. Der Großvater war an einem Schlaganfall gestorben. Ihr Mann selbst litt an erhöhtem Blutdruck, obwohl er erst 45 Jahre alt war, und seit dem Babyalter an Neurodermitis. Leonie hätte noch einige Krankheitsgeschichten aus der Familie ihres Mannes aufzählen können, konzentrierte sich aber wieder auf die Verlesung des Bestellzettels und blieb stumm.
„Kommen wir erst zu den äußeren Merkmalen. Männliches Geschlecht ist gewünscht. Größe zwischen 188 und 192 cm.“
Christian nickte. Er war der festen Überzeugung, dass große Männer sich leichter durchsetzen konnten. Die Gegenbeispiele wie Napoleon, Dschingis Khan oder Atilla, der Hunnenkönig, waren in seinen Augen nur Ausnahmen.
„Dunkelhaarig.“ Fast bedauernd betrachtete Dr. Hassler Leonies rote Locken, die ihr sanft ins Gesicht fielen. „Blaue Augen.“
Wenigstens die würde das Kind von seiner Mutter haben. Christians Augen waren haselnussbraun.
„Athletischer Körperbau“, stellte der Doktor an Christian gewandt fest, der von Kindheit an ein fanatischer Ruderer war. „Gesichtszüge, Nase, Ohren, Hände, Körperform und so weiter, wie abgebildet.“ Zuvorkommend reichte er ihnen ein Dutzend computergenerierter Hochglanzabbildungen ihres potenziellen Sohnes, wie sein Aussehen im Alter von 20 Jahren zu erwarten wäre.
Leonie hielt die Blätter in der Hand und musterte ratlos den gutaussehenden, jungen Mann, der ihr Sohn werden würde. Doch das erwartete Glücksgefühl wollte sich bei ihr nicht einstellen.
Sie freute sich zwar sehr auf die bevorstehende Schwangerschaft und auf ihr Baby, das sie anschließend in ihrem Arm wiegen würde. Sie freute sich auf Wilhelm. Selbst der Name des Babys stand schon fest, obwohl es noch nicht existierte. Lieber hätte sie sich jedoch überraschen lassen und das unbekannte Wesen in ihrem Bauch willkommen geheißen, als ein medizinisches High-Tech-Produkt eingepflanzt zu bekommen. Aber Christian hatte sich geweigert, eine Zeugung auf natürlichem Weg zu riskieren. Er wollte den optimalen Sohn, den tadellosen Erben. Das Risiko einer Krankheit, Behinderung oder anderweitigen Enttäuschung sollte ausgeschlossen werden, was Optigenio für sehr viel Geld versprach.
„Intelligenzquotient über 130 können wir garantieren.“
Soweit Leonie wusste, war das viel.
„Wie der Herr Papa wird der Filius willensstark und durchsetzungsfreudig sein. Da müssen wir nichts verbessern“, schmeichelte er Herrn von Krumm. „Mit ausgezeichneten Reflexen, Entschlusskraft und hoher Auffassungsgabe.“
Wäre Leonie mutiger gewesen, hätte sie nach den emotionalen Fähigkeiten ihres zukünftigen Sohnes gefragt. Würde er ein großes, gütiges Herz haben, voll Mitgefühl und Verständnis? Würde er musikalisch sein, gut zeichnen können, einen Sinn für die Schönheit der Natur entwickeln? Bei all diesen für ihren Mann scheinbar unnötigen und daher nicht vorgesehenen Dingen würde sie ihrem Kind helfen, sie zu entdecken.
„Wenn Sie bitte hier unterzeichnen“, forderte der Verkäufer sie auf.
Christian von Krumm griff entschlossen zum Füllfederhalter und setzte seine Unterschrift schwungvoll unter den Vertrag.
Leonie spürte, wie ihre Hände feucht wurden. Was tat sie ihrem Kind mit dieser Unterschrift an? Würde er ihr verzeihen, dass er von einer Firma hergestellt worden war?
Dr. Hassler und Christian schauten sie ungeduldig an und zögerlich stimmte sie dem Abkommen zu.
Wilhelm von Krumm war ein Wunschkind.
2. Kapitel
Will streckte seinen Kopf aus der aufgebrochenen Hintertür des einstigen Architektenbungalows, der inzwischen nur noch nach modrigem Holz und Mauerwerk roch. Die kühle Nachtluft war feucht und legte sich wie ein feiner, erfrischender Film auf sein Gesicht. Leise verließ er das Haus und verharrte einige Atemzüge unter einer mächtigen Platane.
„Es ist mein Leben“, flüsterte er.
Dann lief er los, sprang geschickt über den Gartenzaun und folgte der abfallenden Straße nach Süden.
Von den anderen Mitbewohnern hatte er sich nicht verabschiedet. Er durfte den Spitzeln der Firma keine wertvolle Zeit schenken. Außerdem wollte er sich für sein Handeln weder entschuldigen noch rechtfertigen müssen. Toms Heimweg nachzustellen, war vermutlich so einfach, wie der Spur eines Elefanten durch einen Porzellanladen zu folgen. Will wunderte sich, dass er überhaupt noch fliehen konnte. Aber wahrscheinlich brauchte der unfähige Rainer längere Zeit, bis er bei Optigenio einen Zuständigen erreicht hatte. Der Schnellste und Intelligenteste war dieser Sozialarbeiter noch nie gewesen.
Wie ein schwarzer Schatten bewegte Will sich zwischen den Gebäuden. Als wäre er mitten in einem Computerspiel, plante er seine Bewegungen auf einer virtuellen Karte in seinem Kopf. Bei seinen ausgedehnten, täglichen Joggingrunden hatte er sich die umliegenden Häuser und Straßenzüge eingeprägt.
Bis zum Morgengrauen musste er einen vorübergehenden Unterschlupf gefunden haben, denn er brauchte ab jetzt den Schutz der Dunkelheit. Die Firma würde jede Spur von ihm verfolgen. In den aufgegebenen Gebieten gab es zwar keine systematische Überwachung, da dort die Stromversorgung noch schlechter war als in den Städten. Von seinen Mitbewohnern, die ab und zu für Plünderungsaktionen in unbewohntes Gebiet vorgedrungen waren, hatte er jedoch gehört, dass die Regierung sporadisch unbemannte Drohnen einsetzte. Er selbst hatte noch keine gesehen. Aber Lukas und Mark prahlten gerne mit ihren Abenteuern und Will war sich daher nicht sicher, welche ihrer Geschichten wahr oder frei erfunden war. Auf jeden Fall musste er verdammt vorsichtig sein.
Während er durch die dunklen, verlassenen Straßen lief, ging ihm viel durch den Kopf. Öffentliche Plätze und belebte Viertel musste er meiden, da dort elektronische Systeme mit ausgefeilter Gesichtserkennung im Einsatz waren. Jede Nacht würde er ein Stück weiter von der Stadt wegkommen. Davonlaufen wollte er es nicht nennen. Dieses Wort ließ er in seinen Gedanken nicht zu. Er rannte.
Es begann zu dämmern. Der nahende Tag kündigte sich durch munteres Vogelgezwitscher und diffuses Licht an. Je weiter er sich von der Stadt entfernte, desto wilder wurde die Landschaft und desto weniger menschliche Spuren gab es. Nur noch einzelne Häuser schienen bewohnt. Einige waren von grünen Pflanzenvorhängen komplett überwuchert. Andere waren eingestürzt. Mauern zerfielen, Holz verfaulte. Wo einst Wiesen, Fußballplätze oder Gärten gewesen waren, wuchsen jetzt Büsche und Bäume.
Er war länger als drei Stunden schnell gerannt. Verschwitzt trabte er jetzt vor sich hin. Er musste runter von der Straße. Am Waldrand entdeckte er eine Reihenhaussiedlung. Die schmalen Häuser duckten sich dort zusammen, als würden sie sich gegenseitig stützen. Vorsichtig näherte sich Will den Gebäuden von der Rückseite. Die kleinen Gärten waren verwildert. Um rostige Schaukelgerüste wand sich Efeu. Teiche waren ausgetrocknet oder in schlammige Algenbrühen umgekippt. Will stieg über wackelige Zäune, wuchernde Hecken und erreichte einen Garagenhof. Durch den Asphalt und zwischen Pflastersteinen wuchsen Löwenzahn, hohes Gras und einzelne kleine Büsche. Die Natur begann, ihr Terrain entschlossen zurückzuerobern. Im Schutz einer vermüllten Garage, der das Tor fehlte, legte Will eine Pause ein. An die Betonwand gelehnt, lauschte er. Nur Vogelgezwitscher und Froschgequake waren zu hören. Von menschlichen Bewohnern fehlte jede Spur. Will entspannte sich. In einem der Häuser würde er ein gutes Versteck für den heutigen Tag finden. Erschöpft schloss er die Augen, wartete, bis sich sein Atem beruhigte und stellte seine Tasche ab.
Dann stockte sein Herzschlag. Jemand hatte sacht auf seine Schulter getippt.
Was hatte er übersehen? War er blindlings in eine Falle getappt? Er hielt die Luft an und spannte seine Muskeln. Optigenio benutzte Elektroschocker aus eigener Produktion. Will rechnete mit einem schmerzhaften Stromschlag. Egal. Er würde nicht kampflos aufgeben. Der Mann musste direkt hinter ihm stehen. Er würde ihn aus dem Gleichgewicht bringen. Unmerklich federte Will in den Knien ein und konzentrierte seine Kraft auf eine abrupte Drehung. Er schnellte herum und schlug mit voller Wucht zu. Er traf harten Gummi. Die Aktion dauerte nur Sekundenbruchteile. Donnernd fiel ein Autoreifenstapel um. Ein graues Fellbündel mit gelben Augen flog fauchend an seiner Wange vorbei. Will rieb sich die Faust. Er hörte seinen Herzschlag und lehnte sich an die Betonwand. Langsam rutschte er mit geschlossenen Augen in die Hocke.
Eine kleine Katze hatte ihn erschreckt! Er schüttelte über sich selbst den Kopf. Er war angespannt. Wenn er nicht aufpasste, würde er bald wie Tom wegen jeder Kleinigkeit überreagieren. Tom fürchtete hinter jeder Ecke einen Optigenio-Mitarbeiter. Er hatte Angst im Dunkeln, Angst vor Spritzen, Angst vor Schmerzen, Angst vor dem Alleinsein, Angst vor dem Leben. Wie mochte es ihm jetzt gehen? War er zusammen mit den anderen abgehauen?
Die graue Katze beobachtete Will aus sicherer Entfernung und putzte sich. Warum machte er sich Sorgen um die anderen? Alle, auch Tom, waren alt genug, um auf eigenen Füßen zu stehen. Freundschaft war ein verdammt sentimentales Gefühl. Er schulterte seine Tasche und überquerte den Hof, als er ein näherkommendes Motorengeräusch wahrnahm.
„Scheiße“, fluchte er und schaute sich um.
Der Garagenhof bot keine Versteckmöglichkeit und bis zum Waldrand oder den Häusern war es zu weit. Daher rannte er zur offenen Garage zurück, die eher eine Falle als ein Versteck war. Die gelben Augen der Katze folgten ihm. Autos fand man in den aufgegebenen Gebieten selten. Will kauerte sich hinter den umgefallenen Reifen auf den Boden. Der meiste Verkehr floss über die Autobahnen. Überlandfahrten, außerhalb der besiedelten Städte, waren aufgrund der schlechten Straßenverhältnisse schwierig und nur mit Sondergenehmigung möglich. So versuchte die Regierung, die Plünderei einzudämmen.
Will war klar, er hätte weiterrennen müssen. Der Abstand zu seiner alten Wohnung reichte nicht aus. Die Firmenmitarbeiter fahndeten vermutlich innerhalb eines geschätzten Suchradius’. Es blieb ihm nichts anderes übrig, als sich hier zu verstecken und zu warten.
Wie die Maus im Mauseloch, dachte er.

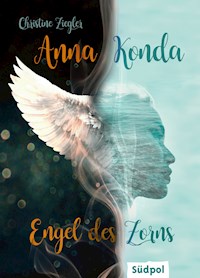


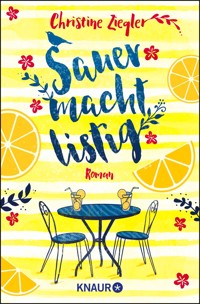














![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)









