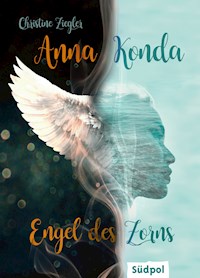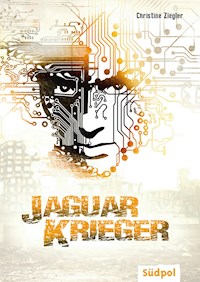15,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Südpol Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Anna Konda
- Sprache: Deutsch
Lovestory zwischen Licht- und Schattenwelt Halbengel Anna ist hin- und hergerissen zwischen ihrer Sehnsucht nach Leo, dem attraktiven Gehilfen Luzifers, und dem lebenslustigen Surfer Elias. Als beide nach Monaten zeitgleich zurückkommen, häufen sich seltsame Vorkommnisse im Kloster – der versiegelte Durchgang zur Unterwelt, der in der Krypta verborgen liegt, hat offenbar Risse bekommen. Bietet er noch ausreichend Schutz vor den Kreaturen der Hölle? Ein geheimnisvolles Zeichen scheint Anna einen Ausweg zu weisen. Doch von welcher Seite kommt es – Himmel oder Hölle? Anna weiß nicht mehr, wem sie trauen kann, aber sie wird ihre Familie mit all ihren Gaben beschützen, auch wenn sie sich dafür gegen Leo stellen muss … Romantisch, spannend und humorvoll – der zweite Teil der fesselnden Trilogie Engel der Finsternis ist der zweite Teil der fesselnden Romantasy-Trilogie "Anna Konda" von Christine Ziegler. Liebe, Spannung & Übernatürliches - eine romantische Geschichte im Spannungsfeld zwischen christlicher Mythologie und Realität, zwischen Engel und Teufel. Für Fans von Marah Woolf, Ava Reed und Kerstin Gier.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 399
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Originalcopyright © 2021 Südpol Verlag, Grevenbroich
Autoin: Christine Ziegler
Umschlaggestaltung: Corinna Böckmann
E-Book Umsetzung: Leon H. Böckmann, Bergheim
ISBN: 978-3-96594-103-8
Alle Rechte vorbehalten.
Unbefugte Nutzung, wie etwa Vervielfältigung, Verbreitung, Speicherung oder Übertragung,
können zivil- oder strafrechtlich verfolgt werden.
Mehr vom Südpol Verlag auf:
www.suedpol-verlag.de
Wieder für Anna
Engel haben Flügel.
Manche strahlen weiß,
andere schillern
tiefschwarz.
Michael und seine Engel erhoben sich, um mit
dem Drachen zu kämpfen. Der Drache und seine
Engel kämpften, aber sie konnten sich nicht
halten und sie verloren ihren Platz im Himmel.
Er wurde gestürzt, der große Drache, die alte Schlange,
die Teufel oder Satan heißt und die ganze Welt verführt.
Der Drache wurde auf die Erde gestürzt,
und mit ihm wurden seine Engel hinabgeworfen.
(Offenbarung, Kapitel 12, Vers 7-9)
Tagebucheintrag von Anna Konda am 2. Advent
Alle tun so, als wollten sie mich beschützen.
Aber wer ist eigentlich ehrlich zu mir? Wem kann ich trauen?
Ich spüre, wie durchlässig die Pforte zur Hölle inzwischen ist und das Böse sich mehr und mehr im Kloster zeigt.
Was, wenn der große Drache erwacht? Wird meine Kraft dann ausreichen?
Montag, 16. November
Er ist neben mir. Ganz dicht. Ich höre seinen Herzschlag. Und natürlich kann ich ihn riechen. Kalter Rauch kitzelt mich in der Nase und legt sich düster auf meine Zunge. Ich lasse meine Augen geschlossen, stelle mich schlafend und warte. Fast schüchtern spüre ich seine Lippen auf meiner Stirn.
Auch wenn die sachte Berührung meine Haut nur wie ein fallendes Blütenblatt streifte, traf mich seine Gegenwart wieder seelentief. Innerhalb eines Sekundenbruchteils saß ich senkrecht im Bett und schnappte nach Luft. Mein hellblauer Frotteeschlafanzug klebte nassgeschwitzt an mir. Mit einem Seufzer strich ich eine Haarsträhne aus dem Gesicht.
Seit meinem 17. Geburtstag quälte mich dieser Traum, der Nacht für Nacht ähnlich ablief. Wenn Leo mich so aufgewühlt sehen könnte, würde er bestimmt meine Vorliebe für Vampirromane dafür verantwortlich machen. Leo hasste die Blutsauger und hatte steif und fest behauptet, es gäbe sie wirklich. Ich las auf jeden Fall keine Vampirgeschichten mehr. Das war mir inzwischen zu unheimlich. Einen Teufel zu vermissen, war Abenteuer genug.
Trotz meiner dicken Bettdecke fror ich. Vor einer Woche hatte die altersschwache Zentralheizung des Klosters den Geist aufgegeben und lief nur noch im absoluten Notbetrieb. Daher war es in meinem Zimmer frostig kalt. Am Morgen blühten sogar Eisblumenfelder an den Fensterscheiben. In der Dunkelheit tastete ich nach einem frischen Schlafanzug, zog mich in Rekordgeschwindigkeit um und kuschelte mich wieder ein.
Im Morgengrauen weckte mich ein dumpfer Schlag gegen mein Dachfenster. Augenblicke später durchschnitt ein kehliger Schrei die klösterliche Stille. Erschrocken sprang ich auf und öffnete das Fenster. Am Himmel wirbelte ein schwarzes Federknäuel durch die Luft. Zwei ineinander verkrallte Raben stürzten lautlos auf den Boden zu.
Von wegen eine Krähe hackt der anderen kein Auge aus, dachte ich und stieg auf meinen klapprigen Hocker. Worum es bei dem Streit wohl ging? Um Futter? Den besten Schlafplatz? Oder wollten sie herausfinden, wer von beiden stärker war? Ich beugte mich aus dem Fenster, konnte aber aus meiner Perspektive nicht erkennen, ob die Vögel sich vor dem Aufprall voneinander gelöst hatten, hoffte es aber. Den beiden würde eine von Herrn Lis Lektionen zu Emotionskontrolle und Gewaltvermeidung guttun. Er erklärte mir gebetsmühlenartig, wie gefährlich Wut sei. Wobei unser Koch, der gleichzeitig mein Kampfkunsttrainer war, sich gegenüber den Raben selbst nicht im Griff hatte. Seit sich die schwarzen Vögel im Herbst auf dem Klostergelände eingenistet hatten, führte er sogar einen erbitterten Privatkrieg gegen sie. Anfangs hatte er versucht, sie mit glitzernden Gegenständen zu vertreiben. Inzwischen hatte er ein sogenanntes Knallschreckgerät installiert. Mich nervte das Ding, nur die Raben waren davon völlig unbeeindruckt. Sie saßen in den Ästen der kahlen Bäume, krächzten lauthals oder hüpften auf Futtersuche über die Obstbaumwiese. Manchmal durchwühlten sie sogar die Abfalleimer auf dem Schulhof. Schlaue Tiere, sie wussten genau, wo etwas zu finden war.
Wegen der arktischen Kälte zog ich meinen Anorak über den Schlafanzug und setzte eine Wollmütze auf. So schlurfte ich in die Küche.
»Hast du diese verrückten Vögel gesehen?«, fragte ich meine Mutter, die mir eine Tasse Kräutertee in die Hand drückte. Wie jeden Tag hatte sie bereits um sechs Uhr mit den Schwestern das Morgengebet, die Laudes, in der Kapelle gebetet. Ihre Finger waren eiskalt.
»Ja, sie sind ein böses Omen.«
Ich verdrehte die Augen. »Was für ein Unsinn. Sie sind Teil der Natur. Das ist alles.«
Meine Mutter schüttelte den Kopf. »Sie bringen Unglück. Wenn ein Rabe ans Fenster klopft, bringt er den Tod.«
Sollte ich ihr erzählen, dass ich genau davon geweckt worden war? Ob ein Aufprall überhaupt als Klopfen zählte? Vermutlich fände sie es so oder so nicht witzig und würde in Tränen ausbrechen. Daher ließ ich es bleiben und schnappte mir einen selbstgebackenen Schokokeks und stellte mich damit ans Fenster. Dabei spürte ich den Blick meiner Mutter im Rücken. Sie ließ die ungesunde Wahl meines Frühstücks unkommentiert. Kein Rabe war zu sehen. Der novembergraue Ausblick war trostlos.
»Das ist Aberglaube«, stellte ich fest.
»Nein, das ist die Wahrheit. Raben sind gefährlich. Dein Vater wollte es auch nicht hören. Als Junge hat er sogar versucht, sie zu zähmen. Und jetzt ...«
Ich drehte mich zu meiner Mutter um, die mit den Tränen kämpfte. »Und was?«
Sie antwortete nicht und räumte stattdessen Geschirr aus der Spülmaschine in die Küchenschränke.
»Und was?«, wiederholte ich meine Frage.
»Ist er tot.«
Ich gab auf und fragte nicht weiter. Seit mein Vater vor drei Jahren in der Kirche zusammengebrochen war, hatte meine Mutter nicht nur ihr Lachen, sondern offensichtlich auch ihren Sinn für logische Zusammenhänge verloren. Unsere kurzen Gespräche endeten seitdem oft in einer Sackgasse. Dass mein Vater versucht hatte, Raben zu zähmen, war mir neu. Aber es passte zu ihm, dass er sich nicht von altem Aberglauben und ein paar schwarzen Vögeln hatte einschüchtern lassen. Wie sehr ich ihn vermisste.
»Ich habe nach dem Gebet Herrn Li getroffen«, wechselte meine Mutter das Thema, »und soll dir ausrichten, dass das Morgentraining ausfällt. Er trifft sich mit einem Handwerker.«
Na super! Dann hätte ich mich nach dem Rabenstreit wieder hinlegen können. Bei der Kälte war ich keine so begeisterte Frühaufsteherin wie der Rest der Klostertruppe. Wortlos verschwand ich mit der Teetasse und zwei weiteren Keksen in mein Zimmer. Dort schlüpfte ich schnell in meine Jeans und einen dicken Wollpulli. Hoffentlich konnte der Handwerker die Heizung reparieren, bevor wir in diesem Gemäuer in Kryoschlaf fielen. Ich packte meine Schultasche und putzte mir die Zähne. Nicht einmal das Wasser aus dem Wasserhahn war warm. Ich spritzte mir ein paar Tropfen Eiswasser ins Gesicht und beendete damit meine Morgenwäsche.
Meine Mutter war bereits weg und spülte vermutlich gerade das Frühstücksgeschirr der Schwestern. Wieder einmal fragte ich mich, ob sie es bereute, dass sie mich als ihre Tochter großgezogen hatte. Seit ich im Sommer, kurz vor meinem 17. Geburtstag erfahren hatte, dass nicht sie, sondern ein Engel meine leibliche Mutter ist, hatte sich viel geändert. Zumindest in meinem Kopf. In unserer kleinen Dachgeschosswohnung hingegen lief alles weiter wie gewohnt. Meine Fragen oder Bemerkungen ignorierte sie. Damit war sie in diesem renovierungsbedürftigen Gemäuer nicht die Einzige. Gäbe es eine Weltmeisterschaft im Übersehen und Überhören von Fragen, fände man hier eine gut trainierte Mannschaft. Anders als meine Mutter hatten die Nonnen die Attacke des zornigen Engels in der Klosterkirche sogar live miterlebt und stellten sich genauso taub und stumm. Selbst meine Lieblingsschwester Clara tat so, als wäre nichts passiert. Ich wäre wirklich froh gewesen, wenn sich alle der Realität stellen würden, auch wenn sie alles andere als normal war.
Trotz Lis ausgewogenem Trainingsplan und regelmäßigen Meditationen war ich weit von meiner inneren Mitte entfernt. Für mein seelisches Gleichgewicht hätte ich mir gewünscht, einfach mit jemand über mein Anderssein sprechen zu können. Aber über meiner himmlischen Herkunft lag ihm Kloster ein bleischwerer Mantel des Schweigens. Und das war bestimmt nicht der einzige Mantel, der hier rumlag und ein Geheimnis verbarg.
Nachdem ich von Tod bringenden Vögeln geweckt worden war und eine halbe Stunde Zeit zum Totschlagen hatte, beschloss ich, vor Schulbeginn auf dem Friedhof eine Kerze anzuzünden. Dann konnte ich mich auch vergewissern, dass die Raben den Absturz unbeschadet überstanden hatten. In der Kapelle nahm ich aus einem Karton neben der Tür eine rote Grabkerze und trat hinaus. Seit ich zurückdenken kann, hasste ich diesen Monat samt seiner trübseligen Feiertage. Allerheiligen (Halloween wurde im Kloster ignoriert), Allerseelen und der Totensonntag lagen bereits hinter uns. Aber immer noch bedeckte zäher Nebel die Welt wie ein feuchtes Leichentuch.
Alles hatte seine Farbe verloren. Die meisten Pflanzen waren abgestorben oder versteckten ihre Lebendigkeit tief unter der Erde. Mir ging es ähnlich. In der dunklen Jahreszeit zog ich mich zurück und fiel in eine seelische Winterstarre.
Seit Tagen, gefühlt war es eine Ewigkeit, hatte ich die Sonne nicht mehr auf meinem Gesicht gespürt. Ich dachte an die längst vergangenen Sommertage, schloss die Augen und stellte mir den blühenden Garten der Schwestern vor, mit sonnenreifen Tomaten, duftendem Lavendel und natürlich mit unzähligen Zucchinipflanzen. Wie gerne wäre ich jetzt barfuß durch taunasses Gras gelaufen. Aber der Sommer war Erinnerung. Stattdessen knirschte unter meinen Füßen gefrorener Kies.
Wie aus dem Nichts schoss ein Rabe aus dem Nebel heraus und landete auf einem Grabkreuz.
»Na, du bist doch bestimmt einer dieser Kampfpiloten«, sagte ich zu dem Vogel.
Der Rabe flatterte ein paar Mal mit den Flügeln und faltete sie dann am Körper. Seine schwarzen Krallen umklammerten das Metall.
»Du hast es gut, deine Füße sind wahrscheinlich nie kalt.« Obwohl ich gefütterte Stiefel trug, waren meine Zehen Eiszapfen. Ich blickte mich um, ob irgendwo ein verletzter Rabe auf dem Boden lag. »Ich bin froh, dass euch nichts passiert ist. Ihr Raben solltet euch vertragen und zusammenhalten. Hier im Kloster habt ihr nicht nur Freunde.« Der Vogel flog zwei Kreuze weiter in Richtung Benediktas Grab und rief seinen Kollegen in den Bäumen ein munteres KRAKRA zu. »Du hast natürlich recht, alle Rabenvögel stehen unter Naturschutz.« Ich zögerte. »Auf mich trifft das übrigens nicht zu. Ich bin unnatürlich. Mich dürfte es eigentlich gar nicht geben.«
Alles, was ich über meine Herkunft wusste, hatte mir Leo erzählt. Meine wirkliche Mutter war ein unerfahrener Engel beim ersten Erdeinsatz. Sie unterstützte einen italienischen Priester beim Kampf gegen einen Dämon, verliebte sich und wurde schwanger. Ich wurde im Himmel geboren und kurz nach meiner Geburt von den Engeln abgeschoben.
»Ginge es nach denen da oben, sollte ich brav im Kloster bleiben. Aber das kommt nicht infrage. Nächstes Jahr bin ich mit der Schule fertig und ziehe aus.«
Der Vogel ließ mich nicht aus den Augen.
Komplett verrückt, dass ich einen Raben mit meiner Lebensgeschichte volltextete. Aber es gab Dinge, die wollte hier keiner hören und andere, die konnte ich niemandem sonst erzählen. Ich ging einen Schritt auf den Vogel zu und beugte mich zu ihm. Das Tier blieb regungslos sitzen, als wäre es eine Plastikattrappe. »Ich sag dir, was los ist, ich bin ein verdammt einsamer Halbengel mit Liebeskummer«, flüsterte ich.
Durchdringend starrte mich der Rabe an.
»Mein Freund ist auf der anderen Seite der Erde und sucht an australischen Stränden nach Freiheit und der perfekten Welle. Also, zumindest dachte ich mal, dass er mein Freund ist. Er scheint mich nicht sonderlich zu vermissen. Zwar schickt er mir fast täglich Fotos in Badehose mit oder ohne Surfbrett, aber er hat noch nicht mal einen Rückflug gebucht. Er bleibt, so lange sein Geld reicht und stürzt sich dort täglich in die Brandung. Wassertropfen glitzern dann in seinen Rastalocken und hübsche, sonnengebräunte Surferinnen strahlen neben ihm um die Wette.« Ich sonnte mich momentan allenfalls in Selbstmitleid. Meine Lebensfreude schwand mit jedem trüben Tag und ich hielt mich selbst kaum aus. Ein Blick aus dem Fenster oder in den Spiegel reichten, um meine Laune unter den Gefrierpunkt sinken zu lassen. Bei feuchtem Wetter sah ich wie ein explodierter Rauschgoldengel aus. Diesen Engelslook, den alle an mir liebten, ertrug ich im Moment nicht. Deshalb zog ich meine Haare durch ein Glätteisen oder flocht sie zu einem festen Zopf. »Und der andere kümmert sich um wichtige Angelegenheiten der Hölle.«
Obwohl mein Engelsanteil alles Dunkle mied, verstrich keine Stunde, in der ich nicht auch an Leo dachte. Obwohl er mir weder Fotos noch sonst irgendwelche Nachrichten schickte, war er mir immer nah. Was hier im Kloster unmöglich war, denn er war ein Angestellter Luzifers. Meine Sehnsucht spielte mir einen Streich. Die geweihten Mauern schirmten mich nämlich nicht nur vor Handystrahlen (Im Kloster hatte man nur in der Küche und im Kreuzgang Empfang), sondern auch vor den Einflüssen des Bösen ab. Das hatte mir sogar Luzifer bestätigt, als er mich nach der Attacke eines zornigen Engels geheilt hatte.
Leo hatte mir zum Abschied ein Lederarmband mit einem silbernen Apfelanhänger geschenkt und mir versichert, ich könnte ihn damit sogar ins Kloster rufen. Das hatte ich mich bisher aus Rücksicht auf die Nonnen nicht getraut. Wegen meiner unnatürlichen Sehnsucht durfte ich sie nicht in Gefahr bringen. Trotzdem legte ich das Armband nie ab und trug es sogar im Schlaf.
»Die zwei sind völlig unterschiedlich, so wie Feuer und Wasser«, erklärte ich dem Vogel, der mich weiterhin nicht aus den Augen ließ. »Aber beide haben mir ein Stück meines Herzens gestohlen und das ist davon nicht leichter, sondern unendlich schwer geworden.«
Es tat gut, meine Gefühle auszusprechen. Der Rabe war ein geduldiger Zuhörer. »Sogar meine beste Freundin hat Besseres zu tun«, jammerte ich weiter. Muriel sah ich zwar regelmäßig in der Schule. Jede freie Minute verbrachte sie jedoch mit ihrem Freund Tim. In den Sommerferien waren sie sogar zusammen in Italien gewesen. Ich war wie immer daheim geblieben und hatte nicht im Meer, sondern in Trübsal gebadet.
»Niemand vermisst mich«, klärte ich den Vogel auf, der plötzlich den Kopf drehte und nervös flatterte. In diesem Moment spürte ich es auch. Obwohl noch keine Schritte zu hören waren, wussten wir beide, dass Li sich näherte. Die Abneigung schien auf Gegenseitigkeit zu beruhen.
»Das Sichtbare wird überbewertet. Du wirst es nicht glauben, aber das sagt ausgerechnet Meister Li. Ich möchte wirklich wissen, warum er euch nicht mag.«
Jetzt konnte ich meinen Kampfkunstlehrer hören. Seine Schritte waren eilig. Kurz darauf sah ich ihn auf der anderen Seite des kleinen Friedhofes an der Mauer entlanglaufen.
»Guten Morgen«, rief ich ihm zu.
Der Rabe flog weg. Kaum merklich zuckte Li zusammen. Mit einem knappen Nicken erwiderte er meinen Gruß und lief weiter. Über seine graue Arbeitsbekleidung, hochgeschlossenes Oberteil, Hose und kniehoch gewickelte Stoffgamaschen, hatte er eine dicke schwarze Steppjacke gezogen.
Seit ich ein Kind war, trainierten wir zweimal täglich. Aber in den letzten Tagen hatte er mehrmals abgesagt. War ich ihm zu träge? Im Moment fiel mir wirklich alles schwer. Schnelle Bewegungen, langsame, Konzentration oder Stille. Von den Schultagen gar nicht zu reden. Dieses Problem hatte ich jedoch jeden Winter und Li hatte dafür immer Verständnis gezeigt. Wahrscheinlich hatte er einfach zu viel um die Ohren. Die kaputte Heizung, die Einkäufe, die Küche. Ich musste ihn unbedingt mehr unterstützen.
Aber da war noch etwas anderes. Ich konzentrierte mich auf seine Aura und konnte sein Unbehagen fühlen. Er wollte mir aus dem Weg gehen und hatte nicht damit gerechnet, mich hier zu treffen. Normalerweise besuchte ich Schwester Benediktas Grab erst am Nachmittag.
Ich blickte ihm nach. Er trug einen langen Gegenstand an der mir abgewandten Seite. Der Langstock war seine Lieblingswaffe. Ich kniff die Augen zusammen. Das war kein Stock, das war ein Schwert. Genauer gesagt ein leicht gebogenes Samurai-Schwert, das ich noch nie zuvor gesehen hatte.
Um unsere Heizung konnte es bei dem wichtigen Termin also nicht gehen. Der schwarze Lack der Schwertscheide glänzte und war mit goldenen Ornamenten verziert.
Schnell verschwand er durch die Kapellentüre. Li hatte mir viel beigebracht: Qi Gong, Tai-Chi, waffenlose Selbstverteidigung, den Umgang mit Lang- und Kurzstock, Pfeil und Bogen, Säbeln oder Messern. Aber nie mit einem Samurai-Schwert.
Trainierte er ohne mich? Allein? Oder hatte er einen neuen Schüler gefunden?
Der Gedanke versetzte mir einen dumpfen Schmerz in der Magengegend und ich fühlte mich noch ein Stück verlassener.Wie Li es mich gelehrt hatte, atmete ich die Enttäuschung aus, um mich nicht von meinen Gefühlen ablenken zu lassen. Leider gehörte Emotionskontrolle nicht gerade zu meinen Stärken und in den letzten Wochen hatte ich mich widerstandslos treiben lassen. Der Anblick des Samurai-Schwertes war jedoch ein regelrechter Schock. Was ging hier vor? Mechanisch setzte ich einen Fuß vor den anderen. Ich sammelte mich mit jedem Schritt und horchte auf das Unsichtbare. Meine Eindrücke waren verworren. Deutlich konnte ich Lis Unsicherheit fühlen, fast war es Angst. Sie war gemischt mit der Erinnerung des Ortes, der Trauer um die Toten und meinen eigenen Gefühlen, Leos Nähe und Elias’ Fehlen. Dazwischen waberte wie Nebel eine diffuse Anspannung. Die Wahrnehmung entzog sich mir, sobald ich glaubte, sie fassen zu können. Ich blieb blind. Langsam ließ ich los und lockerte meine Muskeln.
Herr Li war im Kloster aufgetaucht, als ich noch ein Säugling war und hatte meine menschlichen und übermenschlichen Fähigkeiten trainiert. Welches Ziel verfolgte er jetzt? Was war wichtiger als mein Unterricht? Gab es eine Gefahr, die ich nicht wahrnahm?
Ich schlängelte mich weiter durch die Grabreihen und murmelte zur Beruhigung die Namen der längst Verstorbenen vor mich hin. Neben den Mönchen, die das Kloster über Jahrhunderte bis zur Säkularisation bewirtschaftet hatten, lagen vereinzelt Nonnen begraben. Sie waren vor ungefähr einhundert Jahren in das Gebäude eingezogen und hatten eine Frauengemeinschaft aufgebaut. Da war die glänzende Vergangenheit des reichen Klosters schon längst Geschichte. Manche Namen waren kaum lesbar. Regen, Schnee und Sonnenschein hatten die Schriften auf dem schwarzen Blech fast vollständig ausgelöscht.
Schwester Theresa M. Zettler 1897-1961, Pater Nodbert, gestorben 1407, Schwester Faustina M. Mühlgram 1943-2001, Bruder Ulrich Brun 1623-1659, las ich im Vorübergehen.
Was für ein Durcheinander! Mein offizieller Vater Vaclav Konda hatte hier kein Grab. Er war in seiner tschechischen Heimat beerdigt worden.
Der Rabe landete vor mir.
»Ich hab nichts für dich. Tut mir leid. Nächstes Mal bringe ich was mit.«
Lautlos ließ sich ein zweiter Rabe von einem Ast gleiten und landete auf einem verwitterten Grabkreuz. Mit dem Schnabel pickte er gegen die Namenstafel.
»Dir bringe ich natürlich auch was mit«, erweiterte ich mein Angebot. Eigentlich durfte ich sie nicht füttern. Li hatte strikte Anweisungen zur Krähenbekämpfung erlassen.
Ich hielt inne, ging vor dem Kreuz in die Hocke und las den Namen des ehemaligen Mönches Gabriel Kondrauer. Über dem Namen war das Zeichen eingeritzt, das mir Luzifer kurz vor seinem Verschwinden auf einer Bodenplatte der Kirche gezeigt hatte. Es waren zwei aneinandergereihte, steile Bögen, wie die Schreibübung eines Schulanfängers. Ich berührte den Kratzer mit meinem Zeigefinger und zog ihn erschrocken zurück. Es fühlte sich an, als wäre ein Stromschlag durch meinen Körper gezuckt. Beim zweiten Versuch war die Reaktion weniger elektrisierend. Langsam fuhr ich die Bögen nach und spürte, wie die Linie sich unter meinen Fingerspitzen erwärmte. Sie begann in dem eiskalten Metall zu glühen. Woher kam die Hitze? Warum hatte ich das Zeichen bisher übersehen? So wie ich es auch bis zur Begegnung mit Luzifer in der Kirche ignoriert hatte und der markierten Bodenfliese instinktiv aus dem Weg gegangen war?
Ich konnte mich nicht erinnern, jemals meinen Fuß darauf gesetzt zu haben. Die Nähe zur Krypta mied ich, seit ich denken konnte.
Während der Sommerferien hatte ich bei der Renovierung der Klosterkirche mitgeholfen und hatte mich dem Zeichen einmal testweise genähert. Von ihm ging ein deutliches hochfrequentes Vibrieren aus. Aufgeregt. Gierig. Es war ganz anders als das dumpfe Klopfen und der dunkle Sog, der aus der Krypta nach oben drängte.
Ich stand auf. Sollte ich so tun, als hätte ich es nicht gesehen? Aber würde ich mich damit nicht genau so verhalten wie die Nonnen und meine Mutter? Nur keine Fragen stellen und alles hinnehmen.
Nachdenklich drehte ich den silbernen Apfelanhänger zwischen meinen Fingern und starrte auf das Grabkreuz. So viel in meinem Leben war verworren. Antworten hatte mir bisher nur der Teufel gegeben. Mein Blick fiel auf die beiden Raben, die sich mit gesträubten Federn kampflustig musterten und redete mir ein, dass auch für mich Angriff die beste Verteidigung sei. Auf jeden Fall war Mut besser als die ständige Angst, einen Fehler zu machen.
Die schwarzen Vögel belauerten sich. Keiner wollte den ersten Schritt machen. Aber ich würde es tun. Ich musste aufhören, den Kopf in den Sand zu stecken, sonst würde mich die Last der Geheimnisse irgendwann erdrücken. Jeden Nachmittag, wenn ich an Schwester Benediktas Grab eine Kerze anzündete, schwor ich mir, dass ich meine kleine verrückte Familie, die alten Nonnen, meine Mutter, Herrn Li und die ehrwürdigen Klostermauern nie mehr in Gefahr bringen und stattdessen vor allem Bösen beschützen würde. Aber das konnte ich nur, wenn ich meine Trägheit überwand und endlich die Rätsel dieses Ortes und meiner Herkunft löste.
Die Gebete der Schwestern verriegelten zwar einigermaßen erfolgreich den Zugang zur Unterwelt, über dem Menschen vor über 1000 Jahren dieses Kloster gebaut hatten. Aber was, wenn irgendetwas oder irgendwer diesen uralten Schutzwall schwächte? Wenn er Risse bekam und durchlässig wurde? Vermutlich war ich nicht nur ein Teil, sondern eher die Ursache dieses Problems und darum lag es auch an mir, die Sache in den Griff zu bekommen. Schließlich hatte meine Existenz Luzifers Aufmerksamkeit auf das Kloster gelenkt. Ich musste herausfinden, was dieses Zeichen bedeutete.
»Ich nehme die Herausforderung an«, sagte ich mit fester Stimme und hoffte, dass dieser Satz bis in den hintersten Winkel der Hölle zu hören war. Meine Entschlossenheit erfüllte mich mit großer Ruhe. Alles hing zusammen, nur verstand ich es nicht. Noch nicht. Ab jetzt würde ich die Augen weit aufmachen und all meine Sinne einsetzen. Irdisch wie überirdisch. Bis ich Leo traf, hatte ich mich für normal und einigermaßen durchschnittlich gehalten. Weder Herr Li noch die Schwestern hatten jemals ein Aufheben darum gemacht, dass ich Auren sah, oft Gedanken lesen oder manchmal sogar Menschen manipulieren konnte. Letzteres hatte mir Li natürlich streng verboten. Leo war erstaunt gewesen, wie gut meine mentalen Fähigkeiten entwickelt waren. Das bedeutete aber auch, dass ich sie noch verbessern konnte. »Da ist noch Luft nach oben«, teilte ich den beiden Raben mit und musste lachen. Für Vögel war das selbstverständlich.
Die Kirchturmuhr schlug.
Erst einmal musste ich mich jedoch beeilen, um nicht zu spät zur Schule zu kommen. Ich steckte die Kerze in meine Anoraktasche. Ich würde sie nach dem Unterricht anzünden.
Plötzlich zischte es hinter meinem Rücken, als würde gleich ein Feuerwerkskörper in die Luft fliegen. Hatte ich mit der Berührung des Zeichens eine Kreatur aus der Hölle angelockt? Ich atmete tief ein. Dann drehte ich mich mit einem Ruck um und hätte mit jeder teuflischen Gestalt gerechnet. Einem widerlichen Dämon, gestaltloser Dunkelheit oder Leo oder sogar Luzifer selbst. Stattdessen loderte auf Gabriel Kondrauers Grab eine weiße Lichtsäule und bewegte sich schnell auf mich zu. Ein Engel? Ich konnte eine ähnliche Aura wahrnehmen wie damals in der Kirche. Überrascht wich ich zurück, hielt mir geblendet eine Hand vor die Augen und versuchte, in dem übernatürlichen Strahlen einen Gegner zu erkennen. Aber ich konnte nichts sehen. Dafür würde mich das Licht jeden Moment verschlingen. Meine Gedanken überschlugen sich. Die Säule stoppte wenige Zentimeter vor meiner Nasenspitze. Langsam streckte ich meine Hand nach ihr aus. Vielleicht war dieses Licht gar nicht mein Gegner, sondern es würde sich mit mir gegen Luzifer verbünden. Licht war meinem Wesen schließlich näher als die Dunkelheit. Bot mir der Himmel vielleicht gerade seine Unterstützung an?
Bevor meine Fingerspitzen die Oberfläche berühren konnten, schoss ein Rabe über meine Schulter und flog mitten in das tosende Strahlen hinein. Ich machte unwillkürlich einen Schritt zurück und stolperte über eine Grabeinfassung.
Als ich wieder aufsah, war das Licht erloschen und die Säule verwandelte sich in schwarzen Rauch.
Leo!, war mein erster Gedanke. Aber dann spürte ich die Feindseligkeit, die mir entgegenschlug. Ein kräftiger Windstoß blies den leichten Brandgeruch und den Rauch auseinander und beendete den Spuk.
Was war das gewesen? Welche Kräfte waren hier am Werk? Himmel und Hölle? Auf welcher Seite hatte Gabriel Kondrauer gestanden? Eines war sicher, Luzifers Macht nahm innerhalb des Klosters zu und er zeigte es mir deutlich. Wie sonst hätte das Zeichen glühen können? Aber nicht nur sein Einfluss wurde stärker. Das helle Licht machte mir Mut – vielleicht war ich doch nicht allein und bekam himmlischen Beistand. Endlich.
Lautes Krächzen riss mich aus meinen Gedanken. Schon wieder stürzten sich zwei Raben in der Luft aufeinander und landeten unter hektischem Flügelschlagen auf dem gefrorenen Kies. Am Boden attackierten sie sich mit Schnäbeln und Krallen. Kleine, schwarze Federn schwebten in der Luft.
Muriel machte große Augen, als ich im Laufschritt um die Ecke bog. Sie lehnte gerade ihr Fahrrad an die Steinfigur des heiligen Antonius. Würde es geklaut werden, würde sie den Heiligen persönlich für mangelnden Diebstahlschutz verantwortlich machen.
»Hi, Muriel«, rief ich ihr zu.
Meine Freundin musterte mich schweigend, was bei ihr ziemlich unheimlich wirkte. Normalerweise hat sie das erste und letzte Wort und auch die Worte dazwischen.
»Es muss ein Wunder geschehen sein. Du bewegst dich schneller als eine Schnecke und erinnerst dich an meinen Namen. Und vor allem – du lächelst«, staunte sie. »Woher kommt dein plötzlicher Energieschub? Bestimmt nicht von deiner Apfeldiät. Was ist passiert? Sag mir die Wahrheit, die ganze Wahrheit und nichts als die Wahrheit.«
Ich zuckte mit den Schultern. »Nichts«, antwortete ich einsilbig. Ich konnte ihr nicht erzählen, dass ich auf einem Grabkreuz das Teufelszeichen entdeckt und dessen Aura gespürt hatte, dass mich eine Lichtsäule verschlingen wollte und dass Herr Li mit einem Samurai-Schwert das Kloster verlassen hatte und ich herausfinden würde, warum er das tat und vor allem, wovor er sich fürchtete.
»Und das soll ich dir glauben? Seit Wochen schleichst du wie ein Zombie herum mit leerem Blick und Sabber im Gesicht.« Muriel verfiel in ihren Zombie-Walk und zog sich ihre geringelte Strickmütze über die Augen. Ich nahm sie ihr vorsichtshalber vom Kopf, damit sie auf den Treppenstufen nicht stürzte. »Du funktionierst in der Schule wie ein Roboter, lachst nicht über meine genialen Witze, willst meine Bücher nicht lesen, weil du davon nicht schlafen kannst, bist blass und wirst immer dünner. Du bist im Winter immer gaga, aber so schlimm war es wirklich noch nie. Und dann kommst du eines nebligen Novembermorgens frisch und munter mit strahlenden Augen und glühenden Wangen um die Ecke gejoggt und bist durch NICHTS verwandelt.«
Vielleicht sollte ich Muriel doch alles erzählen. Schließlich war sie meine beste Freundin. Eine Geschichte über Schwerter, geheimnisvolle Zeichen, Engel und Teufel würde ihr bestimmt gefallen. Aber sie würde mir kein Wort glauben und das war gut so. Dass ich ein Halbengel bin, hatte ich ihr bisher bewusst verschwiegen. Ich hatte Angst, dass sich unsere Freundschaft dadurch verändern würde und ich mochte Muriel genauso, wie sie war. Ihre unbekümmerte Art erdete mich.
»Deine neue Frisur gefällt mir«, lenkte ich ab. Seit Muriel mit Tim zusammen war, hatte sie ihre Haare wachsen lassen. Sie reichten ihr inzwischen bis zum Kinn. Früher hatte sie sie selbst mit der Schere kurz geschnitten.
Muriel schüttelte langsam den Kopf. »Das kann ich bei dir nicht behaupten. Aber wenn es dir jetzt besser geht, warum auch immer, kannst du mit dem Glätten aufhören. Das macht auf Dauer die Haare kaputt. Ich würde für deine Locken wirklich alles geben.«
Wir standen vor dem Klassenzimmer. Muriel griff nach meinem Oberarm. »Jetzt dämmert’s mir. Hat Elias, der Verräter, dich vielleicht angerufen oder dir geschrieben?«, fragte sie streng und schlug sich im nächsten Moment die Hand vor den Mund.
Ungläubig schüttelte ich den Kopf, dann spürte ich, wie mein Herz einen kleinen Sprung machte. »Er kommt zurück?«
Muriel zuckte mit den Schultern. »So viel zu Überraschungen und dass alle glauben, dass ich nicht dichthalten würde. Von mir weißt du nichts. Ich bin verschwiegen wie ein Grab.«
Es gongte und wir setzten uns auf unsere Plätze.
Frau Schöll, unsere Englischlehrerin, stürmte ins Klassenzimmer. »Good morning, students. We start with a prayer. In English, please.«
Wir standen auf.
»Wann?«, fragte ich leise.
»On Wednesday«, antwortete Muriel mit einem breiten Grinsen.
Das war schon übermorgen.
Nach Unterrichtsende kehrte ich zum Friedhof zurück. Während der Mathestunde hatte ich mir überlegt, wie ich bei meinen Nachforschungen vorgehen würde. Fragen über Fragen wirbelten durch mein Hirn.
Als Erstes würde ich Clara nach dem Zeichen fragen. Sie kannte sich mit der Geschichte des Klosters aus und kümmerte sich um die Kunstschätze. Von Zeit zu Zeit frischte sie sogar verblassende Inschriften mit weißer Farbe auf. Vielleicht war ihr das Symbol mit dem Doppelbogen schon einmal aufgefallen. Das Zeichen war, im Gegensatz zu den Buchstaben auf dem Grabkreuz, gut zu erkennen. Wann mochte Bruder Gabriel hier gelebt haben? Hatte einer seiner Mitbrüder das Zeichen ins Metall geritzt oder war es später angebracht worden? Warum hatte der Teufel es mir im Sommer gezeigt?
Danach würde ich Li fragen, warum er vor 17 Jahren ins Kloster gekommen war. Hatte ihn jemand eingeladen?
Aus Clara könnte ich wahrscheinlich ein paar Informationen herauskitzeln. Bei Herrn Li war es komplizierter. Kommunikation lief mit ihm indirekt ab. Er unterrichtete nach dem Prinzip Lernen durch Beobachten. In seinen Augen reichte es nicht, Dinge mit dem Kopf zu verstehen, ein Schüler musste sie körperlich verinnerlichen. Fragen wich er instinktiv aus.
Auf dem Kirchendach hatte sich eine Krähengroßfamilie aufgereiht und unterhielt sich lautstark krächzend. Menschen beobachten schien ein Krähenhobby zu sein. Die Welt war immer noch müde und viel zu kalt. Aber mir ging es besser. Ich wunderte mich selbst über die zurückkehrende Energie.
Am Grab Benediktas angekommen, holte ich die Kerze und eine Packung Streichhölzer aus meiner Tasche. Mit klammen Fingern bewegte ich das rote Zündholzköpfchen über die Reibfläche. Doch das Zündholz erlosch, ehe sich eine Flamme entwickeln konnte.
Ich riss das nächste Hölzchen ab, das sich weich und feucht anfühlte. Beim Zündversuch brach es entzwei. Leo hätte einfach geschnippt und zwischen seinen Fingern hätten Flammen getanzt.
»Komm, ich gebe dir Feuer, Anna«, bot eine vertraute Stimme an.
Perplex drehte ich mich um. Ich hatte nicht gehört, dass sich mir jemand genähert hatte und fühlte mich bei meinen Gedanken an Leo ertappt. So viel zu meiner gesteigerten Aufmerksamkeit. Allein der Gedanke an Leo blockierte meine Wahrnehmungsfähigkeit. Daran musste ich wirklich arbeiten.
Schwester Clara streckte mir lächelnd ein orangefarbiges Plastikfeuerzeug entgegen. In der farblosen Umgebung war sie mit ihrer schwarz-weißen Ordenstracht bestens getarnt. Außerdem machten ihre praktischen, gummibesohlten Schuhe kaum Lärm beim Gehen. Sie trug übrigens Sandalen (!), aber immerhin auch dicke weiße Wollsocken. Nur das orange Feuerzeug störte die perfekte Anpassung an ihre Umwelt.
»Danke«, antwortete ich knapp.
Eigentlich kam sie wie gerufen, trotzdem war ich vom Versagen meines Frühwarnsystems genervt. Ich hielt ihr die Kerze hin und wartete, bis der Docht Feuer gefangen hatte. Claras rechte Hand zitterte ein wenig und sie nahm die linke stabilisierend dazu. Ihre linke Hand, die der fanatische Engel im Sommer abgehackt hatte, war immer noch zarter und blasser als ihre gesunde Hand. Eigentlich hatte der Engel vorgehabt, mich zu töten, weil er der Meinung war, ich würde das göttliche Gleichgewicht stören. Die offizielle Version war, dass Schwester Clara sich ihre Hand in einer landwirtschaftlichen Maschine abgetrennt hatte. Die Ärzte hatten sie wieder angenäht.
»Wenigstens ein kleines Licht«, stellte ich fest und platzierte die Kerze auf dem kahlen Grab.
»Du kannst nichts dafür, Anna.« Clara hakte sich bei mir unter. »Ihr Tod hat nichts mit dir zu tun.«
Das sah ich anders. Gemeinsam schauten wir dem Flämmchen zu, wie es gegen das winterliche Zwielicht ankämpfte.
»Blödsinn. Das Höllentor in der Krypta ist nur wegen mir geöffnet worden«, widersprach ich. Ich hatte genug davon, Dinge schönzureden oder totzuschweigen.
Clara warf mir einen erstaunten Blick zu und bekreuzigte sich. Dann starrten wir Seite an Seite auf das Grab. Der einzige jämmerliche Schmuck war ein kahler Rosenstock. Am liebsten hätte ich das dornige Gestrüpp gepackt und herausgerissen. Ich war wütend, nahm mich aber zusammen und beschloss, im Frühling ein kleines Buchsbäumchen zu pflanzen. Buchs ist immergrün und auch im Winter ein Zeichen des Lebens.
Clara drückte meinen Arm. »Wir alle müssen uns entscheiden, wie weit wir gehen und wie viel Dunkelheit wir uns zutrauen. Manchmal überschätzt man seine Fähigkeiten, Anna.«
War das eine Warnung? Ich war gespannt, wie Clara fortfahren würde.
»Benedikta hat sich selbst dazu entschlossen, einen Blick hinter die Türe zu werfen. Ihr Herz konnte die Dunkelheit nicht ertragen. Aber jetzt ist unsere liebe Schwester im Licht. Da bin ich mir sicher. Denn wer an Jesus Christus glaubt, hat das ewige Leben. Grabkerzen trösten die Lebenden, die Toten brauchen sie nicht mehr.«
»Was weißt du von der Hölle?«, kehrte ich zum Thema zurück.
Clara zögerte. »Ach, Anna. Finsternis umgibt uns, genauso wie Licht. Wir alle haben eine dunkle Seite und müssen damit leben.« Sie lächelte mich liebevoll an. »Du bist anders. Deine Seele meidet die Dunkelheit.«
»Warum kennst du dich so gut mit meiner Seele aus?«, fragte ich aggressiver, als ich eigentlich beabsichtigt hatte.
Claras Blick war ehrlich erstaunt. »Ich kenne dich seit dem ersten Tag.« Sie begann zu beten und würgte damit das Gespräch ab. Aber so einfach würde sie mich heute nicht loswerden. Ich wartete und wickelte mich in meinen Daunenanorak. Clara hingegen trug nur eine schwarze Strickjacke über ihrem Ordenskleid, betete aber ausdauernd.
»Amen«, sagte sie endlich und gab auf.
Ich deutete auf das benachbarte Grab von Gabriel Kondrauer. »Kennst du das Zeichen über dem Namen?«
Clara musterte die Bögen. »Nein, das ist mir noch nie aufgefallen. Das muss neu sein.« Sie beugte sich vor und setzte ihre Nahbrille auf, die an einem Kettchen um ihren Hals hing. »Vielleicht ist der Kratzer während des Gerüstaufbaus entstanden. Mit einer langen Stange kann man schon mal irgendwo gegen stoßen.«
Das bezweifelte ich. Warum sollte Baumaterial über den Friedhof getragen worden sein? Das wäre viel umständlicher gewesen, als es durch das breite Hauptportal in die Kirche zu bringen.
»Ist dir das Zeichen schon mal an einer anderen Stelle aufgefallen?«, bohrte ich weiter.
Clara schüttelte den Kopf.
»Und sagt dir der Name Gabriel Kondrauer etwas?« Aufmerksam beobachtete ich Schwester Clara.
»Nein.«
Es war nur eine kleine Veränderung in ihrer Stimme. Aber es war egal, ob sie eine Silbe oder einen langen Satz gesagt hätte. Es war eindeutig: Clara log.
»Lass uns reingehen, bevor du dir eine Erkältung holst. Du zitterst ja schon.« Sie legte ihren linken Arm um meine Schulter und zog mich an sich. »Wenn du magst, kannst du mir eine Apfelkiste in die Küche tragen. Ich habe mal wieder zu viele Äpfel eingepackt und jetzt ist sie mir zu schwer. Als ich dich hier stehen sah, habe ich sie an der Mauer abgestellt. Herr Li wartet in der Küche. Wir sollten uns beeilen, sonst wird das nichts mit unserem pünktlichen Abendessen.«
»Das dürfen wir nicht riskieren«, antwortete ich und ging auf ihren Ablenkungsversuch ein.
Clara nickte erleichtert und rieb sich demonstrativ die Hände. Ich schaute ihr nach, wie sie mit wehendem Schleier über den Friedhof lief. Plötzlich war ihr kalt geworden.
Mein Mittagessen hatte heute nur aus einer trockenen Breze des Pausenverkaufes bestanden. Daher freute ich mich auf ein warmes Abendessen. Wenigstens mein Appetit blieb von Kälte oder Lügen unbeeinträchtigt.
Schwester Clara hatte ihre Kräfte tatsächlich überschätzt. Die graue Holzkiste war bis zum Rand gefüllt mit kleinen Äpfeln, die süß dufteten. Für mich stellte das Gewicht kein Problem dar. Bei den Renovierungsarbeiten hatte ich weit schwerere Kisten mit Arbeitsmaterialien und Lampen auf wackelige Gerüste geschleppt.
Als ich die Kiste aufhob, veränderte sich die Gegenwart. Nur eine kleine Abweichung, weder eine Bewegung noch ein Geräusch. Leo! Meine Nackenhärchen stellten sich auf und ich begann schlagartig zu schwitzen. Alarmiert festigte ich heute schon zum zweiten Mal meine Aura. Das war eine Abwehrübung, die mir Herr Li schon als Kind beigebracht hatte. Ich richtete mich langsam auf und horchte.
Clara hatte die Tür zur Kapelle für mich offen stehen lassen. Sie bewegte sich quietschend im Luftzug. Langsam drehte ich mich um die eigene Achse. Nichts.
Meine Wahrnehmung hatte mir einen Streich gespielt. Leo hatte mich gewarnt, dass ich ihn nie mehr vergessen würde. Ich hatte das für Angeberei gehalten. Aber offensichtlich hatte mich der Kontakt zu ihm nachhaltig verändert. Er hatte sich in mein Nervensystem hineingefressen und blockierte meine Synapsen. Früher war es für mich ganz natürlich gewesen, eine Präsenz zu spüren. So selbstverständlich wie ich heute Morgen Lis Nähe bemerkt hatte. Ich brauchte dringend eine Lösung, um meine Sinne von Leo zu befreien.
Ich starrte in die Apfelkiste, als läge dort die Antwort und fand sie an einem anderen Ort. Mein Herz fieberte Elias entgegen. Ich war froh, dass Muriel sich verplappert hatte. In seiner Nähe hatte ich mich immer sicher und geerdet gefühlt. Vielleicht konnte er für mich ein Gegengift oder noch besser ein Heilmittel sein. Ehrlich und ohne Geheimnisse.
Ein Rabe hüpfte mir auf dem Kiesweg entgegen. Er blieb erwartungsvoll stehen und legte seinen Kopf schief. Die Vögel wurden immer zutraulicher.
»Das ist Wegelagerei«, beschwerte ich mich bei dem Vogel, der seinen Hals streckte und den Schnabel leicht öffnete. »Aber du erinnerst mich an mein Versprechen von heute Morgen.« Ich rollte ihm einen Apfel zu. Mit aufmerksamem Blick verfolgte er meine Bewegungen und stoppte die Frucht mit dem Schnabel.
»Der ist bestimmt süß«, versprach ich und dachte dabei schon wieder an Leo. »Ich hab dir doch von meinem Freund in Australien erzählt. Er ist bald wieder da. Dann wird es mir bestimmt besser gehen.« Der Vogel hackte auf den Apfel ein. Herr Li wäre entsetzt, wenn er mich beim Rabenfüttern beobachtet hätte. Ich hinterging seine Bemühungen.
Andererseits verheimlichte auch Li etwas vor mir. Nur was?
Ein zweiter Rabe stürzte sich auf die Frucht.
Um Streit zu verhindern, legte ich einen weiteren Apfel auf den Boden. Aber die Vögel waren bereits im Kampfmodus und flogen auf. Sie wirbelten durch die Luft, als wären sie zu einem Körper verschmolzen. Die beiden konnten sich offensichtlich nicht ausstehen und nutzten jede Gelegenheit sich zu streiten. Die Äpfel waren da nur ein willkommener Anlass, bestimmt nicht der Grund. Ich nahm mir vor mich rauszuhalten und sie nicht mehr zu füttern.
In der Küche erwarteten Clara und die uralte Schwester Renata die Apfellieferung mit gezückten Messern. Sofort machten sie sich ans Schälen und Schnipseln.
»Heute gibt es Apfelstrudel«, kündigte Li freundlich an. Unser morgendliches Zusammentreffen erwähnte er mit keinem Wort. Er hatte sich wieder völlig unter Kontrolle. Kein Gedanke, kein Gefühl drangen nach außen. Er zeigte mir eine Oberfläche glatt wie ein spiegelnder See. So kannte ich ihn.
»Wie lief der Termin mit dem Handwerker?«, fragte ich so unschuldig wie möglich. Ich hielt die Augen gesenkt, war aber innerlich hellwach.
»Gut«, antwortete Li. Seine Aura verdichtete sich, wurde noch undurchdringlicher. Er rechnete scheinbar damit, dass ich versuchen würde, sie zu überwinden. Ich ließ augenblicklich los. Es stand mir nicht zu, meinen Lehrer zu bedrängen. Dazu war mein Respekt vor ihm zu groß. Trotzdem fragte ich weiter.
»Warum hatten Sie ein Schwert dabei?«
Die Frage war für die anderen unauffällig, da Li oft unterschiedliche Waffen zum Training mitbrachte. Nur Li wusste, wovon ich sprach. Seine Augen verengten sich. »Du täuschst dich.« Er blieb völlig ruhig, wie ein stiller See. Zu ruhig.
»Kochmütze«, schrie Schwester Renata plötzlich.
Clara kicherte. Sogar über Lis Gesicht huschte ein Lächeln. Die Heiterkeit entspannte die aufgeladene Situation. Lis Kopf war wie immer kahlgeschoren, was eine Kochmütze unnötig machte. Aber Schwester Renata bestand darauf. Aus hygienischen Gründen, wie sie gerne erläuterte. Sie trage mit ihrer Nonnentracht einen Schleier, da könne kein Haar in die Suppe fallen. Ich glaubte jedoch, dass sie darunter genauso kahl war wie Herr Li.
Wenn man bei uns manchmal etwas im Essen fand, was dort nicht hingehörte, lag es nicht an Herrn Li, sondern an Schwester Renata, die fast blind und taub war – Schleier hin oder her. Letzte Woche hatte meine Mutter Renatas Hörgerät aus einer Portion Lasagne gefischt. Das Hörgerät funktionierte nicht mehr, nachdem es bei 220 ºC überbacken worden war. Seitdem war Renata von der Außenwelt völlig abgeschnitten, was sie aber tapfer ignorierte und unverdrossen ihre Befehle erteilte. In einer Woche sollte das neue Hörgerät geliefert werden.
Herr Li tat so, als habe er Renata nicht gehört, und arbeitete weiter.
»Ich helfe gerne beim Apfelschälen«, bot ich an, weil ich nicht allein in meinem kalten Zimmer sitzen wollte. In der Küche war der Backofen für den Apfelstrudel vorgeheizt und verbreitete eine wohlige Wärme. Schwester Renata war in der Küche keine große Hilfe mehr, was sie natürlich nie zugegeben hätte. Offiziell war sie immer noch die Küchenchefin, worauf sie in regelmäßigen Abständen lautstark hinwies.
»Und dass mir keiner Rosinen in den Strudel mischt«, schrie sie. »Die mag unser Pfarrer Brenner gar nicht.«
Pfarrer Brenner war bereits vor meiner Geburt gestorben, hatte aber in Schwester Renatas Gedächtnis das ewige Leben. Jedes Gericht wurde danach beurteilt, ob es dem ehrwürdigen Geistlichen mundete oder nicht.
Herr Li reichte mir kommentarlos mit beiden Händen einen Apfelschäler. Jeder Gegenstand (und schien er noch so unwichtig) wurde von ihm mit größter Achtsamkeit übergeben.
Ich dachte an das Samurai-Schwert. Noch mehr als die Waffe beschäftigte mich jedoch Lis Unruhe. Erst jetzt realisierte ich, dass ich bis zu diesem Morgen an Li noch nie eine Emotion wahrgenommen hatte. Eigentlich wusste ich nichts von ihm, obwohl ich ihn seit 17 Jahren kannte. Er hatte sich immer unter Kontrolle gehabt.
Auf dem Weg zur Schule war ich über die Obstbaumwiese gelaufen. Aber Li war nicht dort gewesen. Er hatte höchstwahrscheinlich mit dem Schwert das Klostergelände verlassen und damit bestimmt gegen das Waffenrecht verstoßen. Beim Abendtraining würde ich danach fragen. Stumm setzte ich mich zu Clara und Renata an den Tisch und dachte mal wieder an Leo. Äpfel erinnerten mich immer an ihn und zurzeit gab es sie täglich. Die knorrigen, alten Apfelbäume hatten uns eine reiche Ernte beschert.
Als ich Leo am Anfang unserer Bekanntschaft gefragt hatte, was er wolle, hatte er geantwortet, warten, bis die Äpfel reif sind. Jetzt waren die Äpfel schon lange reif. Sie waren sogar überreif. Sie lagerten im kühlen Vorratskeller des Klosters und begannen vereinzelt schon zu verfaulen und zu verschimmeln. Nur Leo war nicht zurückgekommen. Seit meinem Geburtstag hatte er kein einziges Mal versucht, mit mir Kontakt aufzunehmen. Nicht unter meinem Lesebaum oder am Badesee. Ich hatte dort oft auf ihn gewartet.
»Ich brauch Nachschub«, schrie Schwester Renata und klopfte mit dem Messer auf die Tischplatte. Die Kiste konnte sie nicht ohne Aufstehen erreichen und das war auch gut so. Ehe man ihr eine Frucht zum Schälen gab, musste man überprüfen, ob sie noch essbar war oder besser in den Kompost wanderte.
Herr Li bereitete in der Zwischenzeit den Strudelteig vor. Er benutzte kein Nudelholz zum Ausrollen, sondern schleuderte den Teig kunstvoll durch die Luft, bis er papierdünn war und er ihn auf der Arbeitsplatte faltenfrei auslegte. Es war wie ein eleganter Tanz, den Mensch und Teig zusammen aufführten. Mit einem ähnlichen System konnte er auch Nudeln herstellen.
»Darf ich es auch probieren?«, fragte ich.
Li nickte und machte es mir langsam vor. So gut wie möglich versuchte ich, seine geschmeidigen Bewegungen zu kopieren. Lernen durch Sehen und Tun. Mit dieser Methode unterrichtete er mich schon mein ganzes Leben. Das war ganz anders als in der Schule, wo alles theoretisch erklärt wurde.
Der Teig wurde dünner und dünner und ich wirbelte in einer Mehlstaubwolke durch die Küche. Clara klatschte anerkennend in die Hände. Es machte kaum einen Unterschied, ob man Stöcke oder Strudelteig schwang. Oder ein Samurai-Schwert? Ich musterte Li aus dem Augenwinkel. Warum nur hatte er mich Letzteres nicht gelehrt? Welche Fähigkeiten besaß er noch, von denen ich nichts wusste? Was fürchtete er? Seine Geheimnisse nagten an mir.
»Konzentrier dich, Anna. Du lässt dich ablenken. Wenn du zu stark ziehst, gibt es einen Riss«, ermahnte er mich.
Tatsächlich wickelte sich der Teig um meine Hand und ein riesiges Loch klaffte in der Mitte. Ich knetete den Teig zusammen und versuchte es erneut. Schließlich machte Übung den Meister. Herr Li hatte diesen Titel im Gegensatz zu mir wirklich verdient.
»Und machen Sie mir den Teig nicht wieder so dick wie beim letzten Mal«, brüllte Schwester Renata. »Zart und durchsichtig muss er sein. Man sollte dadurch Zeitung lesen können. So mag ihn der Herr Pfarrer am liebsten.«
Versonnen blickte sie nach diesen Worten ins Leere und vergaß uns, die Äpfel und die Teigdicke. Nach wenigen, ruhigen Atemzügen sank ihr das Kinn auf die Brust. Sie war eingeschlafen und lächelte dabei selig.
Meine Teigportion wurde von Versuch zu Versuch brüchiger und verlor ihre Elastizität. Von papierdünn war ich weit entfernt. Herr Li verlor über meinen gescheiterten Versuch kein Wort und strich mein Teigstück mit Butter ein. Ich setzte mich wieder an den Tisch und machte mit den Äpfeln weiter.
»Wir sind bald fertig. Du hast bestimmt viel zu tun oder willst dich mit Freunden treffen«, bot Clara an.
»Nein, nein. Das passt schon«, verteidigte ich meine Anwesenheit in der warmen Küche.
Clara betrachtete mich. »Muriel habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Es geht ihr doch gut?«
Ich nickte und teilte eine Frucht in zwei Hälften. »Es geht ihr ausgezeichnet«, versicherte ich. »Sie hat jetzt einen Freund und ist jede freie Minute mit ihm zusammen.«
»Tim, oder? Ich erinnere mich an ihn. Der große junge Mann, der bei Benediktas Beerdigung mit Muriel Weißwürste verteilt hat? Ein Freund von Elias?«
»Genau der.«
Clara nickte und schälte weiter. Schwester Renata war aus ihrem Sekundenschlaf hochgeschreckt und warf beharrlich die geschälten Äpfel in die Komposttüte und Kerngehäuse und Schale zu den gezuckerten, mit Rum aromatisierten Apfelstückchen in die Edelstahlschüssel.
»Und Elias?«, fragte Clara, während sie Kerne und Stiele gelassen aus der Apfelstrudelfüllung heraussortierte.
»Er ist auf dem Heimweg. Am Mittwoch wird er in München ankommen. Dann muss er sich erst mal um ein neues WG-Zimmer kümmern. Sein altes hat er vor der Reise aufgegeben und seine Sachen bei einem Freund untergestellt. Am Wochenende will er seine Eltern besuchen und dann kommt er vielleicht auch bei uns vorbei.«
Großzügigerweise hatte Muriel ihr Wissen mit mir in der ersten Pause geteilt. Ich konnte sie schnell überzeugen, dass Vorfreude viel besser ist als eine halbe Überraschung. Hätte sie noch eine Stunde länger dichthalten müssen, wäre sie wahrscheinlich während der Mathestunde geplatzt.
»Er war lange weg, das hat ihn bestimmt verändert.« Clara mischte getrocknete Rosinen zu den Apfelstücken. »Freust du dich ihn wiederzusehen?«
Sollte das ein Verhör zu meinem Seelenleben werden? Selbst Schwester Renata und Li schienen gespannt auf meine Antwort zu warten. Tatsächlich klopfte mein Herz verräterisch schnell, wenn ich mich an unseren letzten gemeinsamen Tag erinnerte. Nach dem Ausflug nach München hatte er mir zum Abschied vor der Klosterkirche einen Kuss gegeben. Ich hoffte, dass er sich in den vier Monaten nicht allzu sehr verändert hatte.
»Ja, ich freue mich sehr.«
Clara schnippelte vor sich hin. »Gestern habe ich Steinwart in der Kirche getroffen. Er hat erwähnt, dass sein Sohn sich für Aufträge in unserer Kirche interessiert. Elias ist doch Schreiner und einen guten Handwerker können wir auf jeden Fall gebrauchen.«
Verblüfft blickte ich auf. Ich wusste zwar, dass Elias gerne mit alten Sachen arbeitete und sich für Denkmalpflege interessierte, aber er mied die Nähe seines Vaters, was ich gut verstehen konnte. Graf Steinwart war ein rechthaberischer, unfreundlicher Mann. Dennoch war er dem Kloster eng verbunden. Viele Äbte, die im Kreuzgang begraben lagen, stammten aus der Grafenfamilie und Steinwart führte die Tradition fort. Er unterstützte die Nonnen sowohl finanziell als auch mit ungefragten Ratschlägen. Seit Beginn der Renovierungsarbeiten traf er sich regelmäßig mit Mutter Hildegard. Wenn es nach mir ginge, hätte er besser Geld für eine neue Heizung spenden sollen. Das würde wenigstens den Lebenden im Kloster zugutekommen.
Elias hatte sich nach der Schule eine Ausbildungsstelle in München gesucht, da er es zu Hause kaum ausgehalten hatte. Der Graf war schwer enttäuscht gewesen, dass sein zweiter Sohn nicht studieren wollte.
»Am Samstag kommen Steinwart und Herr Rosenberg, ein Kunsthistoriker vom Denkmalamt, zu einer Besprechung. Vielleicht will Elias dazukommen«, überlegte Clara. Sie weigerte sich standhaft, Elias’ Vater Graf