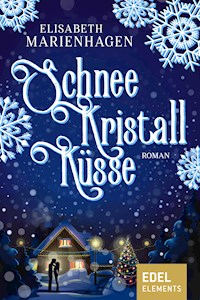5,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dp DIGITAL PUBLISHERS GmbH
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Die Winzerfrauen-Reihe
- Sprache: Deutsch
Die glücklichen Zeiten einer jungen Familie weichen den Schrecken des Krieges
Der finale Band der Familiensaga um Winzertochter Magdalena
1924: Winzertochter Magdalena und ihre Lieben erleben eine glücklich Zeit, doch dann stellt das Schicksal sie vor eine große Herausforderung. Zeitgleich wird die politische Situation mit Hitlers Machtergreifung immer heikler. Im Dorf ist bald nichts mehr, wie es war: Die Jahre sind geprägt von Angst vor Denunzianten und den Nazis. Als Heiners Schwager Joseph nach der Reichsprogromnacht hilfesuchend vor der Tür steht, wird es riskant für Magdalenas Familie. Denn der junge Zionist ist auf der Flucht vor der Gestapo und braucht ein Versteck …
Erste Leser:innenstimmen
„Fulminanter Abschluss einer bewegenden Reihe, die ich nicht so schnell vergessen werde!“
„Historisch hervorragend recherchierte und fesselnd verpackte Familien- und Liebesgeschichte.“
„Packend, emotional und authentisch!“
„Selten fand ich eine Protagonistin so sympathisch und habe so sehr mitgefühlt.“
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 437
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Kurz vorab
Willkommen zu deinem nächsten großen Leseabenteuer!
Wir freuen uns, dass du dieses Buch ausgewählt hast und hoffen, dass es dich auf eine wunderbare Reise mitnimmt.
Hast du Lust auf mehr? Trage dich in unseren Newsletter ein, um Updates zu neuen Veröffentlichungen und GRATIS Kindle-Angeboten zu erhalten!
[Klicke hier, um immer auf dem Laufenden zu bleiben!]
Über dieses E-Book
1924: Winzertochter Magdalena und ihre Lieben erleben eine glücklich Zeit, doch dann stellt das Schicksal sie vor eine große Herausforderung. Zeitgleich wird die politische Situation mit Hitlers Machtergreifung immer heikler. Im Dorf ist bald nichts mehr, wie es war: Die Jahre sind geprägt von Angst vor Denunzianten und den Nazis. Als Heiners Schwager Joseph nach der Reichsprogromnacht hilfesuchend vor der Tür steht, wird es riskant für Magdalenas Familie. Denn der junge Zionist ist auf der Flucht vor der Gestapo und braucht ein Versteck …
Impressum
Erstausgabe Juni 2022
Copyright © 2025 dp Verlag, ein Imprint der dp DIGITAL PUBLISHERS GmbH Made in Stuttgart with ♥ Alle Rechte vorbehalten
E-Book-ISBN: 978-3-96817-035-0 Taschenbuch-ISBN: 978-3-98637-781-6
Covergestaltung: Rose & Chili Design unter Verwendung von Motiven von shutterstock.com: © Praew stock, © Avatar_023, © Mykola Mazuryk, © ShotPrime Studio, © Miiisha Lektorat: Claudia Wuttke
E-Book-Version 08.04.2025, 16:25:28.
Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Sämtliche Personen und Ereignisse dieses Werks sind frei erfunden. Etwaige Ähnlichkeiten mit real existierenden Personen, ob lebend oder tot, wären rein zufällig.
Abhängig vom verwendeten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Unser gesamtes Verlagsprogramm findest du hier
Website
Folge uns, um immer als Erste:r informiert zu sein
Newsletter
TikTok
YouTube
Jahre im Wandel
Personenverzeichnis
Aus Wingert:
Familie Scholtes
Herbert, Vater, verstorben
Annegret, Mutter, verstorben
Lorenz, ältester Sohn, gefallen
Antonia, geb. Philipp, Lorenz’ Witwe
Frieder, beider Sohn
Alphons Berthold, Oberknecht, Antonias zweiter Mann
Valentin, Knecht
Heiner, Sohn, Maler und Bildhauer, heiratet Esther
Judith, Tochter von Heiner und Esther
Magdalena, heiratet Matthias Gronau
Familie Gronau
Gustav, Vater
Lieselotte (Lotte), Mutter, verstorben
Moritz, Sohn, gefallen
Stefan, Sohn, gefallen
Matthias, Hoferbe, verheiratet mit Magdalena
Martin, beider Sohn
Ella, (Eleonore), beider Tochter
Lydia Adams, eine Cousine
Gesinde:
Traudl, Köchin
Ida, Magd
Familie Kornbach
Herr Kornbach
Edelgard, seine erste Frau, verstorben
Dörte, seine zweite Frau
Carl, Sohn, in der Nervenheilanstalt
Constanze, Tochter, Magdalenas ehemals beste Freundin
weitere Kinder
In der Blauen Forelle
Familie Lauterer
Berta, geb. Marx, die Wahlschwester Magdalenas
Johann, ihr Mann
Johann, (Johannchen), Sohn
Liesbeth(Liesel), Tochter
Max und Leo, Zwillinge
Weitere Kinder
Helferinnen
Linda Ferber
Trudchen, ihre Schwester
Marie, ihre Schwester
Friederike Langen, Matthias’ ehemalige Verlobte
Eugen Burger, Lehrer, Nachfolger von Herrn Lanz, ausgewandert
Herr Meier, der neue Dorflehrer
Pfarrer Julius Grimm, Nachfolger von Pfarrer Holzmann
Alma Grimm, Julius’ Schwester und Haushälterin
Aus Leiwen
Die Jakobsons
Nathaniel Jakobson, Vater
Rivka, Mutter
Esther, Tochter, heiratet Heiner
Joseph, Sohn
Doktor Bender, Arzt, Nachfolger seines Vaters
Wilhelm Zänder, Matthias’ Cousin
Aus Trier
Doktor Ludes, Gynäkologe
Aus Düsseldorf
Hans Vollmer, Maler und Illustrator, Heiners Freund
Teil 1
1923 – 1928
Die Weihnachtskrippe
23. Dezember 1923
Magdalena saß in der Stube auf der Bank am Esstisch, gähnte und lehnte den Kopf an die Schulter ihres Mannes Matthias. Er war sicher auch müde. Jedenfalls hatte er dunkle Schatten unter den Augen. Ihr sechs Wochen alter Sohn hielt sie beide ganz schön auf Trab. Momentan schlummerte Martin friedlich in der Wiege, die hinten im Eck der Stube neben einem Ohrensessel ihren Platz gefunden hatte. Beneidenswert. Ihnen gegenüber saß ihr Bruder Heiner, der unverschämt ausgeruht aussah. Vor zwei Tagen war er aus Düsseldorf gekommen. Nicht nur, um das Weihnachtsfest mit ihnen zu feiern, sondern auch, um seinen Neffen in Augenschein zu nehmen, der ungefähr zwei Monate vor dem Geburtstermin am Martinstag auf die Welt gekommen war.
Immer wieder suchte Heiner ihren Blick. Bestimmt wollte er das Gespräch fortsetzten, in dem es um seine Herzensangelegenheit gegangen war. Vor dem Essen war Matthias ahnungslos hineingeplatzt. Magdalena richtete sich auf und nickte ihrem Bruder kaum merklich zu. Leicht war es nicht für ihn. Er in Düsseldorf und seine Liebste in Leiwen. „Freiwillige vor! Wer von euch hilft mir, die Krippe aufzubauen?“
„Hier, ich!“ Heiner hob sofort die Hand.
„Mich lass bitte aus!“, wehrte Matthias ab. „Meine Mutter hat ihre Figuren mit Argusaugen bewacht und mir tut heute noch der Hintern weh, wenn ich daran denke, dass mir einmal eine der Figuren hinuntergefallen und zerbrochen ist …“
Seine Mutter hatte ihn nach dem Motto: „Wer seine Kinder liebt, züchtigt sie“ erzogen. Unmittelbar nach Martins Geburt war sie einer Herzkrankheit erlegen. Seither brauchte Magdalena keine harschen Befehle oder Demütigungen mehr zu befürchten und statt Trauer beschlich sie mitunter ein Gefühl der Erleichterung.
„… Lenchen, ich bleibe freiwillig hier und hüte unseren Sohn.“
„Das nenne ich einen vorbildlichen Vater“, scherzte Heiner, der trotz seiner Unterschenkelprothese schneller aufgestanden war als sie.
„Wir sprechen uns wieder, wenn du selbst Kinder hast. Außerdem willst du deiner Schwester sicher eine Menge Düsseldorfer Kunstszenen-Klatsch erzählen. So oft siehst du sie schließlich auch nicht mehr.“
Heiner grinste, ging voraus und öffnete die gegenüberliegende Tür. Im Wohnzimmer duftete es herrlich weihnachtlich nach Nadelwald und Bienenwachs. Der Baum war etwas krumm gewachsen, was der üppige Weihnachtsschmuck mehr als wettmachte: Zuckerstangen, Äpfel, Strohsterne, Lametta, bunte Glaskugeln und ein paar vergoldete Walnüsse.
Die Kisten mit den Krippenfiguren hatten die Mägde bereits gestern heruntergetragen und den gusseisernen Ofen in der Frühe eingeheizt. Zu Weihnachten sollte es mollig warm sein im Wohnzimmer. Den schönsten Raum im Haus benutzten sie, wie es im Dorf üblich war, nur an hohen Feiertagen, zu besonderen Gelegenheiten oder für ausgewählte Gäste. Eine Schale mit Plätzchen stand auf dem Tisch. Magdalena griff nach einer Zimtwaffel und sog den leckeren Duft ein. „Möchtest du auch eine?“
„Später vielleicht.“
Gemeinsam hoben sie den Deckel von der Kiste. Erwartungsvoll sah Magdalena ihren Bruder an. Jetzt hatte er die Chance zu reden – und schwieg. Er griff nach einem der in Zeitungen eingeschlagenen Päckchen, wickelte das Papier ab und stellte einen der Heiligen Drei Könige auf den Tisch. Magdalena strich die Zeitung glatt. Sonst linste sie gerne in die alten Artikel hinein, doch er griff schon nach der nächsten Figur und befreite sie von ihrer Hülle. Bei Heiners Tempo hatte sie nicht einmal die Chance, die Überschriften zu lesen. Sie legte die Zeitung beiseite und breitete ein Leintuch über den Beistelltisch, auf dem der Stall thronen sollte. In dem Moment seufzte Heiner laut auf und ließ seine Hände sinken. „Es ist nicht zum Aushalten! Da will ich der Frau, die ich über alles liebe, einen Heiratsantrag machen, will wissen, ob sie mich nimmt. Pustekuchen – in ihrem letzten Brief stand, dass ihre Familie und sie ein paar Tage zu Verwandten fahren und erst heute Nacht von dort zurückkehren – Esther und ich treffen uns deshalb erst morgen.“
Seine Ungeduld fand sie verständlich, aber da klang noch mehr an. „Ich dachte, du wärest längst im Reinen mit ihr. Ihr kennt euch seit drei Jahren, habt ihr eure Zukunftspläne wirklich noch nicht besprochen?“
„Im Grunde schon, aber mein Übertritt klappt nicht und damit bricht die Voraussetzung für die Einwilligung ihrer Eltern weg. Also muss ich erst mit Esther reden und klären, wie sie unter diesen Umständen zu mir steht.“
„Braucht ihr die Zustimmung ihrer Eltern denn?“
„Nein, das nicht. In ein paar Wochen wird Esther einundzwanzig.“
„Na also. Damit ist sie volljährig.“
„Nichts, na also! Sie ist gläubig …“
„Wie lange weißt du schon, dass du nicht zum Judentum konvertieren kannst?“ Magdalena griff nach einem der kleineren Päckchen und wickelte ein Schäfchen aus. Sie gönnte ihrem Bruder das Glück mit Esther von Herzen, trotzdem war sie insgeheim froh, dass er katholisch blieb. Die Leute im Dorf hätten Heiner den Abfall von der Kirche nie verziehen. Ihm in Düsseldorf machte die Verachtung der anderen vielleicht nichts aus. Aber ihre Familie und sie mussten hier leben.
„Seit ungefähr sechs Wochen.“ Ihr Bruder hielt Maria in Händen und stellte sie neben den bärtigen, sehr viel älteren Joseph, den er zuvor ausgepackt hatte.
„Und du hast ihr die ganze Zeit keinen Ton davon gesagt?“ Ihr Blick blieb an dem ungleichen Paar hängen. Wieso war er so verzagt? Fürchtete er, als Krüppel mit einer Unterschenkelamputation nicht gut genug für die acht Jahre jüngere Esther zu sein?
„Ich habe ihr einen Brief geschrieben, aber nicht abgeschickt. Ich muss sie sehen, wenn ich ihr sage, wie die Dinge stehen. Wenn ich Esthers Ja-Wort habe, treten wir gemeinsam vor ihre Eltern und ich werde um sie kämpfen. Aber erst muss ich wissen, wie sie reagiert.“
Was für eine vertrackte Situation.
„Triffst du sie morgen bei ihren Eltern?“ Magdalena wickelte das nächste Päckchen aus, begutachtete das Jesuskind mit seinen drallen Armen und speckigen Beinen und legte den Wonneproppen in die Krippe. Ihr Sohn hatte deutlich weniger Fett auf den Rippen.
„Ist das hier die heilige Inquisition?“, fragte Heiner halb im Spaß, halb im Ernst. „Ich habe sie in meinem letzten Brief gebeten, mir morgen Mittag mit ihrem Bruder ein Stück entgegenzugehen. Wenn sie meinen Antrag annimmt, begleite ich sie nach Hause und stehe für uns ein. Wenn alle Stricke reißen, bleibe ich bis nach der Mitternachtsmette, um ihren Vater zu beweisen, wie ernst es mir mit dem Übertritt war.“
„Muss das sein? Damit brüskierst du die Leute im Dorf!“ Dass jeder in Wingert seine Sonntagspflicht erfüllen und – zumal an Weihnachten – die Messe besuchen musste, wenn er nicht von der Gemeinschaft geächtet werden wollte, wusste er ganz genau. Das brauchte sie ihm nicht zu erklären.
„Wenn ich Esther sonst nicht kriege?“ Heiner seufzte. „Außerdem hast du heute selbst die Sonntagsmesse geschwänzt!“
„Na, hör mal! Das ist etwas ganz anderes! Ich komme gerade erst aus dem Kindbett!“ Magdalena stemmte ihre Fäuste in die Hüften, während er ungerührt den Ochsen auspackte. „Seit Martins Geburt habe ich mich noch nicht wieder in der Öffentlichkeit gezeigt.“
Heiner runzelte die Stirn. „Fabrikarbeiterinnen können von so einem Luxus nur träumen. Die müssen spätestens drei Wochen nach der Entbindung wieder ranklotzen – achtundfünfzig Stunden in der Woche. Und weil ihr Lohn hinten und vorne nicht reicht, stehen manche mir sonntags Modell.“
„Und die Kinder?“ Magdalena dachte an ihren Sohn, den sie nur mit sorgsamer Pflege durchgebracht hatte.
„Landen meist in Heimen oder Waisenhäusern. Anders geht es nicht. Ihre Großmütter schuften oft selbst noch in der Fabrik und Krippenplätze sind rar.“ Heiner platzierte einen Schäfer, der Ausschau nach einem verlorenen Lamm hielt, etwas abseits von den anderen Figuren. „Die Frauen müssen aus Not heraus arbeiten gehen. Dazu sollte keine Mutter gezwungen sein.“
„Da sind wir einer Meinung.“ Manchmal vergaß Magdalena über ihren Sorgen die Dankbarkeit: Selbst in schlechten Zeiten hatten ihre Familie und sie immer genug Essen und ein Dach über den Kopf gehabt.
Während Heiner die Figuren in der Krippe zurechtrückte, sammelte sie die Zeitungen zusammen. Ihr Bruder erbat eine weitere Decke und verwandelte die Kiste kurzerhand in einen Hügel auf dem die Heiligen Drei Könige samt Kamel ihren Platz fanden. Zuletzt traten sie ein paar Schritte zurück und betrachteten das Krippenspiel. Edel sah es aus. Aber eins stand fest: Im nächsten Jahr, wenn Martin ein Krabbelkind war, würde sie Figuren aus Holz aufstellen. „Heiner …“
„Hm?“ Er zuckte zusammen, als sie ihm ihre Hand auf den Arm legte. Vermutlich hatte er an Esther gedacht. „Ich wünsche dir alles Glück der Welt für morgen.“
Muttergefühle
24. Dezember 1923
Magdalena saß in dem mit dunkelgrünem Samt bezogenen Ohrensessel in der Stube und stillte Martin. Matthias schmierte ihr ein Brot, schnitt es in handliche Häppchen und setze den Teller mit ihrem Frühstück auf den kleinen Beistelltisch in ihrer Reichweite.
„Was war denn heute Nacht mit ihm los?“
Abwechselnd hatten Matthias und sie das brüllende Kind herumgetragen und vergebens versucht, es zu beruhigen.
„Wenn ich das wüsste.“ Endlich war der kleine Vielfraß satt. Bäuchlings legte Magdalena Martin auf ihren Unterarm und er hob den Kopf, zumindest versuchte er es.
„Schau dir unseren kleinen Kämpfer an, Lenchen!“
Die neue Position schien ihrem Sohn recht gut zu behagen. Allerdings nicht sehr lange, schon quengelte er wieder los.
„Bleib sitzen und iss.“ Matthias nahm ihr das Kind ab und vergaß dabei nicht, Martins Kopf zu stützen. „Na du, willst du in die Küche? Oder lieber hinüber zu Tante Berta in die Blaue Forelle?“
Martin gluckste, während Magdalena ihr Frühstück verspeiste.
„Ich sehe schon, das ist die richtige Richtung. Wollen wir weiter zum Laden der Ferber-Schwestern?“
Martin zog eine Schnute.
„Oha, möchtest du etwa nach Düsseldorf zu Onkel Heiner? Tja, das hast du nicht richtig durchdacht. Der ist doch hier. Und, was sagst du dazu?“
Das Bäuerchen, das Martin gequält hatte, löste sich.
Magdalena kicherte. „Da hast du deine Antwort.“
„Zu schade, dass ich in die Schiefergrube muss. Bis nachher, ihr zwei.“ Matthias reichte ihr das Kind.
Nachdem er die Tür geschlossen hatte, legte sie ihren Sohn behutsam in die Wiege und breitete ein mit Daunen gefülltes Kopfkissen über ihn. Sein Federbett. Der Bezug zeigte den gestiefelten Kater, der fröhlich pfeifend durch eine hügelige Landschaft in Richtung einer Burg wanderte. Ihre Freundin Friederike hatte die Zeichnung Heiners zufällig in die Finger bekommen, seine Zustimmung eingeholt und daraus ein Geschenk für Martin angefertigt.
Der Kleine schaffte es irgendwie, die Arme aus der Decke zu befreien. Er ruderte mit den Händen herum und quäkte leise. Magdalena sank gähnend in den Ohrensessel. Ob sie überhaupt alles richtig machte? Seit sie selbst Mutter geworden war, vermisste sie ihre eigene mehr denn je. Sie wischte über ihre feuchten Augen, beugte sich vor und schubste die Wiege sanft an. Leise knarrten die Kufen auf den Dielen hin und her. Martins Protest wurde schwächer. Als er ganz abgeflaut war, ließ Magdalena ihre Hand sinken. Endlich Ruhe! Eigentlich hätte sie jetzt aufstehen und nach nebenan in die Küche gehen sollen, um bei den Vorbereitungen für das Weihnachtsessen zu helfen. Hüpfende Schritte, die vor der Tür abrupt Halt machten. Sie sprang auf. Einen Moment zu spät.
„Mutter schickt mich“, krähte ihr Neffe Frieder unbekümmert. Goldblonde Locken umspielten ein Engelsgesicht. Haarfarbe und blaue Augen hatte der Junge von ihrer Schwägerin Antonia geerbt. Abgesehen davon glich er seinem verstorbenen Vater, Magdalenas ältestem Bruder Lorenz, Zug um Zug. In seinen Händen hielt Frieder eine große, wohl nicht allzu schwere Schachtel.
„Pst! Nicht so laut!“
„Wiegenkinder sind blöd. Die schlafen immer bloß …“
Wenn es nur so wäre!
„Da ist eine Tüte mit Plätzchen drin. Gefällt dir das Papier? Ich habe die Weihnachtsbäume darauf selbst gedruckt. Papa hat Kartoffelstempel für mich geschnitzt.“ Alphons, Antonias zweiter Mann, zog Lorenz’ Kind wie sein eigenes groß und ihr Neffe lief ihm hinterher wie ein Hündchen.
„Was für eine schöne Idee! Sag deinen Eltern herzlichen Dank. Ich habe auch etwas für dich.“ Gefolgt von ihrem neugierigen Neffen eilte sie in die Küche hinüber.
Zwei gerupfte Gänse lagen auf dem mit einem Wachstuch geschützten Tisch. Einige Flaumfedern waren auf den Boden gefallen. Die restlichen steckten in einem Stoffbeutel und würden als Ersatz für verklumpte in Kissen oder Bettdecken dienen. Traudl, die Köchin, rief die jungen Mägde an den Tisch.
„Die sind ja schon tot“, maulte Frieder. „Das Schlachten hätte ich mir gern mal angeschaut. Mama wird immer böse, wenn ich sage, dass ich zugucken will.“
„Da hat sie recht. Das ist nichts für kleine Kinder“, gab Magdalena zurück.
„Ich bin schon sechs!“
Die mollige Traudl wandte den Kopf zu ihnen um und lachte. „Kinderwille Kälberdreck und wer ihn tut, der is ein Depp.“
„Pff!“ Frieder machte kehrt und stapfte in die Stube zurück.
Magdalena kniete beim Küchenschrank nieder. In dem Abteil für Krimskrams lagerten derzeit einige Plätzchentüten und Zuckerzeug: Bonbons und Karamellen.
„Wenn die Gäns’ gerupft sin, müsst ihr die Federkiele abflammen.“ Mit dem Schürhaken zog die Köchin die Abdeckung eines der Kochfelder beiseite und entfernte die Eisenringe, die für unterschiedlich große Töpfe gedacht waren. Feuer züngelte aus der Öffnung empor. Als Traudl das Tier über die Flammen hielt, stieg Magdalena der strenge Geruch verbrannter Federn in die Nase.
„Jetzt bist du dran, Ida. Und gib acht! Soll ich Ihnen unterdessen einen Malzkaffee kochen, gnädige Frau?“, fragte Traudl.
„Nein danke. Wie ich sehe, hast du alles wunderbar im Griff.“
Die Köchin strahlte. Mit einer Tüte Naschwerk in der Hand ging Magdalena zur Stube zurück. Die Tür war zugezogen. Sie drückte die Klinke herunter. Frieder stand mit dem Rücken zu ihr an der Wiege. Lächelnd trat sie näher. Dass sein kleiner Vetter ihn doch interessierte, hatte sie nicht erwartet.
„Schau einmal, hier sind ein paar …“ Der Rest des Satzes blieb ihr im Hals stecken. Ein Schreckenslaut entfuhr ihrer Kehle. „Was tust du da?“ Die Tüte mit den Plätzchen glitt Magdalena aus den Fingern und fiel mit einem leisen Schlag zu Boden.
„Er sollte nicht frieren, da habe ich ihn zugedeckt.“ Mit großen blauen Augen sah er unschuldig zu ihr auf und lächelte. „Wenn ich die Decke nicht festhalte, rutscht sie runter …“
„Aber du … du …“
Er presste das Kissen über Martins Mund und Nase! Selbst jetzt drückte er noch zu!
„Sofort weg da!“ Sie packte Frieder und zerrte ihn rüde von ihrem Sohn fort. Er stolperte zurück, ihr war es egal.
„Martin!“ Hastig riss sie das Kissen von dem Gesicht ihres Sohnes.
Einen Moment blieb es still. Ein leises Wimmern. Gott sei Dank. Ihm war nichts passiert! Sie hob ihr Kind aus der Wiege, strich ihm über den Kopf und hielt Martin an ihrer Brust geborgen. Erst jetzt schlug der Schock durch. Ihre Beine zitterten, kalter Schweiß lief ihr den Rücken hinunter. Mit ihrem Sohn im Arm sank sie auf den Sessel und atmete ein paar Mal tief durch. „So etwas darfst du nicht tun! Niemals, Frieder. Hörst du?!“
„Er hat ein bisschen geweint und ich dachte, ihm ist kalt. Mutter sagt, dass Babys es immer warm haben sollen.“ Ihr Neffe beobachtete sie sehr genau. „Hast du dich erschreckt?“
„Ja, sehr!“ Bei ihrer Antwort huschte ein zufriedener Ausdruck über sein Gesicht. Nein, das konnte nicht sein. Er war ein Kind, der Sohn ihres ältesten Bruders – und kein Monster. Trotzdem hätte sie ihn am liebsten an den Schultern gepackt und wütend aus dem Zimmer gejagt. „Wenn wieder etwas mit Martin ist und du helfen willst, holst du in Zukunft bitte mich oder einen anderen Erwachsenen.“
„Das mache ich“, antwortete Frieder fügsam.
Aber es würde kein nächstes Mal geben. Magdalena war fest entschlossen, ihren Sohn nie mehr mit ihm allein zu lassen. Jedenfalls nicht in nächster Zeit. Ob Frieder überhaupt begriffen hatte, was sie derart aufregte? Mühsam schluckte sie ihren Ärger hinunter und beschloss, ihm die Situation zu erklären, da Antonia ihm offensichtlich die elementarsten Dinge nicht beigebracht hatte. „Weißt du, Martin ist noch so klein, er kann deine Hände nicht wegschieben. Er hätte ersticken können, wenn du ihm das Kissen auf Mund und Nase drückst. So etwas darfst du nicht tun, niemals!“
„Oh, ach so“, meinte er. „Wollen alle Frauen Kinder?“
„Alle sicher nicht.“
„Meine Mutter möchte unbedingt eine Schwester für mich haben. Mich fragt sie gar nicht.“
„Würdest du dich denn über ein Geschwisterchen freuen?“
„Nein, ich glaube nicht.“
Aus einem Impuls heraus kniete Magdalena vor ihm nieder. „Aber es ist doch schön, wenn du jemanden zum Spielen hast.“
„Was soll ich denn mit einem Mädchen spielen?“
„Vielleicht wird es ein Brüderchen?“
„Mama will aber ein Mädchen. Und wenn es weint, bin bestimmt ich schuld. Ich bin immer an allem schuld.“
„Wolltest du darum nicht, dass Martin schreit?“
„Ja!“ Frieder schniefte. „Ich dachte, du sagst es der Mama. Die schimpft sogar, wenn ich Spinnen die Beine ausreiße. Du verrätst mich doch nicht? Sonst krieg ich Haue.“
„Nein, das mache ich nicht, das verspreche ich dir.“ Von den Erziehungsmethoden ihrer Schwägerin hielt Magdalena nicht gerade viel und sie hoffte nur eins, dass Martin später einmal nicht so über sie redete wie Frieder über seine Mutter.
Er deutete auf die Cellophantüte, die am Boden lag. „Ist die für mich?“
Magdalena nickte.
Frieder holte sie und besah die Plätzchen von allen Seiten. „Na ja, ein paar sind noch heile. Ich muss jetzt gehen.“
Erleichtert atmete Magdalena auf. Sie legte Martin in seine Wiege zurück, lauschte seinen Atemzügen und beobachtete ihn, sein zartes Gesicht mit der kleinen Nase. Irgendwann wurde sie ruhiger, schließlich gähnte sie sogar. Aber schlafen? Höchstens kurz die Lider schließen …
***
Als sie die Augen öffnete, saß Heiner schräg gegenüber auf dem dunkelgrünen Sofa mit dem Nussbaumumbau, in den ein ovaler Spiegel eingelassen war. Zu Lebzeiten ihrer Schwiegermutter hatte keine der Mägde oder gar Magdalena es je gewagt, stehen zu bleiben und ihre Konterfeis zu bewundern. Selbst Wochen nach Lieselottes Tod befolgten sie dieses ungeschriebene Gebot noch. Ihr Bruder hielt einen Stift in der Hand, ein Zeichenblock lag vor ihm.
„Malst du etwa mich?“ Sie schaute zur Wiege und die Erinnerung kam wieder hoch. Frieder mit dem Kissen über Martin gebeugt.
„Hätte ich dich wecken und um Erlaubnis bitten sollen?“
„Wie lange sitzt du denn schon da?“
„Ungefähr seit einer Stunde.“
„Ausgerechnet heute nicke ich einfach ein!“ Martin! Wie hatte sie schlafen können?
Heiner legte den Stift beiseite. „Die Zeichnung interessiert dich nicht? Du mit offenem Mund, sichtlich schnarchend.“
„Zeig her!“, befahl sie gespielt streng.
„Wie gnädige Frau wünschen.“ Er trat an die Wiege und reichte ihr das Blatt.
Den Sessel, die Wiege und ihren Körper hatte er mit ein paar Strichen skizziert, ihren linken Arm auf der Lehne nur angedeutet. Die rechte Hand lag im Schoß, den Kopf hielt sie nach unten geneigt und ein wenig zur Seite gedreht. Die kurzen, dunklen Locken umkringelten die Wangen. Ihre Gesichtszüge waren deutlich sorgfältiger ausgearbeitet. Die geschlossenen Lider, der leicht geöffnete Mund, die kleine Stupsnase. Sah sie wirklich so aus? Zierlich und schmal, beinahe wie ein übermüdetes Kind – und gleichzeitig mütterlich? Dabei fehlte ihr jeder Instinkt. Sonst wäre sie nicht so vertrauensselig in die Küche gegangen, um Plätzchen zu holen.
Heiner beugte sich über die Wiege und musterte ihren Sohn. „Wenn meine Erinnerung mich nicht trügt, sieht er genauso aus wie unser Neffe in dem Alter.“
„Das stimmt nicht“, fuhr sie auf. „Die beiden gleichen sich kein bisschen!“
„Du klingst verärgert? Hat Frieder etwas angestellt?“
Sollte sie ihm die Wahrheit sagen und aus einer Mücke einen Elefanten machen? Frieder war ein Kind! Er hatte es nicht böse gemeint. „Ich bin einfach nur todmüde und erschöpft.“
„Dann geh hoch und leg dich hin. Ich kümmere mich so lange um den Kleinen.“
Magdalenas Blick ging aus dem Fenster und wanderte von der Blauen Forelle schräg gegenüber zu ihrem Elternhaus. Inzwischen wohnte Antonia mit ihrem zweiten Mann dort. Es war direkt an den Tanzsaal der Gastwirtschaft angebaut, einen ehemaligen Stall – und seit sie Matthias vor vier Jahren in ihr neues Zuhause gefolgt war, sah sie die Gebäude von dieser Warte aus.
Magdalena hielt das Bild, das ihr Bruder gezeichnet hatte, immer noch in den Händen. Sie zwang sich zu einem Lächeln und gab es ihm zurück. „Die Zeichnung wäre ein wunderbares Weihnachtsgeschenk für Matthias.“
„Vielleicht zusätzlich.“
Aus den Augenwinkeln heraus beobachtete sie Herrn Kornbach, der mit seinem Sohn die Straße entlang Richtung Wald hochmarschierte. Ob sie Holz schlagen wollten?
„Ich habe mich gestern über den Kornbach gewundert. Der hat Matthias und mich kaum gegrüßt.“
„Wir gelten als Judenfreunde. Das passt seiner neuen Frau nicht. Insbesondere du stehst im Blickpunkt des Interesses. Jeder im Ort weiß, wohin es dein Herz zieht.“
„Haben die nichts Besseres zu tun, als über mich zu klatschen?“, fragte ihr Bruder kopfschüttelnd.
„Offensichtlich nicht. Die neue Frau Kornbach ist im Hetzen ganz groß und ihr Mann frisst ihr aus der Hand. Sie ist in München aufgewachsen und eine glühende Anhängerin Adolf Hitlers und seiner Ideen. Bei jeder Gelegenheit plappert sie etwas von ‚Deutschland den Deutschen‘ und dass Juden die ‚Ursache allen Übels‘ seien.“
„Ein Glück, dass die Hitler-Partei nach dem November-Putsch verboten worden ist.“
„Du solltest sie mal von dem Kerl schwärmen hören. Ein schöner Mann sei er, ihr Idol, und wie er reden könne …“
„Der gelackte Affe schön? Hoffentlich verschwindet der lange hinter Gittern. Und jetzt geh nach oben und ruh dich aus. Dein Sohn ist in den besten Händen.“
„Das will ich meinen.“ Lydia, die Cousine ihres Schwiegervaters, eine hagere, hochgewachsene ältere Dame, die Matthias und Heiner noch ein Stück überragte, trat mit ihrem Strickzeug in der Hand ein. Ursprünglich war sie gekommen, um Matthias Mutter zu pflegen, inzwischen stand sie Magdalena mit Rat und Tat zur Seite und war ihr eine unentbehrliche Stütze geworden.
Im Schlafzimmer warf Magdalena einen Blick auf die Uhr. Kurz nach neun. Noch vier Stunden, bis ihr Bruder Esther die entscheidende Frage stellen würde. Sie war selbst ganz aufgeregt.
Esthers Entscheidung
24. Dezember 1923
Heiner wählte den Weg nach Leiwen hinunter durch die Weinberge. Es war zwar kalt, aber nicht allzu glatt. Sein Atem bildete kleine Wölkchen, die so schnell verschwanden, wie sie auftauchten, und ihn reizte der Gedanke, diese vergängliche Schönheit auf eine Leinwand zu bannen: Ein blaugrüner Untergrund, eine Schlangenlinie im unteren Drittel und durchscheinende, wabernde Nebel. Die sanften Hänge, der glitzernde Fluss, die Moselschleife und die geraden Reihen der Weinstöcke drängten erstaunlich oft in seine Bilder. Nicht immer konkret als Landschaft, sondern verfremdet in Linien und Formen. Auch die Frau, zu der es sein Herz zog, tauchte häufig als Thema auf. Nicht ihr Gesicht oder ihre Figur, sondern ihr helles, lichtes Wesen. Esther hatte das Trostlose aus seinen Gemälden vertrieben, das schwere Dunkel verdrängt und die Erinnerungen an den Krieg erträglicher gemacht. Darum liebte er sie – und für das, was sie war: ein wertvoller, warmherziger Mensch. In dem Moment glitt er ab. Er schwankte, breitete instinktiv die Arme aus und schaffte es, nicht hinzuschlagen.
Dieses Bild würde er malen – und die Warnung war angekommen. Deutlich achtsamer als zuvor stieg Heiner den steilen Pfad hinunter. Auf der Ebene schritt er rasch aus und entdeckte in der Ferne schließlich zwei Gestalten. Dunkle Mäntel, dicke helle Schals und ebensolche Pudelmützen! Esthers wiegender Gang! Sie waren es. Joseph winkte ihm zu.
Seine Aufgabe als Chaperon nahm der pfiffige Knirps nur sporadisch wahr, etwa wenn ihr Grüppchen das Haus seiner Eltern verließ oder sie darauf zugingen. Für seine zehn Jahre war er durchaus verständig, besonders, wenn ihm als Anreiz eine Kinokarte winkte. Meist lief er voraus oder blieb ein wenig zurück und Esther und Heiner genossen für eine kurze Zeit ein fast ungestörtes Glück.
Joseph hob die Hand, und seine Schwester und er stürmten wie auf Kommando los. Lachend kamen die beiden bei Heiner an und während sie verschnauften, stiegen milchige weiße Atemwölkchen zum Himmel. Die sich mit seinen mischten, ehe sie vergingen.
„Du lahme Ente!“ Joseph grinste triumphierend, dabei war die Verliererin ihm nur um Haaresbreite unterlegen.
Nachdem Heiner sich vergewissert hatte, dass kein Mensch zu sehen war, neigte er den Kopf zu der lächelnden Esther hinunter und drückte ihr einen Kuss auf die weichen Lippen. Danach war es an der Zeit, gut Wetter bei Joseph zu machen. „Komm mal her. Ich will was prüfen. Ich glaube, du reichst mir schon bis zum Kinn. Kann es sein, dass du gewachsen bist?“
Der Junge nickte stolz.
„Es geht doch nichts über ein geschultes Auge. Wie du siehst, ist es mir gleich als Erstes aufgefallen.“
„Famos. Du bist wirklich ein feiner Kerl.“ Auf Josephs Stirn erschien eine steile Falte. Mit düsterer Miene sagte er: „Ich hoffe, dass Papa seine Meinung noch ändert. Ich hätte viel lieber dich als Schwager und nicht Mendel Marx. Der hat ganz schiefe Zähne, spuckt beim Reden wie ein Lama und hält Filme und Kinos für reine Zeitverschwendung.“
Heiner sah fassungslos zu Esther, die seinem Blick auswich.
„Mit dem kann ich überhaupt nicht reden. Mit dir schon. Du hast Ahnung. Heiner, ich würde mir so gerne ‚Der Mann mit der eisernen Maske‘ angucken. Es ist ein Abenteuerfilm, genau das Richtige für mich. Darin geht es um den Zwillingsbruder von Ludwig dem Vierzehnten. ‚Die Kette klirrt‘ soll auch furchtbar spannend sein. Kennst du den Film?“
Irgendwie brachte er es fertig, zwei Worte herauszupressen. „Leider nicht.“
Esther hielt ihren Kopf nach wie vor gesenkt. Demnach war es wahr. Ihr Vater hatte einen anderen für sie ausgesucht. Sollte sie ihm jetzt auf sein Geheiß den Laufpass geben? Heiner biss die Zähne zusammen, wollte ihr in die Augen schauen, und wissen, wie sie zu dem Ansinnen stand. Sie guckte stur zu Boden.
Joseph plapperte weiter. „Da rettet ein Mann Bergleute in einer Grube vor dem Ertrinken. Aber alle spannenden Filme kriegen ein Jugendverbot. Das ist grenzenlos gemein.“
„Wir sollten nicht länger hier herumstehen, lauf schon einmal vor, Joseph, wir gehen nach Hause“, sagte Esther leise.
Ihr Bruder begriff endlich, dass seine Schwester mit Heiner alleine sein wollte, um eins ihrer „langweiligen Erwachsenengespräche“ zu führen, wie er es nannte. Er schielte zur Mosel. „Ich gucke mal, was das Eis macht.“
„Geh aber nicht drauf“, rief Esther ihm nach. Endlich sah sie zu Heiner auf. „Ich würde meines Lebens nicht mehr froh, wenn ihm unter meiner Obhut etwas passiert.“
„Dein Vater hat dir also einen Ehemann ausgesucht?“ Wieso wirkte sie angesichts dieser Tatsache derart gelassen? Ihn kostete es seine ganze Kraft, ruhig zu bleiben. Langsam gingen sie hinter Joseph her.
„Papa findet auf einmal, dass es höchste Zeit wird, mich zu verheiraten. Ohne mein Wissen ist er an einen Heiratsvermittler herangetreten, hat sich die Kandidaten angesehen und einen für mich ausgewählt.“
Wütend presste Heiner die Kiefer aufeinander. Seine Zähne knirschten, als ob er sie zu Staub zermahlen wollte.
„Auch die Ehe meiner Eltern ist auf diese Weise arrangiert worden. Vater hat mit goldenen Zungen auf mich eingeredet, damit ich den Antrag akzeptiere. Sogar Mutter hat ihn unterstützt, nur Joseph ist auf meiner Seite. Ich werde Mendel nicht nehmen.“ Esther seufzte. „Wenn ich nur wüsste, was auf einmal in Papa gefahren ist.“
„Korrespondiert er mit Rabbi Hanauer?“
„Schon seit einer Weile. Woher weißt du davon?“
„Weil das sein Verhalten erklärt. Mit dem Übertritt wird es nichts werden.“
„Wieso klappt es nicht?“, flüsterte sie tonlos. „Der Rabbi wusste um deine Beweggründe und hat deinen Wunsch nach der langen Zeit trotzdem abgelehnt? Das kann ich nicht verstehen! Wie hast du dich gefühlt? Ich an deiner Stelle wäre sehr wütend gewesen.“
„Im ersten Moment war ich außer mir vor Zorn! Sobald ich mich etwas beruhigt hatte, war ich zugänglicher für seine Argumente. Er will nicht ins Visier der Deutschnationalen geraten und fürchtet um seine Familie. Ich habe ihm gesagt, dass ich trotzdem nicht von dir lassen würde. Zum Abschied hat er mich umarmt und gemeint, ich solle mir einen anderen Rabbi suchen, einen, der mutiger sei als er.“
„Das brauchst du nicht!“ Eine jähe Röte überhauchte ihr sonst sehr blasses Gesicht. Unwillkürlich waren sie stehen geblieben. Esther streifte einen Handschuh ab, wandte ihm ihr Gesicht zu und verzog ihre Lippen zu einem anbetungswürdigen Lächeln. Ihm stockte der Atem. Zärtlich strich sie ihm über die Wange. Ihre Fingerspitzen waren kalt. Er fing sie ein und umschloss sie mit seiner warmen Hand. „Heiner, ich liebe dich! Wohin du gehst, dahin gehe auch ich und wo du bleibst, da bleibe auch ich. Wo du bist, da will ich sein …“ Sie verstummte.
Dein Volk ist mein Volk, dein Gott ist mein Gott. Wo du stirbst, da sterbe ich auch, ergänzte er in Gedanken. Doch das hatte hoffentlich noch lange Zeit. Dass sie nicht den ganzen Bibelvers aus dem Buch Ruth zitierte, war ihm gleich. Sein Gott musste nicht ihrer werden. Wenn er nicht einmal selbst wusste, woran er noch glaubte. An einen gütigen Vater im Himmel? Er schob den Gedanken beiseite. Was zählte, war das Hier und Jetzt. Er riss sie in seine Arme und drückte seine Lippen auf ihren Mund. Und wenn die halbe Welt zugeschaut und sich ereifert hätte, dieser Moment und dieser Kuss gehörte nur ihnen. Esther erwiderte seine Leidenschaft mit Hingabe und schmiegte sich dichter an ihn. Sie zu liebkosen, sie zu küssen … es war wie ein Rausch! Atemlos hob er den Kopf und stieß die Worte hervor, die ihm auf der Seele brannten. „Heirate mich, werde meine Frau!“
Ein lautes Knacken. Verflucht, den Jungen hatte er ganz vergessen. Erschrocken ließ er die Arme sinken. Esther wirbelte herum. Joseph hatte einen dürren Ast gefunden und entzwei gebrochen. Damit klopfte er auf einer gefrorenen Pfütze herum. Heiner seufzte erleichtert und fing an zu lachen. Sein angehender Schwager … störte ihn mitten im Heiratsantrag. „Und? Willst du mich?“
„Ja“, flüsterte Esther. Sie sagte es noch einmal lauter und schrie es zuletzt fast hinaus. „Ja! Ja, ich will!“
„Mein Stern! Mein süßer, wunderbarer Stern!“ Glücklich riss er sie ihn seine Arme. Für diese Antwort musste er sie küssen. Schließlich fasste er nach ihrer Hand, zog ihre kalten Finger an die Lippen und legte seinen Arm um sie. „Lass uns gehen, du frierst.“
Gemeinsam setzten sie ihren Weg fort und schlossen zu Joseph auf. Ihr Bruder hatte unterdessen seinen Schwur vergessen, dem Eis auf dem Fluss fernzubleiben und steuerte auf die Mosel zu.
„Sofort weg da!“, mahnte Heiner ihn.
„Seltsam, dass Papa wegen deines Übertritts geschwiegen hat. Ich hätte seine Beweggründe besser verstanden. Wegen Mendel habe ich ihn sogar angeschrien. Dabei möchte er lediglich unsere Gesetze befolgen.“
„Ich weiß.“ Heiner hatte nicht umsonst mit dem Hebräischen gekämpft und das jüdische Recht kennengelernt, die Halacha. Die es einem Goi, einem Andersgläubigen wie ihm, nicht gerade leicht machte. Wild entschlossen hatte er begonnen, die Ge- und Verbote auswendig zu lernen. Angefangen beim richtigen Anlegen des Gebetsriemens, über die Vorschriften zum Essen, bis hin zu denen bei der intimen Vereinigung von Mann und Frau. „Deswegen wollte ich ja übertreten. Trotz Rabbi Hanauers Ansicht, dass jemand, der das Judentum freiwillig zu seiner Religion wähle, schon ein wenig meschugge sein müsse. Ein bisschen verrückt – oder sehr verliebt, was letztlich auf das Gleiche hinausliefe. „Was ich bei ihm wolle, ich bräuchte mein Leben nicht nach sechshundertdrei Geboten und Verboten auszurichten. Dafür solle ich froh und dankbar sein.“
Diese Regeln, die Mizvot, galten nicht nur in Deutschland, sondern überall auf der Welt. Ein amerikanischer Jude, der eine Moskauer Synagoge besuchte, sang dort die gleichen Lieder, sprach die gleichen Gebete und die Gemeinde lebte nach den gleichen Regeln wie bei ihm zuhause. Vielleicht beruhte das Gerücht von einer weltumspannenden jüdischen Verschwörung auf diesem Gefühl der Gemeinschaft, das aus dem Befolgen der Regeln der Halacha entstand? Ziemlich traurig, wenn es so wäre. Esther schmiegte sich dichter an ihn.
„Heiner, mein Vater ist ein guter Vater. Dass er mich gemäß den Gesetzen unseres Glaubens verheiraten will, werfe ich ihm nicht vor. Jedenfalls solange er mich nicht in eine Ehe zwingt. Wenn er das täte, würde ich mit dir davonlaufen. Eins sollst du noch wissen: Ich werde meine Religion nicht ablegen wie einen schäbigen Mantel. Ich bleibe Jüdin.“
Obwohl sie vermutlich als Abtrünnige galt, wenn sie eine Ehe mit ihm einging. „Ich habe nichts anderes erwartet.“
Esther und er scheuchten Joseph vor sich her und bogen schließlich nach links in die Römerstraße ab. Die ersten Häuser kamen in Sicht und Heiner nahm seufzend den Arm von ihrer Taille und pfiff ihren Anstandswauwau zurück an ihre Seite. Es ging noch einmal nach links in die Ausoniusstraße.
Wenig später standen sie vor dem zweistöckigen Haus, das die Jakobsons gemietet hatten. Jetzt hieß es, sich wappnen – und auf in den Kampf.
Ein ernstes Gespräch
24. Dezember 1923
Heiner betätigte den Messingklopfer an der Haustür der Jakobsons und betrachtete das kleine Kästchen neben dem Türrahmen. Die Mesusa hing absichtlich schief, um Menschen an die ihnen innewohnende Unvollkommenheit zu erinnern. Energische Schritte im Flur. Esthers Vater öffnete ihnen. „Herein mit euch. Bitte, treten Sie auch ein, Herr Scholtes. Wir haben Sie erwartet.“
„Danke sehr.“ Immerhin hatte Herr Jakobson ihm nicht die Tür vor der Nase zugeschlagen.
An sich mochte Heiner den lebhaften kleinen Mann mit den kurzen grauen Haaren, dem gepflegten Vollbart und dem gewinnenden Lächeln, das sein Gastgeber heute jedoch nicht zeigte. Mit undurchdringlicher Miene nahm Herr Jakobson ihm den Mantel ab, versah ihn mit einem Bügel und hängte ihn an einen der Messinghaken der Garderobe.
„Mama, wir sind da. Ich hab solchen Hunger.“ Joseph stürmte in die Küche zu seiner Mutter.
Was Frau Jakobson antwortete, konnte Heiner nicht verstehen. Sie sprach leise. Er folgte seinem Gastgeber in das Wohnzimmer. Der runde Esstisch, die passenden Stühle und die Vitrine – der gemütlich eingerichtete Raum erinnerte ihn an die Stube im Haus seiner Eltern, an seine Kindheit. Im Kreis von Esthers Familie fühlte er sich wohl. Gern gesehen war er derzeit leider wohl nicht.
„Bitte, nehmen Sie Platz, Herr Scholtes.“ Herr Jakobson deutete auf einen der Sessel, ließ sich auf dem Sofa nieder und klopfte auf die Sitzfläche. „Esther, komm her.“
Widerspruchslos folgte sie der Anweisung ihres Vaters und setzte sich. Den Rücken hielt sie sehr aufrecht, die Füße eng beisammen, die Hände sittsam im Schoß gefaltet und schaute stumm von einem zum anderen. Sie schwiegen und lauschten Josephs lautstarkem Jammern.
„Aber Mama, bis dahin bin ich verhungert.“
„So schnell passiert das schon nicht. Ich gehe nun hinüber, um unseren Gast zu begrüßen.“
„Das ist doch nur Heiner, der gehört längst zur Familie. Dem macht es gar nichts aus, wenn du den Kuchen anschneidest und mir vorher ein Stück abgibst.“
„Joseph!“
Schritte kündigten ihr Kommen an. Heiner sprang auf, ging Esthers Mutter entgegen und neigte höflich den Kopf. Sie lächelte, wenn auch flüchtig. Die Hand reichte er ihr nicht. Inzwischen wusste er, dass fromme Jüdinnen ausschließlich ihren Ehemann berühren durften.
Frau Jakobson nahm neben ihrer Tochter Platz. Wie eine zu allem entschlossene Leibgarde hatten Esthers Eltern sie in ihre Mitte genommen – und er konnte endlich loslegen: „Ich werde nicht lange um den heißen Brei herumreden. Ich liebe Esther und bin gekommen, um Sie um die Hand Ihrer Tochter zu bitten.“
Herr Jakobson schüttelte den Kopf. „Ihre Bewerbung lehne ich ab.“
„Vater!“ Esther hatte trotz allem wohl eine andere Antwort erhofft.
„Herrje, Papa! Ich mag euren Streit nicht anhören.“ Joseph, der im Türrahmen erschienen war, flüchtete in den Flur. Gleich darauf fiel eine Tür krachend ins Schloss.
„Ihre Tochter und ich sind uns einig. Wir lieben uns. Für Esther steht ein Haus bereit, ich kann eine Frau und auch eine Familie ernähren. Mein Leumund ist einwandfrei. Sie beide kennen mich lange genug. Sie wissen, dass ich ein anständiger Mensch bin.“
„Papa, das kannst du nicht bezweifeln!“
„Herr Scholtes, ich schätze Sie als Freund, aber nicht als Mann für meine Tochter. Sie sind kein Jude.“
„Und daran wird sich nichts ändern. Hitlers Marsch auf die Feldherrenhalle und eine Attacke auf seinen Sohn haben Rabbi Hanauers Ansicht über meinen Übertritt leider geändert. Rechte Schlägertrupps haben den jungen Mann durch Düsseldorf gejagt und halbtot geprügelt. Der Rabbi will nicht ins Visier völkischer Fanatiker geraten. Er möchte seine Familie schützen und niemanden provozieren. Das verstehe ich.“
„Suchen Sie einen anderen Rabbi“, forderte Esthers Vater.
„Damit der mich nach drei Jahren wieder abweist?“
„Vielleicht sind Sie einfach kein geeigneter Kandidat?“
Dieser Verdacht war Heiner selbst auch schon gekommen. Dem Rabbi war bei den vielen Diskussionen und Debatten sicher nicht entgangen, dass sein Schüler im Krieg den Glauben an Gott verloren hatte.
Esthers Mutter hörte aufmerksam zu – und schwieg.
„Papa, mir ist völlig egal, ob Heiner Jude ist oder nicht.“
„Du hältst den Mund!“, antwortete ihr Vater barsch und richtete seine Aufmerksamkeit wieder auf Heiner. „Sie finden es also gut und richtig, meine Tochter aus ihrem Lebenskreis herauszureißen? Sie ihrer Religion zu entfremden und sie nach Düsseldorf schleppen? Ich nenne dieses Verhalten Egoismus. Sie denken nur an sich.“
„Papa, das stimmt nicht!“, warf Esther ein.
„Ich rede nicht mit dir. Also schweig still. Sie pflegen Bekanntschaften mit nackten Frauen. Sie zeichnen Akte.“
„Nackte Männer stehen mir auch Modell“, erklärte Heiner gelassen. „Daran ist nichts Verwerfliches.“
„Nun, mir passt es nicht. Sie haben vor, Esther in eine Stadt zu bringen, in der sie wochen- und monatelang alleine sitzen wird, während Sie Aufträge anderswo übernehmen.“
Betroffen stellte Heiner fest, dass er diesen Punkt tatsächlich nicht bedacht hatte. „Sie kann mich begleiten oder in solchen Zeiten zu Ihnen fahren.“
Herr Jakobson rieb über seinen Bart. „Und wenn Kinder kommen, die nach unserer Rechtsauffassung dank ihrer Mutter Juden sind? Wie soll das zugehen?“
„Über dieses Thema haben Ihre Tochter und ich noch nicht miteinander geredet.“
„Ich möchte, dass Heiners und meine Kinder christlich getauft werden, Papa.“
Herr Jakobson wurde aschfahl.
„Du willst was?“ Ihre Mutter packte Esther am Arm.
„Sie sollen nicht unter Vorurteilen leiden. Solange alles gut läuft, gibt es keine Probleme. Da heißt es höchstens hinter vorgehaltener Hand: ‚Hütet euch nachts in die Nähe der Synagoge zu gehen, dort haust der Kroakes, der euch holt.‘ Aber sobald es einmal nicht so …“
„Moment, der wer?“ Die Wendung, die das Gespräch genommen hatte, verblüffte Heiner.
„Hast du die Leute in Leiwen noch nie von dem Geist reden gehört, der angeblich in der Thorarolle unserer Synagoge wohnt und Kinder entführt.“ Sie schaute von ihm zu ihren Eltern. „Ihr könnt es nicht bestreiten: Sobald die Ernten schlecht sind und die Trauben am Weinstock verfaulen, fliegen wieder Steine durchs Fenster und wir werden bespuckt. Das will ich meinen Kindern nicht zumuten.“
Heiner ballte die Faust. „Was sagst du? Bespuckt? Ist dir das schon passiert?“
Esther nickte. „Und Mutter auch.“
„Wann?“
„Vor zwei Wochen. Eigentlich wollte ich es dir gar nicht sagen.“ Sie seufzte.
„Den knöpf ich mir vor … Welcher Dreckskerl hat das getan? Kennt ihr ihn?“
„Nein. Der Mann hatte etwas Militärisches. Kurz geschorene Haare, sicher ein Freikorpsler“, antwortete Esthers Mutter. „Einer dieser Deutschnationalen. Er hat uns nach einem Wilhelm Zänder gefragt. Anfangs war er höflich und bestand sogar darauf, uns ein Stück zu begleiten. Ich denke, er fand Gefallen an Esther. Aber als er die Mesusa an unserer Haustür gesehen hat, ist er wütend geworden. Er hat etwas von Judenpack gebrüllt und erst meiner Tochter und dann mir ins Gesicht gespuckt …“
„Ich hatte solche Angst.“ Esther ließ den Kopf hängen.
„Wir beide standen wie erstarrt …“
„… und ließen es geschehen. Dabei habe ich mich so gedemütigt, erniedrigt und verletzt gefühlt. Und wütend war ich. Am meisten auf mich selbst, weil ich den Kopf eingezogen habe und mit Mutter ins Haus gerannt bin.“
„Das war das Beste, was ihr tun konntet.“
„Aber das verächtliche Lachen dieses Menschen verfolgt mich bis in meine Träume. Meine Hilflosigkeit. Ich habe mich dermaßen geekelt und di Mame auch.“
Heiner hielt es nicht mehr auf seinem Platz. Ihm war es egal, was ihre Eltern davon hielten. Er ging zu Esther, zog sie in seine Arme und strich ihr tröstend über das Haar. Wenn er an diesen Kerl dachte …
„Ich hätte ihn ohrfeigen sollen.“
„Esther, wer weiß, was dann geschehen wäre. Ob du überhaupt noch leben würdest und ich … bin ein verfluchter Krüppel. Willst du so einen wie mich wirklich heiraten?“ Er ließ seine Arme sinken und trat ein Stück zurück. „Gegen solche Kerle könnte ich dich vielleicht nicht beschützen.“
„Keine Sorge! Das übernehme ich …“ Keiner von ihnen hatte Joseph bemerkt, der mit blitzenden Augen in das Zimmer getreten war. Offenbar hatte er gelauscht. „… wenn ich erst groß bin. Niemand darf euch etwas antun. Das lasse ich nicht zu!“
„Du … solltest das nicht hören.“ Die sichtlich erschrockene Frau Jakobson eilte zu ihrem Sohn.
„Warum nicht, ich bin kein kleines Kind mehr! Was richtig und falsch ist, weiß ich sehr wohl. Und ich will, dass Heiner mein Schwager wird. Hast du lange genug überlegt?“, fragte er seine Schwester. „Nimmst du ihn?“
„Und ob.“ Esther fasste Heiner an beiden Händen.
„Liebste!“
„Gut, können wir dann jetzt endlich den Kuchen essen?“, wollte ihr Bruder wissen.
Frau Jakobson nickte. „Einverstanden! Ich gehe Kaffee kochen.“
Sollte das heißen, dass Esthers Mutter ihn akzeptiert hatte? Fragend sah Heiner ihr nach. „Und was sagen Sie, Herr Jakobson?“
Dessen Blick ging ernst und prüfend zu seiner Tochter.
„Bitte, Papa!“, flehte sie mit ihrer zärtlichsten Stimme.
Seufzend gab er nach. „Wenn eine jüdische Mame etwas entscheidet, bleibt ihrem Mann nichts anderes übrig als sich zu fügen. Ob mit oder ohne meinen Segen, Esther ist fest entschlossen, Sie zu heiraten. Verhindern kann ich es nicht. Und …“
„Danke, Papa.“ Sie fiel ihrem Vater um den Hals.
„… und ich will mein Kind nicht verlieren.“
„Damit kann ich leben.“ Heiner hielt ihm die Rechte hin, die Herr Jakobson nach kurzem Zögern drückte.
„Auf Du und Du. Mein Name ist Nathaniel, der meiner Frau lautet Rivka. Ich vertraue dir einen großen Schatz an, Heiner. Erweis dich seiner würdig.“
Eine Weihnachtsbotschaft?
24. Dezember 1923
Draußen war es längst finster geworden. Unruhig lief Magdalena in der Stube auf und ab und warf gelegentlich einen besorgten Blick auf die Uhr.
„Dein Bruder kommt bestimmt bald.“ Ab und zu sah Matthias von der Zeitung auf und lächelte sie aufmunternd an.
Sein Vater saß im Lehnstuhl und döste. Lydias Nadelspiel klapperte und Martin schlief.
Magdalena blieb am Fenster stehen, das nicht ganz dicht schloss, der kalte Luftzug war deutlich zu spüren. Obwohl sie bereits eine Strickjacke übergezogen hatte.
„Bis wir zur Kirche aufbrechen müssen, ist noch Zeit. Na komm, setz dich und lies Zeitung mit mir.“ Matthias rückte zur Seite und sie kam seiner Bitte nach.
„Gibt es etwas Neues?“, fragte sie ihn, dankbar für die Ablenkung.
„Interessante Sparmaßnahmen. Amtsgerichte dürfen aus Kostengründen nur noch eine politische Zeitung abonnieren und die Amerikaner bewilligen uns womöglich einen Nahrungsmittelkredit in Höhe von zehn Millionen Dollar.“ Er blätterte die erste Seite um und stutzte. „Hier steht ein großer Artikel über die völkische Frage. Unglaublich, dass sie ausgerechnet in der heutigen Weihnachtsausgabe so einem Unfug Raum geben. Es ist ein Essay, nur die Meinung eines Einzelnen, aber trotzdem.“ Verärgert klopfte er mit der Hand auf das Papier. „Wahrhaft christliche Ansichten, das muss ich schon sagen.“
Sein Vater schreckte hoch. „Ist etwas geschehen?“
„Nein, entschuldige, nichts von Belang“, antwortete Matthias ihm.
Gustav fielen die Augen wieder zu, während ihr Mann die Zeitung so hielt, dass Magdalena den Artikel mitlesen konnte.
Wes Geistes Kind der Verfasser war, zeigte sich darin, dass er vom „Feindbund“ sprach, womit er Frankreich, England und Amerika meinte, der das Selbstbestimmungsrecht der Völker in den Vordergrund gerückt hätte. Nach dieser Feststellung ging es unvermittelt weiter mit: ‚Viele Völker, nicht nur das deutsche, befassen sich mit der Völkischen Frage‘.
„Ich verstehe nicht, was das Selbstbestimmungsrecht der Völker mit dem restlichen Artikel zu tun hat“, sagte Magdalena leise, um ihren Schwiegervater nicht zu stören.
„Wenn du mich fragst, gar nichts“, bestätigte Matthias.
„Wovon handelt der Zeitungsbericht denn?“, erkundigte Lydia sich neugierig.
„Entschuldige. Das ist gar nicht so einfach herauszufinden.“ Der nächste Abschnitt regte Magdalena noch mehr auf. Halblaut las sie ihn vor, damit auch Lydia zuhören konnte.
Die völkische Bewegung ist unabhängig von Staatsform oder Politik – es geht um die Frage der Rasse. Wobei eine Vermischung zwischen unterschiedlichen Rassen unweigerlich zu einer Mischung des Blutes führt. Was wiederum für ein Volk sowohl negative als auch positive Folgen haben kann. Schon unsere Ahnen wussten um diesen Sachverhalt. Reines Blut, so viel steht fest, erzeugt reine Gedanken. Schon der römische Geschichtsschreiber Tacitus bescheinigte unseren Vorfahren, reinen Blutes, ein edles Volk, rein an Sitte und kampferprobt zu sein.
„Wieso soll ‚reines Blut‘ zwingend reine Gedanken erzeugen?“, überlegte Magdalena. „Da wird einfach irgendetwas behauptet – und wir sollen es glauben, nur weil ein Römer namens Tacitus zitiert wird? Der den Germanen bescheinigte, ‚ein edles Volk reinen Blutes, rein an Sitte und kampferprobt‘ zu sein. Das ist doch absurd.“
Matthias grinste breit. „Soweit ich mich aus dem Lateinunterricht erinnere, fand dieser Mann lediglich, dass es keinen Menschen freiwillig in unsere ungastlichen Breiten ziehen könne. Das sei der Grund, weshalb die Germanen sich nicht mit anderen Stämmen vermischt hätten. Dass sie tapfere Kämpfer, aufrichtig und ihre Frauen keusch seien, hat er zwar geschrieben. Allerdings gab es seiner Meinung nach auch einiges an den Germanen auszusetzen.“
„Was denn?“, fragte Magdalena.
Lydia nickte beifällig. „Das interessiert mich auch.“
„Wenn die germanischen Männer nicht kämpften, meinte besagter Tacitus, lägen sie auf der faulen Bärenhaut und ließen ihre Frauen arbeiten. Zum Zeitvertreib spielten sie den lieben langen Tag Würfel und söffen ein ihm unbekanntes alkoholisches Getränk. Womit er Bier meinte. Das mache sie aufbrausend und streitlustig.“
„Daran hat sich kaum etwas geändert“, meinte Lydia trocken.
„Meine Klassenkameraden und ich haben uns damals königlich über diese Stelle amüsiert. Und über sein Fazit: Ihre Versammlungen würden häufig in wüsten Raufereien und Totschlag enden. Aber ihre Frauen, die seien treu.“
Magdalena lachte hellauf. „Die weniger löblichen Eigenheiten der Germanen hat der Verfasser des Artikels also glattweg unterschlagen. Eingangs sagt er, dass die Politik nichts mit Rasse zu tun hat und jetzt hört euch an, womit der Text schließt.“
Gustav schnarchte, die beiden anderen lauschten aufmerksam, während Magdalena vorlas.
Leider ist es eine Tatsache, dass sich durch die außenpolitische Lage und Klassenkämpfe immer mehr undeutsches Gedankengut verbreitet. Auch bei Theater, Musik, Kunst und Wissenschaft findet sich zunehmend Undeutsches. Habgier und Raffsucht, die wir unter gewissen Volksgenossen finden, sind undeutsch. Möge im nächsten Jahr ein reinerer Geist wehen.
„Klassenkämpfe und Außenpolitik! Damit widerspricht er seinen eigenen Behauptungen, dass die völkische Bewegung nichts mit Politik zu tun hat.“
Matthias nickte. „Die Aussagen in diesem Text sind völlig unausgegoren und wirr.“
„Die könnten glatt von Adolf Hitler stammen“, sagte Magdalena.
„So viel ‚Ehre‘ gebührt dem Verfasser nicht. Der hat diese Ideen nur aufgegriffen. Die völkische Bewegung existiert schon eine Weile.“
„So ein dummes Geschwätz kann keiner ernstnehmen“, fasste Lydia zusammen. „Wen meint der Autor denn mit gewissen Volksgenossen? Kapitalisten?“
„Vielleicht auch Juden?“, antwortete Magdalena. „Die sind bei den Rechten besonders verhasst. Die Zeitung werde ich gleich verfeuern, damit Heiner den Artikel nicht zu Gesicht kriegt. Ich glaube, genau seinen expressionistischen Stil hat der Verfasser im Sinn, wenn er von undeutscher Kunst schreibt. Das Rohe der Formen und Farben. Es geht meinem Bruder und seiner Clique nicht um die detailgetreue Abbildung der Natur, das Schöne oder Gefällige. Kunst muss verstören, ist sein Motto.“
„Richtig, aber mit der Haltung ecken sie nicht nur bei der völkischen Bewegung an“, meinte Matthias.
Magdalena warf einen Blick auf die Uhr. „So langsam könnte er nach Hause kommen.“
„Gönne ihm doch, dass er seinen Besuch bei Esther auskostet.“
„Also wirklich …“, protestierte sie.
Hatte sie da etwas gehört? Das Geräusch der Haustür, die geöffnet und leise geschlossen wurde? Magdalena sprang auf und lief ihrem Bruder entgegen, der im Begriff war, Mütze, Schal und Mantel abzulegen.
Er wandte den Kopf, aber im Halbdunkel des Flurs konnte sie sein Gesicht nicht erkennen. „Heiner, sag schon …!“
„Sie hat Ja gesagt.“
„Und ihr Vater?“, fragte sie bange.
„War erst dagegen. Aber wir haben ihn davon überzeugt, dass nichts uns trennen kann. Lenchen, Esther und ich werden im März das Aufgebot bestellen und heiraten. Ich wäre am liebsten sofort zum Standesamt, davon wollten meine zukünftigen Schwiegereltern leider nichts wissen.“ Heiner umarmte sie und küsste sie herzhaft auf die Wangen. „Angeblich dauert es drei Monate, bis sie die Aussteuer beisammen haben.“
„Die paar Wochen vergehen wie im Flug“, tröstete Magdalena ihn.
„Von wegen. Aber abgesehen von der Wartezeit bin ich jetzt schon der glücklichste Mann der Welt.“
„Das kann nicht sein! Dieser Posten ist von mir besetzt.“ Matthias war herangekommen und klopfte ihrem Bruder auf die Schulter. „Aber darüber streiten wir uns nicht. Lass uns auf deine Verlobung anstoßen.“
„Darf ich Ihnen ebenfalls gratulieren, Herr Scholtes.“ Lydia streckte ihre Hand aus.
„Danke!“ Er schüttelte sie lachend.
Gustav tauchte auf, mit vom Schlaf geröteten Wangen und noch ein wenig verwirrt. „Was ist denn los, habe ich etwas verpasst?“
„Heiner wird heiraten.“
„Was? Wirklich? Na, geht denn das überhaupt?“, fragte ihr Schwiegervater verdattert. „Nichts für ungut, ich dachte, sie ist Jüdin.“
„Kirchlich heiraten wir nicht, nur standesamtlich.“
„Wie wollt ihr die Feier denn gestalten?“, fragte Magdalena.
„Ganz schlicht. Wir hätten gerne Matthias und dich als Trauzeugen.“
„Danke!“ Begeistert umarmte sie ihren Bruder. „Wie lieb von euch! Ich freue mich!“
„Mit dem größten Vergnügen, Heiner“, antwortete Matthias.
„Wir laden ein paar Freunde und Verwandte ins Standesamt ein und gehen hinterher in die Blaue Forelle. Die wir für die Gelegenheit mieten werden.“
„Und eure Hochzeit soll schon im März stattfinden?“, fragte Lydia.
„Wenn es nach mir ginge, am liebsten gleich morgen.“