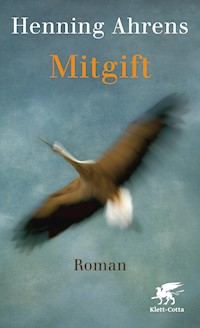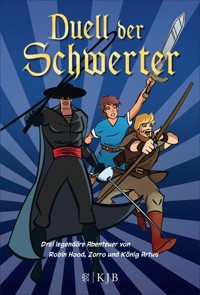19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Klett-Cotta
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
»Auf das Glück der reifen Jahre.« Manchmal ist eine kalte Welle alles, was es braucht, um auch den reifen Jahren noch einmal Möglichkeiten abzugewinnen, das eigene Leben zu gestalten. Aufrichtig, augenzwinkernd, aufmerksam erzählt Henning Ahrens von Menschen, die ihrem Lebensalter mit Lebensmut begegnen: Alten Eltern, erwachsenen Kindern und den Folgen dessen, was man getan hat, ebenso wie späten Umbrüchen, verpassten Chancen und unerwarteten Neuanfängen. Am Strand tritt der Zeichner Hardy Espen auf die Erkennungsmarke eines Soldaten und findet sich in Gesellschaft eines gleichermaßen unverhofften wie treuen Erbes. Seine Partnerin Aimée, studierte Kunsthistorikerin und nun Blumenhändlerin, will ihren Eltern ein letztes Mal entgegentreten. Héloise, Viehwirtin und Hardys Nachbarin, sieht in ihrem Hof die Gelegenheit aufblitzen, noch einmal neu anzufangen, und ein schürzenjagender Gendarme sucht sich mit dem drohenden Ende seines Berufslebens neue Aufgaben. Alle stellen sie fest, dass das Leben einem die Konsequenzen der eigenen Vergangenheit vorhält, dass es niemals stillsteht – und man also besser gelassen bleibt und Schritt hält. Und so setzen sie sich in Gang im Westen der Normandie, zwischen Hügeln und Meer und unter Wolken, die nach wie vor und immer wieder einen Hauch Himmel verheißen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 420
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Henning Ahrens
Jahre zwischen Hund und Wolf
Roman
Klett-Cotta
Impressum
Dieses E-Book basiert auf der aktuellen Auflage der Printausgabe zum Zeitpunkt des Erwerbs.
Klett-Cotta
www.klett-cotta.de
J. G. Cotta’sche Buchhandlung Nachfolger GmbH
Rotebühlstraße 77, 70 178 Stuttgart
Fragen zur Produktsicherheit: [email protected]
Dieses Werk wurde vermittelt durch die Literarische Agentur Gaeb & Eggers.
© 2025 by J. G. Cotta’sche Buchhandlung Nachfolger GmbH, gegr. 1659, Stuttgart
Alle Rechte inklusive der Nutzung des Werkes für Text und
Data Mining i. S. v. § 44 b UrhG vorbehalten
Cover: Anzinger und Rasp Kommunikation GmbH, München
unter Verwendung einer Abbildung von © Paul Powis. All rights reserved 2025 / Bridgeman Images
Gesetzt von C.H.Beck.Media.Solutions, Nördlingen
Gedruckt und gebunden von GGP Media GmbH, Pößneck
ISBN 978-3-608-96645-9
E-Book ISBN 978-3-608-12484-2
Heute, als ich an einem Garten in unserem Viertel vorbeikam, sah ich das Leben hoch aufgerichtet als Reiter auf dem goldenen Rücken einer Orange, den Blick weit voraus. Das allein sage ich dir.
Jannis Ritsos
Einen Hund an seiner Seite, betrachtet er die anbrandende See, überwölbt vom Novemberhimmel, dessen Wolkendecke da und dort Blau durchschimmern lässt. Er steht am Ufer des Ärmelkanals, auf einem historisch zu nennenden Strand, dem Utah Beach, an diesem späten Vormittag verwaist, keine D-Day-Touristen, die Jakobsmuscheln oder Herzmuscheln zertrampeln und silbergrau schillernde, erratisch geformte Austernschalen aufheben oder gar einstecken, um sie daheim als Aschenbecher oder Ablage für Heftklammern zu verwenden.
Hardy Espen, so heißt der Mann, der jene Elemente konfrontiert, in die er einst zerfallen wird. Schauen Sie nur, wie er am Ufer ausharrt, und nun, zur Verwunderung des Retrievers, die Stiefel auszieht und den Parka ablegt, als wollte er demonstrieren, dass ihn die unberechenbaren Böen des Daseins nicht schrecken. Keine verkehrte Haltung, gewiss nicht, vorausgesetzt, sie paart sich mit der Demut, die sein reifes Alter verlangt, doch keine Sorge, Hardy ist die Vernunft in Person, ein Leuchtturm der Besonnenheit – aber … heh … hallo? Wieso watet der Mann ins Meer, und das auch noch in Hose und Pullover? Das Wasser ist eisig, was reitet ihn bloß … o nein, der geht da rein, der geht wahrhaftig rein, ist das zu fassen …
Teil eins
Hund
Eins
Die Welle erwischte Hardy im Gesicht. Er hatte sie kommen sehen, doch an Ausweichen war nicht zu denken gewesen. Die Wucht, mit der sie anbrandete, hätte ihn fast umgeworfen.
Das brachte ihn zur Besinnung. Wasser aus den Augen wischend, machte er kehrt und watete durch die brusthohen Fluten zurück zum Strand, der sich, ein lichter Streifen an diesem grauen Tag, nach Süden ausrollte und im Norden vor einer Anhöhe auslief, in der sich Bunker verbargen. Nun prallten die Wellen gegen seinen Rücken, bei jedem Schritt kämpfte er gegen den Wasserwiderstand, baumstammschwer waren seine Beine, die Extremitäten Eiszapfen, er kam sich vor wie Scott in der Antarktis.
Gelegentlich lugte die Sonne durch die Wolken, wirkte aber so ermattet, als hätte sie im letzten Dürresommer ihre Energie komplett verbraucht und wollte nur noch ruhen. Hardy hingegen musste all seine Kraft aktivieren, um an Land zu gelangen. Dort lag Brahma im Sand und ließ Sabber auf Parka und Stiefel triefen, das Einzige, was Hardy ausgezogen hatte, bevor er, einer irrwitzigen Anwandlung gehorchend, ins Meer gewatet war. Der Utah Beach, das sah er mit flimmerndem Blick, war wie leergefegt. Von Osten näherte sich ein Jogger, nein, eine Joggerin, und auf den Dünen vor dem D-Day-Museum betrachtete jemand das Meer, sah vermutlich zu, wie Hardy sich an den Strand schleppte.
Er hatte kniehohes Wasser erreicht, da spürte er einen Schmerz im linken Fuß. Auf einem Bein balancierend, ertastete er eine dünne Kette, die sich am großen Zeh verfangen hatte, und sah, nachdem er sie zur Hand genommen hatte, dass ein ovales, verdrecktes Metallplättchen daran hing. Eine Halskette, dachte er, und dann: Wann wurde ich zuletzt gegen Tetanus geimpft? Er humpelte weiter, hinterrücks angefallen von der Brandung, und dann, er war endlich auf dem Trockenen angelangt, lief die Joggerin an ihm vorbei, EarPods in den Ohren, ein Smartphone auf dem Oberarm. Sie sah über die Schulter, schien stoppen zu wollen, doch Hardy winkte ab und ließ sich neben Brahma in den Sand sacken. Während er der jungen Frau hinterhersah, die ihn an seine Tochter Lou erinnerte, beruhigte sich sein Atem. Er streifte den Parka über.
Der Schnitt im Ballen, verursacht durch das Metallplättchen, blutete nur leicht. Hardy wollte den Fuß mit beiden Händen zum Mund führen, um die Wunde auszusaugen, aber auf halbem Weg war Feierabend, er war schon mal gelenkiger gewesen. Brahma hob den Kopf und sah ihn aus dunkeltrüben Augen hechelnd an.
»Tja, alter Bursche«, sagte Hardy und kraulte den Schädel des alten Rüden, »besser wird’s nicht.« Er steckte die Kette ein, zog die Stiefel an und schlotterte, gefolgt von Brahma, über den Strand. Hinter dem Durchgang in den fahnenflatternden Dünen passierte er das Landungsboot, den Trupp zu Bronze erstarrter Soldaten, das Restaurant mit Souvenirshop, genau wie die großen Parkplätze beinahe leer. Hardy zog Hose und Pullover aus, warf beides in den Kofferraum seines Duster und schlüpfte wieder in den Parka. Anschließend half er dem Retriever auf die Rückbank und setzte sich ans Steuer. Von seinem Parkplatz aus sah er den Obelisken vor dem Musée du Débarquement und den Sherman Tank, ein Denkmal, wie es in dieser Region oft zu finden war. Die Erinnerung an den Krieg war omnipräsent, jeder noch so kleine Ort feierte jährlich den Tag seiner Befreiung. Obwohl man ihm niemals unfreundlich begegnet war, hatte ihn dies anfangs in Verlegenheit gestürzt, immerhin war sein Herkunftsland Aggressor und Besatzungsmacht gewesen.
Er wollte gerade zurücksetzen, da erblickte er die Person, die auf den Dünen gestanden hatte: ein alter Herr mit langem, graugrünem Mantel und Baskenmütze, der sich auf einen Stock stützte.
»Nicht schlecht«, sagte Hardy über die Schulter zu Brahma, »einen solchen Stock hole ich mir später auch.« Die Scheiben begannen zu beschlagen, also drehte er das Gebläse auf, rumpelte vom Parkplatz und bog im rond-point nach Sainte-Marie-du-Mont ab.
Bei Carentan ging die von schilfigen Gräben durchzogene und mit Gehölzen gesprenkelte Küstenlandschaft in das Marais über, ein flussreiches Feuchtgebiet, im Sommer grüner Weidegrund, im Winter dagegen großflächig überflutet. Dann rollte man auf Dammstraßen durch weite Seen, aus denen Bäume, Büsche und die Spitzen von Zaunpfählen ragten. Hardy blieb auf der Landstraße, er wollte möglichst rasch nach Hause, um die Kleidung zu wechseln und den Fuß zu verarzten, und bog schließlich auf eine kleinere Straße ab, die sich, gesäumt von Böschungen und Hecken, durch die Hügel nach Westen schlängelte. Er verzichtete auf einen Schlenker über Saint-Lazare-sur-Terrette und fuhr direkt zu seinem Haus am Rand von Le Mesnil-Solune. Seit jeher winzig, war der Weiler zunehmend geisterhaft: keine Läden, keine Jobs, keine Zukunft. Ohne Auto war man verloren, selbst gebrechliche Alte setzten sich ans Steuer und tuckerten nach Saint-Lazare, das Landstädtchen, in dem neben Boulangerie, Huit-à-huit, Friseur und Bar-Tabac auch Aîné ihren Blumenladen hatte. Wagemutige fuhren ebenso nach Saint-Lô wie jene Verzweifelten, die einen Arzt aufsuchen mussten.
Die Reifen knirschten auf den Hof, Hardy stellte den Motor aus. Er scheuchte Brahma ins Haus, wo dieser sofort zu Boden sackte, und zog sich oben im Schlafzimmer um. Als er im Ofen des angrenzenden Ateliers Holz nachlegte, fiel ihm die Kette ein. Sie steckte noch unten im Parka, er würde sie abends untersuchen.
Am Zeichentisch sitzend, betrachtete er die in Arbeit befindliche Seite des elften Bandes seiner Serie Les Guerriers de Grottombé. Als er niesen musste, hätte er um ein Haar Schnodder auf die Zeichnungen geblasen, eine reflexartige Bewegung rettete sein Werk. Dann schenkte er sich kalten Tee ein und griff zum Pinsel. Ein Strich, ein Strich und noch ein Strich, so sah sein Leben aus. Es gab Momente, da hätte er gern mit Brahma getauscht.
*
Die Glocke klang dumpfer als gewöhnlich, oder waren das ihre Ohren? Als Ainé den eintretenden Kunden erkannte, gefror das Lächeln, das sie auf ihre Lippen gezaubert hatte. Sie legte die Gerbera neben das halb fertige Gesteck, eine Bestellung von Madame Curieux, die oft bei ihr kaufte, um das Grab ihres Gatten zu schmücken, eines Mannes mit bärbeißigen Zügen, wie das Bild auf dem Grabstein verriet. Aîné hatte es studiert, weil die Einundachtzigjährige bei jeder Gelegenheit von ihm schwärmte, seine Güte pries, seine Treue lobte – wer’s glaubte, wurde selig. Im Alter, so ihre Beobachtung, verbiesterten viele; einige seltene Exemplare hingegen redeten sich ihr Leben so rosarot, als wären sie jahrzehntelang über Zuckerwatte gewandelt.
Der Kunde war ein alter Bekannter, Vincent Parbleu. »Salut, meine Hübsche. Du wirst es nicht fassen, ich brauche einen Blumenstrauß«, verkündete er.
Wie immer zu leutselig, dachte Aîné. »Ach ja?«, fragte sie. »Schon wieder eine Neue?«
Vincent lachte. Würde er nur ein Mal, ein einziges Mal erröten, doch er war zu sehr von sich eingenommen. Bizarr auch, dass er zwar eine Bassstimme hatte, aber wie ein stimmbrüchiger Teenager lachte. Nein, nein, sie hörte wie eine Luchsin, es war die Türglocke, die den Defekt hatte.
»Irgendwas Schönes, Buntes, Duftendes, du weißt ja, was das Herz einer Frau erfreut.«
Aînés Laden hatte zwei Ebenen. Unten befand sich die Verkaufsfläche mit Tresen, Kasse und buntem Allerlei, oben standen die Schnittblumen, und dort kappte, schnitt und steckte sie auf einem hohen, schmalen Holztisch. Die Treppe hinuntergehend, musterte sie Vincent und stellte fest, dass die Jahre Spuren hinterlassen hatten: Der Vollbart graumeliert, das Haupthaar auf der Flucht, dazu ein Bauch, was sie nicht weiter verwunderte, er war nie ein Kostverächter gewesen. Nur seine Klamotten waren unverändert, er trug wie üblich eine Jeans, ausgelatschte Lederschuhe und eine cognacfarbige Lederjacke über einem Pullover aus – Aîné sah genauer hin – Kaschmirwolle. Sie zeigte auf die Vasen, die unten neben den Stufen standen.
»Nimm doch einen der fertigen.«
»Meinst du, die gefallen ihr?«
»Kenne ich sie?« Aîné ging die Stufen hinab. »Wehe, du hast dich an einer meiner Freundinnen vergriffen.«
Vincent sah sie über die Brille hinweg an. »Hm … Vielleicht der da?« Er zeigte auf einen Strauß.
»Eroberung gelungen? Wenn nicht, solltest du spendabler sein.« Sein Zaudern hieß, er war noch nicht am Ziel, nur würde er das niemals zugeben, er saß in der Zwickmühle, und tatsächlich: Er sah weg und kaschierte seine Verlegenheit durch ein ebenso typisches wie unnachahmliches Herabziehen der Mundwinkel, ein Räuspern. Sie sah ihm in die Augen, kostete den Moment aus.
»Üppig ist nie verkehrt«, erwiderte er schließlich, indem er sie ansah.
Alter Chauvi, dachte sie, du hinkst der Zeit hinterher. Sie sah durchs Schaufenster auf den schmalen Platz vor ihrem Laden. Abends wartete dort ein Pizzawagen auf Kundschaft, hinter kahlen Bäumen war das Seniorenheim zu sehen zwischen der Kirche und der Charcuterie des Ehepaars Hochet, freundlichen, wenn auch stockkonservativen Leuten. Aus grauen Wolken nieselte Nässe, die Schieferdächer dunkelten ein.
»Los, Vincent, such dir was aus.« Sie trat hinter den Tresen.
Er bückte sich nach dem größten Strauß. »Du hattest mal mehr Humor, Aîné.«
Sie schaufelte eine Handvoll Luft über ihre Schulter – »Pff« – und entgegnete: »Ich hatte auch mal intelligentere Bekannte.«
»Bekannte, hm?«
»Ja, genau. Der soll’s sein?« Sie nahm ihm die Blumen ab, angelte nach der Brille, ein lästiges Utensil, und begann, den Strauß einzuwickeln. Dieser war wirklich gelungen, dachte sie, ein kunterbuntes Potpourri, das Heiterkeit, ja Glück vermittelte.
»Immerhin hatten wir mal …«
»… Pech miteinander«, unterbrach sie ihn, »zum Glück für barmherzig kurze Zeit.«
»War doch schön damals.« Vincent holte das Portemonnaie aus der Innentasche seiner Lederjacke.
»Jedes deiner Worte«, sagte Aîné, »verteuert diesen Strauß um weitere zehn Euro.«
Er lachte wieder. »Ehrlich? Und wo stehen wir jetzt?«
»Bei sechzig.«
»Sechzig Euro?«
»Jedenfalls keine Franc.«
»Auf dem Schild steht vierzig …«
»Sechzig. Und ein kostenloser Rat: Nimm deinen Bart ab, bevor sich Motten darin einnisten.«
Vincent bezahlte brav und sagte, indem er sich abwandte: »Laus über die Leber gelaufen, wie? Und deine Freundinnen, ma chère, die sind mir ein paar Dekaden zu alt.« Er zwinkerte ihr zu und ging, verabschiedet von einem dumpfen Klingeln.
»Und das will ein capitaine de police sein«, sagte Aîné zu einer Kugeldistel.
Sie sah Vincents dunkelblauen Facel Vega auf die Rue Miquelon abbiegen, die Geschäftsstraße von Saint-Lazare-sur-Terrette, als Ort ebenso bescheiden wie der Fluss, den es im Namen führte. Obendrein zeichnete es sich durch eine gewisse Herbheit aus, die unter anderem den Einwohnern zu verdanken war, meist bodenständige, wenn auch nicht übermäßig intolerante Menschen, immerhin hatten ihre skandinavischen Vorfahren dem westfränkischen König einen eigenen Herrschaftsbereich abgetrotzt, England erobert, auf Sizilien ein Königreich und in der Levante ein Fürstentum errichtet, man war also herumgekommen in der Welt.
Aîné führte ihren Laden nun seit über zwei Jahrzehnten. Der Name, für den sie sich entschieden hatte, Le Kamasutra des fleurs, war aus der Zeit gefallen, entstammte einer offeneren, jedenfalls nicht ganz so vernagelten oder vielleicht schlicht gleichgültigeren Ära. Andererseits waren ihr nie Beschwerden zu Ohren gekommen, sogar betagte Messieurs und Mesdames hatten sich weder mokiert noch empört, der Name, der die Sinnlichkeit der Flora unterstreichen sollte, sei anzüglich, schlüpfrig oder gar ungehörig, sie würde ihn also beibehalten. Mit Anfang fünfzig blieb man besser beim Bewährten.
In jüngeren Jahren wäre die Vorstellung, auf dem Land zu enden, für Aîné einem Albtraum gleichgekommen. Sie war in Bordeaux aufgewachsen und hatte in Paris Kunstgeschichte studiert, ihr Herz schlug bis heute urban. In den 1990ern war sie ihrem damaligen Freund Matthieu, einem aufstrebenden Maler, in die Normandie gefolgt, wo er ein Atelier im Grünen erworben hatte, ohne zu bedenken, dass man abseits der Pariser Szene wenig galt. Als sein Stern zu sinken begann, verlegte er sich in seiner Frustration auf Akte. Anfangs malte er ausschließlich Aîné, begann aber bald, sich in andere Modelle zu vertiefen – nicht nur im übertragenen Sinn und dreisterweise vor ihrer Nase. Eines Abends, sie hatte einiges an Calvados intus, pflückte sie ein Küchenmesser vom Magnethalter, drang in den zum Atelier umgebauten Kuhstall ein, wo Matthieu die Kurven seines neuesten Modells zwecks Wiedergabe auf der Leinwand haptisch vermaß, und schlitzte alle Gemälde auf, die in Reichweite waren. Das Modell, eine Achtzehnjährige, die ihre üppigen, bis über die Brüste fallenden Haare in einem dörflichen Dunkelrot gefärbt hatte, floh halbnackt in die Winternacht. Matthieu starrte sein mit Ölfarbe beschmiertes Küchenmesser an, spie Worte aus, so unverständlich, als spräche er Bretonisch oder Okzitanisch, und verschwand auf Nimmerwiedersehen. Das waren die letzten Takte dieser Liebesballade gewesen. Die nächste – die nächste ernsthafte – hatte erst vor vier Jahren ihren Anfang genommen. Damals war sie im Cheveux à deux, dem Friseursalon der Zwillingsschwestern Jeanette und Babette Dupuis, gleich um die Ecke, Hardy begegnet.
»Ich hatte erstmal die Nase voll«, erzählte sie, nach dem Abendessen mit Hardy in ihrem Wohnzimmer sitzend. Brahma schnorchelte auf einer Decke. »Von Paris, von der Kunst, von den Männern. Die alte Madame Lescalier, Gott hab’ sie selig, suchte eine Nachfolgerin für ihren Blumenladen, und ich habe zugegriffen, obwohl ich keine Floristin war. Ich brauchte ja ein Einkommen. Damals hieß der Laden Fleur de Lis. Und da bin ich nun.«
»Du hättest nach Bordeaux zurückkehren können«, sagte Hardy, dem die Details dieser Lebensphase bislang unbekannt gewesen waren. »Vielleicht hättest du einen Job an der dortigen Uni gefunden.«
»Zu meinen Eltern? Machst du Witze? Ich bin erwachsen.«
»Sind sicher nette Leute.«
»Irgendwie ja, irgendwie nein. Und wie sie darüber denken, dass ich mit einem Deutschen zusammen bin … Puh.«
Hardy schenkte Rotwein nach. »Sie haben Vorbehalte?«, fragte er.
»Weiß nicht. Ist mir egal.«
»Du hast aber keine Geschwister, die sich kümmern könnten.«
»Ja, und? Mein Vater hat als höherer Beamter gut verdient, sie haben eine Haushaltshilfe, ich wäre also überflüssig. Nein …« – sie löste ihren Arm von Hardys Schultern – »… als Einzelkind habe ich genug gestrampelt, um mich abzunabeln. Weder will ich in die Kinderrolle zurückrutschen noch in der Falle ihrer spießigen Erwartungen sitzen. Hältst du das Händchen deiner Mutter?«
Er schüttelte den Kopf, wenig geneigt, das Thema zu vertiefen.
»Immerhin besuche ich sie zwei-, dreimal im Jahr.« Sie strich brünette, weiß durchwirkte Strähnen aus ihrer Stirn. »Seit Matthieu verabscheue ich jedenfalls testosterongesteuerte Trophäensammler«, ergänzte sie. »Vincent gehört ja auch in diese Kategorie.«
Hardy, mit Vincent befreundet, meinte: »Er ist trotzdem ganz in Ordnung.«
»In seinem albernen Facel Vega – allein der Name. Wahrscheinlich ist die Marke deshalb eingegangen.«
»Nein, das Unternehmen hat sich schlicht verhoben, in den 1960ern, glaube ich.«
»So was weißt du?« Sie zuckte die Schultern. »Na, soll er.«
Brahma hob den massigen Schädel und betrachtete die beiden Zweibeiner aus blutunterlaufenen Triefaugen. Hardy hatte nie mit einem Hund geliebäugelt, und dieser alte Bursche war ihm gleichsam in den Schoß gefallen, doch er hatte ihn liebgewonnen, sprach mit ihm und neckte ihn, wenn auch mit Skrupeln, der Arme verstand ja nichts.
»Bist du inzwischen schlauer?«, fragte Aîné, die Brahma betrachtete, und schob sich eine Scheibe Schinken in den Mund.
»Nein«, sagte Hardy, »ich weiß partout nicht, was mir diesen Hund eingebrockt hat.«
»Es muss doch eine Vorgeschichte geben.«
»Sicher, nur welche? Ich zerbreche mir nun seit anderthalb Jahren vergeblich den Kopf darüber, was mich mit dieser Selma Nissen-Wedekamp verbunden haben könnte.«
»Was immer es war, es hatte Folgen.«
Hardy zuckte die Schultern. »Klar, die Folge ist dieser Hundegreis. Darüber hinaus weiß ich nichts, rein gar nichts.«
Aîné sah ihn gespielt skeptisch an. »Vielleicht solltest du auch mal aus dem Nähkästchen plaudern.« Sie hielt ihm ein imaginäres Mikrofon vor die Nase. »Monsieur Hardy, erzählen Sie von Ihren Jugendsünden, sind sie der Born der Fantasie, die Sie als Zeichner von bandes dessinées beweisen? Oder haucht der göttliche Brahma Ihnen die Ideen mit seinem stinkenden Atem ein?«
Hardy ließ den Hinterkopf auf die Rückenlehne des Sofas sinken. Seine Eltern und Großeltern hatten pragmatisch gedacht, auf den sogenannten »gesunden« Menschenverstand gepocht und alle, die sich nicht einordnen ließen, als Spinner abgetan. Hardy hatte sich oft gefragt, wie es ihm gelungen war, diesem Milieu zu entrinnen, aber, dachte er mit Aînés Worten: Da bin ich nun. »Kann ich auch nicht erklären«, sagte er zu guter Letzt. »Ist halt so.«
»Ach, übrigens«, ergänzte Aîné, »welche geniale Eingebung der Fantasie hat dich veranlasst, im November ins Meer zu gehen?«
Hardy war um eine Antwort verlegen.
»Also ein dunkler Impuls«, sagte sie. »Ich hoffe nur, du hast dich nicht erkältet.« Sie bedachte ihn mit einem Lächeln. Dann fragte sie: »Klingt die Türglocke im Laden irgendwie dumpf?«
»Nein.« Er schüttelte den Kopf. »Beim letzten Mal jedenfalls nicht.«
»Hm …« Sie stand vom Sofa auf. »Ich gehe jetzt ins Bad und dann zu Bett. Kommst du auch?«
»Ja, gleich.« Er sah ihr nach, bis sie im Flur verschwunden war, hörte die Badezimmertür hinter ihr zufallen.
Aîné bewohnte über ihrem Geschäft eine Vierzimmerwohnung in einem schlichten Nachkriegsbau, auf beiden Seiten flankiert von ähnlichen Häusern. Gleich um die Ecke befand sich der Friseursalon, in dem sie einander kennengelernt hatten, vier Jahre war das her, vier wunderbare Jahre. Er hatte schon beim ersten Besuch in ihrer Wohnung ein gutes Gefühl gehabt und gewusst, diese Frau war jemand mit Gespür und Sensibilität, mit einem Horizont.
Den Rotwein leerend, hörte er, wie Aîné das Bad verließ. Er gab Brahma einen Klaps, sagte: »Schlaf gut, alter Rabauke«, und ging Zähne putzen. Anschließend, er wollte zu Bett, sah er die Blume auf dem Flurtisch, eine Nelke, die vor der blau glasierten Vase lag, ihre Blüte wies zum Schlafzimmer. Hardy betrachtete sie: Aîné hatte die Nelke mit Bedacht so drapiert, es war Blumensprache, wie sie es nannte, und er wusste, was die Blume signalisierte.
Er trat erwartungsvoll ein. »Da bin ich«, sagte er.
Zwei
Gut anderthalb Jahre zuvor, im April 2021, mitten in Pandemiezeiten, regte sich der Frühling. Eine Brise spielte im knospenden Laub, auf den Weiden spross nach dem tristen normannischen Winter das Gras, die Vögel tirilierten, und auf Hardys Hof stand der sonnengelbe Dienstwagen des Postboten, Victor, der an diesem Tag davonfuhr, ohne einen Pommeau erbeten zu haben. Als sein Postauto hinter den Pappeln und Eichen verschwand, nahm Hardy die Maske ab, versenkte die Werbung im Müll, legte die Rechnungen auf die lange Bank und kehrte mit dem einzigen Brief ins Obergeschoss zurück. Im Atelier angekommen, fiel sein Blick durchs Fenster auf seinen verwilderten Garten. Aîné missfiel der Anblick, aber Hardy wollte partout keinen Ziergarten, wie es in seinem Kieler Zuhause geheißen hatte, immerhin war diese Wildnis Habitat vieler Tiere. Er zog es vor, der Natur freien Lauf zu lassen, wenn auch nur hinten, vorne nicht. Die Franzosen schätzten Ordnung, und für sie war er nun mal ein boche, mithin Angehöriger einer Nation, die sogar Raubzüge und Genozide akribisch geplant und verwaltet hatte, da musste wenigstens ein gepflegter Hof drin sein.
Hardy wurde sich des Briefs in seiner Hand bewusst. Schwarz gerahmter Umschlag, eine Traueranzeige also, adressiert in weiblicher Handschrift. Im nächsten Moment erschrak er: War seine Mutter gestorben? Die Siebenundachtzigjährige wohnte in einem Kieler Seniorenheim, und seiner Schwester Cordelia wäre zuzutrauen, dass sie ihn postalisch und also mit Verspätung informierte. Er öffnete den Umschlag mit dem Opinel und fischte in banger Erwartung die Klappkarte heraus.
Es war tatsächlich eine Todesanzeige, doch was er las, nachdem er die Brille aufgesetzt hatte, erfüllte ihn mit Unverständnis:
Ein strahlendes Licht ist erloschen, ewig leuchtet es weiter.
Eine Ausnahmeerscheinung, eine Inspiration für Freund:innen und Weggefährt:innen, all jenen ein Vorbild, die von ihr lernen durften, eine Lichtgestalt, die Freude und Zuversicht verbreitete und aus jeder und jedem das Beste herauszuholen verstand, ein großherziger, liebenswerter, toleranter Mensch wurde unerwartet aus strotzender Schaffenskraft gerissen. Wir nehmen Abschied von
Selma Nissen-Wedekamp *11.07.1949 † 09.04.2021
Auf der Innenseite der Klappkarte entdeckte er unter den Worten »In Liebe und tiefer Dankbarkeit« weder einen Ehepartner noch Angehörige, Kinder oder Enkel gleichen Nachnamens; es schien sich ausnahmslos um Freunde zu handeln. Nicht einmal der Beruf der Verstorbenen wurde genannt. Die Trauerfeier war für den zweiten Mai, vierzehn Uhr, angesetzt, sie sollte in einer Kapelle des Hauptfriedhofs zu Frankfurt am Main stattfinden.
Selma Nissen-Wedekamp? Hardy kramte vergeblich im Gedächtnis. Im zweiundsiebzigsten Lebensjahr verstorben, also recht früh, obendrein »strotzend« vor Schaffenskraft, für Nahestehende sicher ein Schlag ins Kontor, allein: Wer war die Frau, und wie kam er zu dieser Karte? Er las sie ein weiteres Mal, Wort für Wort, Name für Name. Sagen ließ sich nur, dass sie nicht gläubig gewesen war, denn weder gab es christliche Floskeln noch Symbole. Was er in der Hand hielt, war ihm absolut schleierhaft, und dennoch konnte es kein Versehen sein, man kannte schließlich seine aktuelle Adresse.
Er stellte die Karte schulterzuckend ins Bücherregal und setzte sich an den Zeichentisch, um die Arbeit am zehnten Band der Serie Les Guerriers de Grottombé fortzusetzen. Seine Szenaristin Lébo – ein nom de plume, in Wahrheit hieß sie Léa Bosniak – hatte Skizzen angefertigt, verstand aber nichts von der Komposition einzelner Seiten. Immerhin, das war ihr zugute zu halten, hatte sie ein Händchen für Storys. Über das Tuschen seiner Bleistiftzeichnungen vergaß er alles andere.
Nach dem Grafikdesignstudium war sein Werdegang unstet gewesen: wechselnde Agenturen, teils in der Werbung, teils in der Gestaltung, oft mit befristeten Verträgen. So war es bis nach der Geburt seiner Tochter, Lou, gewesen; dann aber, mit Ende dreißig, war es ihm gelungen, anzukommen. Ein früherer Chef, Artdirector einer Hamburger Agentur, hatte damals einer befreundeten Pariser Verlegerin Hardys Zeichnungen zugespielt, die sich wiederum auf eine Zusammenarbeit mit dem unbekannten Deutschen eingelassen hatte, und so wurde Hardy Comiczeichner. Es war die Verwirklichung eines Kindheitstraums, und doch hatte er inzwischen das Gefühl, das Falsche zu zeichnen. Lébo, eine Französin polnischer Herkunft, zwölf Jahre jünger als er, hatte ihren Argwohn gegenüber einem Nazi-Nachkommen nicht verhehlt, aber das Teamwork hatte sich rasch eingespielt, zumal die von ihr entwickelte und von ihm umgesetzte Fantasy-Serie ein Dauerbrenner war. Einerseits war das prima, andererseits hatte er nach zehn Bänden das Gefühl, stecken geblieben zu sein, das immer Gleiche zu zeichnen: Krieger und Kämpferinnen, archaische Architektur, bizarre Landschaften, brodelnder Nebel, abstruse Geschöpfe, Blut, Magie und nackte Haut. Die Serie drohte in Frazetta-Kitsch abzugleiten, war zu Stangenware mutiert, es ging nur noch darum, Erwartungen zu erfüllen. Und da Lébo auf diesem Ohr taub war und der Verlag auf immer neue Folgebände pochte, saß er in der Falle – schmisse er hin, würde er seine Existenzgrundlage gefährden. Er behalf sich mit privaten Kapriolen. So hatte er einer Feindin des Helden Deuxfou de Montrouge Züge von Marine Le Pen verliehen; im aktuellen Band wiederum hatte Lébo eine elfenhafte Kriegerin namens Brimbelle eingeführt, und Hardy beschloss nach vielen misslungenen Skizzen, ihr die Züge seiner Nachbarin, Héloïse de Bocage, zu verleihen, mit Ende vierzig zwar zu alt und doch ideal.
Als der Tag in grüngoldenem Licht zu vergehen begann, beschloss Hardy, Feierabend zu machen und zu Aîné zu fahren, wollte zuvor aber noch auf dem nebenan gelegenen Hof Les peupliers vorbeischauen, den Héloïse bewirtschaftete. Nachdem er die Pinsel ausgespült, die Radiergummikrümel abgefegt und den Zeichentisch aufgeräumt hatte, verließ er das Arbeitszimmer. Er streifte die Trauerkarte mit einem Blick und stieg die Treppe hinab ins Wohnzimmer, das in die Küche überging, die wiederum an den Garten grenzte. Er bewohnte ein ehemaliges Backhaus, dessen Ofen, das mit Lehm isolierte Viertel einer Kugel, an einer Giebelwand klebt. Die Wände aus lokalem Stein entließen einen klammen Hauch, aber das würde sich bald ändern, denn vermutlich drohte ein weiterer Dürresommer.
Er bog vom Grundstück auf die Straße ab. Der Gang zu Héloïse dauerte fünf Minuten, und er wollte gerade in die zum Hof führende Pappelallee einbiegen, da hörte er Motorenlärm. Hinter ihm erschien ein grasgrüner Claas-Traktor mit Frontlader, der einen Wagen voller Rundballen zog. Am Steuer erkannte er Héloïse. Bei seinem Anblick hielt sie an, und Hardy trat neben den Traktor, lächelte erwartungsvoll, fast etwas dümmlich.
Die Tür des Hightech-Gefährts wurde geöffnet, und eine aparte Frau in Blaumann und Gummistiefeln sprang vom Tritt auf die Straße. Sie begrüßte Hardy mit Wangenküssen. »Ich habe zu tun«, sagte sie, »aber hast du ausnahmsweise eine Zigarette?«
»Du hast Glück, ich habe meine Notfallschachtel dabei.« Er angelte die Schachtel, pechschwarz, mit Schlimme-Folgen-Bildchen, aus einer Jackentasche. Sie fischte eine Kippe heraus, und er gab ihr Feuer. »Ich wollte nur Hallo sagen.«
»Wie schön.« Sie zog mit zurückgelegtem Kopf an der Zigarette.
Hardy betrachtete die Heuballen. »Dieses Frühjahr ist besser, oder?«, fragte er.
»Immerhin hat es geregnet. Ich hoffe, ich muss nicht wieder Heu dazukaufen.« Héloïse schwieg nachdenklich. »Ich werde im Juli fünfzig«, sagte sie dann unvermittelt, die Zigarette zwischen den Lippen. »Furchtbar, oder? Was hat man danach vom Leben noch zu erwarten? Am liebsten würde ich zum Sterben in den Wald gehen.«
»Das sagst du mir?« Er sah unbestimmt zum Himmel auf. »Gut, gib Bescheid«, sagte er dann, »vielleicht komme ich mit.«
Sie lachte gepresst. »Alles eine Katastrophe, ehrlich, diese ganze bekloppte Welt.« Ihre Augen trübten sich ein.
Hardy überlegte fieberhaft, wie er sie aufheitern konnte, er kannte das. Héloïse, eine tatkräftige Frau, versank immer wieder in Schwermut. Raymond, ihr Mann, war mit Anfang vierzig an Krebs verstorben, elf Jahre war das her, sie hatten lange versucht, ein Kind zu bekommen, vergeblich, und mit den Wechseljahren hatte Héloïse diesen Traum endgültig begraben müssen. Zu guter Letzt sagte Hardy aufrichtig, wenn auch etwas lahm: »Du siehst immer noch toll aus.«
»Ah-pfff!« Sie blies die Wangen auf, zog die Schultern hoch, warf eine Handvoll Luft darüber, alles zugleich. Dann trat sie die Zigarette auf dem Asphalt aus und stieg wieder in den Traktor. »Die Arbeit«, sagte sie, bevor sie die Tür schloss, »ist meine Rettung.«
Und dein Pferd, ergänzte er im Stillen.
»Auf bald.«
Die Wagendeichsel ruckte in der Anhängerkupplung, als sie anfuhr, dann bog sie in die Pappelallee ein und rumpelte zu ihrem Hof. Vor der von Haselnusssträuchern und Eichen bekrönten Böschung stehend, blickte Hardy ihr nach. Nach einer Weile las er Héloïses Kippe auf. Er betrachtete den auf seiner Handfläche liegenden Stummel und machte sich dann in der Illusion, einen Beitrag zum Schutz der Natur zu leisten, auf den Heimweg. Unterwegs hörte er ein weiteres Fahrzeug, dann ein Hupen, und erblickte das Auto von Vincent. Dieser lehnte sich aus dem Fenster und rief: »Na, wie geht’s, mein deutscher Freund?«
Hardy trat näher und sah, dass eine Frau auf dem Beifahrersitz saß. »Musst du nicht arbeiten?«, fragte er Vincent.
»Tue ich doch«, entgegnete der und wies mit dem Daumen auf seine Beifahrerin. »Verdächtiges Subjekt, muss dringend zur Leibesvisitation, wer weiß, was sie unter ihrer Wäsche versteckt. Was, Odile?«
Diese entblößte beim Grinsen eine Lücke zwischen den Vorderzähnen. Hardy fühlte sich an Jane Birkin erinnert. Etwas ratlos sagte er: »Na, dann … gutes Gelingen.«
Vincent reckte den Daumen und fuhr in seinem Facel Vega davon.
*
In diesem April war die Welt noch sattgrün. Auf beiden Straßenseiten wogten Hügel bis zum Horizont, gesprenkelt mit Hecken, Wäldern und Gehölzen, übersät von Wiesen und Weiden. Da und dort ein Kirchturm, ein einsames Gehöft. Selten, dass man Getreide sah, hier, in La Manche, überwog die Viehwirtschaft, nicht zu vergessen die Pferde. Die Normannen waren versessen auf sie. Sogar Jean Gabin hatte hier Traber gezüchtet, am Rand vieler Orte gab es ein hippodrome, in den meisten Bistros lief ein Sportsender, der Rennen übertrug, man fachsimpelte und wettete, setzte aber meist kleine Beträge.
Über den Hügeln zogen Wolkenstaffeln nach Norden, ein atmender Himmel, wie es ihn nur in Meeresnähe gab. Die route nationale lief schnurstracks auf die tief im Westen stehende Sonne zu, und Aîné, die am Steuer ihres C3 saß, hatte eine Sonnenbrille aufgesetzt.
»Ich werde wohl hinfahren«, sagte Hardy.
»Ja«, erwiderte Aîné, »mach das. Vielleicht findest du vor Ort heraus, wer die Verstorbene ist.« Sie war seit einer gefühlten Ewigkeit nicht mehr am Meer gewesen – Covid, die confinements, die Sorgen wegen der Finanzen –, doch die Lage schien sich zu entspannen, und heute wollte sie unbedingt hin, hatte sogar ihren Badeanzug dabei. »Besser, du meldest dich an«, riet sie. »Die Zahl der Trauergäste ist sicher beschränkt.«
Hardy erstarrte, als sie Gas gab, um einen alten Renault-Traktor zu überholen, der sich bergauf schleppte, entspannte sich aber schnell wieder. Er wusste, wie gut und sicher sie fuhr.
»Nimm den Zug.«
»Ja.«
»Du könntest auch deine Mutter besuchen. Wann warst du zuletzt in Deutschland?«
»Kurz vor dem Ausbruch der Pandemie, im Januar letzten Jahres.« Hardy verstummte. Die französische Sprache stellte ihn immer noch vor Herausforderungen, er musste nach Wörtern suchen, legte sich Sätze zurecht, Fehler waren unvermeidlich. Aîné korrigierte ihn liebevoll, und dafür war er dankbar, allein: Es kostete Kraft und war oft frustrierend.
Aîné, die es liebte, Auto zu fahren, sang vor sich hin, und er gab ihr einen Kuss, den sie mit einem spielerischen Klaps auf seine Wange beantwortete. Hardy hatte mehrere Beziehungen hinter sich, eine gescheiterte Ehe inklusive, aber diese Frau hatte sich als Glücksgriff erwiesen, ihr Miteinander war wohltuend unaufgeregt.
»Gut«, bekräftigte er. »Ich fahre hin, kehre anschließend aber sofort zurück.«
Sie zuckte die Schultern. »Hast du die Frau im Netz recherchiert?«, fragte sie.
»Ich schnüffele doch niemandem hinterher.«
»Dann bleibt tatsächlich nur die Fahrt zur analogen Trauerfeier mit echtem Sarg, echter Toter, echten Tränen.«
Ein weiterer rond-point, dieser am Rand eines Gewerbegebiets mit gigantischem Leclerc, kurz darauf tauchte links die Stadt Coutances auf, die sich einen Hügel hinaufzog, bekrönt von der weithin sichtbaren Kathedrale.
»Wohin willst du?«, fragte Hardy.
»Wart’s ab.« Sie grinste ihn an.
Weitere Kreisverkehre in rascher Folge, bis sie Blainville passiert hatten und Aîné auf einen Dammweg abbog. Links und rechts von Prielen durchzogenes Marschland. Hinter einer schmalen Brücke fuhr sie schließlich auf einen Schotterparkplatz.
»Da sind wir«, sagte sie. »Schon mal hier gewesen?«
»Nein.« Hardy griff nach seiner Jacke und stieg aus.
»Ebbe«, meinte sie über das Auto hinweg. »Schade, Baden kann ich vergessen.« Sie verriegelte den Citroën. Am Ende der Straße, die in eine zum Strand hinabführende Betonrampe überging, stand ein Türmchen für die sauveteurs, rechter Hand ein Restaurant mit großer Terrasse, linker Hand ein Bretterbau mit dem Schriftzug La Cale. »Vielleicht haben wir Glück«, sagte Aîné, die darauf zusteuerte. »Der Schornstein qualmt.«
Auf der Vorderseite des Bretterbaus gab es eine überdachte Holzterrasse, davor einen Sandstreifen, der an den tiefergelegenen Strand grenzte. Im Sand standen verwitterte, windschiefe Tische und Stühle wie aus einer brocante, weiter hinten hölzerne Bartische mit Bänken. Draußen saß niemand, es war Vorsaison und frisch.
»Da sind Leute, komm, wir schauen mal rein.«
Aîné betrat das … Tja, was war es, fragte sich Hardy, ein Restaurant, ein Imbiss? Die rustikale Möblierung setzte sich im Inneren fort, an den Wänden hing erotischer Kitsch, der Gesinnungskorrekte entweder zu empörtem Abrauschen oder zum Lostreten eines Shitstorms veranlasst hätte, vorausgesetzt, dies hätte nicht schon das auf dem Rost eines offenen Kamins brutzelnde Fleisch bewirkt, Würste, Steaks und Keulen, außerdem bot die Karte Austern und moules frites. Die Normandie war kein Paradies für Vegetarier, Veganern blieb nur das grüne Gras der Wiesen.
Zwei Gruppen tafelten an langen Tischen, sicher Einheimische, es herrschte eine familiäre Atmosphäre. Sie holten sich ein Bier, und Aîné wollte draußen sitzen.
»Endlich mal wieder an der Küste«, sagte sie. »Da bleibe ich doch nicht in der Bude.«
An einem Terrassentisch öffnete Hardy den Bügelverschluss und schenkte bernsteinfarbiges Bier ein. Das Wasser, im Licht der rasant sinkenden Sonne schimmernd, war weit draußen, die freiliegende Fläche mit Felsformationen gesprenkelt, dazwischen standen lange Spaliere von Gestellen, auf denen Drahtsäcke mit Austern lagen. Sie sahen Traktoren, vereinzelt Menschen mit Gummistiefeln und Eimern. Im Nordwesten war die Insel Jersey als dunkler Streifen zu erkennen.
»In der Dordogne sucht man Trüffel und Pilze, hier sind’s die Muscheln.« Aîné betrachtete das Meer, das Kinn auf eine Hand gestützt.
»Vorhin habe ich kurz mit Héloïse geplaudert«, erzählte Hardy.
»Wie geht’s ihr?«
»Wie üblich am Rackern«, sagte Hardy, der sich fröstelnd mit den Armen umschloss.
»Gib mir mal dein Händchen«, bat Aîné. »Ganz kalt. Du Armer.« Sie lächelte, links und rechts der Lippen bildeten sich kokette Fältchen. »Ja, unsere Héloïse … Stürzt ständig in Löcher.«
»Ist sie denn immer noch allein?«
Aîné blickte aufs Meer, das Kinn auf die Hand mit der qualmenden Kippe gestützt. »Sie kann Raymond nicht loslassen«, sagte sie. »Ich glaube, ich muss ihr mal den Kopf waschen.«
»Und ihr Jean?«
»Ihr Jean?« Sie sah Hardy belustigt an. »Nein, nein. Netter Kerl, sehr patent, ohne ihn könnte sie den Hof nicht bewirtschaften, aber er ist bestimmt zwanzig Jahre älter als sie und obendrein verheiratet.«
Hardy schenkte den Rest Bier ein. Es dämmerte rasant, der Wind hatte aufgefrischt; dies war die Stunde zwischen Hund und Wolf, die blaue Stunde. »Wie wär’s mit einem Strandspaziergang?«, fragte er.
»Und danach wird gegessen.« Aîné stand auf.
Der letzte Traktor des lokalen Austernzüchters zog einen mit Drahtsäcken beladenen Anhänger die Rampe hinauf, während sie neben dem Turm der Strandwacht die Stufen hinunterstiegen, geblendet vom Scheinwerferlicht, dann verschwand das Fahrzeug wie vom Dunkel aufgesogen.
Sie schlenderten Arm in Arm am Strand nach Süden. Vor den Dünen Spaliere verwitterter Holzpfähle, der Wind trug ihnen ein Rauschen zu, das Meer schickte sich an, wieder aufzulaufen. In der Ferne markierten felsige Klippen das Ende des Strands, die Fenster der Wohnhäuser oben darauf waren erhellt. Der Mond dagegen ließ sich nicht blicken, auch die Sterne machten sich rar, verbargen sich hinter Wolken. Im Sand schimmerten Muscheln im letzten fahlen Licht wie irdische Gestirne.
Drei
Als Zeichner war Hardy ein Beobachter, zumal seiner Mitmenschen, und hatte stets ein Skizzenbuch dabei. Gelegentlich beschlich ihn die Befürchtung, sein forschender Blick könnte aufdringlich wirken oder gar missverstanden werden, doch er ließ nicht davon ab. Die Pandemie hatte der Sache einen zusätzlichen Reiz verliehen, die halb verdeckten Gesichter luden zu Spekulationen ein: Sichtbar waren Stirn, Augen und Haare, aber wie das Gesicht zur Gänze aussah, blieb der Fantasie des Betrachters überlassen. Der Augenblick der Wahrheit kam, wenn jemand die Maske absetzte, um etwas zu essen oder zu trinken oder mit dem Zigarettenrauch ein paar Viren zu inhalieren.
Dieser Tick hatte Hardy diverse Überraschungen beschert, und als er im Nomad nach Paris saß, setzte sich dies fort. Die dunkeläugige Frau mit schwarzen Locken musste bildhübsch sein, vermutlich um die dreißig – als sie aber die Maske absetzte, um ihren Lippenstift nachzuziehen (der sich, wie er sehen konnte, auf der Innenseite der Maske abzeichnete, als hätte sie in Gedanken jemanden geküsst), entpuppte sie sich als Mittvierzigerin mit den Zügen einer vom Leben enttäuschten Person. Der Brillenträger mit ergrauender Halbglatze wiederum, der einen Band der Serie Amours Fragiles las und schon deshalb Hardys Sympathie genoss, war gewiss ein honoriger Fünfzig-plus-x-Jähriger mit den Zügen eines ästhetisch geschulten Intellektuellen, doch als er einer Tupperdose ein Sandwich entnahm und zum Verzehr die Maske ablegte, kam das ungeschlachte Gesicht eines Riesenbabys zum Vorschein; er glotzte Hardy, als er dessen Blick bemerkte, höhnisch an. Umgekehrt entpuppte sich eine zunächst unscheinbar wirkende Frau als markante, wohltuend unkonventionelle Schönheit, die von Hardy im Skizzenbuch festgehalten wurde.
Nach dem Umzug in die weiträumige Normandie hatte er ein Auto erworben, einen gebrauchten Duster, der ihm, da unter Einheimischen beliebt, das Gefühl gab, sich in das neue Umfeld einzufügen. Er war also selten mit der Bahn unterwegs, obgleich er die kontemplative Stimmung liebte, die ihn jedes Mal erfasste. Was er durchs Abteilfenster sah, war ebenso interessant wie Gesichtszüge – ob Landschaften, Feldfrüchte, Vieh, Industrie oder Art und Zustand der Architektur, alles gab Aufschluss über die jeweilige Gegend, so auch auf dieser Fahrt, die über Bayeux und Caen nach Paris führte. Gegen Mittag in der Gare Saint-Lazare angelangt, nahm er einen RER zur Gare de l’Est, die er hurtig verließ, um endlich die Maske absetzen zu können. Im Freien durchatmend, zog er eine Zigarette aus der Notfallschachtel, die er für die Reise gekauft hatte, und rief seine Szenaristin, Lébo, an.
»Ich bin’s, Hardy«, sagte er, als sie endlich ranging.
»Sieh an«, erklang ihre raue Stimme. »Ich hoffe, du bist fleißig. Bald fertig?«
»Ich bin in Paris.« Hardy sah zum Himmel auf, ließ den Blick über das mächtige, bis unter das Dach ausgebaute Gebäude gegenüber der Gare und die roten Markisen der Bistros gleiten. »Zeit für einen Kaffee? Ich stehe vor der Gare de l’Est.«
»Du bist in der Saint-Lazare angekommen, stimmt’s? Wieso hast du nicht von dort angerufen, ich hätte es nicht so weit gehabt.«
»Ich bin auf der Durchreise«, entgegnete Hardy, »in anderthalb Stunden geht’s weiter.«
»Aha? Das erklärt alles. Gut, ich komme, obwohl es die Mühe kaum lohnt.«
»Ich sitze hier dann irgendwo.«
»Gut, dann bis irgendwo gleich.«
In der Taxischlange stritten sich zwei Fahrer um einen Gast, der sich wegduckte, um eventuell virenverseuchtem Speichelflug auszuweichen. Beladen mit Rucksack und Reisetasche verließ Hardy den Vorplatz der Gare, bog in die zum Canal Saint-Martin führende Straße und fand auf Anhieb einen Tisch vor einem Bistro an der Straße, die am Kanal verlief, und bestellte einen grand crème. Die Bäume waren grün, die Sonne lugte durch die Wolken. Zwei Tische weiter saß eine Frau, gekleidet wie Queen Victoria auf einem Ausritt im schottischen Hochmoor, inklusive Bowler Hat mit Bändchen. Er porträtierte sie umgehend mit weichem Bleistift, zog danach einen härteren aus dem Etui, um Details zu ergänzen.
Lébo kam auf einem E-Roller angezischt. Sie begrüßte ihn mit Wangenküssen, setzte sich mit knarzender Lederjacke und knallte das iPhone auf den Tisch.
»Das nennt man spontan«, sagte sie. »Hätte ich von dir gar nicht erwartet.«
Hardy antwortete mit einer entschuldigenden Geste. Sie orderte ein Glas Weißwein. Die Silberringe im linken Ohr hatte sie trotz Ankündigung nicht entfernt, wie ihm auffiel, als sie die Haare zurückstrich.
»Wohin soll’s gehen?«
Er erklärte in aller Kürze seinen Reiseplan.
»Und dafür lässt du mehrere Arbeitstage sausen? Die Frau ist tot«, sagte Lébo, »mausetot, was willst du da erfahren? Ist doch reine Zeitverschwendung.«
Immer mit der Tür ins Haus, so war sie, manchmal schüchterte sie ihn ein, und das ärgerte ihn, er riss sich zusammen.
»In anderthalb Monaten bin ich fertig«, entgegnete er, »mach dir bloß nicht in den Rock.«
Da lachte sie sehr hell, sie trug tatsächlich einen Rock, schlug die in hohen Wildlederstiefeln steckenden Beine übereinander und nippte am Wein. »Na gut«, sagte sie, »dann leg eine Blume auf des toten Weibes Kiste.«
Als ob er ihre Genehmigung gebraucht hätte.
»Magst du vielleicht«, begann er, »bei Gelegenheit über eine neue Serie nachdenken? Oder wenigstens einen einzelnen Band? Mit ganz anderem Hintergrund, meine ich.«
»Wieso?« Ihre Augenbrauen drohten, unter ihrem Pony zu verschwinden. »Hast du den Eindruck, mir fällt nichts mehr ein? Außerdem schneide ich mir bereits die Szenarios zweier weiterer Serien aus den Rippen. Und die Guerriers laufen super.« Sie sah ihn an. »Richtig super.«
»Ja, sicher.«
»Hast du etwa ein Problem mit Brimbelle?«
»Nein, nein.«
»Was dann?«
»Ich zeichne die Serie nun schon so lange und würde …«
»Huuu …« Sie entließ einen Schwall Luft. »Ausruhen kannst du dich im Sarg. Oder leg dich zu deiner Toten, vielleicht flüstert sie dir ein paar posthume Offenbarungen ins Ohr.«
Das ärgerte Hardy, und er blaffte: »Mir geht’s nicht um eine Pause, ich möchte schlicht was anderes machen.«
Lébo fischte ihre E-Zigarette aus einer Brusttasche der Lederjacke und zog daran. Dann sagte sie milder: »Ich bin mit Arbeit zugeballert, ich könnte das nicht leisten. Du musst dir schon selbst was ausdenken, Hardy.«
Offenbar schaute er so verblüfft drein, dass sie ergänzte: »Wie, noch nie daran gedacht?« Sie schwenkte den Zeigefinger, geschmückt mit einem Totenschädelring. »Hardy, Hardy«, sagte sie grinsend, »mein süßer, kleiner Deutscher – brauchst du etwa Anordnungen? Du bist doch erwachsen.«
»Das ist schlicht nicht mein Job.«
»Dann mach’s zu deinem Job. Oder fühlst du dich zu alt dafür?«
Das bestritt er vehement.
»Na also.«
Sie plauderten noch eine Weile, dann musste er los. Er lud sich das Gepäck auf, und sie küsste ihn zum Abschied lange auf die Wange.
»Ich mag dich, Hardy«, sagte sie, »das weißt du, hm? Außerdem bist du der ideale Zeichner für die Serie. Mach’s gut. Wir telefonieren.«
Er nickte. »Schöne Grüße an Fernand.«
»Den habe ich zur Mami zurückgeschickt«, sagte sie, den E-Roller aktivierend. »Hat geklammert wie ein Äffchen.«
Und sie verschwand im großen Paris.
Der ICE raste mit über dreihundert Sachen durch die Champagne sèche: mit langem Atem ausrollende Hügel; Feld neben Feld neben Wiese neben Feld neben Feld neben Feld; wie hingetupfte Gehölze oder Wäldchen; weit voneinander entfernte Dörfer, verbunden durch einsame Straßen; die Betonkathedralen der Getreidespeicher; über den Äckern Staubschleier, aufgewirbelt von Traktoren. Während Hardy aus dem Fenster sah, sehnte er sich danach, in dieser Weite zu stehen und aufs Geratewohl loszugehen, doch der Zug fuhr unaufhaltsam weiter, die Landschaft wurde kleinteiliger, waldiger, enger und begann schließlich, sich quetschkommodenartig zusammenzufalten – sie waren in Deutschland. Hardy wandte den Blick ab. Er feilte an Skizzen, las in einem Gedichtband aus Aînés Bücherregal, Espaces d’instants, dessen Autor, Jean Follain, in der Nähe von Saint-Lô aufgewachsen war. Hardy mochte die Gedichte, stieß aber frustrierend oft an die Grenzen seines Sprachvermögens. Kurz vor Frankfurt sah er wieder aus dem Fenster, betrachtete die Graffiti auf Brückenpfeilern und Lärmschutzwänden, bestaunte die Vegetation der Böschungen und Wildwuchsinseln zwischen Verkehrsadern, die Essigbäume und Schmetterlingsflieder, die sich bis an den Hauptbahnhof heranrobbten. Er fuhr mit dem Taxi zu seinem Hotel am Rand des Holzhausenviertels, das er ausgewählt hatte, weil der Hauptfriedhof von dort aus fußläufig zu erreichen war.
Eigentlich verabscheute er Hotels. Vor elf Jahren, er war nach der Trennung von seiner Frau aus der Hamburger Wohnung ausgezogen, hatte er zuletzt in einem unterschlüpfen müssen. Mit Grausen dachte er an jene Lebensphase zurück: der Streit, die Vorwürfe, das Scheidungsprozedere; die trotzige Trauer Lous, ihrer Tochter, damals fast siebzehn. Nicht, dass er etwas bereute; zudem war Suse, seine Ex-Frau, weder rachsüchtig gewesen noch hatte sie Lou gegen ihn in Stellung gebracht, im Gegenteil – sie hatte ihn ziehen lassen und bald wieder geheiratet –, aber die Zeit bis zum Abi seiner Tochter war quälend gewesen.
Hardy packte Rucksack und Reisetasche aus, hängte den schwarzen Anzug in den Schrank und schrieb Aîné, er sei gut angekommen. Anschließend rief er, am Schreibtisch sitzend, auf dem ein Tastentelefon stand, in einer Mappe Briefpapier und Stift bereitlagen, seinen alten Schulfreund Peter Molitor an, der seit Jahrzehnten als Anwalt in Frankfurt lebte.
»Ja, hier Molitor?«, ertönte eine gestresste Stimme.
»Hallo, Peter, ich bin’s, Hardy.«
»Hardy? Gibt’s ja nicht. Wie lange ist das her?«
»Lange. Hör zu – ich bin gerade in Frankfurt. Hättest du heute Abend Zeit?«
Ein trockenes Lachen. »Geht’s noch kurzfristiger?«
»Ich hätte mich ankündigen sollen«, sagte Hardy verlegen, immerhin hatte er schon Lébo überfallen. »Ich nehme an, du hast heute Abend was vor?«
»Ja, habe ich. Kann ich unmöglich absagen. Wie lange bist du hier?«
»Ich fahre übermorgen früh.«
»Puh … wird schwierig. Du ahnst nicht, was hier los ist – in meiner Ehe knirscht und kracht es, man will mich aus der Kanzlei drängen, ich stehe sozusagen im Krieg, Alter. Ohne Cäcilia würde ich mich im Main ertränken.«
»Du meinst Connie. So heißt deine Frau, richtig?«
»Die ist nicht gemeint.«
»Ah …« Hardy verstummte. Dann kam er, um abzulenken, auf sein Anliegen zu sprechen und klärte Peter über die am kommenden Tag stattfindende Trauerfeier auf. »Sagt dir der Name etwas?«, fragte er.
»Nissen-Wedekamp?«, sagte Peter. »Nein. Klingt irgendwie norddeutsch, oder?«
»Vielleicht bin ich morgen klüger«, erwiderte Hardy.
»Schon verrückt, deshalb nach Frankfurt zu reisen. Hast du Urlaub?«
»Ich bin selbständig, niemand gibt mir Urlaub. Aber nach einer hitzigen Diskussion hat mir mein Über-Ich drei Tage freigegeben, zum Leidwesen meiner Szenaristin.«
»Szenaristin? Ah, stimmt – du malst noch, richtig? Ja …«, sagte Peter gedehnt, »sicher ein schöner Job. Du hast ja schon in der Schulzeit viel gekritzelt.«
Hardy verkniff sich eine Entgegnung. Er war während seines gesamten Werdegangs als Zeichner mit den absurdesten Ressentiments und Vorurteilen konfrontiert worden, und die grassierende populistische Schablonendenke machte es nicht besser. Stattdessen fragte er: »Wie geht’s der Familie?«
Trommelte Peter mit den Fingern auf den Tisch? Er sagte: »Ich bin in der Kanzlei. Ich habe zu tun. Sollte ich morgen noch einen Slot haben, hörst du von mir. Alles klar?«
Damit war er weg. Hardy starrte sein Handy an, halb verblüfft, halb verärgert. ›Slot‹? Mangelnde Zeit, schön und gut, aber warum so patzig? Zu Schulzeiten hatte Peter, nun Anwalt für Wirtschaftsrecht, zu seinen besten Freunden gezählt. Später war jeder zunächst mit sich selbst beschäftigt gewesen: Studium, Berufseinstieg, Freundinnen, Nestbau und so fort, sie hatten sich selten gesehen. Nun hatte er offenbar eine Affäre. Kein Wunder, dass seine Ehe litt.
Hardy dachte gern an die Tour zurück, die er mit Peter und einem weiteren Kumpel, Thomas Kunz, nach dem Abi unternommen hatte und die dazu beigetragen haben könnte, dass er in der Normandie lebte. Juli 1985. Die Väter hatten sich geweigert, ihren Söhnen ihr Auto zu überlassen, also hatte Peter seinen Onkel gefragt, ein entspannter Typ, der ihnen sofort seinen Zweitwagen angeboten hatte, ein roter Fiat Panda. Mit dieser Gurke gondelten sie los, ein Zelt im Kofferraum; ihr Ziel, die Bretagne, war eine Hommage an ihre Französischlehrerin, Frau Knutsen, einerseits eine Paukerin, die sie bis zum Erbrechen Vokabeln und Grammatik hatte büffeln lassen, andererseits jung und attraktiv und der Schwarm diverser triebgeplagter Jungs. Wer sie angeschmachtet hatte, hatte seine Zunge gehütet, er wäre sonst übel gehänselt worden, doch der Dackelblick, mit dem nicht ganz wenige an Frau Knutsens vollen Lippen gehangen hatten, war verräterisch gewesen, zweifellos auch für das Objekt der Begierde selbst.
Sie wollten in die Bretagne, von Kiel aus betrachtet eine Reise ans andere Ende der Welt, weil Frau Knutsen immer wieder davon geschwärmt hatte. Um keine Zeit zu verplempern, fuhren sie durch und wechselten sich am Steuer ab, aber der lange Ritt forderte seinen Tribut, und im Südwesten der Normandie, einen Katzensprung von der Bretagne entfernt, passierte es dann.
Sie waren hibbelig durch zu viel Koffein, Schlafmangel und Aufregung, den Führerschein hatten sie ja erst seit Kurzem. Brothers in Arms von den Dire Straits lief als Kassette, und sie sangen gerade lautstark einen Refrain mit, als vor ihnen ein Huhn über die Straße lief. Peter saß am Steuer, ein Glück, schließlich war es die Karre seines Onkels, und anstatt gnadenlos weiterzufahren wie in der Fahrschule gelernt, gab er widerstreitenden Reflexen nach – er wich aus und ging zugleich in die Bremsen. Der Panda kam ins Schleudern. Hardy erinnerte sich daran, erstaunlich ruhig geblieben zu sein, während sich die Kiste um die eigene Achse drehte und mit dem Heck gegen einen Baum krachte, eine Esche, das wusste er noch genau.
Sie taumelten aus dem Auto, Thomas zeigte mit zitternder Hand auf das Huhn, das es glücklich über die Straße geschafft hatte. Niemand war verletzt, jeder stand unter Schock. Der Motor surrte und klackte, die Kassette leierte noch: »Moooniiih frrr nossiiiii-hi-hi-hi-hi …«
»Schalt das aus«, blökte Hardy.
Peter beeilte sich, den Zündschlüssel herauszuziehen. Er klaubte den Autoatlas aus dem Fiat und klatschte ihn aufs Dach. »Wo sind wir überhaupt?«, fragte er die anderen.
Schulterzucken. Es waren analoge Zeiten, Handy oder GPS waren Zukunftsmusik, und Thomas, der sich an Straßenschilder erinnerte, latschte ein Stück auf der Straße zurück, um sie zu studieren.
Wieder da, erklärte er: »Das nächste Kaff heißt Avranches.«
»Wie viele Kilometer sind’s bis dorthin?«, fragte Hardy.
»Steht nicht drauf.«
»Wie, nicht drauf?«
»Da steht nichts. Ich bin doch nicht blind.«
»Okay«, sagte Peter, »wir müssen eine Werkstatt finden.«
»Zu Fuß?«, fragte Thomas.
»Oder wir trampen«, schlug Hardy vor.
»Klar«, entgegnete Peter, »hast du andere Autos gesehen? Die Franzosen machen Siesta.« Sie sahen sich den Fiat genauer an: Hinten rechts war er übel demoliert, das Rücklicht abgefetzt, die Stoßstange lose. »Offenbar bloß Blechschaden«, meinte Peter, setzte sich ans Steuer und versuchte, den Motor anzulassen.
Seine Kumpel lauschten dem Röcheln und Schleifen, das bei mehreren Startversuchen erklang. Am Ende blieb Thomas, der in Französisch bestenfalls fünf Punkte gehabt hatte, beim Auto zurück, und Hardy brach mit Peter nach Avranches auf, laut Atlas acht Kilometer entfernt.
»Mein Onkel wird im Dreieck springen«, klagte Peter, »und wer soll das bezahlen? So ein verdammter Mist.«
»Ja, echt, das blöde Huhn«, sagte Hardy.
Ihre Füße qualmten, als sie den Ort erreichten. Sie fanden eine Werkstatt, der Fiat wurde abgeschleppt. Auf ihre Frage, wann dieser repariert sei, zeigte der Automechaniker auf fünf, sechs ramponierte Wagen, die noch zum Leben erweckt werden wollten, sah sie danach fragend an und rieb die Fingerspitzen der rechten Hand aneinander. Die veranschlagte Summe klang sogar in D-Mark happig, und Peter trat den Canossa-Gang zur nächsten Telefonzelle an, um seinen Onkel zu informieren.