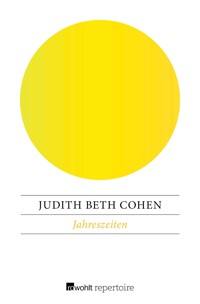
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Rowohlt Repertoire
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein junges Lehrerpaar, in den Städten und an den politischen Bewegungen der späten sechziger Jahre erwachsen geworden, kauft ein altes Farmhaus im entlegensten Winkel der USA. Doch während sie das Haus bewohnbar machen, den Garten anlegen, mit der herben Landschaft vertraut werden und in der herzlichspröden Gemeinschaft gleichaltriger Neusiedler und altansässiger Nachbarn Fuß fassen, wird immer deutlicher, daß ihre Beziehung zerbricht.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 392
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
rowohlt repertoire macht Bücher wieder zugänglich, die bislang vergriffen waren.
Freuen Sie sich auf besondere Entdeckungen und das Wiedersehen mit Lieblingsbüchern. Rechtschreibung und Redaktionsstand dieses E-Books entsprechen einer früher lieferbaren Ausgabe.
Alle rowohlt repertoire Titel finden Sie auf www.rowohlt.de/repertoire
Judith Beth Cohen
Jahreszeiten
Roman aus Vermont
Aus dem Englischen von Irmela Brender
Ihr Verlagsname
Über dieses Buch
Ein junges Lehrerpaar, in den Städten und an den politischen Bewegungen der späten sechziger Jahre erwachsen geworden, kauft ein altes Farmhaus im entlegensten Winkel der USA. Doch während sie das Haus bewohnbar machen, den Garten anlegen, mit der herben Landschaft vertraut werden und in der herzlichspröden Gemeinschaft gleichaltriger Neusiedler und altansässiger Nachbarn Fuß fassen, wird immer deutlicher, daß ihre Beziehung zerbricht.
Über Judith Beth Cohen
Judith Beth Cohen ist 1943 in Detroit geboren. Sie studierte englische Literatur, Psychologie in New York, Boston und bei Ivan Illich in Mexiko. Ab 1970 unterrichtete sie am Goddard College in Vermont. Ihre Erzählungen erschienen in allen großen Literaturzeitschriften Amerikas. «Jahreszeiten» war ihr erster Roman.
Inhaltsübersicht
Die rororo-Reihe «neue Frau» legt erzählende Texte aus den Literaturen aller Länder vor, deren Thema die konkrete sinnliche und emotionale Erfahrung von Frauen und ihre Suche nach einem selbstbestimmten Leben ist. Die monatlich erscheinenden Bände wenden sich an alle, die mit Spannung verfolgen, wie sich die Beziehung der Geschlechter und das Selbstverständnis der Frau wandelt.
I Frühling
… Das ist Vermont, das Land, von dem es heißt,
es verberge sich vor wilden Zeiten und sei weit
vom Zentrum des Lebens entfernt.
This Song von Hayden Carruth
Der Bach besiegelte unsere Entscheidung. Das Haus am Teich zwischen Abfall und Müll, rostenden Autowracks und einer baufälligen Scheune wirkte eher wie eine Bruchbude. Wir würden einiges an Arbeit hineinstecken müssen: Wände verputzen, eine Heizung einbauen, Leitungen legen und Installationen montieren. Doch zwei Leute konnten das wohl schaffen, und der Bau selbst war stabil. Zu dem Grundstück von rund dreihunderttausend Quadratmetern gehörten Wald, freies Feld, ein paar Hügelketten mit schöner Aussicht, also vielfältige Landschaft und Vegetation. Das Haus lag an der Straße, dem Teich zugewandt, dahinter erstreckte sich das Land. Wir folgten dem Pfad durch das erste Feld, wo ein alter Garten gewesen war, durch ein Kiefernwäldchen zum zweiten Feld, einem Kreis, von immergrünen Pflanzen umsäumt, dann zurück durch sumpfigen Wald mit Farnen und Pilzen am Wegrand und Bäumen, die sich aus abgestorbenem Unterholz reckten. Da hörten wir den Bach rauschen. Der Pfad war zu Ende. Vom Geräusch des Wassers angezogen, bahnten wir uns einen Weg durch den Wald und stießen auf einen herrlichen Bach, der im Frühling zu einem sprudelnden Wasserfall und im Sommer zu einem friedlichen Bächlein werden würde. Er trennte das Grundstück in zwei Teile und verführte uns dazu, den Besitz zu kaufen. Doch meine Gefühle waren noch immer widersprüchlich.
Am Tag, als wir die Farm kauften, strömte der Regen so über die Windschutzscheibe, daß wir kaum die ungepflasterte Straße vor uns ausmachen konnten. Auf dem Weg zur Bank fuhren wir an einem Reh vorbei, das neben der Autobahn äste, und wenn wir miteinander gesprochen hätten, dann hätten wir es ein gutes Omen genannt. Wir schoben papierene Schecks über einen Tisch und erhielten dafür wieder Papier; die vieldiskutierte Transaktion wurde zur Scharade, eine nicht gewünschte Wahl, der ich erlaubt hatte, mein Leben zu prägen. Am Tag, als wir die Farm kauften, ließ das nasse Aprilgras kommende Kälte ahnen, während ich in einer Parka warm zu bleiben versuchte und darauf wartete, Besitz zu ergreifen. Am Abend in unserem gemieteten Zimmer schrieb ich, um nicht zu streiten, und verzeichnete meine Kränkungen.
Ich bog den Einband des neuen schwarzen Buches zurück und dachte an die schlummernden Tagebücher, die ich als junges Mädchen geführt hatte, einen Band für jedes Jahr. Jetzt fallen die losen, vergilbenden Blätter aus ihren Ringbindungen. Ich habe sie in Kisten immer mitgeschleppt, von zu Hause ins College und dann in Häuser, die ich mit Sam bewohnte; hineingesehen habe ich selten, ich war zufrieden in dem Bewußtsein, daß meine gesammelte Vergangenheit mir eine Identität gibt. Im College hörten die Tagebücher auf, und Arbeiten für meine Englisch-Seminare traten an ihre Stelle – «Die Sentimentalität von Greys Elegie» statt meiner eigenen Trivialitäten. In den ersten Jahren meiner Ehe führte ich kein Tagebuch. Wenn man neben einem anderen wacht und schläft, dessen Stunde und Tage mit den eigenen verstrickt sind, dann bleibt kein privater Raum zum Schreiben. Hatte ich nicht einen Gefährten für meine Bekenntnisse? Um Tagebuch zu schreiben, würde ich mich von ihm entfernen müssen.
Ich schreibe auf meinem Schoß im Bett, während er neben mir liegt, Nachrichten hört und den bildlosen, kaputten Fernsehschirm anstarrt.
Der Kauf der Farm ist keine drastische Veränderung, die unsere Zukunft besiegelt, sagen wir uns. Wir sind immer noch frei, wir können jederzeit das Haus an andere vermieten, wenn wir beschließen sollten, Vermont zu verlassen. Wir haben uns in keine größere Abhängigkeit von einem Ort oder voneinander begeben, sagen wir. Es ist das gleiche Ritual wie bei unserer Heirat: Wir sagten uns, die Zeremonie sei für unsere Angehörigen, nicht für uns. Welche falsche Tapferkeit! Welche Lügen! Wir gleichen so sehr unseren Eltern.
Vor sieben Jahren, als wir in Bill Knapps Restaurant Hamburger aßen, sagte ich, wir sollten heiraten. «Der Eltern wegen.»
«Wir brauchen keine gesetzlichen Rituale, um unsere Verbindung zu sanktionieren», sagte Sam.
Wir kamen überein, es wegen unseres beruflichen Fortkommens zu tun. Wenn wir unverheiratet zusammen lebten, würden wir kaum eine Anstellung als Lehrer bekommen. Wir warteten eine Woche und prüften uns, dann brachten wir zögernd unsere Vorstellungen in Einklang und teilten die praktische Arbeit auf. Ich übernahm Sams politische Einstellung und seine Liebe zu den Wäldern; er ließ sich von meinem Interesse für Kunst anstecken. Er verhielt sich väterlich während meiner emotionalen Krisen und machte Zerbrochenes wieder ganz. Ich schrieb seine Arbeiten, füllte seine Bewerbungsformulare aus und sorgte dafür, daß die Rechnungen bezahlt wurden – eine zufriedenstellende Arbeitsteilung. Sechs Jahre lang zogen wir im Nordosten umher und mieteten die Häuser anderer Leute. Im Staat New York war es ein Sommerhaus, das ein ehemaliger Gouverneur für seine zwergenhafte Frau gebaut hatte, die Decken und Waschbecken entsprachen ihrer Größe. Unsere hochgewachsenen Freunde mußten im Wohnzimmer gebückt gehen, doch Sam und ich, beide kleine Menschen, fühlten uns darin wohl. Auf dem Lande in Massachusetts war es ein Haus, das hübsch im Wald versteckt lag; wir hatten eine lange, ungepflasterte Zufahrtsstraße und fanden die Abgeschnittenheit romantisch, bis der Tankwagen nicht mehr durch den Matsch kam und wir bis zum Frühling das Heizöl kanisterweise anschleppen mußten. Häuser anderer Leute. Sechs Jahre lang unterrichteten wir, reisten, studierten, lebten bescheiden; wir engagierten uns stark in politischer und sozialer Arbeit.
In diesem Frühling 1972, zwei Jahre nach der Invasion in Kambodscha und den Morden bei der Studentendemonstration an der Kent State University, fuhren wir durch den Norden von Vermont. Wohin sollten wir als nächstes? Wir waren ausgelaugt von den Protesten und suchten ein einfacheres Leben, doch wir wollten vor Konflikten und unserer Verantwortung nicht davonlaufen. Während wir über die Landstraßen fuhren und uns nach einem Haus umschauten, das wir uns leisten konnten, sprachen wir über den nächsten Schritt.
Wir laufen nicht davon, Sam ist sich sicher, wir schaffen etwas Besseres. Nicht nur in den Städten kann man wirkliche Arbeit leisten. Sich der Natur und dem Klima zu stellen, mit wenig Geld auszukommen, eine Gemeinschaft zu finden, in der Politik menschlich sein kann – das sind lohnende Ziele. Ich widerspreche. Ein Haus zu besitzen, erinnert mich an unsere Eltern.
«Wir wollen lieber noch reisen. Laß uns eine Zeitlang in Europa leben.»
«Das geht nicht. Wir hätten bald kein Geld mehr. Wenn wir es in Grund und Boden anlegen, haben wir etwas dafür vorzuzeigen.»
Für Sam war der Kauf der Farm, vereinfacht gesagt, ein Akt der Zweckmäßigkeit. Ich habe Angst. Das Haus am Leech Pond droht wie eine Falle, nicht mehr benutzt, rostig und dennoch gefährlich, aber ich folge Sam hinein, wiederhole seine vernünftigen Sätze, um meine Ängste zu betäuben, versuche, mich für eine einfache Existenz zu begeistern, für den Anbau der eigenen Nahrung, für die Suche nach anderen, die unser Leben begleiten. Die grünen Hügel, verwitterten Scheunen, gefleckten Kühe und ein knorriger Baum, der plötzlich hinter der nächsten Straßenkurve auftaucht, ergeben ein gut zusammengestelltes ländliches Idyll, und das macht es leichter, ihm zu folgen.
Er zündet sich eine Zigarette an. Ich fahre wütend auf. «Wie oft habe ich dich schon gebeten, im Bett nicht zu rauchen.»
«Entschuldige», sagt er, nimmt noch einen Zug und drückt die Zigarette im Aschenbecher auf dem Boden aus.
Morgen werde ich darüber stolpern, denke ich. Ignoriert er mich absichtlich, um mich zu verletzen? Beachtet er meine Wünsche so wenig, daß er sie gar nicht wahrnimmt?
Ich ahne einen kommenden Streit. Er erzählt mir, die Scheibenwischer des Landrovers funktionierten nicht mehr; er habe im strömenden Regen kaum hierher zurückgefunden. Er schaltet den Fernseher aus, ohne sich weiter um mich zu kümmern. Ich möchte, daß er sich mein Tagebuch ansieht, daß er fragt, was ich schreibe. Statt dessen greift er nach der New York Review auf dem Boden neben dem Bett und liest.
Ich weiß, was er sagen würde, wenn ich ihn zum Reden zwingen würde: «Du denkst, der Kauf der Farm wird dir deine Freiheit nehmen, aber du irrst dich. Ich werde dich nicht unterdrücken. Du kannst deine Unabhängigkeit haben, deine Phantasien, deine geträumten Liebhaber. Eine Ehe ist nicht unbedingt die beste Lebensform, sie ist anderen nicht überlegen, aber dazu haben wir uns nun mal entschlossen. Warum machen wir nicht das Beste daraus? Warum sollen wir uns beklagen?»
Vor sieben Jahren saß ich mit flatternden Haaren hinter Sam, die Beine über seine BMW gespreizt, die Arme eng um ihn geschlungen, und fuhr mit ihm über die Landstraßen bei Madison. Er brachte mich an geheime Plätze, wo wir uns auf welkes Laub legten und darüber diskutierten, ob die letzte Wahrheit in den Naturwissenschaften oder in der Kunst zu finden sei. Sam trat für Vernunft und Naturwissenschaften ein, ich stritt für Leidenschaft und Kunst.
«Mit einem Eimer dazustehen und Geld für eine Bürgerrechtsbewegung zu sammeln ist sinnlos. Das Böse hat es immer gegeben, es ist Teil der menschlichen Existenz, es wird nicht verschwinden», sagte ich.
«Kunst ist Luxus. Die Naturwissenschaften enthüllen die Geheimnisse des Lebens. Hast du jemals durch ein Mikroskop Chromosomen betrachtet? Künstler sind reaktionär.»
Verbale Gymnastik, lustvoller als unsere ersten Nächte im Bett, als ich meinen Schlüpfer anbehielt und meine Jungfräulichkeit für meine erste Liebe aus der Oberschule bewahrte, die ich heiraten wollte. Sam akzeptierte mich mit meinen Grenzen; er ließ mich sein Bett teilen trotz meiner Vorschriften – ein bißchen Petting, mehr nicht. Morgen um Morgen schaltete ich den Wecker ab und schlief neben ihm wieder ein, schwänzte die Anthropologie-Vorlesung um acht. Zwei Jahre lang ging es so, er warb um mich, ich blieb unentschieden.
Bedauernd sagte ich ihm: «Wenn ich mit dem College fertig bin, werde ich Mitchell heiraten.» Dennoch schrieb mir Sam von seinem Sommerjob lange Briefe. Ich zog mich in mein Zimmer zurück, um sie zu lesen, und sehnte mich nach Sam, obwohl Mitchell unten auf mich wartete. Ein weiteres Jahr lang trafen Sam und ich uns einmal in der Woche keusch bei Bier und Pizza. In lebhaften Gesprächen diskutierten wir über den dunklen Tisch hinweg alles außer unseren Gefühlen füreinander.
«Meine Mutter ist wieder im Krankenhaus, ihre Depression. Ich wollte, ich könnte ihr helfen.» Ich vertraute mich ihm an, er hörte zu. Sein Mitgefühl gab mir Stärke.
Als ich mit dem College fertig war, endete auch mein Verlöbnis. Obwohl wir uns beide dazu entschlossen hatten, weinten Mitchell und ich, als wir uns trennten; wir trauerten mehr um unseren romantischen Jugendtraum als um einander. Es fiel uns schwer, das Drehbuch zu verbrennen, das wir uns gemeinsam geschrieben hatten. Er ging nach Kalifornien, ich raste zu Sam ins Bett.
«Ich will dein Freund sein, aber weiter sollten wir jetzt nicht gehen, wo du gerade diese Beziehung beendet hast», wehrte sich Sam.
«Aber es war deinetwegen, verstehst du das nicht?» Ich blieb hartnäckig, lieferte den konkreten Beweis: Zum erstenmal gab ich mich ihm sexuell hin, ich drängte mich ihm praktisch auf. Es war unbefriedigend und peinlich, und wir machten unsere Verkrampfung dafür verantwortlich. Wir versicherten einander, daß es besser werden würde. Im Laufe der Monate wurden wir entspannter im Bett, doch nie wurde Sex für uns einfach oder natürlich. Wir unterdrückten unsere Enttäuschung und wandten uns höheren Zielen als der fleischlichen Befriedigung zu; wir maskierten unsere Unwissenheit mit Idealismus.
Wenn wir jetzt miteinander schlafen, geschieht es gezwungen, mechanisch. Ich lasse zu, daß er mich liebt, als würde ich ihm einen großen Gefallen erweisen, und sage ihm durch meinen Körper, daß ich unzufrieden bin. Er ist schuld. «Wir fangen immer an zu streiten, bevor wir ins Bett gehen», sagt er. Seine Einsicht fasziniert mich. Ich warte auf mehr, hoffe auf eine ungeheure Enthüllung, die alles besser macht, aber für ihn ist das Thema beendet. Ich ziehe mich in meine Phantasien zurück. Jedes Jahr wähle ich einen anderen Mann als Helden, gewöhnlich einen gemeinsamen Freund. Das Drama bleibt in meinem Kopf; die Szenen, die ich mir vorstelle, erregen mich intensiver als alles im wirklichen Leben.
Ich höre auf zu schreiben. Er legt die Zeitung weg. Er liegt auf dem Bauch, schließt die Augen, dann schiebt er seinen Arm um meinen Bauch. Er schiebt mein Nachthemd hoch, streichelt die Innenseite meiner Schenkel, dann fängt er an, seine Finger zwischen meine Beine zu stoßen. Ich reagiere nicht. Ich ignoriere seine Einladung. Sam schaut mich nicht an, er sagt kein Wort. Er zieht seinen Arm zurück, dreht sich herum. Nach wenigen Minuten schläft er.
Wir fahren an einem einsamen Haus vorbei, es steht auf einem Hügel neben einem krummen Baum, ein weißes Pferd posiert daneben – ein vollendet komponiertes Stilleben. «Herrlich», sagt Sam und macht ein Foto. So hätte er uns gern, gelassen, in vollendeter Pose, aber ich schaffe es nicht. Er will meine dunkle Seite nicht wahrhaben, will nicht akzeptieren, daß ich komplizierter, widersprüchlicher bin als er. Seine Mutter ist nicht seit zwölf Jahren krank gewesen wie meine, die jetzt wieder depressiv im Krankenhaus liegt. Heute abend habe ich meinen Vater angerufen, um das Neueste zu hören, obwohl ihr Schmerz mich auch ohne Hilfe von Telefondrähten erreicht, der Bote ist in mir. Mein Sicherheitsgefühl war schon immer dünn, zerbrechlich. Wenn in den Nächten meiner Kindheit Daddy noch spät im Büro arbeitete, warf ich mich im Bett hin und her, unfähig, zu schlafen oder bei meiner Mutter Trost zu suchen. Ich stellte mir vor, wie er zusammengebrochen über seinem Schreibtisch hing, tot durch Herzinfarkt, oder wie er nach einem Überfall zusammengeschlagen auf seinem Parkplatz lag. Ich erwartete Unheil, rechnete damit, daß das zarte Gespinst unserer kleinen Familie zerriß, war das Reservoir unartikulierter gemeinsamer Ängste, die als Tränen ausströmten.
Dann Daddys Schlüssel an der Haustür. Erleichterung. Ich drehte mich herum, schlief und träumte. Morgen würden Sam und ich zum Leech Pond ziehen. Konnten wir unsere Entscheidung noch ändern? Können Verpflichtungen rückgängig gemacht werden? Er schläft neben mir, während ich dem Regen lausche.
Ich träume von Häusern – von einem bescheidenen Ziegelhaus im Mittleren Westen, hinlänglich, aber mit Mängeln; die Räume sind zu eng, um gemütlich zu sein, das große Fenster in der Fassade liegt hinter einer spindeligen Blautanne versteckt. Der Rasen ist ordentlich gemäht, doch der Keller bleibt unfertig, Generationen unserer vernachlässigten Katzen und Hunde stolzieren darin umher und «machen ihr Geschäft», wie mein Vater es nennt, auf unsere Kisten mit Büchern und Porzellan. Das Haus meiner Kindheit. Als Bubbe gestorben war, zogen wir aus ihrer Etagenwohnung hierher. Davor verbrachten wir viele Sonntage mit der Suche nach einem Haus. Ich war sieben, meine Schwester drei, wir rutschten auf dem Rücksitz unseres Plymouth, Baujahr 49, hin und her, während unsere Eltern stritten. «Drei Schlafzimmer und eine Diele. Das Haus muß eine Diele haben», verlangte meine Mutter.
«Immer in den Wolken», sagte mein Vater. «Du mußt denken, ich könnte Geld zaubern.»
«Andere Anwälte können sich hübsche Häuser leisten. Warum du nicht?»
«Habt ihr gehört?» Er wandte sich zu uns um. «Sie hätte einen dieser reichen Anwälte heiraten sollen.» Er wartete und hoffte auf Gelächter.
«Ach, Molly, Molly, mein Liebes, immer in den Wolken.»
Es war nicht lustig, wir hörten die Bitterkeit.
Obwohl Mutter nie ihre Diele bekam, stellten wir eine Couch ins Eßzimmer und schoben den Ausziehtisch unters Fenster, damit wir gemeinsam Platz zum Fernsehen hatten.
Ich sehnte mich nach einem Zimmer, in das ich meine Freunde bringen, wo ich hinter ihnen die Tür schließen konnte. Meine Klassenkameraden hatten weitläufige Häuser mit Dielen im Obergeschoß, Hobbyräumen und Bars im Keller, mit phantastischer Innenausstattung: zebragestreiften Hockern, Lampen mit Hularöcken und Glühbirnenbrüsten. In unserem Keller breitete ein riesiger Heizofen seine Rohre über ein Bügelbrett aus. In einem verschlossenen Abstellraum bewahrte mein Vater Lebensmittelvorräte auf. Er hortete Sonderangebote von Konservendosen, jede Woche durchstöberte er die Supermärkte danach. Meine Schwester und ich gingen mit Schlüssel und Einkaufstasche in den Vorratsraum und taten, als enthalte er Schätze. Wir wählten Dosen aus, Tomaten, Mais, grüne Bohnen, Reichtümer, die wir Mutter an den Herd brachten.
«Euer Vater könnte einen Laden aufmachen. Er kauft Sachen, die wir nie verwenden. Er denkt, er macht ein gutes Geschäft. Seine Familie war nie sehr intelligent, ich hätte es wissen müssen.» Doch mir kamen die Stapel weißer Bohnen tröstlich vor.
Ich träume von Häusern – fern von den Ziegeln und Bäumen und Rasen meiner Kindheit durchstreife ich die Korridore einer eleganten Villa, Raum um Raum voller unbekannter Gemälde und Möbel, Dielen, Bibliotheken, Zimmer mit Türen, unauffällige Refugien, private Nischen.
Ich schaue hoch und suche Bestätigung, möchte meine Eltern fragen: Gehört das wirklich uns? Sie verschwinden und machen Fremden Platz. Ich gehöre nicht hierher. Ich muß nach Hause. Wo das ist, wie ich dort hinkomme, weiß ich nicht mehr.
An unserem ersten Abend in der Leech Pond-Farm standen wir in der Küche und betrachteten die vermoderte Decke, von der Gipsbrocken auf den unebenen Linoleumboden fielen, die dunkelgrünen Wände mit den Wasserflecken, an denen sich die verschimmelte Tapete wölbte. Nur wenig Licht drang durch das eine niedrige Fenster. Bei Tag hatten Bach und Hügel uns verzaubert, bei Nacht ist das Haus so elend wie ein Slum in der Stadt.
«Was haben wir bloß getan?» frage ich ihn halb kichernd, halb schluchzend.
«Mein Gott, ich hoffe, das war kein Fehler.» Er schaudert.
Wir legten unsere Matratze auf den Boden des einzigen Raumes mit intakten Wänden und schliefen dann kaum, sondern warteten auf die Sonne, damit wir an die Arbeit gehen konnten.
Leech Pond ist ein seichter Teich, der von Algen und Sumpfsträuchern ausgetrocknet wird. Sie gedeihen, während der Teich schrumpft. Schnappschildkröten sind hier zu Hause. Ein paar Hechte paaren sich hier noch, unser Abwasser ernährt sie. Von einer Quelle auf einem der Hügel führt ein leckes Rohr unter Wasser durch den Teich, unter der Straße durch und in unser Haus.
Der einarmige Clyde hat mit seiner Hacke den Rasen vor dem Haus aufgerissen, die Erde zur Seite geworfen, einen sechs Fuß tiefen Graben hinterlassen und die Wurzeln der Weide verletzt, nur damit ein neues Wasserrohr uns mit unserer Quelle verbinden kann. Wir betreten das Haus durch einen unverputzten Raum, der jetzt mit Werkzeug, zerrissenen Gummistiefeln und sechsundfünfzig Kaffeedosen voller Schrauben, Stifte und Nägeln in verschiedenen Größen angefüllt ist. Isoliermaterial hängt tropfend an der eingedrückten Decke. Wenn es regnet, hallt das laute Tropfen im Wohnzimmer wider. Das Dach kommt als nächstes dran.
Buck hat uns die Leech Pond-Farm verkauft. Er stammt aus einer der ältesten Familien dieser Stadt, die einst eine wohlhabende Gemeinde von Granitarbeitern und Farmern mit Milchwirtschaft war. Doch der Steinbruch wurde geschlossen, und die Bevölkerungszahl sank ständig, bis Städter wie wir anfingen, hier Grundbesitz zu kaufen. Buck versagte in seiner kurzfristigen Tätigkeit als Straßenbeauftragter. Seine Frau verließ ihn, seine Farm verfiel. Jetzt fährt er sein Snowmobile über die winterlichen Hügel, das er jedes Jahr gegen ein größeres, schnelleres Modell eintauscht, und verschandelt die Wälder mit weggeworfenen Öl- und Bierdosen, die wir aufsammeln, bevor sie unterm Laub verschwunden sind. Buck lebt mit seinem halbwüchsigen Sohn ein paar Meilen entfernt bei der Autobahn in einem neuen Wohnwagen mit Teppichboden und gerüschten Vorhängen.
Er kommt oft vorbei, um zu sehen, was wir «seinem Haus» antun. Unter der Küchenspüle tauscht Sam den alten Gartenschlauch, der als Abflußrohr diente, gegen ein neues Plastikrohr aus.
«Was machst du da drunten?» fragt Buck. Das Bier hat ihn leutselig gemacht.
«Buck, warum hast du mir nicht gesagt, daß hier unten nur ein Gartenschlauch ist?»
Er lacht. «Oh, das hab ich vergessen.» Sam kriecht unter der Spüle hervor. Buck nimmt eine Bierdose aus seiner Sechserpackung.
«Hier, trink ein Bier. Immer mit der Ruhe. Hab ich’s dir nicht gesagt? Bist du fair zu mir, bin ich fair zu dir.»
Ich mische mich ein. «Buck, in der Scheune standen ein paar alte Milchkannen. Ein Trödler kam vorbei, und ich habe sie ihm gegeben. Er hat mir zwei Dollar dafür gezahlt.»
«Verdammt noch mal! Die kann er nicht haben. Ich werd sie zurückholen.»
«Also, hier ist das Geld.» Ich gebe ihm die zwei Dollar.
«Ihr zwei habt eine Menge Kram.» Buck betrachtet unsere Kisten.
«Ich hätte für die Farm mehr von euch verlangen sollen. Ihr habt ein gutes Geschäft gemacht.» Er blinzelt mir zu.
«Was habt ihr mit meiner Diele gemacht?» Er sieht sich das winzige Viereck neben dem Bad an, dessen schiefe Wände mit Sprüchen auf Holztäfelchen bedeckt gewesen waren, mit Warnungen, nicht die Frau zu schlagen, seine Dummheit nicht zu zeigen, bei der Arbeit nicht einzuschlafen – der Humor der Besitzlosen.
«Wann läßt du dir mal die Haare schneiden?» fragt Buck Sam.
«Und du, Buck?» Bucks kurzgeschorener Kopf wird kahl, sein Bauch wölbt das Hemd.
«Warum gibst du mir nicht etwas davon?» Buck packt eine Handvoll von Sams dickem Haar.
Sam weicht aus. «Du hast mir bei unserem ersten Besuch hier versprochen, die Grenzen des Grundstücks mit mir abzugehen. Wann machst du das?»
«Ich hab dir gesagt, ich mach’s, also mach ich es. Bist du fair zu mir, bin ich fair zu dir.» Bevor Buck geht, erinnert er Sam: «Mir ist es egal, wie einer seine Haare trägt.»
Auf wackeligen Leitern stehend, reißen wir grüne Asphaltschindeln vom Dach. Darunter kommen verwitterte Holzschindeln zum Vorschein; viele sind verfault oder zerbrochen. Aufgescheuchte fette weiße Spinnen, so groß wie ein Silberdollar, retten sich an langen, seidigen Fäden in die Tiefe.
Vorübergehende Nachbarn halten uns für töricht, weil wir aus ästhetischen Gründen eine Isolierschicht entfernen. Sie finden verwitterte Holzschindeln nicht hübscher als eine grüne Verkleidung. Aber wir werden Isolierstoff in die Wände spritzen lassen, erklären wir ihnen. Von außen sieht das Haus schon besser aus. Ich streiche die Fensterrahmen in einem Kastanienbraun, zu dem ich Braun und Rot mische. Die große Weide auf dem Rasen verdeckt schadhafte Stellen; unser steiles Dach erhebt sich malerisch über den Bäumen.
Drinnen kommt die Küchendecke herunter, mit ihr Klumpen von altem Isoliermaterial, das uns auf der Haut klebt. Glasfasern zerkratzen uns die Arme, verstopfen uns die Lungen. Besucher, ehemalige Schüler von Sam, helfen, die neue Decke einzuziehen. Sie machen das Dach höher – die Speichertür wird nun ein großes Fenster. Licht dringt herein und trocknet Bucks Muffigkeit aus. Auf den Dachsparren balancierend, verputze ich die Risse in der Trockenmauer und streiche dann die Decke weiß. Die Wand zwischen den beiden Zimmern im Erdgeschoß reißen wir heraus und haben nun einen großen Raum. Unsere freiwilligen Helfer schleppen handgesägte Scheunenpfähle herbei, die jetzt aussehen, als hätten sie das Haus seit hundert Jahren getragen. Zwischen den Fenstern baut Sam Bücherregale ein, sie dienen als weitere Isolationsschicht. Als letztes nehme ich mir das widerliche Bad vor, danach soll das Obergeschoß an die Reihe kommen. Ich streiche Wände und Boden in strahlendem Orange und bedecke die Kunststofffliesen mit Holzbrettern aus der Scheune. Das Bad wird erträglich, und ich kann es jetzt benutzen, ohne jedesmal eine Grimasse zu schneiden.
Unser Arbeitsrhythmus wird zwanghaft, wir unterbrechen ihn nur, um zu essen. Es ist unmöglich, einen Augenblick der Ruhe, Einsamkeit zu finden, einen Raum für sich allein, eine Möglichkeit, allein mit Sam zu reden oder übers Land zu gehen. Entscheidungen haben ihr Eigenleben. Die alten Schüler und neuen Nachbarn, die kommen und gehen, besprechen sich mit Sam, wenn sie Fragen haben, nicht mit mir. Ich spüre meine Unfähigkeit und halte mich an das, was ich kann – streichen, abreißen. Ich verschwinde im Hintergrund. Sam entwickelt sich zum Pseudochef. Manche Helfer bleiben über Nacht, schlagen ihre Zelte im Freien auf oder legen ihre Schlafsäcke irgendwo auf den Boden. Obwohl ich mich vor unserem Publikum still verhalte, sieht Sam den Zorn in meinen Augen und meinen Bewegungen.
Im Bett fragt er: «Was ist los mit dir?»
«Niemand bespricht irgendwas mit mir. Es ist, als würde ich noch nicht mal hier wohnen.»
«Du bist nie da, wenn wir etwas bereden, du bist immer mit anderem beschäftigt. Außerdem habe ich nicht angenommen, daß du dich für Leitungen und Installationen interessierst.»
«Ich weiß nichts. Wenn ich etwas lernen will, bin ich im Weg. Was soll’s!»
«Bitte, sprich leiser. Sollen dich alle unten hören? Was würden wir ohne diese Hilfe tun? Wir können niemanden bezahlen.»
Ich ersticke meinen Widerspruch im Kopfkissen, damit ich unsere Gäste nicht in Verlegenheit bringe.
Sam und ich flüchten allein zum Holzplatz. Über die Route 15 folgen wir einem Lieferwagen, seine Ladung besteht aus zwei kleinen Kindern und einem schwarz-weiß gefleckten Kalb. Die Kinder spreizen ihre Finger zum V und winken uns zu. Wir fahren an einem wild gewordenen Pferd vorbei, das einen Zaun entlanggaloppiert; es rast bis zum nächsten Zaun, macht kehrt, rast zurück. Hinter ihm reckt sich ein glänzendes Metallsilo zum Himmel und reflektiert in der Sonne. In Wolcott durchstöbern wir die Trödelläden nach einer Marmorplatte für unser Bad. Wir mögen Wolcott; hier findet man meilenlang abmontierte Installationen, Toilettenschüsseln, gebrauchte Badewannen auf Klauenfüßen, glänzende Porzellanbecken, sie stehen unbeholfen nebeneinander auf dem Kies und werden wahrscheinlich nie wieder Wasser auffangen.
Im General Store, dem Laden für alles, kaufen wir ein paar Dichtungen und noch einen Pinsel. Ed verschwindet im dunklen Hintergrund, um das Gewünschte zu suchen. Ed und Edna führen den Laden in einem alten Haus, dessen weiße Schindeln mit häßlichen grauen Abdeckplatten beklebt wurden, um die Kälte abzufangen. Reklameschilder aus den vierziger Jahren werben für Red Rose-Tee und Philipp Morris-Zigaretten, sie rosten schon und werden teilweise von Handzetteln verdeckt, die zu Versteigerungen und kirchlichen Gemeindefesten einladen. Eine Reihe weißer, handgeschriebener Schilder zählt alles auf, was man hier findet: Textilien, Angelgerät, Eis und Munition, Werkzeug und Jagdscheine, Toiletten, Lebensmittel und Tiefkühlkost. Die Waren sind abenteuerlich in Regalen und auf den Theken gestapelt.
Ich lese die handgeschriebenen Notizen über dem Ladentisch: ein Lagerplatz zu vermieten, Fahrräder und Herde zu verkaufen, ein Abendessen zugunsten der Parteikasse der Demokraten, eine Sammelbüchse für die Familie, die gerade abgebrannt ist, eine Mitteilung: «Kinder, spielt bitte nicht in dem Lastwagen, der neben dem Laden steckengeblieben ist. Danke.» Allen wird der gleiche Raum zur Verfügung gestellt. Über den Ladentisch hinweg gibt Edna einem anderen Neuankömmling Ratschläge zur Frühjahrsbepflanzung.
«Vor dem 30. Mai sollte man nichts in die Erde stecken», sagt sie.
Es herrscht wieder Friede. Sam und ich planen unseren Garten. Wir sind uns einig, daß wir mit dem Haus rasche Fortschritte machen.
Roy, ein Original der Gegend, ist der Besitzer der Esso-Tankstelle in der Stadt. Diese Tankstelle ist mehr als eine Werkstatt, mehr als eine Zapfstelle für Diesel und Benzin, sie ist der gesellschaftliche Mittelpunkt des ganzen Gebiets. In seinen fettverschmierten Fingern hält Roy eine Bierdose; die Zigarette, die an seiner Lippe klebt, deutet auf eine zackige Narbe aus einem längst vergessenen Kampf. Er zieht Männer und Frauen an, Einheimische und Neuankömmlinge. Wir bitten ihn, die Autowracks abzuschleppen, die Buck uns hinterlassen hat.
«Das ist wirklich eine Schweinerei», sagt Roy. «Mit Buck und Flora stand es ziemlich schlecht, bevor er die Farm verkaufte. Es heißt, sie hat ganz schön herumgeschlafen. Jetzt schaut mich nicht so an, ich wiederhole nur, was ich gehört habe. Den Jungen hat sie bei ihm gelassen. Aber man kann ihr eigentlich keine Vorwürfe machen. Buck hat seinen Job verloren und ganz ordentlich gesoffen. Schlimm, wenn so was passiert. Kennt ihr Carl, Bucks Bruder? Die beiden reden nicht miteinander. Letztes Jahr hat jemand Buck als Carls Gegenkandidaten für den Magistrat aufgestellt. Das war vielleicht ein Witz. Carl ist ein richtiger Politiker. Zwei Brüder, und so verschieden. Man weiß wirklich nicht, warum manche Leute sind, wie sie sind, stimmt’s?»
Roy läßt sich zu einem weiteren Bier einladen, bevor er sich an die Arbeit macht.
«Ich sag euch, ich werde jedes Jahr um mehr als tausend Dollar betrogen. Esso droht mir dauernd, nicht mehr zu liefern, weil ich so viele Schulden bei ihnen habe. Das kommt davon, wenn man Kredit gibt. Es sind nicht die jungen Leute, die mich übers Ohr hauen. Es sind die anderen, die ihr Leben lang hier gewohnt haben. Mann, in dieser Stadt habe ich vielleicht Feinde! – Also, Sam, wir kümmern uns jetzt besser um die Wracks, wenn ich heute noch was tun soll.»
Ich schaue zu, wie der Kran auf Roys Lastwagen verrostete Autoskelette aus dem Sumpf zieht. Wenn es am Haken hängt, erlebt jedes Wrack eine kurze Auferstehung, dann wird es auf die Ladefläche des Lasters gelegt, und der Haken holt sich das nächste. Fünfzehn verrottete Fahrzeuge verließen ihr Grab. Buck wollte sie mit dem Bulldozer tiefer in den Sumpf pressen, damit man sie nicht sah. Es ist befriedigend zu beobachten, wie der Schrott verschwindet, aber nachdem die größeren Ruinen entfernt sind, tauchen neue Stücke auf, als wären sie die Nachkommen der Wracks – Auspuffrohre, Auspufftöpfe, Räder. Sobald die Laster beladen sind, wirkt Roy wieder entspannt. «Hier wird es wirklich anders aussehen, wenn ihr zwei zugepackt habt. Buck wird seine Farm nicht wiedererkennen. Sag mal, kennst du Sarah?» Roy schaut mich an. «Die bei mir Benzin zapft. Sie ist eine großartige Frau, hat das College abgeschlossen. Sie schreibt ein Buch, aber sie sagt, sie will alles über Autos lernen. Ich hab nichts dagegen, wenn Frauen an Autos arbeiten, du, Sam?» Er blinzelt mir zu.
«Ich habe versucht, ihr was beizubringen, aber sie hat kein Interesse», sagt Sam.
Die Geschichten über Roy und Sarah gehören zur örtlichen Folklore. Sarah, eine zweiundzwanzigjährige Radikale, wohnte neben der Tankstelle und besuchte sie oft, trank dort Bier und machte Späße mit Roy. Eines Tages schnitt sie ihr taillenlanges Haar ab und signalisierte damit ihre Emanzipation von den asketisch wirkenden, bekifften jungen Männern in ihrem Leben. Sie lud Roy zum Bridge ein. Jetzt ist sie stolz auf ihre Affäre mit Roy, einem Hiesigen, einem Arbeiter.
«Ich leiste mehr für die Beziehungen zwischen Neuankömmlingen und Vermontern als alle Politiker mit ihrem rhetorischen Geschwätz.»
Roys Frau plaudert mit Sarah an der Tankstelle, manchmal spielt sie mit den beiden Bridge und tut, als wisse sie nichts. Samstag abends führt Roy Sarah zum Tanz, wenn seine Frau keine Lust dazu hat. Meistens hat sie keine.
Im Obergeschoß fing ich damit an, die alten Tapeten und den Verputz zu entfernen. Während ich arbeitete, fielen große Brocken von den Latten dahinter und rissen mir die Haut auf. Grauer Staub füllte den Raum und meine Lungen und rieselte durch das Kaminloch, so daß auch der untere Fußboden mit einer dünnen weißen Puderschicht bedeckt wurde. Schweigend reiße ich die schadhafte, verblaßte Tapete mit ihren Rosensträußen, hingekritzelten Telefonnummern, mit Herzen umrahmten Initialen ab und denke dabei über das Leben nach, das Unbekannte in diesem Zimmer, in diesem Haus geführt haben mögen. Mülleimer voll Verputz werden auf den Abfallplatz geschleppt. In einem hastig angefertigten Trog mische ich neuen Gips und rühre ihn, damit er glatt wird. Ich werfe ihn so an die Wand, daß eine Struktur entsteht. Es dauert so lange, bis der Gips dick wird, und dann ist er so schnell verbraucht, daß ich einen weiteren Fünfzig-Pfund-Sack die Treppe heraufschleppen und wieder mischen muß. Die Arbeit geht langsam voran. Es dauert Wochen, bis die Wände trocken sind und ich den Boden und die Leisten abkratzen kann. Eifrig bemüht, meine Arbeit ordentlich zu machen, male ich die Ränder braun, die Wände weiß und fahre mit meinem Pinsel sorgsam über jede Wölbung. Es wird ein schlichter Raum daraus, ich möbliere ihn mit einem schmalen Bett, einem Larkin-Schreibtisch, den ich auf einer Versteigerung gefunden habe, einem Schaukelstuhl, den jemand weggegeben hat, auf den Boden lege ich das Zebrafell, das ein Freund aus dem Peace Corps in Kenia mitgebracht hat. Endlich habe ich ein eigenes Zimmer, wo ich allein sein, denken oder schreiben kann, wo meine Stimmungen und Rhythmen maßgebend sind. Doch wir haben endlich warmes Wetter, und es fällt schwer, im Haus zu bleiben. Neue Besucher kommen, und wo sonst sollten sie schlafen als in diesem Zimmer, das ich vollendet habe?
Meine Freundin aus Kindertagen und ihr Mann besuchen uns, bevor sie nach Afghanistan reisen, wo er als Arzt im öffentlichen Gesundheitswesen arbeiten wird. Debby und ich werden zu neunundzwanzigjährigen Schulmädchen, wandern gemeinsam meine Landstraße entlang und rufen alte Erinnerungen wach, um unsere Geschichten bis zu diesem Augenblick fortzuführen.
«Ich hätte mir dich nie als Farmersfrau vorgestellt», sagt sie.
Wir lachen. Obwohl das Bild romantisch ist und ich nicht genau weiß, was ich eigentlich bin, paßt ihr Etikett nicht.
Zum erstenmal sind Debby und ich als Achtjährige so zusammen gegangen, damals die langen, baumgesäumten Gehwege entlang, die von unserer Grundschule zu meinem Haus führten. Sie kam zu mir «zum Spielen», ich lud sie am Telefon ein, von meiner Mutter unterstützt, die mein gesellschaftliches Leben in die richtigen Bahnen lenken wollte. Mit zwölf schlossen Debby und ich hinter uns die Schlafzimmertür; heimlich, beschämt und erregt erkundeten wir unsere Körper. Ich erinnere mich an ihre langen, spitzen Brüste, die so anders waren als meine runden, an die Berührung ihrer rauhen, krausen Haare; ihr Geruch blieb an meinen Händen haften. Was wir taten, war nicht wirklich, beschwichtigten wir uns, nur eine harmlose Übung für später. Abwechselnd spielten wir den Jungen, dem wir den Namen unseres neuesten Schwarms gaben. Jetzt versuchen wir, den Menschen zu entdecken, der jeder von uns geworden ist, durch die Schichten erworbener Neurosen zu stochern, uns von den Männern abzusetzen, die wir gewählt haben.
«Schreibst du noch?» fragt sie.
«Ich habe gerade wieder ein Tagebuch angefangen. Jahrelang habe ich nichts geschrieben außer Briefen.»
Samstag nachmittags saßen Debby und ich am Küchentisch in dem stillen Haus, während mein Vater schlief und meine Mutter einkaufte. Stundenlang schrieben wir kichernd in linierte Hefte, bis wir den Drang nicht mehr zurückhalten konnten, unsere Geschichten vorzulesen.
«Ich erinnere mich noch an deine Erzählung mit dem Titel ‹Abenteuer im Puff›, über das junge Mädchen, das zur Prostitution gezwungen wurde. Es hat mich schockiert, daß du wußtest, was das bedeutet», sagte ich.
«Hätten wir nur Kopien behalten! Stell dir den Spaß vor, sie jetzt zu lesen. Weißt du noch – die Idee mit dem Puff kam von einem Schnappschuß, den wir entdeckten; mein Vater stand da während des Kriegs mit ein paar orientalischen Frauen vor einer Hütte.»
«Ja, genau, wir überlegten, was das wohl zu bedeuten hat, und fragten uns, ob wir es deiner Mutter zeigen sollten.»
Wir suchen unseren Weg zwischen den Pfützen auf der Straße.
«Ich fand deine Geschichten immer viel besser als meine», sagt Debby.
«Du hast mich inspiriert. Ich hätte nie etwas geschrieben, wenn du mich nicht dazu ermuntert hättest.»
«Und was ist daraus geworden?» fragt sie.
«Im College habe ich alle meine kreativen Energien in Englisch-Aufsätze gesteckt, dann wurde es wichtiger, die Gesellschaft zu verändern. Geschichten zu schreiben erschien so eigennützig, so elitär.»
«Glaubst du das immer noch?»
«Ich bin mir nicht mehr sicher. Vielleicht ist es von größter gesellschaftlicher Relevanz, etwas zu schaffen, was anderen Freude macht.»
«Wie Kinder machen?» Sie lacht.
Früher sagten wir, daß wir Kinder haben wollten, bevor wir dreißig seien, doch wir gebrauchen sorgsam unsere Pessare, obwohl unsere Geburtstage näher rücken. Wir sind uns einig, daß jetzt nicht die richtige Zeit für Kinder ist; wählen zu können ist unser Luxus.
«Jeder wählt sich seine Arbeit aus persönlichen Gründen, egal, für wie politisch er sich hält», sagt Debby. «Es sieht aus, als gingen wir nach Afghanistan, weil wir den Menschen in den Entwicklungsländern helfen wollen, aber im Grunde kommt dieser Job unseren egoistischen Reisewünschen entgegen.»
Ich lehne ihren Mann ab, den Fremden, der mir in unserem vorletzten College-Jahr ihre Freundschaft entzog. Sie beendete ihr Studium nicht, heiratete und folgte ihm nach Kalifornien. Ihre Wahl enttäuschte mich.
Vor ihrer Hochzeit verbrachte ich einen Tag mit ihnen; sie stritten sich über Vorbereitungen und Verwandte wie ein altes Ehepaar. Ich kam mir betrogen vor. Debby verriet unsere Träume – akademische Titel, berufliche Karriere – wegen eines Mannes, gab unsere frühe Intimität so leicht wegen eines Gefährten auf, der teilweise vielleicht bot, was sie brauchte, aber nie jene gegenseitige Anerkennung und jenes Verständnis, die in weiblicher Gleichheit wurzelten.
Obwohl er ein Eindringling ist, wirkt ihr Mann auf mich anziehend. Er ist rothaarig und drahtig, in seinen festen Muskeln steckt ruhelose Energie. Daß er mir gefällt, macht mich gelassener, distanzierter. Wenn wir einen Augenblick allein sind, neckt er mich: «Wie wär’s mit uns, sie sind nicht da.» Dann lacht er und parodiert sich selbst, er ist sicher, weil er es nicht ernst meint. Aber mich macht er verlegen mit seinen fiesen Andeutungen. Ich finde sie nicht komisch.
«Weißt du», erzählt mir Debby, «wir waren beide unerfahren, als wir heirateten, und keiner von uns hat seither mit jemand anderem geschlafen.»
Ich kenne ihre Geschichte, aber die seine überrascht mich. Welch ein gefährdeter Zustand, wo die Medien, die Jugendkultur und unsere Zeitgenossen alle den Sex verherrlichen.
«Ich will ihn nicht verlassen, aber ich bin von Neugier besessen. Ich frage mich, wie es mit einem anderen wäre. Ich wünsche mir diese Erfahrung. Er sagt, er ist mit mir zufrieden, er will keine anderen, das Risiko lohnt sich nicht.»
Sie beneidet mich um meine Liebhaber. Ihretwegen hält sie mich für weise und erfahren. Ich versichere ihr, daß es kaum etwas bedeutet, es ist so lange her. Mit Mitchell war ich so sehr mit Empfängnisverhütung beschäftigt, daß unser Liebesleben ein medizinisches Problem wurde. Ich vertraute nie der Flasche voll Schaum, die er mir brachte. Als ich einen Blasenkatarrh bekam, bat ich den Arzt um Sulfonamide und die neu herausgekommenen Pillen zur Empfängnisverhütung und rechnete mit seinem Tadel, weil ich nicht verheiratet war.
Während Sam auf mich wartete, hatte ich eine kurze Affäre mit einem geschiedenen älteren Studenten. «Macht dir Sex Spaß?» fragte er, und ich antwortete verlegen: «Ich weiß nicht. Ich nehme es an.» – «Meiner geschiedenen Frau hat es keinen Spaß gemacht», sagte er. Es war anders, unter ihm zu liegen, weil er magerer und leichter war als Mitchell oder Sam; es war einfacher, wenn kein schwerer Mann mich niederdrückte, aber ich brauchte eher Fürsorge als Sex. Meine Mutter war wieder im Krankenhaus wegen ihrer Depression, und entsetzt stellte ich mir ein Leben vor, in dem ich hoffnungslos versuchte, andere Leben in Ordnung zu bringen. Sam bot mir Schutz, und das war viel wichtiger als Sex.
Der starke Geruch von feuchtem Mist schlägt uns entgegen, als wir am frisch gepflügten Feld des Nachbarn vorbeigehen.
«Als wir in Arizona waren, gab es da ein paar Nacktparties», sagt Debby. «Wahrscheinlich hatte es mit der Abgeschiedenheit auf der Navajo-Reservation zu tun. Alle Ehepaare, die da im Gesundheitswesen arbeiteten, kamen sich sehr nahe. Uns war gar nicht klar, was geschah. Zuerst berührten sich die Leute nur. Wir taten nie mehr, zu richtigem Sex kam es nicht, aber zwei Ehen gingen auseinander.»
Ich versuche mir die Szene vorzustellen, die sie beschreibt: Ein Spiel, als sei Sex harmlos, die Rückkehr zu den sündenlosen Tagen der Kindheit. Doch Debby und ich könnten uns jetzt nicht mehr so liebkosen wie damals, als wir zwölf waren.
Sie stimmt mir zu. «Wahrscheinlich wollen wir alles auf einmal. Wir wollen den Spaß, aber nicht die Folgen. Ich mache meine Eltern dafür verantwortlich. Ihre Verbote haben mich daran gehindert, Erfahrungen zu machen, als es Zeit dafür war.»
«Unsere Eltern haben uns gelehrt, die Welt sei gefährlich und bösartig. Sie haben uns beigebracht, wir seien verletzlich und brauchten Schutz. Ich komme mir immer noch sehr verwundbar vor, ein Opfer auf eigene Gefahr.»
«Sie waren selbst so unsicher», sagt Debby. «Die Wirtschaftskrise, Antisemitismus, ihre eingewanderten Eltern …»
Die Kühe der Nachbarn grasen neben der Straße.
«Ich habe mir überlegt, daß eine Trennung nach zehn Ehejahren gesund sein könnte. Bald sind wir zehn Jahre verheiratet. Was meinst du?»
«Bei uns sind es erst sieben Jahre.» Ich prophezeie ihr, daß sie bald einen Seitensprung arrangieren wird. Sie widerspricht nicht.
«Dein Leben kommt mir jetzt so friedlich vor.»
Ainsley sammelt seine Herde. Er ruft die Tiere mit einem hohlen Schrei, einem Signal, das sie verstehen, dann lächelt er und winkt uns zu. Wir bleiben stehen und lassen die schwarzweißen Hereford-Rinder über die Straße gehen.
«Ich beneide dich um deine Reisen. Ich würde Leech Pond sofort verlassen und nach Asien gehen. Ich bin noch nicht bereit, seßhaft zu werden.»
Wir nähern uns dem Haus. Die Männer beugen sich über Sams neues Motorrad und sprechen über Maschinen.
«Vielleicht sollte ich nicht mit ihm nach Afghanistan gehen», sagt sie und bricht ab, als wir in Hörweite unserer Männer sind.
Meine Eltern, unsere nächsten Gäste, kommen nach kurzfristiger Voranmeldung. «Mit Mutter kann man nie vorausplanen», erinnert mich Daddy. Seit über zehn Jahren hat sie alle zwei bis drei Monate «ein Tief», ist depressiv. Trotz einer Serie von Psychiatern, Drogen, Lithium, Schocks geht es Jahr um Jahr so weiter. Sie entfernt sich und tritt in einen depressiven Stupor ein, als wäre er ein Zimmer, das für sie hergerichtet ist und auf sie wartet. Wir versuchen sie zurückzuhalten, aber sie entzieht sich immer mehr, bis ein Zwangsaufenthalt im Krankenhaus ihr Halt gebietet. Ich stehe am anderen Ende der Telefonverbindung und versuche, meinem Vater Rat und Trost zu geben. «Was kannst du tun?» sagt er. «Du lebst nicht hier.» Ja, ich bin erleichtert, daß ich nicht dort bin, dankbar, daß ich mit Sams Hilfe entfliehen konnte.
In ihren Stadtkleidern folgen sie mir durch den Wald zum Bach; sie sind nicht zimperlich. Wir sprechen weder über Mutters Krankheit noch über ihre vier Schwestern, die alle an Krebs starben, bevor sie fünfzig waren. Zwischen den Depressionen ist Mutter normal, so normal, wie ich sie in Erinnerung habe. Sie ist noch immer schön, die Drogen und Schocks konnten dem Glanz ihres Haars, der Farbe ihrer Haut oder dem Strahlen ihrer Augen nichts anhaben. In der Depression streikt ihr Körper, sie bekommt Falten und schrumpft sichtbar; sie kann nicht auf die Toilette, nicht essen, nicht schlafen. Sie geht auf und ab, sie bleibt stehen, wiegt sich hin und her, verzieht den Mund, doch wenn sie ein oder zwei Monate später aus diesem Zustand auftaucht, ist sie verwandelt, auf geheimnisvolle Weise ist der Bann gebrochen.
Meine Eltern haben beide einen Zwilling, meine Mutter einen Bruder, der Herrenbekleidung in Colorado verkauft, allein lebt und nie nach Hause kommt, mein Vater eine Schwester, blond wie er.
«Er kümmert sich mehr um sie als um mich», beschwert sich meine Mutter. Der Zwilling meines Mannes, sein Gegenstück, ist so dunkel, wie er blond ist. Sam und ich sind mehr wie Zwillinge. Wir gleichen uns in unseren Unterschieden, sind einander ähnlich geworden. Einer hat vom anderen Redeweise, Meinungen, Gewohnheiten übernommen, wir wissen nicht mehr, von wem die Regeln stammen, nach denen wir leben, doch wir versuchen uns zu erinnern. Während wir einander ähnlicher werden, versucht jeder verzweifelt, sich zu behaupten. Manchmal meine ich, unser Blut hat sich vermischt – er ist mein Bruder geworden. Ein Inzest-Tabu entsteht zwischen uns; wir schaffen Distanz, um unsere Getrenntheit zu erhalten, wir reagieren allergisch aufeinander, und jeder hüllt sich in durchsichtige Schleier. Nachts verschweige ich mein Bedürfnis, umarmt zu werden. Ich packe ein zerknülltes Taschentuch unter meinem Kopfkissen und sehne mich nach einem geträumten Fremden.
Durch unsere dünnen Wände kann ich hören, wie meine Eltern in die Nacht reden.
«Warum kann ich keinen Nerzmantel bekommen?» fragt meine Mutter. «Alle anderen Anwaltsfrauen haben einen.»
«Schlaf jetzt», sagt mein Vater. «Meinst du, jetzt sei der richtige Zeitpunkt, darüber zu reden?»
Unterdrücktes Leid, Geheimnisse gehören zum Zusammenleben mit ihr. Geflüster bewohnte unsere Räume – was ist aus ihrem Vater geworden? Warum ist ihr Bruder im Krankenhaus? Woran leidet ihre bettlägerige Mutter, die unter uns wohnt? Geheimnisse, die ich nicht verstehen konnte. Eine Reihe schwarz gekleideter Schwestern, fünf waren es und meine Mutter in der Mitte, stiegen in einen Wagen. Ich wußte, daß meine Großmutter tot war, aber ich war noch nicht alt genug, um mehr tun zu können als diese fremden Erwachsenen anzustarren, schwarze zerbrechliche Museumsstücke, die ich betrachten, aber nicht berühren durfte. In den nächsten zehn Jahren starben dann meine Tanten eine nach der anderen.
Nach dem Tod ihrer zweiten Schwester blieb meine Mutter den ganzen Morgen im Bett. Wie Krankenschwestern versuchten meine Schwester und ich, sie zum Aufstehen zu bewegen.
«Bitte», bat ich, «bitte, zieh dich an.»
«Ich kann nicht», sagte sie. «Ich habe keine Kraft.»
Am späten Nachmittag schaffte sie es, einen Pullover und einen Rock anzuziehen. Ich hatte Bohnen und Hamburger gekocht, sie saß mit uns am Tisch und rührte das Essen nicht an.
«Es wird schon wieder», sagte sie. «Es geht mir jetzt besser. Ich finde nur keinen Schlaf.»
Immer wieder hofften wir, jetzt sei es vorbei mit ihrer Apathie, unseren Wachen, unserer Ohnmacht ihr gegenüber. Eines Morgens regte sie sich nicht. Mein Vater entdeckte das leere Röhrchen Schlaftabletten. Aus Filmen wußten wir, was zu tun war: Mein Vater an ihrer einen, ich an der anderen Seite zwangen sie, hin und her zu gehen, während Linda unten Kaffee kochte. Der Arzt schickte sie in die psychiatrische Abteilung eines Privatkrankenhauses. Einen Monat später kam sie nach einer Reihe von Schockbehandlungen wieder nach Hause und war normal. Wir sprachen nicht über das, was geschehen war.
Aber ich änderte meine Pläne. Ich würde nicht, wie jahrelang geplant, an ein auswärtiges College gehen, sondern zur Universität in der Stadt. Täglich fuhr ich mit dem Bus hin und ging durch die heruntergekommenen Gassen rund um die Universität. Weiße, moderne Gebäude, innen sauber und sicher, wuchsen aus dem Boden. Die Straßen der Umgebung blieben unverändert.
An der Theke eines Drugstores trank ich neben Arbeitern und Schwarzen meinen Kaffee, Studenten ging ich aus dem Weg. Mein Mittagessen zog ich aus einem Automaten im Keller eines dunklen, unheimlichen Gebäudes, das Old Main hieß; ich genoß die Düsternis wie eine viktorianische Heldin.
Zwischen den Vorlesungen wanderte ich suchend durch Buchhandlungen. Ich nahm gebrauchte Psychologie-Lehrbücher vom Regal und las stehend die Kapitel mit der Überschrift «Manisch-depressive Psychosen», ohne etwas daraus zu lernen. Tauben huschten davon, wenn ich an einer dunklen Ecke auf meinen Vater wartete, der mich im Wagen mit nach Hause nahm. Es wurde dunkel, er verspätete sich immer. Ich war müde, brauchte Schlaf. Das Studium und der Briefwechsel mit Mitchell in Kalifornien erschöpften meine Energie. Ich hatte keine Verabredungen, ging zu keinen Parties. Ich fuhr zur Uni und zurück, schrieb Briefe und schlief. Wenn mein Vater schon jemanden im Wagen hatte, war ich erleichtert. Waren wir allein, fürchtete ich, er könne in Tränen ausbrechen und seinen Schmerz zeigen, statt ihn zu verbergen.
Allmählich gab mir Mutter meine Rolle als Kind zurück. Sie beugte sich über mein Bett.





























