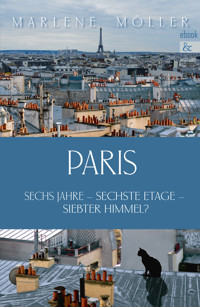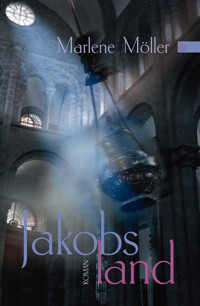
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Buch&media
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Santiago de Compostela, 1815: Verzweifelt über seine Kinderlosigkeit, besticht der Majoratsherr Don Gayoso y Pardo den jungen Franziskanermönch Jeronimo, besiegt die Tugend seiner Gattin und setzt deren Sohn als Alleinerben ein. Als später zwei eigene Kinder geboren werden, deckt Gayoso, besessen von der Idee der Reinheit des Blutes, den Betrug auf, was eine Tragödie in Gang setzt, die durch das gnadenlose Urteil der Sacra Romana Rota von 1826 besiegelt wird. Hundertfünfzig Jahre später erkennt eine Journalistin in dem sensationellen Rechtsfall Parallelen zum eigenen Familiendrama und macht sich auf Spurensuche ins Jakobsland ?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 448
Veröffentlichungsjahr: 2013
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
FürMirjamJudithHannahundEva
Nein! wie die Sterblichen doch die Götter beschuldigen! Von uns her, sagen sie, sei das Schlimme! Und schaffen doch auch selbst durch eigene Freveltaten, über ihr Teil hinaus, sich Schmerzen!
Homer, Odyssee
Ihre Spuren verwischt, die Gräber verweht, die Herzen zerfallen, die Tränen versiegt. Sie wird die Schatten nachfahren, den Staub sammeln und warten, bis sie auftauchen überm Weiher im Nebelreigen.
Und wenn sie vergeh’n in der Tiefe des Parks, wird sie warten, bis sie wiederkehren, im Wellenschlag des Meeres, im Glanz des Mondes, im Duft einer Rose, und ihr zuraunen, sie seien beisammen im Balsamduft ferner Gärten, alle beisammen …
MARLENE MÖLLER lebte von 2005 bis 2011 in Paris, jetzt wieder in Stuttgart, wo sie geboren ist. Studium: Germanistik, Soziologie und Politikwissenschaft in Tübingen, Freiburg und Paris. Berufe: Lehrtätigkeit an Hochschule und Gymnasium, wissenschaftliche Redakteurin. Vier erwachsene Töchter.
Bisher erschienen: »Paris. Sechs Jahre – sechste Etage – siebter Himmel?« (München 2013, ISBN 978-3-86520-481-3); »Seelenheimweh. Vom kurzen Leben und langen Sterben eines Terroristen« (Hilden 2009, ISBN 978-3-940891-12-9).
Weitere Informationen über den Verlag und sein Programm unter www.buchmedia.de
September 2013© 2013 Buch&media GmbH, MünchenUmschlaggestaltung: Kay Fretwurst, FreienbrinkCovermotiv: Kathedrale zu Santiago de Compostela mit dem BotafumeíroPrinted in Germany · ISBN 978-3-86520-466-0
Inhalt
Der Entschluss
Suche nach dem Anfang
Der dunkle Gast
Der Mächtige steht auf
Das Böse zeigt sein Gesicht
Die Hexe
Der Mönch verlässt das Kloster
Die Ankunft
Zeit der Liebe
Extramuros
Das Tagebuch
Ein stummer Abend
Die Sehnsucht siegt
Die Trennung
Der Nachtmahr
Semana Santa
Im Elternhaus
Die Taufe
Die Nachgeborenen
Der lange Kampf
Das Urteil
Die unschuldigen Kinder
Verstoßen
Abschied
Der Entschluss
Mein Sohn!
Einsam wie im Grab und verloren wie ein ausgesetztes Kind verbringe ich meine Tage in der von spanischen Eroberern errichteten Stadt hinter Mauern, inmitten der philippinischen Hauptstadt, die mir bestimmt wurde als Ort der Verbannung auf Lebenszeit und aus der kein Entkommen möglich ist, nicht nur, weil es mir durch meinen obersten Aufseher, den Erzbischof von Manila, untersagt ist, mich außerhalb der Festungsmauern von Intramuros zu begeben, sondern weil dahinter, jenseits der Bucht mit dem abendlichen Trost der verglühenden Sonne, das Meer mich bewacht, von Schiffen durchkreuzt, auf denen Piraten ihre Opfer suchen.
In den Jahren der Heimatlosigkeit und Erniedrigung ist mein vormals fester Glaube siech geworden, die Zuversicht fahl, und zu Zeiten wird das Gemüt so finster wie der Himmel vor einem Taifun, wenn sich das Schwefelgelb der Zerstörung über das Schwarz der Hölle schiebt. Später dann, wenn heftiger Regen beides weggespült hat und ich mich imstande fühle, die Finsternis in mir für geraume Zeit zurückzudrängen, sinniere ich so manche Stunde darüber nach, ob mir nicht doch eine Art von Flucht möglich wäre, und sei es auch nur für kurze Frist am Tage oder in der Nacht, wenn es mir gelänge, die Verließe meines inneren Gefängnisses zu verlassen, in denen ich ebenso unentrinnbar eingeschlossen bin wie am Ort meiner äußeren Gefangenschaft. Womöglich könnte so mein Leben in der Fremde einen tieferen Sinn erlangen als den der Verbüßung meiner Strafe, die ja nur dann zur Sühne würde, wenn ich sie im rechten Geist ertrüge, statt innerlich Klage zu führen über ihre Grausamkeit und Härte.
Über den Rinnsalen solcher Grübeleien taucht gewöhnlich eines der Bilder aus der Vergangenheit auf, das meines Sohnes und seiner Mutter, wie sie einander gegenübersaßen bei jenem Nachtmahl im Hause Gayoso, das der Auflösung der Familie vorausging. Ein stummer Abschied, zu schwer für Tränen oder Worte, einer, der verordnet war und durchgeführt werden musste. Der Schmerz jener Stunden flammt mit jedem Gedanken an Dich erneut wieder auf, doch hat er seit meiner Einquartierung in einer Gesindekammer des Klosters San Augustín, neben dem Palais des Erzbischofs, eine gewisse Wandlung erfahren. Wenn anfänglich meine Tage damit erfüllt waren, den Kummer des Verlustes der Heimat ohnmächtig zu erdulden und dumpf dahinzuleben, indem ich des Morgens aufstand von einem Lager, auf dem ich nachts kaum Schlaf gefunden hatte, um mich am Abend in wehrloser Schwäche wieder darauf niederzulassen und abermals die Ruhelosigkeit der Nacht zu erwarten, so habe ich im Laufe der Zeit eine Verfassung erlangt, die mir Kraft gibt, die zugeteilten Arbeiten mit Gleichmut zu verrichten und in den Ruhestunden zurückzuschauen in die Heimat und auf mein dort verbrachtes Leben.
So bin ich schließlich dahin gelangt zu erwägen, ob es nicht hilfreich sein könnte für Dein Leben, wenn ich meine Erinnerungen aufzeichnete, denn nur so würdest Du eines Tages Kunde davon bekommen, wie all die Taten begangen werden konnten, die, von außen betrachtet, als so frevlerisch erachtet wurden, dass sich mir, im Schatten des allgemeinen Urteils, vermutlich noch immer die Feder sträuben würde, sie aufzuschreiben. Doch da wir alle, Schuldige und Unschuldige, den Folgen dieser Taten nicht mehr entrinnen können, die Tage unseres Lebens, werde ich versuchen, Dir ein Bild zu malen von der Zeit, als sich durch unsere Schritte die Steine lösten, welche zu jener mächtigen Lawine wurden, die uns später donnernd überrollte.
Da ich nicht wissen oder ahnen kann, welchen Gang Dein Schicksal genommen hat, vermag ich auch nicht vorherzusagen, ob Dir diese Schilderungen eines Tages willkommen sein werden. Ich kann nur meiner inneren Stimme folgen und mit der Niederschrift beginnen. Dabei muss ich die Bürde der Ungewissheit tragen, ob Wut oder Unmut in Deiner Seele durch mein Tun noch vergrößert werden, oder ob ich Dich damit stützen kann auf Deinem Weg durch das Leben, an dessen Rand zu stehen mir nicht vergönnt ist. Nach langem Prüfen und Wägen habe ich nun also beschlossen, Dir gelegentlich einen Brief zu schreiben, vorläufig ohne ihn abzuschicken, und Dir nach und nach alles zu berichten, was ich aus jener Zeit im Gedächtnis behalten und im Herzen bewahrt habe.
Jetzt kann ich nur noch hoffen, es möge ein Segen auf meinem Vorhaben liegen.
Es grüßt Dich in respektvoller Zuneigung
Dein Vater
Manila, den 23. Februar 1845
Post Scriptum: Obgleich es eine zu persönliche Anmerkung sein mag, möchte ich Dir mitteilen, dass mir in den letzten Tagen eine merkwürdige Belebung widerfuhr, die von meiner Absicht, Dir zu schreiben, auszugehen scheint. Fast täglich nahm ich in meiner Kammer eine kleine Veränderung vor, um sie in eine Art Schreibkabinett zu verwandeln. An die Schmalseite, wo unter dem Fenster mein Bett aus Bambusrohr stand, habe ich ein Tischchen samt Hocker gerückt, um mehr Licht zu bekommen, und dort Papier, Tinte und frisch gespitzte Federn zurechtgelegt.
Mein Lager steht nunmehr an der Längsseite des Raumes, davor ein Schemel mit Papier für Nachtgedanken. Als Kommode dienen mir zwei Bretter, die über dem Fußende des Bettes von Wand zu Wand verlaufen, denn das Zimmer ist zu klein für ein weiteres Möbelstück. Auf dieser Ablage gedenke ich die Briefe an Dich zu sammeln, neben meinen Büchern, Wäschestücken und Habseligkeiten.
Inzwischen bin ich daran gewöhnt, in dieser winzigen Kammer zu leben, sie passt zu meiner Gefangenschaft und hat durchaus Ähnlichkeit mit einer Klosterzelle. Im Übrigen stellen diese äußeren Umstände die weitaus geringere Schmach dar, verglichen mit dem Verlust meiner geistlichen Würde. Jetzt, wo ich mit einem lange nicht gekannten Eifer alles für ein Ziel eingerichtet habe, fühle ich mich wohler in dieser Muschel am Ende der Welt, in der ich mich künftig vielleicht auch lebendiger fühlen werde, weil meiner dort eine heimliche Beschäftigung harrt. Mittlerweile ist auch jene Unentschlossenheit gewichen, ob ich die vergangenen Ereignisse aufschreiben soll. An ihre Stelle trat die leidliche Zuversicht, dass Du, obgleich Du die Geschichte Deiner Familie nicht ohne Schmerzen wirst lesen können, vermutlich erkennen wirst, wie sehr ich bestrebt war, Dir mit ihrer Niederschrift etwas Gutes zu tun.
Suche nach dem Anfang
Endlich
Die Briefe übersetzt, wieder in Santiago. Ankunft im Winter, es wird kaum Tag, doch es ist die Zeit von Margaretha und Jeronimo, wie im Jahr 1816, vom Erscheinungsfest bis Ostern. »Rosenzeit, schnell vorbei … «Wetter bleibt.
Sie wird die Orte des Geschehens besuchen, endlich! Jahre sind vergangen, seit sie das letzte Mal, sechzehn, seit sie erstmals hier war, und seit über zwanzig Jahren schleppt sie die Gayosos mit sich herum, im Hirn und im Herzen, die Majoratsfamilie, die vor zweihundert Jahren hier lebte, in Sanct Jago, wie es damals noch hieß.
Raus, trotz Reisemüdigkeit! Die Treppe der Quintana hoch, vorbei an der Kathedrale, Via Sacra, San Payo de Antealtares, Rua da Acibechería. Weiter! Kein Blick für die Altstadt. Vor zum Cervantes-Platz, früher Plaza del Campo, ein paar Schritte noch, hier: Rua Algalia de Abacho. Weiter hoch, links, da: Rua Algalia de Arriba und der kleine Platz. Kein Zweifel, sie steht vor dem Stadthaus der Gayosos. Endlich. Überm Balkon das Familienwappen: vier Felder, unten rechts die truchas, die Forellen derer von Gayoso. Nun hat die arme Seele Ruh, würde ihre Großmutter sagen.
Zwei Fahnen schlagen im Wind, die galizische und die spanische. Sicherheitskräfte vor dem Portal, daneben eine Tafel in Galizisch: »Xunta de Galizia, Consellería de Justicia de Interior e Relacions Laborais«. Wachen führen sie durch den ehemaligen Pazo. Überall Trennwände für Büros, Salon und Speisezimmer verstellt mit Käfigen für Schreibkräfte und Computer; in der Bibliothek das Büro des Amtsvorstehers; die Treppe ist, wo sie war, nicht, wie sie war, der alten Pracht beraubt.
Ihr Hotel liegt im Allerheiligsten der Jakobsstadt, ein Steinwurf zum Uhrturm der Kathedrale, bemooste Dächer vor dem Fenster. Sie zieht die Regenluft ein, schließt die Augen: Gewonnen! Ein Glücksmoment! Sie hat der Glaubensfestung ein Geheimnis entrissen! Dumpfe Schläge markieren die Nacht zur vollen Stunde, Abstände lang und bang. Der helle Ton der Viertelstunde ist leichter zu ertragen. Irgendwo klagt eine Flöte.
Streifzüge durch nasskalte Gassen und die Bogengänge der Rua do Villar und der Rua Nueva. Ein halbdunkles Antiquariat. Sie kommt mit dem Besitzer ins Gespräch. Rodolfo ist ein Experte der Stadtgeschichte. Seine Katze buckelt, weil er sie aus dem Sessel scheucht, damit sie sich setzen kann. Rodolfo ist dabei, die Druckfahnen seines Werkes zu korrigieren: El Marquesito, Don Juan Díaz Porlier, zwei dicke Bände. Er will nicht glauben, dass sie die Geschichte des jungen Freiheitskämpfers kennt, den die Absolutisten aufgehängt haben. Eine Ausländerin sollte »seine« Geschichte kennen? Und er will auch das Drama der Gayosos nicht glauben, bis sie ihm die Quelle zeigt. Als sie sagt, sie habe das alles aufgeschrieben, verkündet er von seinem Podest herunter: Ja, es seien schon öfters Deutsche gewesen, die Bücher über Spanien geschrieben hätten. Sie seien sehr gelehrt, muy docta.
Teurer Sohn!
Mein Leben fließt dahin, still wie ein bald versiegender Bach, und ich werde die verbleibende Zeit nutzen, Dir die Geschichte Deiner Familie, Deiner Kindheit und Jugend zu erzählen, die Du zwar selbst erlebt, von deren dunklen Hintergründen Du aber erst nach Verkündung des Urteils der Sacra Romana Rota, im März des Jahres 1826, Kenntnis erhalten hast. Wenn ich Dir sage, dass der Dir unbekannte Teil dieser Geschichte in der Abgeschiedenheit der Abteikirche eines galizischen Zisterzienserklosters seinen Anfang nahm, in der Monasterio de Osera, vor dem Gnadenbild, der Virgen de la Leche so hat dies gewiss seine Berechtigung, was die vormaligen Begebenheiten anbelangt, und mag deswegen auch wahr sein, im schlichteren Sinne des Wortes. Es schiene mir jedoch vermessen, Dir gleichzeitig zu versichern, dies sei bereits die ganze oder einzige Wahrheit über den Ursprung des Unglücksstromes.
Meine Bedenken will ich Dir sogleich erklären. Wenn jemand sich gedrängt fühlt, den Ursprung eines Geschehens aufzuspüren, so wird er vermutlich das Bild der Vergangenheit von allen Seiten betrachten und es so lange drehen und wenden, bis er sich imstande fühlt, die Spuren der Ereignisse von einem vorläufigen oder tatsächlichen Ende her bis zu einem, sagen wir zutreffenden oder einleuchtenden Anfang hin zurückzuverfolgen. Demnach wäre zu vermuten, dass schließlich jede Geschichte ebenso viele Anfänge haben könnte, wie es deren Erzähler geben mag, die dann auch gleichzeitig zu Deutern würden, weil sie die verstreuten Geschehnisse zu einem »Lauf der Dinge« zusammenfügten, indem sie ihnen eine gewisse Folgerichtigkeit verliehen.
Aus meiner Erfahrung und dem Studium der Theologie und Geschichte kann ich sagen, dass dies die übliche Art der Weitergabe von Gewesenem ist, was damit zusammenhängen mag, dass der Chronist immer schon der Klügere ist, weil er den Ausgang kennt, indes diejenigen, die vormals Pläne geschmiedet und Taten begangen haben, aus der Fülle der wirklichen und vorgestellten Möglichkeiten das Ende nicht ahnen konnten. Geleitet vom Bemühen, durch seine Schilderung der Undurchschaubarkeit des Lebens größere Verständlichkeit zu verleihen, das heißt, ein Knäuel verworrener Ereignisse in ein Stück geordneter Geschichte zu verwandeln, wird der Geschichtsschreiber unbemerkt das gelebte Leben seiner eigenen Vorstellung anverwandeln, weil nur so, wie er es selbst begreift, er das Gewesene darzustellen vermag.
Dieser Beschränkung eingedenk werde ich, soweit Vernunft und Skepsis dies gebieten, alle mir angemessen erscheinenden Abweichungen von meiner eigenen Betrachtungsweise vor Dir ausbreiten, was nicht bedeuten soll, dass ich, meiner Erinnerung oder Zuständigkeit misstrauend, alles daran geben wollte, mein eigener Synoptiker zu werden. Vielmehr haben sich in meiner Vorstellung verschiedene Sichtweisen übereinander geschoben, und weil ich bisher kein endgültiges Urteil hinsichtlich der Rätsel des Lebens habe finden können, werde ich mir nicht anmaßen, die einstigen Ereignisse in einen einzigen ursächlichen Zusammenhang zu bringen.
Ein Weiteres ist zu bedenken, ehe wir uns auf den Weg in die Vergangenheit begeben. Wenn jemand sich vorgenommen hat, eine tragische Geschichte aus dem Dunkel der Jahre heraufzuholen, dann wird er, wiederum gemäß seines Temperamentes, entweder einen leichten, von allem Erdenschweren noch unbelasteten Ursprung entdecken, oder einen dunklen, künftiges Unheil im Keim schon in sich bergenden. Im Grunde ist es jedoch die Vieldeutigkeit des Geschehens selbst, die es ermöglicht, dass jeder die seiner eigenen Mischung aus Temperament und Weltsicht gemäße Gestalt der Vergangenheit vorzufinden scheint.
Wenn Deine Geduld und Dein Interesse es erlauben, so werde ich das Gesagte sogleich am Beispiel der Familiengeschichte der Gayosos veranschaulichen: Als Anfang sei zunächst der Ort genannt, an dem es dem verzweifelten Pilger zum ersten Mal in den Sinn kam, das Schicksal seiner Familie selbst zu bestimmen und es nicht länger dem Allmächtigen zu überlassen, der ihm fremd war, oder der Santíssima Señora, die er liebte. Don Gayoso hatte mit seiner Gattin eine Wallfahrt zum erwähnten Kloster von Osera unternommen, das seinen Namen vom nahen Fluss herleitet, dessen lateinische Wurzel darauf hinweist, dass in grauer Vorzeit Bären in der Gegend hausten, in der sich später die Mönche des heiligen Benedikt niederließen. Vor der verblassten Statue der stillenden Madonna aus dem 13. Jahrhundert hat er, statt mit seinem angetrauten Weibe das ersehnte Kind zu erflehen, beschlossen, selbst für einen Nachkommen zu sorgen. Don Joseph hat mir später anvertraut, dass er vor dem Gnadenbild das Gefühl hatte, es sei die stillende Madonna gewesen, die ihm, während seine Ehefrau ein Kind aus Wachs am Altar aufhängte, auf geheimnisvolle Weise diesen Gedanken eingeflößt habe, den er deshalb für eine göttliche Eingebung hielt. An dieser Deutung magst Du erkennen, wie tief man nach dem Ursprung eines Geschehens graben sollte und dass dieser nicht unbedingt in Taten, sondern gelegentlich in geheimen Gedanken und an einsamen Orten zu suchen ist, an Orten, wo finstere Entschlüsse als Erleuchtung und schwere Sünden als gottgewollt empfunden werden.
Um Deine Nachsicht bittend, werde ich sogleich einen allgemeinen Ursprung aufzeigen, fernab vom Geraune über mysteriöse Eingebungen: Man kann durchaus der Meinung sein, dass alles, was damals geschah, bedingt war durch die Gesetze unseres Landes, genauer gesagt, durch die darin enthaltenen Vorstellungen über das Majorat, seine Natur, seinen Ursprung, seine Bedeutung und die Form seiner Weitergabe. Besonders hervorzuheben ist hier das uneingeschränkte Erstgeburtsrecht, wonach der Primogenitus Alleinerbe aller Güter und Rechte ist, während die Geschwister fast leer ausgehen. Beim Erlöschen der Linie des Erstgeborenen geht das Erbe, abermals ungeteilt, an den Zweitgeborenen über und dann, wofern dieser keine Nachkommen haben sollte, an den Nächstgeborenen. In diesem Zusammenhang kann man mit Fug und Recht behaupten, dass die Schadenfreude und Begehrlichkeit seiner beiden Brüder Don Joseph in immer größere Wut und Ausweglosigkeit getrieben haben. Aus familiären Umständen, die ich später schildern werde, konnten beide, Miguel und Fernando, die Hoffnung hegen, ihre Nachkommen könnten eines Tages das Erbe der Gayosos antreten. Diese Haltung war ein Grund für die Ungeduld des erst seit zwanzig Monaten verehelichten Majoratsherrn, der nur zu leicht glaubte, er könne aufgrund seines Alters keine Kinder mehr zeugen. Gegen diese Sichtweise wäre allerdings einzuwenden, dass Gesetze, gleichgültig, wie beklagenswert sie sein mögen, nicht zum Sündenbock für die Umgehung ihrer rechtlichen Folgen gemacht werden dürfen. Obgleich Gesetze den Betroffenen in eine Zwangslage bringen mögen, so hat er es doch selbst zu verantworten, ob und auf welche Weise er sich daraus befreit.
Jetzt ist es an der Zeit, die unmittelbar auslösenden Ereignisse hervorzuheben. So traurig dies heute klingen mag, es war die späte Geburt Deiner Halbgeschwister, zuerst Carlos und ein Jahr später Dolores. Die beiden hätten nie geboren werden sollen und mussten eben deshalb geboren werden. Durch die leiblichen Kinder bekam die bis dahin als dunkles Geheimnis gehütete Wahrheit die Aussicht, eines Tages aus dem Kerker der Lüge befreit zu werden und auf die Welt, will heißen unter die Menschen, zu kommen.
Während der Armenspeisung an der Klosterpforte des Convento Santa Clara, die zu meinen täglichen Pflichten gehört, weil sich die Nonnen nicht zeigen dürfen, ist mir eine weitere Möglichkeit eingefallen, die Wurzeln der Geschichte freizulegen. Sobald die Bettler eine Portion Reis in ihren Kokosschalen und den Segensspruch erhalten hatten, eilte ich in meine Kammer, um meine Überlegungen fortzusetzen. Sie führen allerdings weniger zu einem direkten Anfang als zu einem tieferen Ursprung und werfen ein Licht auf das Gewicht der persönlich empfundenen Schuld, das wohl stets auch davon abhängt, wie die Allgemeinheit die Tat beurteilt. Wie Du inzwischen weißt, ist Don Gayoso der Mann, der alles, was noch geschehen sollte, ersonnen, ins Werk gesetzt und damit Leid und Verstrickung über seine Familie gebracht hat – und über mein Leben. Dennoch möchte ich ihm nicht die alleinige Schuld zuweisen, denn zum einen hat er Mittäter und Mitwisser gefunden, des Weiteren wird ein rechtschaffener Mensch kaum fähig sein, so viel Unrecht zu begehen, wenn er nicht irgendwo, vermischt mit den eigenen Absichten, gleichzeitig der Meinung wäre, dies alles auch in Hinblick auf ein allgemein anerkanntes oder wenigstens verständliches Ziel tun zu dürfen, wäre er auch der einzige Mensch, der diesen Zweck hoch genug einschätzte, um solche Mittel zu rechtfertigen.
Für Don Gayoso bestand im Halbdunkel seiner standesgemäßen Empfindungen und Gedanken durchaus ein solcher Zusammenhang, was ihm zu einer, wenn auch zweifelhaften, Rechtfertigung verhalf. Aus diesen Erwägungen ergibt sich ein weiterer Zugang zu den Geschehnissen der Vergangenheit: Alle Leidenschaft und Schonungslosigkeit, aller Hochmut eines spanischen Granden, verbunden mit der Hybris, die Gesetze seines Tuns eigenmächtig festlegen zu können, alle Bedenkenlosigkeit bei der Durchsetzung seiner Interessen, aber auch hinsichtlich seines Erdenglücks und dem seiner Familie, alle Zügellosigkeit des Herzens und Maßlosigkeit seiner Vorstellungen sind nicht allein im Inneren dieses Majoratsherrn lebendig, sondern haben unterirdische Quellen. In beträchtlichem Umfang entspringen sie dem, was ich die »Seele des spanischen Volkes« nennen möchte. Von Dämonen bevölkert, von Idealen und Wahnvorstellungen gleichermaßen besessen, von Frömmigkeit erfüllt wie von Aberglauben geschüttelt, führt die spanische Volksseele ihr hartnäckiges Eigenleben, fern aller Einschränkung durch Vernunft und aufgeklärte Einsicht. In diesem Dunstkreis hat die Vorstellung von der Reinheit des Blutes, der limpieza de sangre, einen gewaltigen Einfluss und kann eine zum Äußersten treibende Kraft werden, besonders in adeligen Kreisen.
Ein weiteres, eher banales Motiv mag auch der gekränkte Mannesstolz gewesen sein ob der Kinderlosigkeit in einer spät arrangierten Standesehe, denn dass Don Joseph zu jener Zeit bereits Vater einiger früh gezeugter Bastarde war, hat er mir selbst gestanden. Es kam jedoch für ihn nicht in Betracht, seine Gemahlin davon in Kenntnis zu setzen oder gar das Kind einer Magd zu adoptieren. Außerdem wurden die Jugendsünden des Mayorazgos durch vorhandene oder rasch geschlossene Eheverhältnisse überdeckt. Ich werde Dir später noch Genaueres über die außerehelichen Nachkommen Deines Ziehvaters berichten. In summa ist festzuhalten: Gayoso konnte seiner hochwohlgeborenen Gattin keineswegs zumuten, in den Niederungen seiner Jugendjahre nach einem Erben zu suchen.
All diese Überlegungen haben mich dazu bewogen, den angefangenen Brief ein paar Tage liegen zu lassen, und so kann ich Dir heute mitteilen, wo ich mit meiner Erzählung zu beginnen gedenke. Die Wahl des Ausgangspunktes mag Dir auf den ersten Blick zu einfach und selbstsüchtig erscheinen, für mich ist er hingegen hilfreich, weil die Bürde des Vermutens und Deutens entfällt, die am Ende Dir selbst überlassen bleiben soll. Da ich weder einen tieferen Ursprung noch einen auslösenden oder bestimmenden Anfang der Geschichte festzulegen vermag, werde ich dort beginnen, wo ich selbst zum ersten Mal darin vorkomme, das heißt, ich werde mir die Briefe von meinen Erinnerungen diktieren lassen.
Mein Sohn, die Jugend ist reich an Gefühlen und voller Tatendrang, sie urteilt rasch und ohne tiefere Einsicht. Das reife Mannesalter dagegen ist arm an stürmischen und beflügelnden Empfindungen, doch wissend dafür und zögerlich im Urteil. So will ich denn aus zweifachem Grund, so gut ich dies vermag, es unterlassen, die Fäden der Vergangenheit mit den Knoten sich aufdrängender Urteile zu befestigen, und vielmehr alle Sorgfalt darauf verwenden, sie ebenso leicht und ineinander verschlungen liegen zu lassen, wie ich sie beim Rückblick auf meine Lebenstage vorfinde.
Ich werde mich also aufmachen, um noch einmal die Fluren meiner Jugend zu durchstreifen, mich an der Glut der einstigen Gefühle zu wärmen und danach in den Verließen des Alters zu verstummen.
Gott und die Heilige Jungfrau mögen Dich segnen
Dein Vater
Manila, an mehreren Tagen des März anno 1845
Der dunkle Gast
Erdbeben
Es traf sie mitten im Alltag, in dem sie noch immer keinen Platz gefunden hatte. Es war ein Trompetenstoß, der die bröckelnden Mauern ihrer mühsamen Absicherungsversuche mit einem Schlag zum Einsturz brachte. Im selben Augenblick brachen auch alle Zukunftsvorstellungen zusammen, denn sie begriff blitzartig: Kein Stein wird auf dem andern bleiben.
Zwar waren früher schon Dinge passiert, die eine Unterscheidung zwischen Zufall und Fügung fragwürdig machten, doch was bisher an Rätselhaftem geschah, war eher als seltsam oder unerklärlich zu bezeichnen, vor allem aber als harmlos. Doch das hier war ein Urteil. Ohne sich dessen bewusst zu sein, reagierte sie auch wie eine Verurteilte: Schrecken, Verdrängung, Leugnen, Resignation, alles immer wieder und in konfusem Durcheinander über die nächsten Monate verteilt. Doch im ersten Moment saß sie nur da, schaute auf das Schriftstück, dann zur Vitrine des Biedermeierschranks, wo seltsamerweise die Gläser noch gerade standen.
Vor ein paar Jahren hatte es in der Gegend Erdstöße gegeben, ausgehend vom Zollerngraben. Im Epizentrum wurden Dächer abgedeckt, Spalten in Hauswände gerissen, die Bewohner liefen schreiend und betend auf die Straße, manche verbrachten die Nacht im Freien. Auch in Tübingen war die Erschütterung zu spüren gewesen. Im Lesesaal der Universitätsbibliothek, wo sie saß, wurde die Wahrnehmung des Bebens durch die Spannweite von Decke und Fußboden verstärkt, Wände und Boden hatten spürbar gewackelt. Panische Flucht der Benutzer. »Wehe den Müttern und ihren Kindern«, schoss es ihr durch den Kopf, denn sie war schwanger.
Die Wohnung im vierten Stock des wuchtigen Bürgerhauses war damals nicht betroffen. Allerdings hatten sie später in der Vitrine umgekippte Gläser entdeckt. Doch an diesem Tag war alles unverändert, obgleich es ihr schien, als habe die Erde abermals gebebt.
Teurer Sohn!
So lange ich die Gefangenschaft in dieser Stadt und dieser Welt noch tragen muss, werde ich mich immer wieder an die erste Begegnung erinnern, die ich als junger Mönch mit Don Gayoso hatte. Eher werde ich das kurze Glück vergessen, das wenig später unverhofft auf mich einstürmte und meinen Seelenfrieden zerstörte. Dieser erste Auftritt Gayosos in meinem Leben legte ohne Worte die Regeln fest, nach denen alles Weitere sich gestalten sollte, bestimmt durch die gewaltige Übermacht Don Josephs, man könnte auch sagen, durch eine unwillkürliche Wehrlosigkeit, die seine Gegenwart bei mir auslöste.
Wie oft habe ich darüber nachgedacht, worauf dieser Magnetismus beruhte, dem ich ausgeliefert war, sobald er auftauchte, und der mich ihm zu Willen sein ließ, gleichgültig, was er von mir verlangte. War es die Glut seines Wesens, die aus seinen Augen sprühte, seine fordernde Art zu sprechen, seine riesige Gestalt, neben der ich mich klein und hilflos fühlte, die Aura der Macht oder seine Wortgewalt, die mich erdrückten? Oder waren es all diese Eigenschaften zusammen? Gleichviel, eine Antwort magst Du selbst finden, denn Du hast ja Deine Kindheit im Hause Deines Ziehvaters verbracht und gewiss eine nachhaltige Erinnerung an ihn bewahrt.
Lass uns also zurückschauen in die Klosterkirche von San Francisco am Vorabend des Allerheiligentages des Jahres 1815. Im Frieden mit mir und der Welt sprach ich im Beichtstuhl Pilger und Bürger von Sanct Jago von ihren Sünden los, als die Monotonie der Schuldbekenntnisse plötzlich unterbrochen wurde. Eine mühsam unterdrückte Männerstimme murmelte: Er wolle keineswegs beichten, sondern in dringender Angelegenheit mit mir sprechen, das Gespräch habe gleichwohl unter das Beichtgeheimnis zu fallen, obschon er mich ersuche, es in der Sakristei stattfinden zu lassen, wo er mich sogleich erwarte. Unwillkürlich schaute ich durch das Holzgitter, was dem Beichtvater gemeinhin untersagt ist. Im Halbdunkel blitzten mir zwei feurige Augen entgegen, und ich erschrak gewaltig.
Die Sakristei lag im Dämmerlicht, als ich mit kurzem Segensgruß eintrat. Der Wartende schwieg und starrte zu Boden. Schwer atmend saß er am Tisch in der Mitte des Raumes, die Pelerine über den Knien, vor denen er mit beiden Händen seinen breitkrempigen Hut drehte. Als ich ihm gegenüber Platz genommen hatte, begann er mit leiser Stimme zu sprechen: »Ich habe Euch gelegentlich aus der Ferne beobachtet, Padre, aber keine Gelegenheit gefunden, Euch anzusprechen, weil Ihr entweder auf Versehgängen, bei Leichenzügen oder in Begleitung eines Ordensbruders gewesen seid. Schließlich habe ich einen bestimmten Tag festgesetzt, um mit Euch eine höchst delikate Angelegenheit zu besprechen, und zwar den morgigen 1. November. Dies ist der Familiengedenktag derer von Gayoso y Pardo, an dem vor sechzig Jahren, anno 1755, mein Vater geboren wurde, der Tag des großen Erdbebens, das damals gegen zehn Uhr auch in unserer Stadt zu spüren war. Allerdings waren hier weder Menschen noch Häuser zu beklagen, wie im schwer heimgesuchten Lissabon …«
»… mit über achtzigtausend Toten«, ergänzte ich, um meine Aufmerksamkeit zu bekunden.
Der Besucher holte tief Luft, legte den Hut auf den Tisch, warf mir einen scheuen Blick zu, als wolle er um Nachsicht bitten, dann fuhr er fort: »In der Kathedrale wurde während der Erschütterung, die ungefähr fünf Minuten währte, vom versammelten Domkapitel gerade das Gloria in excelsis Deo gesungen, doch die Mönche haben ihren Gesang nicht unterbrochen, obgleich die Altarleuchter beträchtlich wankten und die Kerzen heftig flackerten. Nach dem Gloria hatte die vom Schrecken erschütterte Gemeinde gerade das große Te Deum erschallen lassen, als mein Großvater die Kathedrale betrat. Er war herbeigeeilt, um für die Geburt seines ersten Sohnes und Majoratserben zu danken, und stimmte inbrünstig in den Gesang mit ein. Doch das war erst der Anfang vieler Dankgottesdienste in der verschonten Stadt. Drei Tage später wurde in San Augustín eine gesungene Messe zu Ehren der Señora de la Cerca zelebriert, an der alle Stadtverordneten teilnahmen, um danach den Mönchen ein Almosen von hundertfünfzig Realen für ihr wohltätiges Wirken zu spenden, als Dank für die wunderbare Rettung.
Hier unterbrach sich der seltsame Gast, sah zu mir herüber und schob ein: »Padre, ich bitte Euch um Nachsicht, sogleich werde ich zum Grund meines Besuches kommen. Es ist aber durchaus so, dass die Familiengeschichte etwas mit meinem Anliegen zu tun hat. Nun, nach Eintreffen der Nachrichten aus Lissabon und anderen Städten, wurde klar, dass Sanct Jago nicht das geringste Missgeschick hatte erdulden müssen. Deshalb hat mein Großvater eine stattliche Spende hier, im Kloster San Francisco de Valdedi-ós, entrichtet, gleichfalls für die barmherzigen Werke des Ordens. Ein paar Tage später haben die Mitglieder des Rathauses durch öffentliche Bekanntmachung eine Novene zu Ehren der Señora de la Cerca angeordnet, an deren erstem und letztem Tag das Bildnis Unserer Lieben Frau in feierlicher Prozession durch die Straßen getragen werden musste.«
Um endlich auch etwas zu sagen, fragte ich halblaut, ob ich die Lampe anzünden solle, doch der Besucher winkte nur ab und setzte seine Schilderung fort: »Mein Großvater erzählte noch oft von den merkwürdigen Vorschriften der damaligen Stadtväter: Alle Gläubigen mussten an der Prozession teilnehmen, mit reinlichem, dezentem Aussehen, gelöstem Haar, ohne Kappen oder Zipfelmützen, und jeder, der gegen diese Anordnungen verstieß, musste zwanzig Dukaten Strafe bezahlen oder einen Monat ins Gefängnis. Ferner war in den Straßen, durch welche die Prozession ihren Weg nahm, für größte Reinlichkeit und für Vorhänge an allen Fenstern zu sorgen.«
An dieser Stelle musste Gayoso selbst gemerkt haben, dass es Zeit war, mir den Grund seines Besuches mitzuteilen, denn plötzlich richtete er sich auf und sah mit prüfendem Blick zu mir herüber, um zu ergründen, wie ich den Versuch aufnehme, sein Anliegen hinter der Schilderung des Allerheiligentages anno 1755 zu verstecken. Da er jedoch meiner Haltung und Miene kein Anzeichen von Ungeduld entnehmen konnte, schloss er seine Ausführungen ab, indem er in geschäftlichem Ton hinzufügte: »Schon bemerkenswert, Padre, Zehntausende mussten in Lissabon sterben, und in der Stadt des Apostels nichts weiter als ein paar zuckende Kerzen. Findet Ihr nicht? Nicht jede Familie kann auf einen derart bedeutungsvollen Gedenktag verweisen«, ergänzte er halblaut. Dann schwieg er.
In der Sakristei war es vollends finster geworden, die beiden Männer konnten nur noch die Silhouette ihres Gegenübers erkennen, ein Mönch und ein Majoratsherr, und einer spürte des anderen Not, denn der eine fühlte, was er nicht zu vermuten, und der andere plante, was er noch nicht auszusprechen wagte, und jeder hörte den Atem des anderen. Schließlich kam der Ältere, anknüpfend an seine Vorrede, wieder auf seine Familie zu sprechen: »Mein Großvater war schon fast vierzig Jahre alt, als sein erster Sohn geboren wurde, weil seine erste Frau im Kindbett starb und das neugeborene Mädchen ihr wenig später nachfolgte. Anders bei meinem Vater: Bereits im ersten Ehejahr lag ich, der künftige Majoratsherr, in der Wiege.«
Noch schwerer atmend sprach er weiter: »Nun, Padre, was mich betrifft, so bin ich bis zum heutigen Tag ohne rechtmäßigen Nachkommen! Und es ist eben dieser Kummer, der mich zu Euch führt. Ihr sollt wissen, ich liebe und ehre meine Gattin, Margaretha. Doch nach zwanzig Monaten ehelicher Verbindung hat sich noch immer keine Aussicht auf einen Erben gezeigt.«
Jetzt erhob sich die dunkle Gestalt, und ein riesiger Schatten begann in der Sakristei unruhig auf und ab zu wandern: »Dieser zunehmend bedrückender werdende Zustand hat uns bewogen, kundige Ärzte zu Rate zu ziehen, Reisen zu Brunnen und Bädern zu unternehmen, denen man unter solchen Umständen heilende Kräfte zuschreibt. Doch alle Konsultationen und Kuren waren vergebens. Und dann, Padre, als die irdischen Mittel erschöpft waren, haben wir uns auf Drängen meiner Gattin den geistlichen zugewandt, deren Wirksamkeit ich allerdings von Anfang bezweifelt habe. Neuntägige Andachten unter geistlicher Führung wurden abgehalten, und vierzigstündige Gebete! Kinder aus Wachs wurden aufgehängt, zuerst vor dem Gnadenbild der Virgen de la Leche im Kloster von Osera, dann am Altar der Jungfrau del Pilar zu Zaragoza, danach bei Unserer Lieben Frau vom Carmel und später noch an sechzig weiteren Altären der Santíssima Señora.
«Plötzlich blieb der Wanderer ruckartig stehen, und ich spürte den Luftzug, als er seine Pelerine über die Schultern warf: »Alles vergebens, Padre, kein Anzeichen von Schwangerschaft!«, stieß er hervor. »Hochwürden, Ihr kennt nun mein Unglück. Möget Ihr unsere Familie in Euer Gebet einschließen. Doch gewährt mir die Bitte, auch darüber nachzudenken, Padre, wie Ihr selbst, in eigener Person, dazu beitragen könntet, die Not des Hauses Gayoso zu wenden. Denn eines ist sicher, es gäbe durchaus Mittel und Wege. Fraglos, Padre! Es liegt vielleicht nicht unbedingt nahe, woran ich hierbei denke. Nein, es liegt gewiss nicht auf der Hand. Ich selbst habe diesen Ausweg auch nicht gleich entdeckt, Padre. Deshalb werde ich nach geraumer Zeit wiederkehren, um zu erfahren, ob Ihr die Möglichkeit einer Beteiligung Eurer Person gefunden und erwogen habt.«
Abrupt unterbrach sich der schwarze Riese und verließ die Sakristei mit einem knappen Gruß, ohne die Tür zu schließen. Erst jetzt merkte ich, dass der dunkle Gast mich fast erdrückt und mir die Luft zum Atmen genommen hatte. Lange saß ich reglos da, im dumpfen Gefühl, ein Dieb habe mich überfallen, einer, der mir in der Dämmrung der Sakristei ein Stück des Friedens raubte, um dessentwillen ich das Kleid des Heiligen aus Assisi gewählt hatte, um in feierlichem Gelübde dem Treiben der Welt abzuschwören. Und obgleich ich es nicht wusste, so fühlte ich doch, wie sehr der Eindringling ein unheimliches Ziel verfolgte, weshalb er wiederkommen würde, um womöglich nach und nach die Mauer der Abgeschiedenheit niederzureißen, mit der ich meine Jugend und die Jahre meines Lebens umfriedet hatte.
In den frischen Lebensstrom, von dem ich getragen wurde, hatte der finstere Gesell einen Stein geschleudert, der mich aufschreckte und mein Herz heftiger schlagen ließ. Gleichzeitig beschloss ich, mir die Absichten des Granden nicht weiter auszumalen, und nahm mir vor, meine Ängste der Heiligen Jungfrau zu empfehlen und ihre Fürbitte zu erflehen. Als ich auf dem Weg durch den Patio zur Klausur einen Mitbruder traf, der zur Kapelle ging, bat ich ihn, er möge ein schweres Anliegen in seine Gebete einschließen. In jener Nacht wälzte ich mich ruhelos auf meinem Lager. An meiner Schläfe hämmerte die Frage: Warum hatte Gayoso ausgerechnet mir sein Leid geklagt, mir und keinem anderen Mönch? In den Klöstern der Stadt gab es wahrlich genug Ordensleute. Schließlich beruhigte ich mich mit dem Gedanken, dies alles könne eine von Gott gewollte Prüfung sein, die ich mit Seiner Hilfe auch bestehen würde.
Wider Erwarten ist es mir nicht schwergefallen, mein Sohn, Dir diesen Brief zu schreiben, eher habe ich dabei eine gewisse Erleichterung verspürt, und so gedenke ich, alsbald damit fortzufahren, Dir die damaligen Geschehnisse und Gefühle zu schildern.
In der Hoffnung, Du mögest Interesse am Fortgang Deiner Familiengeschichte haben, grüßt Dich Dein bedachtsam seine Worte wägender
Vater
Manila, den 29. April anno 1845
Post Scriptum: Seit geraumer Zeit überlege ich, ob ich um die Erlaubnis bitten soll, Intramuros verlassen zu dürfen, um einen jener farbigen Überwürfe für meine Lagerstatt zu erstehen, wie sie auf den chinesischen Märkten außerhalb der Mauern feilgeboten werden. Meine alte Wolldecke ist durchgescheuert und von trister Farbe. Fast möchte ich Dich fragen, was Du davon hieltest, doch da wird mir schmerzlich bewusst, wie unerreichbar Du für mich bist, trotz einer wachsenden Vertrautheit.
Der Mächtige steht auf
Riesen
Unruhe und Verwirrung während der nächsten Tage. Sie lässt das Schriftstück in einer Truhe verschwinden, versucht, das Urteil zu leugnen und es zur Wahnvorstellung zu erklären. Gleichzeitig fängt sie an, Spanisch zu lernen. So kann sie Zeit gewinnen, um der Sache auf den Grund zu gehen. Zudem bietet die Sprache einen Halt im Wirklichen, die irreale Bedrohung verblasst, und sie beruhigt sie sich mit dem Gedanken, dass Hirngespinste leicht entstehen, wenn man mit einem Geheimnis lebt.
Die Zustellung des Urteils liegt lange zurück, ein genaues Datum lässt sich nicht mehr ermitteln. Anhaltspunkte bieten die Sprachkurse Ende der Siebzigerjahre und die erste Reise nach Santiago de Compostela im Sommer 1986. Nach ihrer Rückkehr zerbrach die Familie; die abstrakte Drohung war zur konkreten Katastrophe geworden. Das Urteil war vollstreckt.
Doch damals, als das Schriftstück vor ihr lag, starrte sie nur auf die Seiten, dann zum Erker hinüber. Nach stundenlanger Hausarbeit war sie zum Schreibtisch gegangen, hatte den Kopf auf den Arm gelegt und den Ansturm der Schulkinder erwartet. Schwere Schritte auf knarrenden Dielen kündigen zuerst den Vater an. Gleich darauf steht er neben ihr: »Ich glaub, das ist was für dich«, sagt er in seinem gutmütig klingenden Schwäbisch und legt vier Blätter vor sie hin, bedruckt mit acht kleinen Seiten in gotischer Schrift.
In all den Jahren hat sie nicht aufgehört, sich selbst und anfangs auch noch ihn zu fragen, weshalb er diese Kopien gemacht und ihr mit dieser Bestimmtheit gegeben habe. Die stets gleiche Antwort, das wisse er auch nicht, mag zutreffen. E kann keine Auskunft über sich geben, und er will es auch nicht. Seiner Ansicht nach haben »normale« Menschen mit halbwegs durchschnittlicher Intelligenz und Tatkraft Wichtigeres zu tun, als über sich nachzudenken. Die Aufgaben des Denkens und Redens seien vorgegeben und von anderer Natur: Allein die »Urbi-et-Orbi-Probleme«, wie sie seine Themen im Stillen nennt, verdienten es, analysiert und diskutiert zu werden, nicht aber wehleidige Selbstergründung, die Schwierigkeiten nur vertiefe, statt sie zu übergehen.
Wenn es allerdings darum geht, die Stadt und den Erdkreis zu ordnen, hat der Jurist und Theologe, der Seminarist und Stiftler immer recht, alles längst begriffen und geordnet, mit gewaltigem Zugriff auf die Register seiner Fächer und der abendländischen Philosophie. Ein Goliath mit intellektuellen Siebenmeilenstiefeln, immer schon da, immer schon der schlaue Igel, während sie, der ewige Hase, stets im Voraus verloren hat. Der Stil seines Diskutierens ist der des Auftrumpfens, Abkanzelns und der Verkündung von Ex-cathedra-Wahrheiten bei gleichzeitiger Herabsetzung des Gegenübers. Würgemale der Worte. Eine Freundin war heulend aus dem Haus gelaufen, eine andere hatte den Kontakt abgebrochen. Die Ehefrau bleibt ausgeliefert.
Während er so in nächtelanger Suada damit beschäftigt ist, die niederen und entwickelten Offenbarungen des Weltgeistes in den Entwicklungsstufen der Weltgeschichte, die Langsamkeit und Umwege bei der Verwirklichung des allgemeinen Geistes nachzuzeichnen und dabei den jeweiligen Völkern, Staaten und Individuen ihren Werkzeugcharakter bei diesem Geschäft zuzuweisen, um so den ungeheuren Aufwand des Entstehens und Vergehens deutlich zu machen – so wenig man natürlich etwas Konkretes darüber sagen könne – und während sie gleichzeitig unter dem Druck verbaler Herabsetzung und Entmündigung, hoffnungsloser Überforderung, zunehmender Isolation und Verzweiflung aufhört, ein »normaler« Mensch zu sein, und zum Haushaltsroboter mutiert, zerbrechen nach und nach die Seelen ihrer Kinder. Und die im Dauerstreit um sich selbst kreisenden Eltern bemerken es noch nicht einmal.
In diesen Jahren wuchtet E an einer monumentalen Arbeit: Der Rechtsstaat im neunzehnten Jahrhundert. An diesem Herkulesprojekt schuftet er in seinem riesigen Arbeitszimmer vor der Glastür, füllt Türme von Karteikästen, Reihen von Ordnern, und verwandelt die wilhelminische Eremitage mit den geschnitzten Möbeln ihres Großvaters allmählich in eine intellektuelle Vorratshöhle, die immer mehr zuwuchert. Mit der Zeit werden auch auf dem Fußboden Beete aus Kirchenrecht und Staatsrecht angelegt, kleine Rabatten, zwischen denen die Trampelpfade immer enger werden. Gleichzeitig benutzt der gepanzerte Goliath sein Treibhaus der Wissenschaft als stur verteidigten Sicherheitsbunker vor der Verzweiflung der Ehefrau und wirft sie hinaus, sooft sie versucht, mit ihm zu sprechen. Die Kinder haben Zutritt.
Die Kindheit der Mädchen ist voll dunkler Träume, die sie eine Zeit lang aufschreibt, wenn sie morgens davon erzählen, mit ihren hellen Augen, aus denen allmählich das Leuchten verschwindet. Einmal träumt Helene: »Das war in der Nacht. Da sind ganz viele Besuche gekommen, und da hat die Marie gesagt, ich dürfte nicht in ihr Zimmer rein. Da wollte ich es dem Papa sagen. Da bin ich aber gar nicht zum Papa gekommen, aber in ein ganz großes Haus, das hat ausgesehen, als ob es ganz aus Eis wär. Es war ganz weiß. Da war auf einem riesengroßen Stuhl der Papa. Der war auch ganz arg groß. Und da hat der Papa mit einer ganz tiefen Stimme gefragt: ›Was ist?‹ Da hab ich gar keine Antwort gegeben, weil er so groß war. Und wegen der Stimme.«
Ein Vater im Eispalast, auf gewaltigem Thron, riesengroß und übermächtig, der Sprechen erstickt und Nähe verhindert, mit seiner Stimme und mit nur zwei Worten. Das war schon einmal so, vor langer Zeit, im fernen Galizien.
Mein teurer Sohn!
In jenen Wochen nahm der Nieselregen in Sanct Jago kein Ende, Nebel legte sich auf das Kloster und die Dächer der Stadt, der an manchen Tagen so tief hing, dass nur noch der untere Teil der Stadtmauer zu sehen war. Dazwischen gab es Stunden, in denen über den Gärten vor den Mauern ein trügerischer Altweibersommer lag, der bald wieder von unverhofften Regenfällen verjagt wurde, zusammen mit leichtgläubigen Spaziergängern, die ihm getraut hatten. Nach jenem geheimnisvollen Besuch in der Sakristei breitete sich die Lichtlosigkeit jener Novembertage auch in meiner armen Seele aus, die ich eigens Gott geweiht hatte, um sie vor solcher Düsternis zu bewahren und die fühlbar grämlicher wurde, während gleichzeitig meine Gedanken um die Frage kreisten, woher mir Hilfe kommen könnte.
Zunehmend vermied ich Gespräche mit den Ordensbrüdern, denen ich nur noch bei den Stundengebeten und im Refektorium begegnete, wo man nicht unbedingt sprechen musste, weil es während der Mahlzeiten geistliche Lesungen, Abkündigungen und Schweigezeiten gibt. Wann immer ich konnte, flüchtete ich in meine Zelle, um mich im Kummer zu vergraben, und so hatten sich binnen Kurzem die stillen Freuden des abgeschiedenen Lebens in bange Qualen der Einsamkeit verwandelt. Jeden Morgen, wenn wir uns um fünf Uhr zur Matutin im Chor der Kirche versammelten, um Gott den heraufdämmernden Tag zu weihen, prüfte ich mit furchtsam suchendem Blick das wächserne Gesicht des Padre Ignacio, der sich, mir gegenüber, mit kraftlosen Händen an beiden Seiten des Chorgestühls abstützte. Er war mein vormaliger Novizenmeister, und wehmutsvoll erinnerte ich mich an die Zeit des Noviziats, als ich dem gütigen Padre in allen Fragen des geistlichen Lebens und der Ordensregel unterstellt war. Seit der heiligen Profess hatte ich zu keinem meiner Vorgesetzten ein ähnliches Vertrauen fassen können.
Wie gerne hätte ich mit dem weisen Ordensmann über die rätselhafte Begegnung gesprochen, doch der bereits von Alter und Krankheit Geschwächte hatte sich, seitdem es ob der schwierigen politischen Lage keine Novizen mehr gab, in den abgelegenen Flügel des vormaligen Noviziats zurückgezogen, wo er seinen Studien nachging und nur noch zu den Mahlzeiten erschien. Außerdem fürchtete ich, ein noch nicht enthülltes Geheimnis durch eine solche Aussprache womöglich zu überhöhen, zumal nicht auszuschließen war, dass der ungebetene Gast am Ende eine zu große Unruhe in mir verursacht haben mochte. In der einsamen Not jener Tage nahm ich allabendlich das Kreuz von der Wand meiner Zelle, um es, vor meinem Lager kniend, zu umschließen und mit Inbrunst an die Brust zu drücken, den Herrn bittend, es möge sich zeigen, dass die dunkle Gestalt ein böser Spuk gewesen sei und Er mich vor seiner Wiederkehr verschonen möge. Doch mein Flehen war umsonst. Etwa zehn Tage später, als ich nach der Messe mit dem Ministranten die Sakristei betrat, saß Don Gayoso bereits dort, mit dem Rücken zur Tür. In gebieterischem Ton verlangte er, den Messdiener wegzuschicken, ordnete an, ich solle die Lampe anzünden und mich setzen.
»Hochwürden, Ihr wisst schon, weshalb ich heute gekommen bin, nicht wahr?«, fragte er halblaut und beschwörend. Dabei beugte er sich mit dem Oberkörper derart weit über die Tischplatte, dass ich unwillkürlich zurückwich: »Padre, Ihr habt doch gewiss die Frage verstanden? Es ist Euch doch inzwischen klar geworden, weshalb ich gekommen bin?«, wiederholte er drängender und mit noch wilder flackernden Augen.
»Bei der Santíssima Señora, nein, ich weiß es nicht! Ich ahne nur, es könnte der nämliche Grund sein, der Euch schon das erste Mal bewogen hat, mich aufzusuchen.«
»Sehr gut, Padre, das ist doch schon etwas!« Unüberhörbarer Spott lag in seiner Stimme: »Und was denkt Ihr, weshalb ich heute gekommen sein könnte, nunmehr zum zweiten Mal?« Der Fragende zog die Augenbrauen hoch, lehnte sich zurück und kreuzte die Arme über der Brust, ehe er fortfuhr: »Es ist nicht schwer herauszufinden, Padre, denkt um des Himmels willen darüber nach in den vielen Stunden, die dem Gebet und der Einkehr vorbehalten sind. Es gibt Wichtigeres als Beten und Messen lesen. Bedenkt das, Hochwürden! Ich ersuche Euch abermals, Euch herbeizulassen, einmal über weltliche Dinge nachzudenken, über die Verzweiflung eines Ehepaares ob seiner Kinderlosigkeit zum Beispiel. Wofern Ihr mir die Bitte gewährt, soll Euch dies gewiss nicht zum Schaden gereichen. Ich werde in kurzer Frist wiederkommen.«
Darauf erhob er sich ruckartig, warf die Pelerine über die Schultern, drückte den Hut in die kantige Stirn, sodass sein Gesicht nur noch aus Glutaugen und Bart zu bestehen schien, murmelte, wie bedauerlich es doch sei, dass ein Ordensmann offenbar mit Einfalt geschlagen sei und er abermals kommen müsse, um das kindliche Gemüt eines Mönchs auf den Stand eines erwachsenen Mannes zu bringen. Dann ließ er mich nach einem barschen Gruß sitzen und stürmte davon, abermals, ohne die Tür zu schließen. Der Messdiener, der draußen gewartet hatte und jetzt furchtsam hereinkam, um nachzufragen, ob er sich entfernen oder mir noch zu Diensten sein könne, bekam nur ein abwesendes Kopfschütteln zur Antwort.
Die Nacht war hereingebrochen, ich begann zu frieren. Im Gefühl tiefer Ohnmacht gegenüber der herandrängenden Macht des Bösen löschte ich die Lampe, verließ die Sakristei, eilte durch den Patio, vorbei an den gotischen Fenstern der Kapelle, die, von innen erleuchtet, bunte Schatten auf den Weg warfen. Drinnen sangen die Brüder gerade die Komplet. Bei der großen Treppe angelangt, zögerte ich, ob ich umkehren und mich im Gebet mit ihnen vereinen sollte, um des Trostes ihrer Gemeinschaft teilhaftig zu werden. Doch mein Inneres war zu aufgewühlt. Eilig hastete ich die Stufen hinauf und über die Galerie zu meiner Zelle.
Ich schließe diesen Brief mit dem innigen Wunsche, Du mögest niemals so allein sein, wie ich mich damals fühlte, wie ich es heute bin und für immer bleiben werde.
Die Santíssima Señora möge Dich bewahren, dafür betet
Dein Dich segnender
Vater
Manila, den 13. Mai anno 1845
Das Böse zeigt sein Gesicht
Termiten
Am Tag der Zustellung des Urteils nützt sie die Mittagsruhe, um den Rechtsfall genauer zu lesen. Dabei entstehen Fragen, die sie sich zu beantworten versucht. Zunächst ist unklar, gegen wen Don Joseph Gayoso y Pardo vor dem geistlichen Gericht zu Sanct Jago de Compostela im Jahre 1825 geklagt hat: gegen sich selbst oder seine Gemahlin? Gegen seinen Sohn oder seinen Komplizen? Oder schlicht gegen alle?
Egal. Es gibt drängendere Fragen: Was haben die Gayosos mit ihrer Familie zu tun, so offensichtlich, dass E es gemerkt hatte? Keiner ist aus Holz. Selbst er mochte gespürt haben, dass trotz anderer Fakten, historischer und nationaler Unterschiede, in der spanischen Familie die gleichen Kräfte am Werk waren wie in seiner eignen, Termiten, die das Haus von innen zerfraßen, stetig, unaufhaltsam, während die Beteiligten hilflos zusehen mussten.
Und was haben die Gayosos mit ihr zu tun? Die Antwort ist fühlbar: Mit einem Schlag ist sie nicht mehr allein auf der Welt. Es gibt eine Verbindung mit anderen Menschen, obwohl sie längst tot sind. Sie ist heraus aus dem Niemandsland, in dem sie gehaust hatte wie in einer Wüste. Und von jetzt an weiß sie auch, wie alles enden würde. Zwar führt der Weg ins Unglück, aber er führt nicht mehr ins Ungewisse, und sie muss ihn nicht mehr allein gehen. Im fernen Jakobsland gibt es Schicksalsgenossen.
Lieber Sohn!
Nach der Armenspeisung zur Mittagszeit musste ich noch die Fußböden in der Iglesia San Ignacio reinigen, weil dort am nächsten Sonntag ein Pontifikalamt stattfinden wird. Die Kirche steht neben dem erzbischöflichen Palast, und ich werde dort gelegentlich als Sakristan eingesetzt. Den Pförtnerdienst bei den Nonnen von Santa Clara hat mir heute ein einheimischer Laienbruder abgenommen, ein junger Mann, etwa Deines Alters, mit dem ich die Hausarbeiten teile und von dem ich im Laufe der Zeit gelernt habe, mich im landessprachlichen Tagalog leidlich zu verständigen. So kann ich heute früher fortfahren, Dir die Ereignisse der damaligen Wochen zu schildern, die mich jetzt, bei deren Niederschrift, erneut in ihren Bann ziehen.
Es vergingen diesmal nur ein paar Tage, bis Gayoso wieder auftauchte. Kurz nach dem letzten Besuch blitzten seine Augen abermals hinter dem Holzgitter des Beichtstuhls. Halblaut, wieder mit mühsam unterdrückter Stimme und gebieterischem Ton, verfügte er: Ich solle ihm sogleich in die Sakristei folgen, er habe wenig Zeit, und ich hätte jetzt wohl Zeit genug gehabt, über den Grund seiner Besuche nachzudenken. Ohne eine Antwort abzuwarten, stand er von der Kniebank auf und ward verschwunden. Ich überlegte, ob ich fortfahren sollte, die Beichte zu hören, statt dieser herrischen Anweisung zu folgen. Doch als ich den Vorhang des Beichtstuhls beiseiteschob, war niemand mehr da, der noch hätte beichten wollen, und so musste ich ohnehin zur Sakristei zurück.
Als ich den Raum betrat, stand Gayoso mit aufgestützten Armen hinter dem Eichentisch. Mit einer flüchtigen Geste wies er mich an, Platz zu nehmen, und ließ sich gleichzeitig auf einen Stuhl fallen. Nachdem er sich nach meinem Befinden erkundigt hatte, ohne eine Antwort abzuwarten, sprang er auf und fragte unvermittelt: »Könnt Ihr Euch vielleicht noch an den 23. Mai des Jahres 1809 erinnern, Padre? Ein denkwürdiges Datum für Sanct Jago.« Ohne eine Antwort abzuwarten, fuhr er fort: »An diesem ruhmreichen Tag wurde die seit Monaten von drei Divisionen Napoleons besetzte Stadt von unseren Truppen unter General Carrera zurückerobert. Zuvor hatten die Franzosen, gestützt von den Volksfeinden Bazán und Fraguino, zahllose Plagen, Plünderungen und Schikanen über uns gebracht, und so wurden die Schlacht auf dem Campo da Estrela und der überlegene Sieg unserer Truppen ein wahrer Befreiungsschlag, der mit der Vertreibung der Feinde aus unseren Mauern endete, begleitet vom Geläut aller Sturmglocken der Stadt.«
Während ich im Stillen rätselte, was diese Schlacht mit dem Grund des Besuches zu tun haben könnte, fuhr Gayoso lautstark fort: »Als einer der Granden des Landes habe ich mit Miguel, dem älteren meiner Brüder, am Befreiungskampf teilgenommen. Das war der Bevölkerung durch Bekanntmachung des Polizeidirektors und Handlangers der Unterdrücker, Pedro Bazán de Mendoza, vielleicht habt Ihr ja von diesem Vaterlandsverräter gehört, bei Todesstrafe und unter Androhung einer Plünderung und Brandschanzung der Stadt, untersagt worden. Der galizische Adel hatte sich dennoch insgeheim mit den heranrückenden spanischen Truppen auf einem günstig gelegenen Landsitz vereinigt, um den Feinden gestärkt zu begegnen. Auf dem Camino del Padrón näherten wir uns der belagerten Stadt.
Wie Ihr sicher wisst, Padre, konnten die Franzosen unter ihren Befehlshabern Ney und Soult weder der Wucht noch dem Mut des spanischen Ansturms standhalten und mussten nach wenigen Stunden ihre Stellungen verlassen, die sie seit dem frühen Morgen mit Dragonern und Feuerhaufen zu halten versucht hatten, begleitet von lauten Schlachtrufen ›Napoleon‹ und ›la Gloire‹. Das Gefecht brachte den Feind in große Bedrängnis, und er wich rasch hinter die Stadtmauer zurück. Viele der Soldaten trauten gar sich nicht mehr in die Stadt, sondern retteten sich in wilder Flucht über die Vorstadt bis San Roque, um von dort nach La Coruña zu entkommen.«
Zwar kannte ich bereits seine weitschweifige, von lebhaften Gesten begleitete Art zu sprechen, gleichwohl fragte ich mich, ohne mir etwas anmerken zu lassen, weshalb Gayoso mir dies alles erzählte. Doch da kam der Wortgewaltige bereits zum Grund seiner Schilderung: »In diesem verbissenen Kampf, in dem bereits über fünfhundert Leichen der Franzosen und ihrer Pferde das Schlachtfeld bedeckten und der Feind in einem letzten Rückzugsgefecht versuchte, mit seiner Artillerie die Puerta Faxeira zu verteidigen, entdeckte ich plötzlich, mitten im Gemetzel, meinen Bruder Miguel, umringt von Feinden, die verzweifelt um das Stadttor kämpften. Wenige Augenblicke später wurde er schwer getroffen. Blutend hing er vornüber im Sattel. Ich schlug mich zu ihm durch und konnte ihn gerade noch auf mein Pferd ziehen, dem Tier die Sporen in die Flanken schlagen und mitten durch das schlimmste Hauen und Stechen das Schlachtfeld verlassen. Niemals wäre er mit dem Leben davongekommen!«, brüllte Don Gayoso. »Niemals, Padre! Und jetzt schielt er nach dem Majorat! Schamlos und unverhohlen! Zusammen mit dem jüngeren Bruder. Und sie reiben sich die Hände, Padre, ob meiner Kinderlosigkeit! Sobald meine Linie erlischt, tritt Miguels Tochter das Erbe an! Doch sie kränkelt. Deshalb rechnet sich auch der Jüngere Chancen auf das Erbe aus. Sie sind von Neid und Missgunst zerfressen, Padre! Beide! Wie die Brüder Josephs! Und ich schwöre Euch, bei der Heiligen Jungfrau: Keiner hätte in der Schlacht mein Leben verteidigt! Im Gegenteil, sie hätten mich verbluten lassen!«
An diesem Abend war der Wütende nicht zu bändigen, wild gestikulierend stand er vor mir und setzte seine Anklagen fort: »Ihr werdet es nicht glauben, Padre, aber dem Jüngeren, dem Fernando, auch ihm habe ich das Leben gerettet! Jawohl! Auch im Franzosenkrieg. Ein Jahr zuvor zog er im Morgengrauen des 18. Juli aus der Stadt, mit fliegenden Fahnen und inbrünstigen Liedern, im hastig ausgehobenen Batallon Literario, um für Gott und das Vaterland zu kämpfen! Und zu siegen! Jawohl! Oder zu sterben! Por Dios! Halbe Kinder waren das doch, Padre, hatten noch nie eine Waffe in der Hand! Von der Geistlichkeit unter Druck gesetzt und von den Herren Professoren mit Kampfparolen und Geld für die Ausrüstung versorgt. Man kennt das, Padre, die mussten den Kopf ja nicht selbst hinhalten. Nachgeritten bin ich dem Haufen in aller Herrgottsfrüh, hab mich durchgefragt bei den Kompanien, bis ich ihn fand, gegen Abend, im Feldlager.
Und dann habe ich eingeredet auf ihn, halbe Nächte! Den ehrenvollen und süßen Tod auf dem Schlachtfeld hab ich dem Milchbart beschrieben, Padre, und wie dreckig und qualvoll er sein wird, dieser Tod, und wie er verrecken würde! Jawohl! Und ich hab ihm ausgemalt, dass er nichts nützte, sein Heldentod, gar nichts, weder Gott noch dem Vaterland, und dass er sein Leben vergeblich opfern würde, dass er aufgehetzt wurde von gewissenlosen Maulhelden, die ihre eigene Haut nicht wagten.
Und dann geschah das Unerwartete, Padre. Ein paar Tage später hat sich doch der berühmte General Blake, der alte Haudegen, der mit seinen Truppen den unseren zur Hilfe geeilt war, vor seine sechs Kompanien gestellt und hat dem Studentenbatallon, diesen ganzen verführten Grünschnäbeln, genau das Gleiche vorgehalten! Naja, vielleicht nicht ganz so deutlich, aber doch ohne den geringsten Zweifel daran zu lassen, was auf sie zukommt und wie jung und unerfahren sie seien in der Schlacht. Und dann, Padre, ist er die Reihen entlanggeritten, der alte Kämpfer, ich sehe ihn bis heute vor mir, hat die Kerle angeschaut, jeden einzelnen, direkt in die Augen! Und dann hat er losgebrüllt: ›Soldaten, ich hab euch gesagt, was auf euch zukommt! Und nun fordere ich euch auf: Wer zurücktreten will, soll vortreten! Zwei Schritt’! ‹ Totenstille. Dann tritt der Erste vor, dann der Zweite, einige Dutzend folgen. Schließlich macht auch Fernando den ersten Schritt und dann den zweiten. Zwei Schritte zurück ins Leben. Jawohl, so war das!