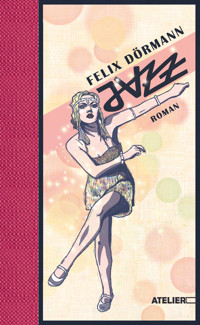
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Edition Atelier
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Der Exil-Ungar Ernö Kalmar schlägt sich in den frühen 1920er-Jahren mehr schlecht als recht mit kleinen Gaunereien in Wien durch. Als er die verarmte Baronesse Marianne kennenlernt, die nach dem Tod ihres Vaters plötzlich ganz alleine dasteht, will Ernö den Schiebereien und Betrügereien zunächst abschwören, doch die Gier nach Erfolg und Anerkennung ist größer als seine Liebe. Mit viel Talent und ohne Skrupel wird er in der Inflationszeit zum König der glamourösen Wiener Unterwelt und Gründer einer Bank. Marianne schlägt währenddessen einen eigenen Weg ein und versucht sich zu emanzipieren. Doch Ernös Macht scheint inzwischen grenzenlos zu sein ... »Jazz« zeigt die Hyperinflation der 1920er in allen Bereichen: im Geldwert, in der Vergnügungssucht, der Liebe und der Verzweiflung.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 345
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
Jazz
Anhang
Nachwort: Die Welt war Jazz geworden
Über Felix Dörmann
Felix Dörmann in Zahlen
Biografien
Impressum
1.
Ein grauer Novemberabend.
Trüb flackern die fahlen Lichter durch die schweren Nebel. Die Pflastersteine glänzen feucht.
Unsichtbare Lasten liegen schwer auf allen Seelen.
Marianne Hartenthurn kommt vom Begräbnis ihres Vaters.
Frierend, müde und verhungert klettert sie keuchend und mit versagenden Kräften die drei Stockwerke zu der kleinen Vorstadtwohnung empor, in der sie von jetzt ab allein mit der alten Fanny hausen soll – vorausgesetzt natürlich, daß Fanny nicht doch nach Böhmen zurückkehrt, wo sie zu Hause ist und wo es ihr jedenfalls besser gehen würde als im hungernden Wien, das derzeit von den Almosen mitleidiger Ausländer lebt. Marianne findet Fanny, den Rosenkranz zwischen gichtigen Fingern, eingeschlafen vor.
Wenn ihr schon die alten Beine nicht mehr erlaubten, ihrem lieben Baron Franz die letzte Ehre zu erweisen, wollte Fanny wenigstens beten, während sie ihn draußen begruben.
Und jetzt war sie eingeschlafen.
»Einheizen, Fanny, im Kabinett vom Papa … und einen Tee mit Rum und ein paar Deka amerikanisches Schinkenfleisch.«
Fanny war emporgefahren und schien verlegen, weil sie statt zu beten geschlafen hatte.
Vor allem wollte sie wissen, ob viele Leute da gewesen wären und ob es schöne Kränze gegeben hätte.
Aber Marianne war ungeduldig.
»Später, Fanny, später«, und sie ging ins Kabinett. »Jetzt nur ein bißchen Ruhe.«
Der schwarze Hut mit dem langen Kreppschleier flog achtlos zu Boden und sie selbst warf sich angekleidet, so wie sie gekommen war, auf das schmale Feldbett, das bisher ihrem Vater als Nachtlager gedient hatte.
Sie zog die Beine hoch, krümmte sich fröstelnd zusammen und zerrte die schwere, mit Schaffell gefütterte Decke über sich. Ihr Vater hatte, als er noch im Felde war und dann auch später zu Hause, unter ihr geschlafen, um die teure Kohle zu sparen.
Mit einem tiefen Seufzer schlief Marianne ein.
Übermüdet von den Erschütterungen der letzten Tage hörte sie nicht das geräuschvolle Hantieren Fannys in der anstoßenden Küche, hörte nicht das Anmachen des Feuers und das Gerassel der Kohlenschaufel. Sie wurde erst wach, als Fanny sie rief und zum alten Maria-Theresia-Schreibtisch mit der aufgeschlagenen Tischplatte hinwies.
So wie sie es vom Baron Franz her gewohnt war, hatte es Fanny auch bei seiner Tochter gehalten. Sie hatte das frugale Abendbrot einfach auf die Schreibtischplatte neben die Lampe hingestellt.
Marianne setzte sich an den Schreibtisch, trank den heißen Tee, verschlang das Konservenfleisch, und Fanny stand daneben und fragte sie aus. Es kränkte sie sehr, daß man den lieben, guten Baron Franz so still und einfach begraben hatte, daß es gar keine richtige »Generalsleich« mit Trauermusik und Gewehrsalven gewesen war. Sie schüttelte nur immer wieder den alten, grauen Kopf und verstand nichts von einer Zeit, die so anders geworden war, und wollte immer wieder erfahren: Wieso dürfen sie denn das? Wer erlaubt es ihnen?
»Sie«, das waren für Fanny die Menschen von heute, die zu Macht und Ansehen gekommen waren, die ihrem Baron Franz den Adel aberkannt, ihn in Pension geschickt und ihn jetzt auch noch wie den nächstbesten Menschen begraben hatten, nachdem er zwei Jahre grenzenloser Verbitterung und vornehm verhüllten Elends ausgehalten hatte.
Das schmale Kabinett war leidlich geworden, der Hunger gestillt.
Marianne schlüpfte in den abgeschnittenen Generalsmantel, der ihrem Vater als Hausrock gedient hatte, breitete außerdem noch die warme Decke über die Knie und begann, Laden und Lädchen des alten Tabernakelkastens zu öffnen. Vielleicht fanden sich irgendwo doch noch so etwas wie ein letzter Wille oder ein paar Zeilen ihres Vaters, die für sie geschrieben waren.
Rechnungen, Bilder und Briefe quollen ihr ungeordnet und in bunter Fülle entgegen. Kinderbilder ihres Vaters. Eines: der kleine Franz auf einem Pony. Aufnahmen aus der Theresianischen Militärakademie mit Jahrgangskollegen, das erste Bild des jungen Leutnants, ein Aquarell des Schlosses Hartenthurn, das noch den Großeltern gehört hatte, ehe es von den Erben verjubelt und verschleudert worden war. Aber auch ein Bild der Mutter kam zum Vorschein, das Marianne nie gesehen hatte. Offenbar von einem Provinzphotographen aufgenommen. Pardubice-Pardubitz stand darauf. Und die Mutter! Wie sah sie so merkwürdig aus auf diesem Bild! Eine Bauernmadonna in einem fragwürdigen, überdekolletierten Salongewand. Auf der Rückseite des Bildes stand eine Widmung: »Hochgeboren Herrn Oberleutnant Baron Franz von seiner geliebten Arabella.« Und daneben in Klammern: »Vozelka Anna, Pardubice 1899, 1. August.«
Vozelka Anna, gut, das war der Name der Mutter, ehe sie der Vater geheiratet hatte, damals, als er von der Ostfront im September 1915 plötzlich auf Urlaub nach Hause gekommen war. Aber Arabella? Das war doch sonderbar.
Und auch ein Brief lag in demselben vergilbten Umschlag. Unbeholfen, mit ungelenker Hand geschrieben und voller Fehler.
Und dann las Marianne den ersten Brief, den ihr Vater von seiner damaligen Geliebten, ihrer Mutter und seiner späteren Frau, erhalten hatte.
»Lieber Frantz,
wo du erlaubst, das ich Euer Hochgeboren ›du‹ nennen darf, theile ich dir mit, das ich bei meiner Mutter eingetrofen bin und sie gesunt und voler Freuden gefunten habe, weil ich mein Glick gemacht habe. Lieber Frantz, meine Mutter weiß nichts davon, wo ich gewesen binn, Sie glaubt, ich war im Dienst bei guten Menschen. Lieber Frantz, ich kan dir gar nicht genug danken, weil du mich wegenohmen hast aus den schrecklichen Haus, wo ich sovil mittgemacht habe und wo ich durch meine grose Dumheit und meine bittere Nott heineingeratten. Das werd ich dir nie vergessen und will ich dich ewig lieben und dir danken auf den Knien und du brauchst mich nur behandeln wie einen gewöhnlichen Dienstbotten, wenn ich nur immer bei dir sein kann. Jeden Wunsch wil ich dir von dein lieben augen ablesen. Du hast mich gerettet von der Schande hir auf Erden und von der ewigen Verdamnis in der Hölle.
Ewig deine liebende Vozelka Anna.«
Jetzt begriff Marianne vieles. Also das war ihre Mutter einmal gewesen. Deswegen hatte der Vater, trotz aller Liebe für die Mutter, so lange gezögert und hätte sie vielleicht nie geheiratet, wenn nicht der Krieg mit seinen Ungewißheiten hereingebrochen wäre.
1901 war sie zur Welt gekommen. Knapp zwei Jahre nach dem Pardubitzer Bild. Achtzehn Jahre also hatte die Mutter mit ihrem geliebten Franz gelebt. Die letzten Jahre sogar als seine richtige Frau, ehe sie im Frühling vor dem Umsturze plötzlich hatte sterben müssen, von einer »Hamsterfahrt« krank zurückkehrend; sterben, ohne ihren geliebten Franz – nach dem sie bis zum letzten Augenblick schrie – noch einmal gesehen zu haben!
Marianne hielt das Bild ihrer Mutter näher zur Lampe. Aber das genügte ihr noch immer nicht. Sie stand auf und hob die Lampe gegen die Wand. Dort hing ein anderes Bild der Mutter aus ihren Jugendtagen.
Gelb leuchtete das Haar in schweren Zöpfen, wie eine Krone in die niedrige Stirn gelegt. Der rote, brutale und doch so reizvolle Mund war lachend geöffnet und ließ die breiten, starken Zähne hervorblitzen. Und die klaren, glasgrünen Augen starrten fast unheimlich und zwingend aus den bräunlichen Schatten, die sie umrahmten.
Es war das Bild der Mutter – und auch ihr eigenes, wenn sie sich damit im Spiegel verglich.
Wie zart und zierlich war doch der Vater im Vergleiche mit seiner wilden böhmischen Bauernmadonna gewesen.
Bauernmadonna, ein Wort, das die Mutter immer wütend gemacht hatte und das sie nicht hören konnte, denn sie wollte eine feine Dame sein und kein Mensch sollte das Bauernblut in ihr ahnen. Sie wollte ihrem Franz ebenbürtig werden – wenigstens äußerlich. Das war immer ihr brennender Ehrgeiz gewesen.
»Weiß Gott, wieviel Blut vom böhmischen Uradel in meinen Adern fließt. In unserer Gegend waren sie alle begütert, die großen Herren des Landes, die heimlichen, ungekrönten böhmischen Könige. Vielleicht bin ich überhaupt selber eine heimliche böhmische Gräfin und du nur ein kleiner steirischer Baron.«
Und wieder saß Marianne an dem Schreibtisch. Aber sie wühlte nicht mehr in den alten Papieren. Erinnerungen waren aufgewacht. Gelb-rot wogende Kornfelder sah sie vor sich und ein Häuschen, mit Stroh gedeckt, halb in den Boden versunken. Und eine alte Frau saß auf der Bank vor der Türe, zu der sie Großmutter sagen sollte und deren Sprache sie nicht verstand.
Plötzlich abends, als die Sonne glühend über die Ebene herabsank, die in grau-violettem Dunst sich weithin erstreckte, kam ein großes braunes Pferd in kurzem Trabe herangesprengt. Ein junger Offizier glitt aus dem Sattel – und die Mutter schrie auf und lachte und weinte, und der Mann hob sie empor, trug sie hinein und küßte das gelbe Haar, den roten Mund und die lichten Augen. Und dann nahm er sie selbst, die kleine Marzi – wie er sie rief – auf den Arm, ganz leise und behutsam, und streichelte sie und flüsterte immer wieder: »Mein liebes, kleines Mäderl.«
Ein heißer, trüber Schleier sank über Mariannens Augen, und ein wildes, fassungsloses Schluchzen brach aus ihr heraus.
»Armer Papa? Liebe Mama! Niemand, niemand ist mehr da, der mich lieb hat und der sich um mich kümmert. Arm und schutzlos stehe ich einer feindseligen Welt gegenüber, die mir und den Meinen alles genommen hat und nur darauf lauert, auch mich ganz in den Staub zu treten. Was soll mit mir geschehen? Was soll aus mir werden?«
Und sie fühlte, wie sie tiefer und tiefer im dumpfen Elend der Massen versank. Wie eine Ertrinkende reckte sie die Arme hilfeheischend empor. Aber alles blieb stumm, und nur die kleine Uhr tickte eilig und gleichmütig weiter durch die Trostlosigkeit dieser langen Nacht.
2.
Am anderen Morgen suchte Fanny die junge Baronesse vergeblich in ihrem Zimmer. Sie fand sie im schmalen Kabinett, auf dem Feldbett ihres Vaters ausgestreckt, wo sie, verlockt durch die wohlige Wärme, geblieben war. Gerade nur, daß sie die Oberkleider abgelegt hatte.
»Aber das heißt man doch nicht ausruhen«, meinte Fanny, als sie ihr den heißen Wasserkakao und die Büchse mit der Kondensmilch hinstellte.
Marianne war übrigens schon munter. Die Sorgen hatten sie zeitig geweckt. Sie überdachte ihre Lage. Von den paar Kronen Waisengeld, die sie als Offizierstochter von dem verkrachten Staat vielleicht erhalten würde, konnte sie ihre Existenz unmöglich fristen. Das reichte nicht einmal für die Gemeinschaftsküche.
Als der Vater fortgegangen war, ohne wiederzukommen, war er noch einmal in das Auktionshaus Schidloff gegangen, um sich ein letztes Mal die Miniaturen seiner Eltern, gemalt von Daffinger, anzusehen, ehe sie am nächsten Tag zur Versteigerung gelangten. So schwer hatte sich der Vater von diesen beiden Bildern getrennt. Viel schwerer als vom Familiensilber und den Perserteppichen, die der Not der Zeit schon lange zum Opfer gefallen waren, um das stumpfe Elend dieser Tage etwas zu mildern und zu erleichtern.
Den größten Teil des Erlöses dieser letzten Verkäufe hatten die Begräbniskosten verschlungen. Ein paar tausend Kronen waren noch da. Wenn sie sich einen neuen Velourmantel mit Pelzkragen kaufte, wovon als einer unbedingten Notwendigkeit schon immer die Rede war, würde gerade so viel bleiben, um bis zum Januar hindurchzukommen, vorausgesetzt, daß keine neue Teuerungswelle alle Berechnungen über den Haufen würfe.
Irgendetwas mußte geschehen. Von irgendeiner Seite mußte Geld kommen. Oder wenigstens eine Versorgung.
Der Gedanke, von früh bis abends über eine Schreibmaschine gebeugt zu sitzen, war ihr grauenhaft. Dazu fühlte sie sich nicht geeignet.
Also zu Kindern! Oder als Stütze der Hausfrau! Zu irgendeinem Schieber oder Kriegsgewinner. Denn wer sonst könnte sich ein Kinderfräulein leisten! Und was man da alles von ihr verlangen würde! Dabei konnte sie eigentlich nichts Brauchbares! Zeugnisse hatte sie auch keine! Also zur Konfektion? Verkäuferin oder Probierfräulein!
Ja, wenn sie noch ihre Stimme gehabt hätte, die früher ihre große Hoffnung gewesen war! Aber eine tückische Angina hatte sie einfach hinweggewischt. Also was tun? Da war guter Rat schwer.
Plötzlich fiel ihr Doktor Pummerer ein.
Pummerer war Rechtsanwalt, ihr Vater hatte einige Male mit ihm zu tun gehabt und hatte ihn ihr als relativ anständigen Menschen geschildert.
Zu diesem Doktor Pummerer wird sie gehen!
Mit dem wird sie sich beraten! Vielleicht kann sie der irgendwohin empfehlen! Vielleicht an irgendeinen Herrn der Reparationskommission oder an irgendeinen Vertreter der diversen Liebeswerke und Hilfsaktionen, die derzeit in Wien ihre Rettungsarbeiten durchführen.
Nachmittags saß sie in der Kanzlei des Doktors.
»Es wird lang dauern«, meinte das Fräulein, die eine Armee von weiblichen Hilfskräften kommandierte. »Der Herr Doktor hat eine wichtige Konferenz. Der Herr Präsident Wiesel ist bei ihm. Sie wissen doch, was das bedeutet?«
»So? Schön. Dann werde ich warten. Ich habe Zeit.«
Das Fräulein schien enttäuscht. Sie hatte den Namen »Wiesel« mit einem gewissen Stolz erwähnt und gar keinen Eindruck damit erzielt. Beleidigt wandte sie sich wieder ihrer Arbeit zu.
Nach einer guten Weile öffnete sich die Türe und von Doktor Pummerer mit süßlicher Devotion herausbegleitet erschien ein kleiner, schlanker Herr mit einem blassen, nervösen Gesicht, das von großen, schwarzen, etwas scheuen Augen belebt wurde, schob sich hastig, mit einer gewissen Katzengeschmeidigkeit durchs Zimmer, starrte einen Moment verdutzt die junge Dame an, wurde rot wie ein Schulbub und verschwand, von Doktor Pummerer ganz ergebenst hinausgedienert.
»Jung schaut er aus, der Herr Präsident Wiesel«, sagte das Maschinenschreibfräulein begeistert, »und so interessant!«
Inzwischen hatte Doktor Pummerer die wartende Marianne entdeckt. »Ja, was wäre denn dieses? Welch ein Fest für meine entzündeten Augen«, begann er mit widerwärtiger Liebenswürdigkeit. »Welch ein hoher Besuch in meiner niedrigen Hütte! Die schöne Baronesse Marianne, der Abgott ihres hochgeschätzten Herrn Papas, unseres verdienten Schlachtenlenkers … und in Trauer, wie ich sehe. Ja, was wäre denn da passiert? Doch nicht …?« Und das runde, rosenrote Ferkelgesicht des Doktor Pummerer wurde plötzlich kreideweiß. »Ein Schlagerl, vielleicht gar?«
»Ja, Herr Doktor. Mein armer Papa. Ich habe gedacht, Sie wüßten es ohnehin. Es stand ja in der Zeitung.«
»Ein Schlagerl, ein Schlagerl«, wiederholte Doktor Pummerer mechanisch. Und dabei fingen seine Knie zu zittern an, und er mußte sich setzen. »Solche Sachen höre ich nicht gern. Wenn man selbst ein bißchen vollblütig ist, ist das immer wie eine leise Mahnung. Und der Herr Papa war doch noch so ein fescher Herr! Ja, ja, der Krieg hat uns alle hergenommen! Das war doch alles keine Nahrung, was man da fressen mußte. Wir waren doch alle unterernährt!«
Und er strich mit seinen kurzen, weißen, fleischigen Prälatenhänden über seinen schwellenden Bauch.
»Aber darf ich die allergnädigste Baronesse bitten, in das Allerheiligste einzutreten«, und er schob sie in sein Zimmer.
»Also, was verschafft mir die hohe Ehre des Besuches? Vielleicht eine kleine Erbschaftsangelegenheit? Ein kleines Zankerl mit dem Herrn Vormund? Wird alles bestens besorgt werden.«
»Geerbt habe ich nichts. Mein Vater hat mir nichts hinterlassen. Verwandte habe ich keine. Die paar wertlosen Möbel wird mir niemand streitig machen. Vormund habe ich bis jetzt keinen. Ich glaube, ich brauche auch keinen mehr.«
Der Übereifer Doktor Pummerers war nach den ersten Worten Mariannens sichtlich erkaltet.
»Allerdings, eine kleine Eingabe an das Vormundschaftsgericht, und die gnädige Baronesse ist mündig. In dankbarer Erinnerung an den Herrn Papa, dem ich so manche wertvolle Konnexion in vergangenen Tagen verdanke, werde ich mir erlauben, die Verlassenschaftsabhandlung und die Mündigsprechung der geschätzten Dame kostenlos durchzuführen.«
»Ich danke Ihnen, Herr Doktor. Das ist sehr freundlich. Aber jetzt hätte ich noch eine Bitte. Ich suche einen Erwerb. Ich muß trachten, mich zu erhalten.«
»Wird nicht leicht sein, ein Unterkommen zu finden. Schlechte Zeiten! Handel und Gewerbe liegen darnieder! Der Krieg hat uns böse Wunden geschlagen. Wir sind Bettler mit Ausnahme der Herren Kriegsgewinner und Valutenschieber. Man müßte an ein Import- und Exporthaus denken. Sind das Fräulein in Sprachen bewandert? Die italienische Mission, die hier tagt, braucht immer junge Bureaukräfte. Ja, wo hatte ich nur meine Gedanken!«, fuhr Doktor Pummerer plötzlich laut auf: »Ich habe schon den richtigen Mann für Sie, der Ihnen eine Lebensstellung anbahnen wird. Haben gnädigste Baronesse ja gesehen, wer soeben von mir weggegangen ist, höchstpersönlich.«
»Ja, ein kleiner Herr, der ein bißchen merkwürdig und unheimlich aussieht. Wie ein kleines, gefährliches Raubtier auf der Lauer.«
»Ausgezeichnet beobachtet«, meckerte Doktor Pummerer vergnügt. »Kleines, gefährliches Raubtier auf der Lauer! Der hat’s verstanden – besser als alle andern. Finanzgenie, hat seine Zeit verstanden. Großer Mann geworden, das kleine, gefährliche Raubtier! Geht bei der Regierung ein und aus! Vertrauensmann des Finanzministeriums und der Valutazentrale! Intimus des Polizeipräsidenten! Millionär in Dollar, Pfunden und Schweizer Franken. Hat mit der Regierung große Geschäfte gemacht! Und die Regierung mit ihm! Reicher Mann! Nobler Mann! Galant den Damen gegenüber! Werde sprechen mit dem Mann. Der wird schon den richtigen Ausweg wissen. Ein Wort von ihm, mit dem nötigen Nachdruck gesprochen, und alle Türen öffnen sich sperrangelweit. Die gnädigste Baronesse wird mir die werte Adresse da lassen und da werden wir sie verständigen, wenn es soweit ist. Vielleicht machen wir ein kleines, gemütliches Soupetscherl bei mir. In allen Ehren natürlich! In allen Ehren! Der Herr Präsident kommt gerne zu mir. Er weiß, er findet immer eine nette Gesellschaft und die Unterhaltung bleibt diskret. – Mit Rücksicht auf den Trauerfall ist natürlich doppelte Vorsicht geboten. Also engster Kreis. Der Herr Präsident hat ausgezeichnete Weine und läßt es sich niemals nehmen, so oft er zu mir kommt, ein paar Flaschen allererster Güte für meine lieben Gäste heraufzusenden, nebst einem kleinen Souvenir für die Damen und einer Schachtel exquisiter Zigarren für die Herren. Ja, der Herr Präsident versteht zu leben. Aber ganz im stillen! Er liebt kein Aufsehen! Das macht böses Blut und erregt nur den Neid der besitzlosen Klasse. Die Herren Sozialdemokraten haben es ohnehin scharf auf ihn. Wir werden nächstens etwas tun müssen für die notleidende Bevölkerung oder für den geistigen Arbeiter.«
Das Fräulein meldete einen neuen Besuch. Marianne erhob sich.
»Also, wie gesagt, meine gnädigste Baronesse, es bleibt dabei. Ich werde Sie dem Herrn Präsidenten dringendst ans Herz legen. Der Moment ist ungemein günstig. Er fühlt sich ohnedies derzeit sehr verwaist und vereinsamt und sucht nach einer Anregung für die karge Zeit, wo ihn seine Geschäfte nicht bis zur Erschöpfung in Anspruch nehmen. Vielleicht, daß er sich das Baronesserl höchst persönlich als Privatsekretärin engagiert.«
»Ja, aber ich kann doch gar nicht stenographieren und maschineschreiben.«
»Aber das macht doch gar nichts! Das lernt sich! Es lernt sich so vieles in diesen Zeiten!« Und er musterte wohlgefällig Mariannens herrliche Gestalt, ihren zarten Teint und das schwere, weizengelbe Haar.
Nur vor diesen Augen fuhr er ein bißchen zurück. Denn in diesen glasgrünen, funkelnden Augen lag etwas Unheimliches, dessen man nicht sicher war. Und für Unbequemlichkeiten und Irregularitäten war der Herr Doktor Pummerer nicht zu haben. Es mußte alles hübsch glatt und mit Behagen gehen.
»Also, wir hören voneinander.«
Und so schieden sie für diesmal. Beide Hoffnungen erfüllt.
Marianne war noch nicht im Hausflur, als bei Doktor Pummerer bereits das Telephon aufschrillte. Der Herr Präsident wollte von Herrn Doktor Pummerer erfahren, wer die interessante, junge Dame gewesen sei, die er bei ihm im Vorzimmer getroffen habe. Er müsse unbedingt ihre Bekanntschaft machen.
Doktor Pummerer suchte schnell nach Ausflüchten – stellte die Angelegenheit höchst schwierig hin. Um so größer sollte dann sein Verdienst sein, wenn sie doch gelang. Jedenfalls sollte einstweilen der Herr Präsident ein bißchen auf der Folter zappeln, ehe ihm Doktor Pummerer seinen Wunsch erfüllte.
Marianne aber mit dem Gefühl: Ich bekomme ja doch jetzt bald eine Stellung – dieser liebe, gute Doktor Pummerer wird mir helfen, wurde leichtsinnig und kaufte sich nicht nur eine Orange, sondern auch ein Paar neue Schuhe für ihr Abendkleid. Vielleicht geht man doch einmal irgendwo hin, wo man anständig angezogen sein muß!
Neunzehn Jahre war sie alt geworden und hatte von ihrem Leben nichts gehabt als Not und Entsagung. Der Krieg hatte ihr ihre Jugend einfach gestohlen. Und diese letzten zwei Jahre an der Seite ihres lieben, aber auch so verbitterten Papas hatten das Martyrium ihres jungen Lebens vollendet. Atmen dürfen in Licht und Sonne ohne Lebenssorgen – welch ein Traum von Glück! Arbeiten – gut! Aber manchmal auch fühlen dürfen, daß man jung und schön ist! Gestern hatte man den Vater begraben – und heute … es war gewiß roh, aber sie hatte heute so eine Sehnsucht, lachen und tanzen zu dürfen.
3.
Bis nahe an sein sechsunddreißigstes Jahr hatte sich Ernö Kalmar in der ungarischen Provinz herumgeschlagen.
Was war er nicht alles gewesen!
Das Klausenburger Gymnasium hatte er gerade noch mit Ach und Krach absolviert. Aber ehe es dazu kam, daß er die Universität bezog, starb der alte Getreidehändler, sein Vater, und so mußte er plötzlich sich und seine Mutter erhalten.
Zuerst versuchte er es jahrelang mit der Schauspielerei, ohne es zu irgendetwas Nennenswertem zu bringen. Dann war er nacheinander: Automobilagent, Juwelenhändler, Klavierspieler in zweideutigen Lokalen, Zeitungskolporteur, Inseratenagent und landete schließlich als Hauptmacher in der Redaktion eines oppositionellen Winkelblättchens, das in wüstem Chauvinismus und in nationaler Verhetzung schamlos arbeitete.
So war er sechsunddreißig Jahre alt geworden, ohne jemals mehr als seinen notdürftigsten Lebensunterhalt verdient zu haben.
Den Krieg hatte er nicht mitgemacht. Als einziger Sohn und Erhalter seiner Mutter und überdies als unentbehrlich für sein Blättchen war er natürlich enthoben gewesen.
Als der Zusammenbruch der Front kam und in den Tagen des Umsturzes der König aus dem Lande verschwand und Graf Karolyi Präsident der Volksrepublik wurde, das Unterste sich zum Obersten kehrte, als heimliche Sowjetemissäre anfingen, das Land zu überschwemmen und das feste Gefüge alter Machthaber sich lockerte, da empfand auch er: Jetzt ist meine Zeit gekommen! Jetzt oder nie!
Er verkaufte seine armseligen Möbel und was sonst entbehrlich schien – packte seine alte Mutter, von der er sich nie getrennt hatte, zusammen und fuhr mit ihr nach Budapest, einen Posten zu ergattern.
Er kam gerade in dem Augenblick an, als Graf Karolyi, der Regent Ungarns, die Macht in die Hände Bela Kuhns, des roten Terroristen, legte, der aus Ungarn eine Räterepublik machen wollte. Bela Kuhn war sein Jugendfreund und Schulkollege noch von Klausenburg her.
Ernö Kalmar wurde freundlich aufgenommen. Er wurde als Arbeiter erster Klasse qualifiziert und erhielt die Aufgabe, die Begeisterung der Massen für Bela Kuhn zu schüren und wach zu erhalten. Und da er einmal Schauspieler gewesen war, zog er von Lokal zu Lokal und deklamierte das Gedicht vom »roten Heiland«, überall stürmischen Beifall von der ängstlichen Menge erzwingend.
Das war Ernö Kalmars große Zeit.
Sie dauerte kaum ein halbes Jahr. Dann stürzte der rote Diktator Ungarns und Ernö Kalmar mußte mit ihm vom Schauplatz verschwinden.
Eile tat not. Denn der weiße Terror begann den roten abzulösen. Ernö Kalmar mußte darnach trachten, so rasch wie möglich aus Budapest zu flüchten und im benachbarten Österreich ein Asyl zu finden.
Eine abenteuerliche Fahrt, um Wien zu erreichen, beginnt. Eine Reise, die früher vier Stunden dauerte, nimmt jetzt schon über eine Woche in Anspruch. Und jeder Tag erhöht die Gefahr. Vereinzelte Bahnstrecken sind aufgerissen und unpassierbar. Auf anderen wieder lauern die Pronay-Husaren, die Soldaten des weißen Terrors.
Der Lastzug, den er bisher benützt hatte, ist stecken geblieben, Maschinengewehrschüsse aus dem Hinterhalt haben die Lokomotive unbrauchbar gemacht.
Er ist gezwungen, seine alte Mutter in der Nähe eines Dorfes allein zu lassen – hinein wagt er sich nicht, denn die Bauern sind weiß gesinnt und mobilisiert. Er muß einen Wagen besorgen, um die nächste Bahnstation zu erreichen, da die alte Frau nicht gehen kann.
Als er nach einer Stunde zurückkommt, findet er seine Mutter erschlagen und ausgeplündert, halbnackt in ihrem Blute am Straßenrand liegend.
Die Augen kann er ihr noch zudrücken, die müden Augen, die so tief in die Höhlen versunken sind und die soviel Jammer gesehen haben.
Dann küßt er ihr noch einmal die verrunzelten Hände und den eiskalten Mund – und flieht. Er hat keine Zeit, sie begraben zu lassen. Die Bauern werden ihn als Roten erkannt und gesucht haben. Die Mutter hat den Tod erlitten, der ihm bestimmt war – von den Weißen, die vom Plattensee her gegen die Hauptstadt anrücken.
In der Morgendämmerung eines Augusttages hat er auf Feld- und Waldwegen den Grenzfluß, die Leitha, erreicht. Er ballt sein Gewand zu einem Bündel, schnürt es fest und zerrt es schwimmend an einer Schnur mit sich hinüber. Ein paar Schüsse von einer Grenzpatrouille sausen über seinen Kopf weg – aber er ist gerettet. Er ist in Österreich und dem weißen Terror entronnen.
Die prominenten Häupter der ungarischen Sowjetregierung sind einstweilen ebenfalls in Österreich gelandet. Ein Geheimvertrag, den die ungarischen Revolutionäre mit den österreichischen geschlossen hatten, sicherte ihnen gegenseitige Asylfreiheit und Hilfe, wenn ihre Anschläge mißlingen sollten. Die Ungarn berufen sich auf den Vertrag und verlangen Aufnahme. Bela Kuhn und die Seinigen sind auf einem Schloß, fern von Wien, interniert worden, wo sie auf die Weiterfahrt nach dem befreundeten Sowjetrußland warten.
Um Ernö Kalmar kümmert sich niemand. Dazu ist er viel zu unbedeutend und politisch harmlos.
Aber auch die Mitglieder der sozialistischen Regierung, die Bela Kuhns Erbe angetreten haben, sind bereits aus Ungarn geflohen und in Wien. Horthy hat die Rumänen ins Land gerufen, um die alte Ordnung herzustellen.
Der weiße Terror wütet.
4.
Das eleganteste und stillste Ringstraßencafé verliert seinen Charakter – soweit es noch einen hatte.
Früher war das »Café Imperial« der Treffpunkt einer vornehmen Auslese der Wiener Gesellschaft gewesen. Während des Krieges ergreifen die Fett- und Marmeladeschieber, die Valutenkäufer, die Kohlenhändler, die Agenten der auswärtigen Missionen, die mit Ex- und Importerlaubnissen einen wüsten Handel treiben, davon Besitz. Dazwischen sitzen zweideutige Kuriere kleinerer Staaten, die Geld und Juwelen für entsprechende Provisionen ins Ausland schmuggeln, um sie vor dem Zugriff der einheimischen Behörden in Sicherheit zu bringen. Mit falschen und echten Pässen wird ein schwunghafter Handel getrieben. Personen erscheinen und verschwinden nach geheimnisvollem Flüstern. Versiegelte Pakete wechseln hin und her. Manchmal erhebt sich ein wüster Skandal, der sich bis zu Tätlichkeiten steigert. Dazwischen drängt sich allerhand Weibliches, teils mit erotischen, teils mit politischen Absichten. Dirnen und Damen in engster Nachbarschaft.
Das eine Zimmer des »Café Imperial« wird zum Sowjetzimmer.
Nach der Überflutung Wiens mit den aus Rußland und der Bukowina ausgewiesenen Ostjuden brechen die ungarischen Emigranten über die Stadt herein und setzen sich fest.
Und fast über Nacht ändert sich der Charakter der Stadt, immer mehr kommt die Mentalität der »Zugereisten« zum Ausdruck. Wien wird balkanisiert und verzigeunert.
Ernö Kalmar findet im Sowjetzimmer selbstverständlich seine Heimat und alle landsmännische Unterstützung, die er braucht, um nicht zu verhungern.
Da sitzt der letzte Gesandte der ungarischen Räterepublik, der es vom Mechaniker und Agenten für Schreibmaschinen bis zum Oberkommandanten der Roten Armee gebracht hatte. Da sitzt, aufrecht und charakterfest, der ehemalige Handelsminister der Karolyi-Zeit, den die Roten gezwungen hatten, als Propagandachef für sie in die Schweiz zu gehen, der aber die Mission benützt hatte, um seinem Vaterland ein für allemal den Rücken zu kehren, nachdem er die erhaltenen Propagandagelder getreulich zurückgeschickt hatte. Da sitzt der Maler, der am ersten Mai die Hauptstadt in ein rotes Farbenmeer getaucht hatte. Da sitzen der rote Theaterintendant, daneben der Komponist der roten Hymne und Vorstand aller Musikschulen aus den Tagen der Räterepublik. Da sitzen sie, die Leute aller Regierungsperioden, die von den Tagen des Umsturzes bis zur Horthy-Regierung einander gefolgt waren. Sogar der schwarze Riese, von dem es heißt, er sei der geistige Urheber der Ermordung Tiszas, weilt unter ihnen.
Und wenn sie auch streiten, einander verachten und bekämpfen, im Hasse gegen die Horthy-Regierung sind sie alle einig. Und sie schreien und toben und gestikulieren und gründen Zeitungen: Die Zukunft, Der freie Mensch, Diogenes.
Im Vorraume des Sowjetzimmers sitzen die Spione und Vertrauten der weißen Regierung, die ihre Wiener Filiale gegenüber im »Grand Hotel« hat, und notieren emsig, wer im Sowjetzimmer zu sehen ist; und sie inszenieren Überfälle und Entführungen roter Politiker, um sie nach Budapest zu verschleppen und dort vors Gericht zu stellen oder verstümmelt und zerstochen in der Donau verschwinden zu lassen, wenn das Material nicht genügt, sie offiziell an den Galgen zu bringen.
Ernö Kalmar findet eine Anstellung bei der Zeitung Der freie Mensch. Er muß gleichzeitig Artikelschreiber, Inseratenagent und Austräger sein. Die Not der Emigranten ist groß und Wien ist arm und teuer. Geld ist nur bei den Kriegsgewinnern und ihrem Anhang zu finden.
Aber noch ist nicht alle Hoffnung geschwunden, daß in Ungarn der rote Terror noch einmal aufflammt – diesmal von Österreich aus. Die ungarischen Terroristen in Verbindung mit den russischen Sowjetagenten, die Wien überschwemmen, arbeiten fieberhaft. Die Kommunistenpartei verfügt über große Beträge zu Agitationszwecken, zwei rote Bataillone der Volkswehr stehen zu ihrer Verfügung. Ein Plan ist ausgearbeitet. Man wird sich Wiens bemächtigen und die sozialistische Regierung stürzen. Die Rollen und Ämter sind im voraus verteilt. Für den Ostermontag ist der große Kommunistenputsch angesetzt, der auch in Wien den roten Terror aufrichten soll.
Aber die sozialistische Regierung ist wachsam. Sie hat von den Plänen Wind bekommen und trifft Gegenmaßregeln. Die Kasernen, aus welchen die roten Bataillone ausrücken sollen, um die Besetzung Wiens durchzuführen, bleiben im entscheidenden Moment von außen gesperrt und bewacht. Der neuerliche Umsturz mißlingt. Ein Verzweiflungssturm auf die Polizeizentrale wird abgewehrt und auf den Straßen liegen die Kommunisten in ihrem Blut.
Der Putsch ist gescheitert – Wien ist der Bolschewikengefahr entronnen und atmet auf.
Die letzte Hoffnung der emigrierten Ungarn, von Wien aus die Heimat wieder erobern zu können, ist begraben. Wien entledigt sich vor allem der russischen Sowjetemissäre. Die ungarischen Emigranten werden zwar geschont, aber sie müssen sich mit den Tatsachen abfinden und dem roten Idealismus abschwören. Es heißt, sich an Wien anzupassen und Existenzmöglichkeiten zu finden. Der politische Rausch weicht dem Selbsterhaltungstrieb und dem angeborenen Geschäftssinn.
Ernö Kalmar ist der erste, der die neue Situation begreift und sich auf sie einstellt. Ein befreundeter ungarischer Apotheker versorgt ihn mit Kokain.
An dunklen Ecken gewisser Straßen ist er zu bestimmten Stunden zu treffen. Auch in gewissen berüchtigten Cafés. Den Gewinn teilt er mit dem Apotheker.
Auch an heruntergekommene Aristokraten, die sich ihrer Armut schämen, macht er sich heran und vermittelt den Verkauf von Familienschmuck an Leute, die mehr zahlen als die offizielle Münze, die kategorisch alle Goldsachen einfordert, Safes und Tresore heimtückisch öffnen läßt, die Ausfuhr der Wertsachen verbietet und im Inland den Kaufpreis des Goldes tief unter der Weltparität hält, um es möglich zu machen, in Holland Fett, Reis, Getreide und Zucker für den ausgesogenen Staat anzukaufen.
Nach und nach gelingt es Ernö Kalmar, wieder bessere Kleider anzuschaffen, die ihm weder zu groß noch zu klein sind und nicht von Spenden für die herabgekommenen Emigranten stammen.
Bisher hat er nur ungarisch geschrieben. Jetzt beginnt er auch deutsch zu schreiben und seine Reporterfähigkeiten für Wiener Tageszeitungen zu verwerten.
Noch wohnt er in seiner elenden Kammer im schmutzigsten Viertel Wiens. Noch ißt er in der Gemeinschaftsküche – aber es geht vorwärts.
Der August 1920 bringt eine neue Teuerungswelle. Der Hollandgulden steigt von 58 auf 80 Kronen.
Die Börse verzeichnet eine Katastrophenhausse auswärtiger Valuten. Aber Kalmar verdient bei dieser Gelegenheit zum ersten Male, denn er hat sich selbst nur das Allernotwendigste gegönnt und jede ersparte Krone in Franken und Hollandgulden angelegt, die er im Schleichhandel erworben hat. Er braucht vor dem kommenden Winter nicht mehr zu zittern wie die anderen – er wird nicht hungern und nicht frieren – er hat sich versorgt. Er denkt sogar daran, sich ein besseres Quartier, näher der Stadt und ihren Kaffeehäusern, zu suchen, in denen sich derzeit das »unterseeische« Geschäftsleben zweideutiger Existenzen abwickelt.
Er ist der erste von den ungarischen Kommunisten, der dem roten Idealismus definitiv abgeschworen hat und sich zur Devise: verdienen, um jeden Preis verdienen, bekennt.
Die Stammgäste des Sowjetzimmers beginnen auf ihn aufmerksam zu werden und ihn mit einer gewissen Hochachtung zu behandeln. Dieser Kalmar versteht’s!, ist die allgemeine Meinung, die sich langsam durchzusetzen beginnt. Der wird es zu etwas bringen! Mit diesem Kalmar muß man sich verhalten.
Ab und zu wagt Kalmar bereits in den eleganten Schieberlokalen aufzutauchen, wo nächtlicherweile die Tausender fliegen. Wo die Offiziere auswärtiger Missionen ihren Sold verprassen und Rosenschlachten mit Wiener Mädeln ausfechten, die der Hunger, der Leichtsinn und die Lebensgier in die Hände der Zahlungskräftigen treibt, die auswärtige Valuten besitzen. Denn Wien gehört bis auf weiteres den Schiebern, die im Gefolge der diversen Missionen aufgetaucht sind, die sich in den Hotels, Palästen, Cafés und Nachtlokalen breitmachen, Stadt und Land ausräubern und von der Not der Stadt zehren und profitieren.
Wie eine Wolke von Geiern kreisen sie über Wien, immer bereit, herabzustoßen und ihre Beute wegzuschleppen. Der große Ausverkauf ist im vollen Gange. Alles ist am Markte zu haben. Kommerzwaren und Kunstschätze, die Ehre der Frauen und die Gesinnung der Männer.
Die Not bändigt alle.
5.
Marianne hält ihre Mündigkeitserklärung in Händen. Doktor Pummerer hat die Sache wirklich rasch und geschickt gemacht.
Gleichzeitig kam eine Einladung des Rechtsanwaltes, der sie bat, ihm das Vergnügen zu schenken und im engsten Freundeskreise am anderen Tage das Abendbrot bei ihm zu nehmen. Jener Herr Generaldirektor und Präsident, von dem er sich so viel für ihre Zukunft versprochen habe, würde auch anwesend sein und sich sehr freuen, sie kennen zu lernen.
Marianne entschloß sich im Hinblick auf ihre Zukunft, die Einladung anzunehmen, obwohl erst knappe vier Wochen seit dem Tode ihres Vaters verstrichen waren.
Eigentlich hatte sie schon früher eine Verständigung Doktor Pummerers wegen irgendeines Postens erwartet. Ihre eigenen Bemühungen, an denen sie es durchaus nicht fehlen ließ, waren bis jetzt resultatlos verlaufen. Die Frauen fanden sie alle viel zu schön – für Männer und Söhne viel zu gefährlich. Und die Männer meinten schmunzelnd: »Sie haben es doch wirklich nicht nötig, in eine untergeordnete Stellung zu gehen, die dazu noch schlecht bezahlt ist.« Und nahezu jeder versuchte, ob die junge Dame nicht doch für ein Rendezvous zu haben wäre …
Nicht ohne leise Erregung zog sich Marianne ihr Um und Auf: das schwarze Taftkleid an und steckte den alten Siegelring mit dem Familienwappen ihres Vaters als einziges Schmuckstück an die Hand.
Trotz der unendlichen Einfachheit ihrer Kleidung sah Marianne strahlend aus. Die mühsam gebändigte Fülle ihres hellgelben Haares wölbte sich wie ein Goldhelm über ihr seltsam schönes slawisches Gesicht, aus dem die lichten Augen in leichtem Fieber der Erwartung herausleuchteten. Es war schließlich überhaupt das erste Mal, daß Marianne in eine Gesellschaft kam. Während des Krieges war sie ein Kind gewesen – nach dem Kriege hatte sie der Vater nirgends hingehen lassen.
»Wir haben mit Leuten, die jetzt Gesellschaften geben können, nichts gemein.«
Marianne kam natürlich, unroutiniert wie sie war, pünktlich – also zu früh.
Sie war die erste Dame. Nur Doktor Pummerers alter Freund, der als Gast in Wien weilte, war bereits da: der Legationsrat Doktor Banciu, ehemals der rumänischen Botschaft zugeteilt, jetzt beim Staatsministerium in Bukarest tätig.
Nicht ohne Zagen war der Legationsrat so bald nach dem Kriege nach Wien gekommen. Aber er hatte richtiges Heimweh nach der Stadt gehabt, in der er aufgewachsen war, in der exklusiven Schule des Theresianums, wohin alle Randstaaten des ehemaligen Österreich-Ungarn ihre vornehmen Söhne hinschickten, um sie zu Juristen und Diplomaten mit vollendeten Umgangsformen erziehen zu lassen. Aber auch Spanier und Ägypter, Serben und Rumänen waren seine Schulkollegen gewesen. Alle erotischen Freuden und Leiden seiner Jugend waren mit Wien verknüpft. Was Wunder, daß es ihn immer wieder hierher zog. Der Abend bei seinem Jugendfreund Pummerer sollte der erste fesche im Geiste der alten fröhlichen Zeiten werden.
Mit sichtlichem Stolze stellte Doktor Pummerer Marianne seinen lieben Freund, den Legationsrat Banciu, vor.
Mit breitem, langsamem und etwas raunzendem Tonfall begrüßte der kleine Diplomat, von dem man nicht sagen konnte, ob er ein altes Kind oder ein junger Greis sei, das schöne Mädchen. Über sein schmales, graugelbes Gesichtchen mit den melancholischen Hasenaugen flog der Schimmer einer Röte.
»Mein Freund Pummerer, dieser Erzgauner, hat immer die schönsten Mädchen zur Hand.«
Und der Diplomat klopfte dem Rechtsanwalt anerkennend auf die Schulter.
Bei dem Worte »Erzgauner« lächelte Doktor Pummerer höchst geschmeichelt. Er liebte solche vertraulichen, beschimpfenden Koseworte, die seine skrupellose Geschicklichkeit anerkannten, die sich hinter seiner gespielten Gutmütigkeit scheinheilig duckte und verbarg.
»Ich hoffe, das allergnädigste Baronesserl wird sich in unserem kleinen Kreise wohlfühlen und ein geliebtes und gefeiertes Mitglied unseres exklusiven Zirkels werden.«
Vorläufig fühlte sich Marianne allerdings noch sehr bedrückt und unbehaglich, ohne aber eigentlich zu wissen warum. Die beiden Herren musterten sie so seltsam. Sie kam sich so warenmäßig abgeschätzt und taxiert vor und hatte einen Moment lang das Gefühl, nackt und hilflos vor den beiden prüfenden Männern dazustehen.
Um die Blicke der Herren, die auf ihrer Haut quälend brannten, ein bißchen von sich abzulenken, kam sie auf die hübschen alten Sachen, Bilder und Möbel des Salons zu sprechen. Doktor Pummerer erglühte vor Freude. Marianne hatte seine schwache Seite getroffen. Er hatte den Ehrgeiz, altösterreichisch und feudal zu wirken und als Kunstkenner und Sammler von Verständnis zu gelten. Aber sein Freund Banciu verdarb ihm sofort den schönen Effekt.
»Er hat nämlich keine Ahnung, was er da hat. Alles nur zusammengestohlen und erpreßt von seinen Opfern. Sie machen sich keine Idee davon, wie er seine Klienten ausplündert.«
»Na, na«, fühlte sich Doktor Pummerer diesmal doch genötigt einzuwerfen, »ist das nicht ein bißchen übertrieben?«
Aber Doktor Banciu fuhr unbeirrt fort: »Nicht nur, daß er den Leuten die unverschämtesten Expensnoten schreibt, gibt er ihnen auch noch so lange keine Ruhe, bis sie ihm nicht die schönsten Stückeln aus ihren Wohnungen überlassen. Und da mein Freund Pummerer meistens gute, alte Familien vertritt, wo es noch schöne, alte Sachen von früher her gibt, blüht natürlich sein Weizen. Er hat eine versteckte Art, den Leuten zu drohen, daß man eine Verlassenschaft geschickter, aber auch ungeschickter – schneller und langsamer führen kann, so daß er die Leute ganz ängstlich macht und sie ihm alles um ein Spottgeld förmlich hinwerfen. Und dann lacht er sie aus – dieser Schuft, daß er sie hereingelegt hat. So wird seine Sammlung immer größer – ohne, daß sie ihn etwas kostete.«
»Na, wenn mein Freund mich durchaus schlecht machen will, könnte man ja auch gewisse kleine Sacherln und Heimlichkeiten von ihm erzählen. Was sich mit meinem Freund Severin in gewissen eleganten Quartieren gewisser stadtbekannter Damen abgespielt hat. Er ist ein bißchen apart in erotischen Dingen, mein Freund … Er weiß strenge Gouvernanten zu schätzen – oder Pflegeschwestern mit energischen Manieren.«
»Lieber Pummerer, du wirst mich noch ernstlich böse machen. Es ist ganz ungehörig, vor einer vornehmen, jungen Dame solche Sachen zu reden. Außerdem mache ich dich auf deine Amtspflicht der Diskretion aufmerksam.«
Die Türe wurde temperamentvoll aufgerissen und zwei Damen in großer Toilette stürmten herein. Eine hellgrün, die andere dunkelviolett gekleidet.
Sie stürzten sich beide mit viel Geschrei und höchst vertraulich tuend auf die Herren. Es waren die rothaarige Lise Varnay, noch immer die begehrte Schönheit, wenn auch schon im Verblühen, und ihre unzertrennliche Freundin Anka von Bergen, deklassierte Aristokratin, Lebedame a. D., geschätzte Darstellerin zweideutiger älterer Damen, die ihre echten oder angenommenen Töchter gerne an die Männer bringen.
Die unangenehm kreischende Pfauenstimme der roten Lisa und das slawisch-französische Geschnatter der alternden Komödiantin mischten sich zu einem wüsten Redeschwall, der sich wie ein Wasserfall über die beiden Männer ergoß.
Plötzlich bemerkten sie Marianne, die gerade etwas abseits saß, und verstummten alle beide gleichzeitig. Lisa unangenehm berührt, denn sie witterte eine Rivalin ihrer verblassenden Beliebtheit. Anka erfreut, denn da sah sie einen neuen Anziehungspunkt für die Herrenwelt ihres Spielsalons, den sie ständig aufzufrischen bestrebt war.
Dieses Mädchen konnte als Attraktion gelten – wenn man sie für das Geschäft gewann.
Marianne wurde vorgestellt.
Lisa blieb kühl, Anka war von überströmender Herzlichkeit – ganz Dame der großen Welt, die sich eines Backfisches liebevoll annimmt und ihre Reize allen demonstriert. Keine Mutter hätte sich stolzer und vordringlicher gebärden können.
Lisa warf ihrer Freundin einen giftigen Blick zu, den diese wohl empfand, aber vornehm übersah. Sie konnte auch vornehm sein.
Zärtlich Marianne streichelnd, untersuchte sie unauffällig, ob alles »echt« sei. Also eine Generalstochter!
Und nun ließ Anka von Bergen ihre ganzen Familienbeziehungen spielen. Den geschiedenen Mann, der ein hoher kroatischer Regierungsbeamter gewesen war, den Onkel, der ungarischer Kardinal war, und eine liebe Tante, welche in jungen Jahren ein weltbekanntes Verhältnis mit einem Thronfolger gehabt hatte.
Lisa kannte diese Walze und unterbrach die Rede erbarmungslos mit der sachlichen Frage: »Wer kommt noch? Und wann essen wir?«
Doktor Pummerer erklärte stolz: »Sobald der interessanteste und populärste Mann von Wien eintrifft – von dem alle sprechen und den so wenige kennen.«
»Doch nicht?«, fragte Lisa beklommen. Denn es gab einen Mann, den sie gerne für sich eingefangen hätte.
Doktor Pummerer vollendete seinen Satz: »Gerade den vielgenannten Präsidenten und Finanzmann Wiesel erwarten wir noch.«
»Na, wenn er mir sein Taschentuch zuwirft, ich hebe es auf«, gestand Lisa in holder Unbefangenheit.
»Sie sind zu gut! Sie machen es den Männern gar zu leicht. Sie müssen strenger sein, dann werden Sie mehr Erfolge haben«, erlaubte sich Doktor Banciu zu bemerken.
»Sitzt schon wieder oben auf seinem Steckenpferd!«, mokierte sich Doktor Pummerer zu Anka hinüber. »Haben Sie vielleicht ein Kinderpeitscherl mit? Dann haben Sie vielleicht Aussicht sogar beim Doktor Banciu«, setzte er zu Lisa gewendet fort.
Doktor Banciu ignorierte diesen Ausfall und vertiefte sich mit Anka in ein Gespräch über gewisse junge Damen, welche für wirkliche Vornehmheit kein Verständnis hätten.
Marianne kam sich in diesem Kreis sehr bedrückt und deplatziert vor. Sie fand den Ton so merkwürdig. Waren das noch Damen – oder nicht? Oder lag die Schuld an ihr? War sie wirklich gesellschaftlich ungeschickt und schwerfällig?
Es schnürte ihr die Kehle zu und sie brachte kein Wort heraus.
»Sind Sie immer so schweigsam, meine gnädigste Baronesse?«, näselte sie Severin Banciu an.
»Ich bin hier so fremd. Aber es wird schon besser werden. Ich habe bisher so zurückgezogen gelebt.« Marianne bat förmlich um Entschuldigung.
»Reizend ist sie! Reizend!«, riefen Pummerer und Anka fast gleichzeitig. »Wie ein unverdorbenes Kind!«
Lisa rümpfte spöttisch die Nase. Doktor Banciu lächelte malitiös.
»Unverdorbene Kinder sind nicht mehr modern. Man will jetzt einen raffinierten Typus.«
Das Telephon im Vorzimmer schlug gellend an.
Der Diener kam mit der Meldung: »Präsident Wiesel läßt bitten, die Herrschaften möchten mit dem Souper beginnen, er habe Sitzung und würde erst später kommen.«
Allgemeine Erleichterung und Zufriedenheit strahlte über alle Gesichter.
Ein üppiges Souper begann. Seltenheiten für das arme Wien dieser Tage, das ausgehungert war, elendes Mehl und mageres Vieh mühsam vom Ausland erbetteln mußte.





























