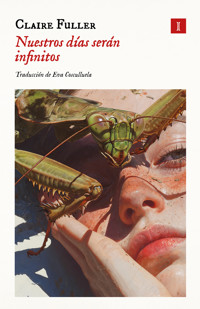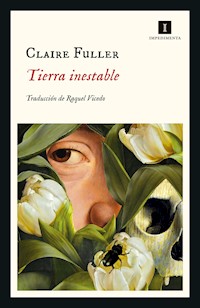18,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kjona Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Wiltshire, im Südwesten Englands: Die Zwillinge Jeanie und Julius leben mit ihrer Mutter Dot am Rande der Gesellschaft in einem windschiefen Cottage. Jeanie kann nicht lesen und nicht schreiben, im Dorf verkauft sie, was sie in ihrem wilden Garten anbaut.Julius kämpft sich mit Gelegenheitsjobs durch. Ihr Leben ist einfach, sie haben nicht viel, aber was sie haben, gehört ihnen. Doch dann stirbt Dot und es kommen Geheimnisse über das Cottage, den Vater und Jeanies schwaches Herz ans Licht, die das Leben der Zwillinge seiner Einfachheit berauben.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 429
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
CLAIRE FULLER
JEANIE UND JULIUS
Roman
Aus dem Englischen von Andrea O’Brien
Für meine ElternUrsula Pitcher und Stephen Fuller
O, will you find me an acre of land,Savoury sage, rosemary and thyme,Between the sea foam, and the sea sand,Or never be a true love of mine
Scarborough Fair,traditionelle englische Ballade
1
Der Morgen dämmert, und Schnee fällt aufs Cottage. Er fällt aufs Reet, verbirgt Moos und Mausschäden, glättet Unebenheiten, füllt Mulden und Verwerfungen, schmilzt, wo er Schornsteinziegel berührt. Er legt sich auf die Pflanzen, auf die nackte Erde im Vorgarten und bildet eine perfekte, wie mit der Teetasse geformte Erhebung auf dem morschen Torpfosten. Er versteckt das Dach des Hühnerstalls genau wie die Dächer vom Plumpsklo und der alten Milchkammer, bestäubt, wo vor langer Zeit das Fenster zerbrochen ist, die Werkbank und den Boden. Im Gemüsegarten hinterm Haus schlüpft der Schnee durch den Folientunnel, kühlt die Steckzwiebeln, zehn Zentimeter unter der Erde, und lässt die frischen Mangoldtriebe schrumpeln. Nur der letzte Winterkohlkopf will sich nicht ergeben, die eingerollten Innenblätter, grün und stark, harren aus.
Im breiten Hochbett über der linken Treppe liegt Dot neben ihrer erwachsenen, sanft schnarchenden Tochter Jeanie. Irgendeine seltsame Lichtveränderung hat Dot geweckt, und sie kann nicht wieder einschlafen. Sie steht auf – Dielenbretter kalt, Luft kälter –, schlüpft in Morgenmantel und Pantoffeln. Als Dot vorbeigeht, hebt der Hund – Jeanies Hündin –, ein keksfarbener Lurcher, der mit dem Rücken zum Kaminsims schläft, wegen der frühen Stunde fragend den Kopf und senkt ihn wieder, als keine Antwort kommt.
Unten in der Küche stochert Dot mit dem Schürhaken in der Herdglut und schiebt zusammengeknülltes Papier hinein, ein paar Späne und ein Holzscheit. Sie spürt einen Schmerz. Hinter dem linken Auge. Zwischen ihrem linken Auge und der Schläfe. Hat diese Stelle einen Namen? Sie muss zum Optiker, ihre Augen kontrollieren lassen, aber was dann? Wie soll sie eine neue Brille bezahlen? Sie müsste ihr Rezept in der Apotheke einlösen, aber das kostet Geld. Auch hier unten ist das Licht falsch. Weißend? Heißend? Gleißend. Sie berührt ihre Schläfe, als wollte sie den Schmerz ertasten, und durch die Vorhänge, dort, wo sie nicht ganz schließen, sieht sie, dass es schneit. Es ist der 28. April.
Offenbar haben ihre Bewegungen den Hund aufgescheucht, denn jetzt ist da unten an der linken Treppe ein Kratzen an der Tür, und Dot streckt die Hand aus, um sie zu öffnen. Sie beobachtet, wie ihre Hand das geschmiedete Eisen greift, die Altersflecken und Schraffuren kommen ihr sonderbar vor, so was hat sie noch nie gesehen: die Mechanik ihrer Finger, wie sich die Haut über die Knöchel spannt, wie sie sich um die Klinke krümmen. Die Glieder sind ihr fremd – die Hand eines Täuschers. Mit dem Daumen auf die winzige Platte zu drücken erscheint ihr unfassbar schwer, die körperliche Erschöpfung schlimmer als damals, als die Zwillinge mit drei Monaten zu unterschiedlichen Zeiten schliefen, oder in diesem entsetzlichen Jahr, als sie zwölf wurden. Mit äußerster Konzentration gelingt es ihr schließlich doch, die Falle hebt sich. Der Hund schiebt die Schnauze durch den Spalt, der Rest seines Körpers folgt. Er winselt und schleckt Dot die linke Hand ab, die da neben ihrem Oberschenkel baumelt, stupst mit der Nase dagegen und bringt sie so zum Schwingen, frei wie ein Pendel. Der Schmerz schwillt an, Dot fürchtet, das Winseln könnte Jeanie wecken, Jeanie, die auf der Doppelmatratze in der rechten Mulde schläft, zuerst von Frank geformt, ihrem schon lange verstorbenen Ehemann, dann, bei den seltenen Gelegenheiten, wenn ihre Kinder nicht da waren, von diesem anderen Mann, dessen Name im Haus nie genannt wird, der zu groß ist, um sich auszustrecken auf dem alten, kurzen Bett, und schließlich von Jeanie weiter durchgelegen, obwohl sie ein Strich in der Landschaft ist und nur ein winziges Stück von der Biskuittorte gegessen hat, von Dot gebacken, letzten Monat, als sie ihren Siebzigsten ein bisschen hier in der Küche gefeiert hat, Bridget machte mit dem Handy Fotos von Julius an der Fiedel und sie am Banjo, Jeanie an der Gitarre, alle haben sie gesungen, nachdem sie sich mit einem Tropfen Port die Stimmbänder geölt hatten, wie Julius immer sagt, und dieses Gefühl, das Dot jetzt hat, ist so ähnlich wie damals, nach dem dritten Glas, wirr und verwischt die Gedanken durcheinander schwindelig die Kuchenreste auf dem Tisch gelassen, sodass der Hund frech auf den Hinterbeinen sie verschlang und sie ihn ausschimpften und lachten, bis ihnen der Bauch … scherzte? schwärzte? … ihre Liebsten bis auf einen, alle zusammen bei ihr, und der Hund, bellend und springend, zu aufgeregt und laut wie im Schnee, reißt Julius aus seinem leichten Schlaf, der Junge schreckt bei jedem Geräusch auf.
All diese Gedanken und mehr gehen Dot kaum bewusst durch den Kopf, während ihr Körper langsamer wird. Ein nasser Mantel, den sie abwerfen will wie Hühner in der Herbstmauser ihre Federn. Ein starres Gewicht. Bleiern.
Als hätte sie jemand mit der flachen Hand vors Brustbein gestoßen, fällt Dot rücklings aufs Küchensofa. Der Hund setzt sich vor sie hin und bettet den Kopf auf ihren Knien, stupst ihre Hand an, bis sie sie ihm zwischen die Ohren legt. Alle Gedanken an Hühner und Kinder, Geburtstage und Betten, alle Gedanken an alles verschwinden und sind still.
Siebzig Jahre Sorgen – das Geld, die Untreue, die kleinen Betrügereien – sind weggeschnitten, und als Dot ihre Hand betrachtet, erkennt sie nicht mehr, wo sie aufhört und der Hund beginnt. Sie sind eins, riesig und frei, auch das Sofa, der Steinboden, die Wände, das Reet auf dem Dach, der Schnee, der Himmel. Alles ist verbunden.
»Jeanie«, ruft sie, hört aber ein anderes Wort. Das bekümmert sie nicht, noch nie hat sie so viel Liebe empfunden, zur Welt, zu allem, was dazugehört. Das Tier stößt etwas hervor, das völlig anders klingt als ein Hundelaut, und es weicht zurück, sodass Dot die Hand von seinem Kopf nehmen muss. Sie rutscht vor, will den Hund erneut berühren, ihn umarmen und in ihm versinken. Doch als Dot sich streckt, kippt sie nach vorn, ihr linker Fuß verdreht sich und rutscht weg. Sie verliert das Gleichgewicht und stürzt mit dem Gesicht zu Boden, die rechte Hand erhoben, um den Aufprall abzufangen, die andere unter der Brust begraben, der Finger mit dem Ehering darunter verkeilt. Dot schlägt mit der Stirn auf den Herd, wo die Steinplatte schon ewig leicht hochsteht, und verschiebt ihn, sodass das daneben hängende Kaminbesteck herunterfällt. Ein letztes klar denkendes Fragment in Dots Verstand fürchtet, das Krachen von Metallschaufel und Feger könnte das Herz ihrer Tochter aus dem regelmäßigen Takt reißen, doch dann erinnert sie sich, dass dies die größte Lüge von allen ist. Das Schüreisen, auch heruntergefallen, rollt weg, unter den Tisch, schaukelt einmal, zweimal, dann liegt es still.
2
Jeanie erwacht, weil Julius sie am Arm rüttelt, erst sanft, dann ruppiger. Sie hastet ihm hinterher, mit flatterndem Nachthemd die Treppe hinab, obwohl er gesagt hat, sie solle nicht rennen. In der Küche herrscht trübes Licht, die Vorhänge sind geschlossen, die Lampe aus, nur das Feuer glüht orange aus dem Herd. Ihre Mutter liegt mit dem Gesicht auf dem Boden und rührt sich nicht. Jeanie schlägt sich die Hände vor den Mund, um ihren Schrei zu ersticken.
»Hilf mir, sie umzudrehen«, sagt Julius, doch als Jeanie ihre Mutter berührt, weiß sie, dass sie tot ist. Dots Arme bleiben zu beiden Seiten liegen, ihre Fußgelenke kreuzen sich, die Pantoffeln fallen herunter, und obwohl sie ihren Morgenmantel trägt, findet Jeanie, sie sieht aus, als würde sie sonnenbaden, etwas, das ihre Mutter nie getan hätte, im Freien hatte man zu arbeiten. Jeanie meidet den Anblick der Wunde an Dots Stirn, und um nichts davon mehr sehen zu müssen, hält sie sich die Hände vors Gesicht. Durch ihre Fingerritzen hindurch sieht sie in rosigen Streifen die Küche und Einzelteile des Körpers ihrer Mutter. Als sie und Julius zwölf waren, oben auf dem Acker von Priest’s Field, hatte sie auch nicht wegsehen können. Der Hund, zuvor unter dem Küchentisch zusammengekauert, kriecht jetzt winselnd darunter hervor, und Jeanie nimmt die Hände vom Gesicht.
»Maude!« Sie schnippt, und auf ihren Fingerzeig hin trollt sich der Hund zurück unter den Tisch.
»Ihr Hals, drück gegen ihren Hals, fühl ihren Puls«, sagt Julius. Er ist neben Dot in die Hocke gegangen, nur in Pyjamahose – seit Jahren hat Jeanie ihn nicht mehr ohne seine Arbeitskleidung gesehen –, graue Haare auf der Brust; von harter Arbeit geformte Muskeln an Armen und Oberkörper.
Aus Gewohnheit und völlig unbewusst drückt Jeanie die Finger an ihren Hals, dann berührt sie ihre Mutter flüchtig an der Wange. »Sie ist kalt. Es ist zu spät.«
»Ich wollte einen Krankenwagen rufen, aber mein Akku ist leer«, sagt Julius.
»Brauchen wir nicht. Es ist zu spät.«
»War wohl Stromausfall. In der Nacht ist alles ausgegangen. Ich kontrollier mal den Sicherungskasten.«
»Sie ist nicht mehr, Julius.«
»Was ist mit dieser Brustmassage?«
»Sie ist tot.«
»Herrje.«
Julius hat eine ernste Miene aufgesetzt, doch die Situation ist so absurd, dass Jeanie am liebsten lachen würde. Wie ein Rülpser steigt ein ungläubiges Glucksen in ihr auf, und wieder schlägt sie sich die Hände vor den Mund, um es zurückzuhalten. Julius legt die großen Hände auf den Kopf, sein schütteres Haar, dann verkrampft er sich auf einmal, alles zuckt; sein Schluchzen klingt wie der Ruf eines exotischen Tiers. Jeanie beobachtet ihn fasziniert. Sie sind mit fast einem ganzen Tag Abstand auf die Welt gekommen, er zuerst, dann Jeanie – unerwartet und unvorbereitet –, von ihrem panischen Vater entbunden, nachdem die Hebamme bereits heimgegangen war. »Mein Stummelchen«, hatte Frank seine Tochter liebevoll genannt. Jeanie denkt oft, dass diese dreiundzwanzig Stunden für ihre Unterschiedlichkeit verantwortlich sind: Die Art, wie Julius die Welt annimmt, wie sie ist, seine Gefühle zeigt, aufgeschlossen für Menschen und Situationen, während sie, Jeanie, sich nach Sicherheit, Heim und Stille sehnt.
Umständlich streckt sie sich über den Leichnam ihrer Mutter, zieht Julius auf die Beine, bugsiert ihn aufs Sofa und setzt sich daneben. Maude blickt auf, als würde sie auf eine Einladung warten, aber weil Jeanie rasch den Kopf schüttelt, legt der Hund die Schnauze wieder auf die Pfoten.
»Ich muss ihren Sturz gehört haben«, sagt Julius, als sein Schluchzen verebbt ist. Er wischt sich mit dem Handrücken über die Nase, reibt sich die Augen. »Oder zumindest das Schüreisen und die Schaufel. Ich hab gedacht, Maude verzapft irgendeinen Mist, und bin wieder eingeschlafen.«
»Es ist nicht deine Schuld«, sagt Jeanie, obwohl sie noch nicht weiß, ob sie das tatsächlich auch so empfindet. Ihr Bruder, wie zuvor auch ihr Vater, hat schon so oft versprochen, die Steinplatte neu zu verlegen. Wenn die eigene Mutter tot auf dem Küchenboden liegt, hat dann jemand Schuld? Sie nimmt ihn in den Arm, und so verharren sie eine Weile, bis Jeanie über seine Schulter blickt, durch den Spalt zwischen den Vorhängen. »Es schneit«, sagt sie.
Sie legen Dot eine Decke über. Jeanie will sie aufs Sofa heben, doch es ist zu kurz. Sie setzt Wasser auf und kocht Tee, den sie am Tisch trinken, die Leiche ihrer Mutter auf dem Boden hinter ihnen, wie wenn ein Kind sich besonders schlecht versteckt hat, aber die Erwachsenen trotzdem so tun, als könnten sie es nicht sehen.
»Sie war ein feiner Mensch«, sagt Julius. »Eine gute Mutter.«
Jeanie nickt, murmelt etwas in ihren Tee.
»Sind die Tischböcke noch in der alten Milchkammer?«, fragt sie, sicher, dass Julius wie immer ihrem Gedankengang folgen wird.
Im Wohnzimmer rollt sie den Läufer auf und schiebt die Sessel an die Wand. Als würde sie hier alles zum Tanzen freiräumen, in diesem Zimmer, wo nie getanzt wurde. Julius legt eine alte Tür auf die beiden Böcke und kehrt zurück in die Küche, um ihre tote Mutter unter Ächzen und Stöhnen rüberzutragen und darauf abzulegen. Jeanie darf ihm nicht helfen. Es gibt eine lange Liste von Dingen, die Jeanie wegen ihres schwachen Herzens zu ihrem Bedauern nie hochheben durfte: Kisten, Heuballen, Babys, Traktoren. Er kommt mit Dot ins Wohnzimmer. Hier ist es kühl, viel kälter als in der Küche. Ein Häkeldeckchen liegt über der Rückenlehne eines Polstersessels, ein Toby-Jug und ein gerahmtes Hochzeitsfoto von Dot und Frank vor einer nie von ihnen besuchten italienischen Landschaft stehen auf einer niedrigen, polierten Truhe, ein Wandteppich verbirgt den in dieser Haushälfte nie benutzten Kamin.
Als Frischvermählte wohnten Dot und Frank ein Jahr lang in der linken Cottagehälfte mit einem Schlafzimmer, doch gleich nach der Geburt der Zwillinge mietete Frank die spiegelverkehrte, rechte Cottagehälfte dazu. Er riss die Wand dazwischen ein und mauerte eine der beiden Haustüren zu, sodass das Doppelcottage nun vom Tor aus betrachtet irgendwie windschief wirkt, innen gibt es noch zwei Treppen, jede führt zu einem kleinen Flur mit je einem Schlafzimmer.
Nachdem Julius Dot auf die alte Tür gelegt hat, tauscht Jeanie die Decke gegen ein sauberes Laken.
Bruder und Schwester sitzen mittlerweile angezogen am Küchentisch, die Teekanne wurde wieder aufgefüllt. Julius hat den Sicherungskasten in der Waschküche überprüft, es gab keinen Kurzschluss, aber der Strom blieb weg, egal, wie lange er an den Kabeln herumgefummelt hat.
»Wir müssen wohl einen Arzt informieren. Macht man das nicht so, wenn jemand gestorben ist?«, fragt Julius, als würde er mit sich selbst sprechen. Nach dem Tod ihres Vaters folgte alles einem bestimmten Ablauf, von dem Jeanie und Julius nichts wussten und den sie jetzt nur erraten können.
»Ärzte sind für Kranke«, sagt Jeanie.
»Aber wir brauchen einen Totenschein.«
Wozu?, denkt Jeanie, sagt aber nichts.
»Damit wir sie beerdigen können«, sagt Julius, als würde er antworten. »Ich hole einen Arzt, er gibt uns den Schein und damit hat es sich.«
Jeanie schüttelt den Kopf. Dot hätte keinen Arzt gewollt, keine Scheine, Formulare, Behörden. Sie waren seit Jahren nicht mehr beim Arzt.
Aber Julius ist aufgestanden und schlüpft bereits in seine Arbeitsstiefel. »Ich muss ins Dorf laufen«, sagt er. Im Dorf, Inkbourne, gibt es eine Arztpraxis, ein Rathaus mit öffentlichen Toiletten, ein Fish-and-Chips und einen kleinen Supermarkt mit Postschalter. Außerdem einen alten Gemüseladen, von einem jungen Londoner mit gewachstem Schnurrbart in ein Feinkostgeschäft umgewandelt, da kann man piekfeines Brot, Käse und Oliven kaufen, aber auch das von Jeanie und Dot gelieferte Gemüse und ihre Eier. Der Besitzer Max serviert an Aluminiumtischen draußen auf dem Gehweg teure Kaffeesorten und edles Gebäck an die vorbeikommenden Wanderer auf dem durchs Dorf verlaufenden Fernwanderweg und die Männer, die mit Lycra-Anzügen auf ihren Rennrädern durchs Dorf fahren, einen Zehn-Pfund-Schein in der kleinen Tasche vorn in den Leggings. »Mit dem Rad kann ich nicht fahren«, sagt Julius, und Jeanie fällt der Schnee wieder ein. »Wenn die Praxis aufhat, sag ich Bridget Bescheid, die will das sicher wissen, sie kann einen der Ärzte informieren. Wenn zu ist, geh ich direkt zu ihr nach Hause.« Er nimmt den Mantel vom Haken an der Rückseite der Tür. Maude steht auf, wedelt mit dem Schwanz.
»Solltest du nicht mit Craig an diesem Badezimmer weiterarbeiten?«, fragt Jeanie.
»Am Todestag meiner Mutter schleppe ich keine Stahlwannen in irgendwelche Luxusbäder.«
»Wie willst du ihm denn Bescheid sagen?«
»Der wird schon merken, wenn ich nicht komme.«
»Hätte er dich nicht heute bezahlen sollen?«
Julius hält inne. »Ich lass dich hier nicht den ganzen Tag allein.«
»Ich muss die Hühner füttern. Es gibt Dinge im Garten zu tun, die nicht warten können.« Sie tritt auf ihn zu. »Du solltest gehen, hol dir deinen Lohn. Wir brauchen das Geld.«
Julius hat die Hand auf dem Türriegel. »Ich schau mal. Wenn ich nicht mit dem Rad fahren kann, komme ich sowieso zu spät.« Die Verärgerung in seiner Stimme bemerkt er wohl selbst, denn er kommt nochmal zurück und schließt sie in die Arme. »Wird schon werden«, sagt er in ihr Haar, »alles wird gut.«
Sie schubst ihn weg. »Weiß ich doch. Ab mit dir.«
An der Haustür sieht sie ihm nach, Maude steht neben ihr, zuerst erwartungsvoll, dann enttäuscht, weil sie nicht mitdarf. Jeanie atmet die eisige Luft tief ein. Der Aprilschlamm ist verhüllt, der Schnee zeigt nur die Kuppen und Mulden der Pflanzen, wie das Laken über der Leiche im Zimmer hinter ihr. Vielleicht hat der Schreck über den späten Schnee Dot zu Fall gebracht. Der Anblick hätte ihr Sorgen bereitet, wegen der Gemüse-Setzlinge draußen in der Kälte, dem Geld, das sie darüber verlieren würden. Später wäre Jeanie aus dem Garten hereingekommen und hätte ihre Mutter mit einem Zettel am Küchentisch vorgefunden, auf dem Bleistiftende kauend, während sie eine Zahlenkolonne nach der anderen durchrechnet.
Fast einen Kilometer lang windet sich der Weg durch ein kleines Waldstück, dann geht’s auf einem von Hecken gesäumten Pfad zwischen zwei Feldern hindurch. An jedem anderen Tag hätte Julius auf der kleinen Lichtung mit Ausblick Rast eingelegt, direkt bevor es den kurvenreichen Anstieg den Steilhang hinaufgeht, Rivar Down zur Rechten, zur Linken der fast fünf Kilometer lange Kammweg über den Kalksteinfelsen bis nach Combe Gibbet. Die Baumgruppen an den Hängen – Buchen, Eichen, Nadelbäume – tragen eine dicke weiße Schneedecke, die Wolken hängen tief über dem abgegrasten Gemeindeland. Aber heute bleibt Julius’ Blick gesenkt, er bemerkt nicht die Spuren der kleinen Säugetiere und Vögel, die vor ihm durch den Schnee getrippelt sind. Er dreht sich eine Zigarette und raucht sie, während er in die ihm seit gut fünfzig Jahren von Wanderungen und Radfahrten vertrauten Furchen tritt, auch wenn die heute verborgen sind. Auf dem letzten, schnurgeraden Wegstück geht er an dem verbeulten Schild mit der Aufschrift »Privat, kein Durchgang« vorbei auf den Hof mit der großen Scheune aus schwarz patinierten Brettern und den versprengten, an den Seiten offenen und mit Brennnesseln umwucherten Betonschuppen, in denen allerlei vergessene Gerätschaften lagern. Als er um die Ecke kommt, steht da das Haus der Rawsons, aus Ziegel und Feuerstein gebaut, davor ihr penibel gepflegter Garten, die Formschnitthecken wie riesige Schneemänner. Er könnte die sechseinhalb Kilometer bis zum Dorf weitergehen oder bei den Rawsons klopfen, um sie zu bitten, ihr Telefon oder Handy zu benutzen. Pepperwood Farm befindet sich schon seit drei Generationen im Besitz der Familie Rawson, der gegenwärtige Mr Rawson war zwanzig, als das Gut nach dem Herzinfarkt seines Vaters auf ihn überging. Teil des rund fünfzig Hektar umfassenden Anwesens ist auch das Ackerland am Fuß des Steilhügels, es reicht bis zum Ufer des schlammigen Flüsschens Ink, dem das Dorf seinen Namen verdankt. Dazu gehören der Buchenwald zu beiden Seiten des Wegs, das Weideland hinter dem Garten und offiziell auch das Cottage mit dem umliegenden Grundstück. Wenn zusätzliche Arbeitskräfte gebraucht werden, hilft Julius manchmal auf der Farm aus, aber diese Jobs vergibt ausschließlich der Gutsverwalter. Rawson selbst, in seinem Gutsherrenaufzug samt Tweedjacke, Wams und Cordhose, geht Julius tunlichst aus dem Weg. Aber an einem Morgen, an dem die eigene Mutter gestorben ist, sind sechseinhalb zusätzliche Kilometer einfach zu viel. Er tritt an die Tür des Farmhauses.
3
Der Türklopfer mit Löwenkopf lässt Julius zögern. Nie zuvor hat er hier auf der Treppe vor der Tür des Farmhauses gestanden. Als Kind kam er oft mit Jeanie und seinem Vater hierher, spielte in und zwischen den wild verstreuten Scheunen und Schuppen, die sich überwiegend im hinteren Teil des Anwesens verbergen. Sie vertrieben sich die Zeit damit, über die Weiden zu stromern, Brombeeren zu pflücken und nachts Dachse zu beobachten, als würde das Land den Seeders gehören und nicht den Rawsons. Das Haus hat Julius damals nur auf Einladung der Haushälterin betreten, immer nur durch die Hintertür und auch nur bis zur Anrichte, wo er und seine Schwester ein Glas Limonade bekamen.
Er hebt den Türklopfer vorsichtig an und lässt ihn fallen. Es hat aufgehört zu schneien, schon jetzt platschen in regelmäßigen Abständen Tropfen von Bäumen und Büschen. Jemand ist die Auffahrt hochgefahren, der Boden ist aufgewühlt und matschig, aber dort, wo der Schnee noch rein ist, zeichnen sich nun in der frühen Morgensonne scharfe, blaue Schatten ab.
Weil aus dem Haus keinerlei Geräusche dringen, will Julius sich schon abwenden, doch dann wird der Riegel aufgeschoben. Rawson selbst steht an der Tür, in Hose und weißem Hemd, aber barfuß. Da erst geht Julius auf, dass er die Haushälterin aus seiner Kindheit erwartet hatte, eine plumpe, liebevolle, beschürzte Frau, die sicher längst tot ist. Wie seine Mutter, denkt er. Tot. Rawson ist groß, er überragt Julius um einen ganzen Kopf und ist ungefähr so alt wie seine Mutter, mit schlohweißem Haar, schwarzen Brauen und einem weißen Schnurrbart, der sich um seine Mundwinkel ergießt. An diesem Morgen hat er auch noch weiße Bartstoppel auf Kinn und Wangen. Wie ein Iltis sieht er damit aus, so einer ist Julius’ Saufkumpan Jenks mal in die Falle getappt, der hat ihn dann in den Pub mitgebracht. Ein aalglattes, schlankes Tier, so ein Iltis.
Rawson weicht überrascht zurück. »Julius«, sagt er, was wiederum Julius überrascht, weil Rawson seinen Namen nicht vergessen hat. »Ist was passiert?«
»Ich müsste mal Ihr Telefon benutzen.« Julius’ Handy, das er sich aus Gewohnheit in die Manteltasche geschoben hat, ist kein Smartphone, wie es neuerdings jeder zu haben scheint, und er hat vergessen, sein Aufladekabel mitzunehmen.
»Natürlich, nur hereinspaziert«, sagt Rawson gestelzt und tritt einen Schritt zurück. Im geräumigen Flur gibt es einen Kamin, Steinboden und Holzvertäfelung. Eine wuchtige Holztreppe windet hinauf zum oberen Stockwerk. Arts and Crafts, nannte Dot das immer, aber Julius hat keine Ahnung, was sie damit meinte, und es interessiert ihn auch nicht.
»Haben Sie auch keinen Strom?« Julius putzt sich auf der Matte die Schuhe ab.
»Doch. Ist er bei euch ausgefallen? Hast du die Sicherungen überprüft?«
Als Rawson sich abwendet, zieht Julius eine Grimasse. »Hmmm, wo hat sie das Mobilteil gelassen? Caroline benutzt es ständig und legt es nie zurück auf die Station.« Rawson verschwindet über den Gang in ein anderes Zimmer mit Blick auf den Vorgarten, mit einem gemauerten Kamin und zwei einander gegenüberstehenden weißen Sofas, über allem thront ein Flügel. Die gute Stube, die niemand benutzt: keine Hunde auf den Polstern, keine Füße auf den Sesseln, keine nassen Löffel im Zucker. »Soll ich die Nummer vom Stromversorger raussuchen? Bei wem seid ihr?«
»Ich brauch die Nummer von der Arztpraxis im Dorf«, sagt Julius beim Betreten des Zimmers. Ihn überkommt der Impuls, die Mütze abzusetzen, obwohl er in der Eile gar keine aufgesetzt hat. Was für ein Scheiß, denkt er.
Rawson sieht ihn kurz an, dann schnell weg. Ist sich wohl zu fein zu fragen, wozu er die Nummer braucht, vermutet Julius. Der Mann läuft kopflos im Zimmer herum, findet das Mobilteil auf einem Sessel, drückt einen Knopf, dann einen anderen, um sicherzustellen, dass das Freizeichen erklingt. »Wer hätte erwartet, dass es Ende April noch schneit?«, sagt er, um irgendwas von sich zu geben. Eine Antwort erwartet er offenbar nicht. Er gibt Julius das Telefon. »Alles in Ordnung mit dem Cottage?« Rawson sucht in seinem Handy nach der Nummer für den Dorfarzt, er läuft durchs Zimmer zurück in den Flur. Julius folgt ihm.
»Meine Mutter ist tot«, sagt Julius unverblümt, nur um zu sehen, ob er Rawson aus seinem Gemurmel reißen kann, aber er erschreckt sich dabei selbst. Sie ist wirklich tot. Die beiden Männer sehen einander an, Julius’ Ausdruck spiegelt sich in Rawsons Gesicht.
Rawson stützt sich am Holzsims über dem Kamin ab. »Was?«
Von oben ertönt eine Frauenstimme. »Wer war das?«
»Julius«, ruft Rawson, den Blick immer noch auf ihn gerichtet.
»Was will er?«
Rawson sieht Julius unverwandt an, Julius hält seinen Blick und wartet, was er wohl antworten wird. Rawson schaut zum gewundenen Holzgeländer hinauf, dann wieder zu ihm. »Nichts«, ruft er. »Erzähl ich dir später.«
Nichts, denkt Julius. Das sind die Seeders für die Rawsons.
Die Frau – Rawsons Frau, nimmt er an – antwortet nicht, kommt auch nicht runter, doch in diesem Augenblick scheint Rawson sich zu besinnen. »Das tut mir furchtbar leid. Was ist passiert?«
»Sie ist gestürzt, mit dem Kopf aufgeschlagen. Heute morgen, ganz früh. Ich muss den Arzt anrufen.«
»Natürlich. Selbstverständlich.« Rawson fummelt wieder an seinem Smartphone herum. »Meine Frau fragt immer Alexa, wenn sie eine Nummer braucht, aber ich komm mit dem Ding nicht klar.«
Julius fragt sich, ob der Mann langsam senil wird; er hat keine Ahnung, wer Alexa sein soll. Schließlich liest Rawson ihm die Nummer vor, und während Julius darauf wartet, dass am anderen Ende der Leitung jemand abhebt, geht Rawson zurück ins Wohnzimmer, doch Julius spürt seine Anwesenheit auf der anderen Seite der Tür, vermutlich lauscht er.
Eine Sprechstundenhilfe antwortet – nicht Bridget –, macht verständnisvolle Geräusche und schreibt sich was auf. Als sie sagt, sie müsse im Computer nach Dot suchen, fürchtet Julius, dass sie keine Patientenakte mehr von ihr haben könnten, aber dann findet die Frau den Namen doch und versichert ihm, Dr. Holloway werde am Vormittag vorbeikommen, sobald er frei sei. Kaum hat Julius das Gespräch beendet, kehrt Rawson in den Flur zurück. Seine Augen glänzen.
»Dürfte ich noch einen Anruf machen?«, fragt Julius.
»Klar. Kann ich dir eine Tasse Tee anb–«
»Nein.«
»Verstehe. Natürlich. Es gibt sicher eine Menge zu organisieren.«
»Danke«, sagt Julius, obwohl er es nicht so meint. Dieser Mann war seiner Mutter was schuldig. Und jetzt ist er ihm und Jeanie was schuldig. »Ich bräuchte noch eine Telefonnummer. Ein Sanitärinstallateur. Für den sollte ich heute arbeiten.«
Er wählt Craigs Nummer, während Rawson die Blumenvase auf dem Tisch einen Zentimeter nach links schiebt und so tut, als würde er auch dieses Telefonat nicht belauschen.
An der Haustür sagt Rawson: »Warte kurz. Ich hab Post für dich.« Der Briefträger kommt nicht mehr zum Cottage, nachdem er einmal mit seinem Transporter auf dem Feldweg stecken geblieben ist und von einem Traktor rausgezogen werden musste. Julius weiß nicht genau, wie oder wann seine Mutter die Post geholt hat. Ohne einen Blick auf die Briefe zu werfen, faltet er sie zusammen und stopft sie in seine Manteltasche.
»Hast du dir schon Gedanken gemacht über die …«, setzt Rawson an, zögert und startet einen neuen Versuch. »Wollt ihr was machen, wegen Dot, eine Totenfeier? Ich würde ihr gern die letzte Ehre erweisen.«
»Nein«, sagt Julius. »Haben wir noch nicht.« Auf der Auffahrt wendet er sich noch einmal um. Spencer Rawson steht barfuß im Schnee und sieht ihm nach.
4
Zwei Stunden später, Julius ist noch nicht zurück, trifft der Doktor am Cottage ein. Mit seinem dicken Bauch, breiten Schultern und Stiernacken füllt er die Küche aus und blockiert das Licht. Als Erstes, gleich nachdem er sich als Dr. Holloway vorgestellt hat, weist er Jeanie darauf hin, dass er nicht viel Zeit habe. Er fragt, wo Dot aufgefunden wurde, warum der Strom weg und wo der Leichnam jetzt sei. »Sie hätten sie eigentlich nicht bewegen dürfen«, sagt er, als Jeanie ihn ins Wohnzimmer zum verhüllten Körper führt. Sie bleibt nicht dort, um die Untersuchung zu verfolgen. Als er bei seiner Rückkehr in die Küche die angebotene Tasse Tee ablehnt, ist sie erleichtert.
Der Doktor reibt sich die Hände, offenbar ist ihm kalt. Im Gegenlicht vor dem Fenster verschwimmen seine Gesichtszüge, Jeanie kann kaum erkennen, wie sich seine Lippen bewegen, als er erklärt, Dot sei sicher an einem Schlaganfall gestorben, es gebe da einen Amtsweg, er müsse also zunächst den Coroner anrufen, bevor er Jeanie einen bestimmten Schein ausstellen könne, den sie für das grüne Antragsformular brauche. Sie hat keine Ahnung, was er da faselt; beim Wort »Formular« fliegen ihre Hände ans Herz, unbewusst drückt sie gegen das Brustbein und merkt dabei, dass sie sich nicht mehr konzentrieren kann auf Dr. Holloways Ausführungen über Dots Krankheit, Warnzeichen und Medikamente.
An der Tür sagt er: »Den Totenschein können Sie dann in der Praxis abholen«, lässt eine fleischige Pranke auf ihre Schulter niedergehen und fügt hinzu, Dot sei eine gute Frau gewesen, es tue ihm leid, dass sie heimgegangen sei. Heimgegangen. Wie er, in seinem Jeep, mit aufheulendem Motor. Jeanie, die allein zurückbleibt, fragt sich, ob er überhaupt weiß, wie ihre Mutter war, und auch, wieso er ihr den Totenschein nicht gleich an Ort und Stelle gegeben hat, wo sie diesen Schein doch offenbar braucht.
Nach einer Stunde, in der Jeanie ohne Sinn und Verstand durchs Haus gegeistert, Julius aber immer noch nicht zurückgekehrt ist, kommt sie zu dem Schluss, dass er wohl doch irgendwie zu seiner Arbeit mit Craig gekommen sein muss. Sie schaltet das Kofferradio ein und hört einer Frau zu, die von ihrer Wanderung auf dem Appalachian Trail durch Amerika plaudert, doch selbst runtergeregelt ist ihre Stimme zu irritierend, deswegen schaltet Jeanie wieder ab. Unversehens findet sie sich vor dem Waschküchenfenster wieder, wo sie auf die pikiert durch den Schnee staksenden Hühner starrt, ohne zu wissen, wann und wie sie hier gelandet ist. Schließlich geht ihr auf, dass sie den Totenschein braucht und diesen aus unerklärlichen Gründen in der Arztpraxis abholen muss. Sie schnalzt nach Maude, und kurze Zeit später marschieren die beiden durch den Schnee in Richtung Dorf.
Die Arztpraxis befindet sich in einem verschachtelten, kastigen Zweckbau mitten auf dem Parkplatz am Rand von Inkbourne. Jeanie weiß, dass dort drei Ärzte arbeiten, Dr. Holloway eingeschlossen, aber sie keinen von ihnen je aufgesucht hat. Das letzte Mal ist sie mit dreizehn beim Arzt gewesen, eine letzte Routinekontrolle nach dem Verschwinden des rheumatischen Fiebers, unter dem sie zuvor immer wieder gelitten hatte. Damals befand sich die Praxis in einem dieser viktorianischen Häuser mit Doppelfassade und Blick auf den Dorfanger. Das war ungefähr ein Jahr nach dem Tod ihres Vaters, als ihre Mutter noch trauerte und vergaß, Essen zu kochen, Lebensmittel einzukaufen und am Abend die Hühner zusammenzuscharen. Sechs Vögel verloren sie in jenem Jahr an die Füchse. Ihre Mutter brachte Jeanie zu einem Arzt, an dessen Name sie sich nicht mehr erinnert. Das Sprechzimmer war kalt, die Fenster vom Frost zart gemustert. Sie solle sich auf die Liege in der Ecke legen und ihr Hemd anheben. Hinter ihm nickte ihre Mutter ermutigend, und obwohl Jeanie schüchtern war, legte sie sich brav hin, entblößte ihren schmalen Brustkorb mit den schmerzhaft geschwollenen Rötungen unter den Brustwarzen. Sie erinnert sich an die grauen Haare, die dem Doktor aus der Nase sprossen, und das eisige Gefühl, als er ihr das Stethoskop auf die Haut drückte. Nachdem er das Ding aus den Ohren gezogen hatte, schüttelte er den Kopf, und ihre Mutter weinte so heftig drauflos, dass Jeanie fürchtete, sie würde nie wieder aufhören. Dot zog ein Taschentuch aus der Handtasche und bedeckte damit ihr Gesicht, sie schaukelte vor und zurück, dort auf ihrem Stuhl neben dem Schreibtisch des Doktors. Er rief die Sprechstundenhilfe herein, Jeanie wurde an der Hand zurück ins Wartezimmer geführt. Dort, die Füße auf dem Stuhl, die Knie umschlungen, blieb sie, bis ihre Mutter sie abholte. Ist das damals gewesen, als Dot ihr zu Hause erklärte, ihr Herz sei durch das von ihr als kleines Mädchen erlittene Fieber und die Schmerzen geschwächt und ganz zerbrechlich geworden – oder ist das später gekommen? Egal, jedenfalls sagte ihre Mutter: »Stell dir dein Herz wie ein Ei vor. Du weißt, was passiert, wenn du ein Ei fallenlässt?« Jeanie hatte schreckliche Angst, ihre Mutter könnte wieder in Tränen ausbrechen, weil sie nicht wusste, was sie dann tun sollte. Vielleicht hatte der Arzt ihrer Mutter eine Tablette gegeben, um das Weinen zu stoppen, während Jeanie im Wartezimmer saß. Als ihre Mutter das mit dem Ei sagte, stellte Jeanie sich vor, in ihrem Brustkorb steckte etwas von der Größe und Form eines Enteneis, aber rosa, und mit einer so dünnen Schale, dass man das Wesen darin sehen konnte: zusammengerollt, blutig und federlos hackte und kratzte es an der Innenhaut der Schale herum. Was für ein Chaos würde es anrichten, wenn es daraus hervorbrach?
Würde man allein ihre Fehlstunden wegen rheumatischen Fiebers zusammenzählen, käme man wohl schon auf ein paar Jahre, und nach der anschließend diagnostizierten Herzschwäche versäumte sie weitere Unterrichtsstunden, Dot behielt sie nur zu gern bei sich zu Hause, gemütlich auf dem Sofa oder im Garten, wo sie bei leichteren Arbeiten half. Sie hatte es vielleicht nie deutlich ausgesprochen, aber Jeanie verstand die Botschaft: Leute wie sie – arm, vom Land – wurden durch die Schule nur von dort ferngehalten, wo sie eigentlich hingehörten, nämlich nach Hause. Sogar Julius ist mit sechzehn von der Schule abgegangen, nach zwei absolvierten, jedoch nicht bestandenen Prüfungen.
Vor der Arztpraxis holt sie jetzt die Hundeleine aus der Tasche und bindet Maude an einer Metallstange fest. Sie protestiert und jault, weil sie allein zurückbleiben muss, aber Jeanie bedeutet ihr, ruhig zu sein. Vor den Glastüren bleibt sie stehen, denn bei der Vorstellung, da reinzugehen, klopft ihr das Herz vor Aufregung bis zum Hals, die Blicke der Leute, doch dann kommt eine Frau heraus, hält ihr die Tür auf, und Jeanie tritt ein. Im Wartezimmer sind mehrere Stühle mit gepolsterter Sitzfläche aufgereiht, einige sind besetzt. Es riecht nach Desinfektionsmittel und Möbelpolitur. Aus den Lautsprechern dringt sanfte Musik, ein Baby weint.
Bridget, die beste Freundin ihrer Mutter, sitzt neben einer Kollegin hinter einem niedrigen Tresen, und als sie Jeanie erblickt, eilt sie zu ihr, ihr Mondgesicht verzieht sich, ihre Augen füllen sich mit Tränen.
»Ach, meine Liebe«, sagt Bridget, breitet die Arme aus, und Jeanie lässt sich umfangen. Bridget umschließt sie sanft, anders als Dot, schnell und knochig, oder Julius, der sie so fest drückt, dass er ihr die Luft aus der Lunge presst. Bridget riecht nach Zigaretten und Polo-Minzbonbons. Nachdem sie sie wieder freigegeben hat, fragt sie: »War Dr. Holloway schon bei euch im Cottage? Ich wollte direkt herkommen, gleich nach Schichtende.« Als die andere Sprechstundenhilfe Bridget mit einer Handbewegung wegscheucht, formt Bridget mit den Lippen ein lautloses Danke. »Komm, wir gehen ins Untersuchungszimmer.«
Sie gehen hinter der Stuhlreihe entlang, wo ein junger, straßenköterblonder Mann mit dicken Lippen in einer Zeitschrift blättert, die Stiefel auf dem gegenüberliegenden Stuhl abgelegt. Als sie an ihm vorbeikommen, knufft Bridget ihn in die Schulter. »Füße runter!«, sagte sie dicht an seinem Ohr. Jeanie ist schockiert von Bridgets ruppigen Umgangsformen, doch der Mann nimmt tatsächlich einen bestiefelten Fuß nach dem anderen vom Stuhl.
Als Jeanie ihn über ihre Schulter hinweg ansieht, grinst er sie an, breit, frech, und sie geht schnell weiter.
Im Untersuchungszimmer sagt Bridget: »Warum hast du dich nicht direkt bei mir gemeldet? Julius hat angerufen und mit einer von den Frauen hier gesprochen, die die Praxis aufgesperrt hat. Ich konnte es nicht glauben. Kann ich immer noch nicht.« Sie umfasst ihr Gesicht mit beiden Händen und öffnet den Mund, mit ihren zerknautschten Wangen sieht sie aus wie eine Trickfilmfigur. Jeanie fragt sich, von wo Julius angerufen hat, vielleicht hat er Craigs Handy benutzt. »Hatte sie einen Schlaganfall?«, fährt Bridget fort. »Oh, ich hoffe, es ist schnell gegangen.« Sie lässt sich schwer auf einen Drehstuhl fallen. »Hat sie ihre Medikamente genommen?«
Jeanie hat vergessen, wie viel und wie schnell Bridget redet. Weil sie allein vom Zuhören müde wird, schafft sie es nicht, mit munterer Stimme zu antworten. »Ich wusste nicht, dass sie Medikamente nehmen musste«, sagt sie schläfrig.
»Ich wette, sie hat sie gar nicht erst aus der Apotheke geholt, hab ich recht? Immer wieder hab ich ihr gesagt, dass sie nichts bezahlen muss, weil sie schon über sechzig ist. Gewesen ist. O Gott. Es hätte sie nichts gekostet.«
»Mum wollte keine Almosen.« Jeanie setzt sich neben dem Schreibtisch auf den Stuhl, für Patienten, nimmt sie an. An der Wand hinter Bridget hängen Küchenschränke, in der Ecke steht eine Liege, ähnlich wie die, auf der Jeanie damals untersucht wurde. Dieses Zimmer macht sie nervös. »Ich wusste nicht mal, dass sie krank oder beim Arzt gewesen ist.«
»Ach, meine Liebe«, sagt Bridget erneut und beugt sich vor, um Jeanie das Knie zu tätscheln. »So vor einem Monat hatte sie ein paar Mini-Schlaganfälle. Es tut mir so leid. Hat sie euch nichts erzählt? Nein, offensichtlich nicht. Sicher wollte sie dich und Julius nicht beunruhigen, nur deswegen hat sie nichts gesagt. Aber die Tabletten hätte sie sich schon besorgen sollen. Aspirin, mehr war das nicht. Gott, ich brauch ne Kippe. Lass uns hinten rausgehen.«
Während sie schaudernd an der fensterlosen Mauer hinter dem Praxisgebäude stehen, zieht Bridget eine Packung Zigaretten aus der Tasche ihrer Uniform. »Ende April noch Schnee«, sagt sie kopfschüttelnd und zündet sich eine an. In Jeanies Schule hat es Mädchen gegeben, die rauchend am rückwärtigen Tor standen und sich über Jungs unterhielten, aber zu denen hat sie nie gehört.
»Es tut mir leid, dass ich es nicht früher zu euch geschafft habe und du den ganzen Weg herlaufen musstest, um es mir zu sagen«, sagt Bridget. »Meine Kollegin hat es mir schon erzählt.«
»Deswegen bin ich nicht hier«, sagt Jeanie. »Ich will die Sterbeurkunde holen.«
»Ah, okay«, sagt Bridget knapp. Sie lässt das Streichholz vor ihre Füße fallen, wo sich schon ein paar angesammelt haben, darunter auch im schmuddeligen Schnee zerdrückte Zigarettenstummel. »Na, zuerst brauchst du wohl die ärztliche Todesbescheinigung von Dr. Holloway, aber der muss vermutlich beim Coroner anrufen. Hat er das erwähnt? Er war doch schon bei euch, oder? Mit der Bescheinigung musst du aufs Standesamt in Devizes.«
»Devizes?«
»Um die Sterbeurkunde zu bekommen und die Bestattungserlaubnis, das grüne Formular.«
Jeanie stützt sich mit der Hand an der Mauer ab. »Kann der Doktor mir die nicht geben?«
Bridget starrt sie an, zieht an der Kippe. »Einen Todesfall musst du offiziell melden, Jeanie. Auf dem Standesamt.« Sie redet, als wäre Jeanie ein Kind. »So läuft das. Diese Unterlagen brauchst du für den Pfarrer oder das Krematorium, und die Sterbeurkunde brauchst du wahrscheinlich auch noch für andere Dinge.«
»Andere Dinge? Welche denn?« In Jeanies Kopf wird es immer voller.
»Wie Dots Bankkonto …«
»Oh, so was hatte sie nie. Keiner von uns. Unser ganzes Geld ist in einer Dose in der Waschküche.« Jeanie lacht, ein irres Kichern, das hätte sie nicht verraten dürfen, wie kann es sein, dass sie und ihre Mutter erst gestern noch im Garten das Zwiebelbeet gejätet haben? Die Wand erscheint ihr auf einmal weich, wenn sie nur ein bisschen Druck ausübt, könnte sie darin versinken, verschwinden.
»Ich kann dich nach Devizes fahren.«
»Ich nehm den Bus.«
»Sei nicht albern.«
»Ich bin nicht albern. Mit dem Bus fahren krieg ich schon hin.«
»Hör zu.« Bridget schrubbt mit dem Zigarettenstummel an der Mauer lang, sodass die fallenden Glutpartikel winzige Löcher in den Schnee stechen. »In den nächsten Tagen wirst du eine Menge zu bewältigen haben. Ich weiß das, schließlich habe ich letztes Jahr meinen Vater beerdigt, erinnerst du dich?« Tatsächlich hat Jeanie das vergessen, das tut ihr jetzt leid. »Du musst dich nicht nur um die Bescheinigungen kümmern, sondern auch um die Beerdigung und die Totenfeier.«
»Totenfeier? Will ich keine.« Die Vorstellung, dass Menschen in ihrer Küche herumstehen, ihr Gebrabbel, die Blicke, mit denen sie sie und Julius anglotzen würden: voller Mitleid mit diesen Sonderlingen, die mit einundfünfzig Jahren immer noch bei ihrer Mutter wohnten.
»Aber sicher wollt ihr eine Totenfeier.«
»Mum hat nicht viele Leute gekannt. Mir fällt keiner ein, der kommen würde.«
»Na, ich und Stu schon mal.« Bridget klingt pikiert.
»Abgesehen von dir und Stu.«
»Außerdem kannte deine Mum eine Menge Leute. Was ist mit Kate Gill vom B&B, und Max? Dr. Holloway will bestimmt kommen. Die Rawsons – oder vielleicht nur er.«
»Rawson? Warum würde der kommen wollen? Die kommen mir nicht ins Haus, keiner von beiden. Es geht nicht darum, die Bude vollzukriegen, oder? Ist doch keine Party.«
»Julius will vielleicht Shelley Swift einladen.«
»Shelley Swift?« Jeanie kramt in ihrem Hirn.
»Sind die nicht befreundet? Ich bin sicher, ich habe sie zusammen gesehen«, sagt Bridget und zieht dabei die Brauen hoch.
Jetzt sieht Jeanie die Frau vor sich: hübsch, mit weichen Wangen, rund und rosig wie Aprikosen, plumpe Arme und Beine, eine Sekretärin bei der Ziegelei. »Herrje, er macht einen Job für sie. Irgendwas mit einem klemmenden Fenster. Er kennt sie doch kaum.«
Bridget ploppt sich ein Polo in den Mund und schiebt es mit der Zunge herum. »Wie du meinst. Wie wäre es, wenn ich dich am Mittwochnachmittag zum Standesamt fahre? Ich schau mal, ob Dr. Holloway die ärztliche Bescheinigung schon fertig hat, dann können wir dort anrufen und einen Termin ausmachen.«
»Du musst mir nichts abnehmen«, sagt Jeanie bockig. Es hat ihr noch nie gefallen, wie Bridget die Leute herumkommandiert und tratscht. Bridget und Dot haben Freundschaft geschlossen, als Jeanie und Julius in die Schule kamen, damals hat Bridget dort als Sekretärin gearbeitet. Nun sitzt sie schon seit Jahren in der Praxis am Empfang, wahrscheinlich auch, damit sie genauestens über die verschiedenen Krankheiten der Dorfbevölkerung Bescheid weiß.
Bridget schnaubt genervt. »Du bist genauso stur wie deine Mutter. Ich will doch nur helfen. Füll ein paar Formulare aus, und die Sache ist erledigt. Ganz einfach.«
Ganz einfach ist hier bestimmt nichts, da ist sich Jeanie sicher.
5
Am Nachmittag starrt Jeanie wieder aus dem Waschküchenfenster, sieht aber nichts; das Radio läuft, doch sie hört nichts. Ihre Gedanken wandern ziellos umher. Sie erinnert sich, wie sie mit ihrem Vater oben auf dem Ham Hill im Gras gesessen und am abendlichen Herbsthimmel die Stare kreisen gesehen hat, dicht an dicht, wie eine schwarze Wolke. Formationsflug, nannte er das. »Das Wort schreibe ich dir zu Hause auf«, sagte er, »dann kannst du es dir abschreiben.« Doch nach ihrer Heimkehr musste er die Zeitung lesen, es gab Dinge zu erledigen, und sie erinnerte ihn nicht mehr daran. Sie denkt an die Vogelscheuchen, von ihr und Julius aus alten CDs gebastelt, die sie neben einer Mülltonne im Dorf gefunden hatten. Er las die Titel vor und sie lachten darüber, dass Burt Bacharachs Größte Hits die Krähen aus dem Salatbeet verscheuchten. Und sie erinnert sich, wie ihre Mutter aus einem Albtraum hochschreckte, in dem Bett, das sie sich nach dem Tod von Jeanies Vater mit ihrer Tochter teilte. Im Traum, so erzählte es Dot, habe sie im Feinkostladen Tomaten und Pflücksalat abliefern wollen, aber er sei leer gewesen, und irgendwie habe sie gewusst, dass auch im Pub und in den Häusern keiner war. Und dann, sagte Dot, sei sie wieder zu Hause gewesen, plötzlich, wie es im Traum eben ging, und auch Jeanie und Julius seien weg gewesen, und da habe sie verstanden, dass sie ganz allein sei.
Das Klopfen an der Haustür bemerkt Jeanie nur, weil Maude in der Küche bellt.
»Sitz«, sagt sie, und Maude gehorcht widerwillig. Vielleicht ist der Doktor aus irgendeinem Grund zurückgekommen, oder es ist Bridget – obwohl die immer, ohne zu klopfen, durch die Hintertür reinkommt. Als Jeanie die Tür öffnet, steht da Mrs Rawson, ihr Mann kommt hinter ihr den Weg hoch. Maude trottet herbei, bellt ein paarmal mit gebleckten Zähnen und schiebt Rawson dann die Schnauze zwischen die Beine, bis Jeanie etwas verspätet einen Pfiff ausstößt, woraufhin sich der Hund ins Haus verzieht und vor den Ofen legt.
»Das mit Ihrer Mutter tut uns so leid«, sagt Mrs Rawson. Sie beugt sich vor, als wollte sie Jeanie küssen oder in die Arme schließen, weicht jedoch im letzten Moment wieder zurück.
»Jeanie«, sagt Rawson ein bisschen unbeholfen, die weißen Zähne blitzen unter dem weißen Schnurrbart hervor. Er hat die Haltung eines Mannes, der sich seiner Attraktivität – für sein Alter – bewusst ist, aufrecht und lässig steht er da, größer als der Türrahmen.
Jeanie fühlt sich verpflichtet, die Tür weiter zu öffnen und die beiden hereinzubitten. Sie schaltet das Radio ab. Mrs Rawson ist ein paar Jahre jünger als ihr Mann, alles an ihr stinkt nach Geld, von der engen wadenlangen Hose und der taillierten Jacke bis zur Sonnenbrille auf ihrem absichtlich grau gefärbten, elegant geschnittenen Haar. Jeanie hat ihr natürlich ergrautes Haar mit einem Gummiband am Hinterkopf zusammengefasst, alle paar Monate holt sie es sich über die Schulter nach vorn, um mit der Küchenschere die Spitzen zu schneiden.
Sie beobachtet, wie Rawson sich neugierig in der Küche umsieht, den Ofen und das Feuer anschaut, das Wandklavier mit der Gitarre daneben, die schattigen Winkel und den blankgeschrubbten Tisch in der Mitte, die ordentliche, mit blumig gemusterten Bechern behängte Anrichte. Sie betrachtet alles mit seinen Augen, unverändert seit seinem letzten Besuch vor vielleicht vierzig Jahren. Sein Blick bleibt an Jeanie hängen. »Julius ist vorhin vorbeigekommen, um unser Telefon zu benutzen, da hat er uns erzählt, was passiert ist. Ich kann es einfach nicht glauben.« Er hat den Kopf gebeugt, vielleicht aus Mitgefühl oder Trauer, doch dann geht Jeanie auf, dass es nur an der niedrigen Decke liegt.
»Wir können es nicht glauben«, stimmt seine Frau ein.
Dass Julius sich entschieden hat, zu den Rawsons zu gehen, findet Jeanie überraschend, aber sie sagt nichts.
»Wir wollten ihr die letzte Ehre erweisen«, fährt Mrs Rawson fort. Sie schiebt die Fingerspitzen in die engen Taschen vorn in ihrer Hose und zieht die Schultern hoch. Ihre Stimme klingt sanft, bekümmert. »Das war sicher ein Schock. So plötzlich. Ein Sturz, hat Julius meinem Mann erzählt.«
»Ein Schlaganfall«, sagt Jeanie, wie sie dieses Wort hasst, so grob und herabwürdigend.
Rawson, auf dem Weg zum Klavier, bleibt stehen und fragt: »Ein Schlaganfall? Kein Sturz?«
»Ein Schlaganfall«, wiederholt Jeanie.
»Wie ich höre, war sie schon eine Weile krank.« Dann: »Stimmt das?«
Jeanie fragt sich, wie es sein kann, dass alle außer Dots Kindern von ihrer Krankheit wussten. Mrs Rawson legt den Kopf schief, und plötzlich herrscht eine angespannte Atmosphäre, etwas Ungesagtes steht im Raum.
Rawson hebt den Klaviaturdeckel. »Gehörte das hier Ihrer Mutter?«, fragt er.
Mrs Rawsons mitfühlendes Lächeln wird schmaler, Jeanie ist klar, dass die Frau aus dem Cottage verschwinden will, so schnell es ihr die Höflichkeit erlaubt. Auch Jeanie will sie loswerden, sie muss allein sein mit ihren ungeordneten Gedanken, die sie jetzt, da diese Leute im Haus sind, zur Ordnung zwingen muss. Rawson scheint allerdings nichts von dem zu bemerken, was seine Frau will, ob nun absichtlich oder nicht, denn er setzt sich auf den Klavierhocker – das Leder ist aufgesprungen, die Rosshaarfüllung quillt hervor – und klimpert mit der rechten Hand eine Melodie, ein kurzer Triller aus einem Lied, das dem Klang nach aus einem altmodischen Musical stammt. Als Maude sofort aufspringt und drauflosbellt, schaut Rawson auf den Hund runter, sagt: »Ganz ruhig, ganz ruhig«, und lächelt.
»Maude!« Jeanie ruft den Hund zurück, der sich unter den Tisch verzieht. »Hat meinem Vater gehört«, sagt Jeanie, woraufhin Rawson rasch die Finger wegzieht und die Hände auf die Hose legt, als wollte er sie dort abwischen.
»Nun …«, setzt Mrs Rawson an, um den Abschied einzuleiten.
»Ist das Problem mit dem Strom gelöst?«, fragt Rawson. Er erhebt sich, legt eine Hand aufs Klavier.
»Nein«, erwidert Jeanie scharf. Dieser Mann ist ihr zuwider, sie verabscheut ihn regelrecht. Sie hätte ihn nie reinlassen sollen, ihre Mutter hätte ihm nicht gestattet, auch nur einen Fuß über die Schwelle zu setzen.
»Julius hat mir erzählt, dass der Strom weg ist.«
»Kein Problem. Wir haben ja den Ofen.«
»Natürlich«, sagt Rawson. »Natürlich.« Offensichtlich hat er nichts mehr zu sagen, trotzdem macht er keine Anstalten zu gehen.
»Nun«, wiederholt Mrs Rawson. Sie hat den Autoschlüssel aus der Tasche geholt und hält ihn in der Hand. »Wenn wir irgendwas tun können, geben Sie einfach Bescheid.«
»Kann ich sie sehen?«, fragt Rawson. »Falls sie noch hier ist. Ihren Leichnam, meine ich.« Die Worte stolpern ihm aus dem Mund, eins nach dem anderen. Er berührt den weißen Schnurrbart, der seinen breiten Mund einfasst wie eine geschweifte Klammer.
Jeanie trifft das völlig unerwartet, und dem Gesichtsausdruck seiner Frau nach zu urteilen, geht es ihr ähnlich. »Darling«, sagt sie, es klingt wie eine Warnung.
»Sie sehen?«, fragt Jeanie.
»Verzeihung, nichts für ungut.« Er vergräbt die Hände tief in den Hosentaschen und spielt mit dem Wechselgeld herum. Hüstelnd wendet er sich ab.
»Wir sollten gehen«, sagt Mrs Rawson. »Und Sie nicht weiter aufhalten.« Das sagt sie mechanisch, schaut Jeanie dabei nicht an, sondern hat den Blick fest auf ihren Mann gerichtet.
An der Haustür wendet sich Rawson ein letztes Mal um. »Geben Sie mir wegen der Beerdigung Bescheid, und der Totenfeier?«
Als Jeanie nicht antwortet, folgt er seiner Frau.
Kaum hat Jeanie die Tür geschlossen, eilt sie ans Küchenfenster. Es ist ihr egal, ob sie sie sehen. Mrs Rawson steigt auf der Fahrerseite in den Land Rover, und noch bevor sie den Motor anlässt, hört Jeanie sie schreien. Die Frau fährt rückwärts auf die gegenüberliegende Weide, vollführt ein paar ruckartige, scharfe Manöver, vor und zurück, dann röhrt der Land Rover den Feldweg entlang zurück zur Farm.
Schon von draußen hört Julius, dass Jeanie im Cottage Gitarre spielt und dazu singt. Er lauscht an der Haustür, sie singt die erste Strophe von »Polly Vaughn«: I shall tell of a hunter whose life was undone. Es überrascht ihn nicht, denn das tun sie immer, wenn die Dinge gut laufen oder schlecht – musizieren. Er zögert, den Schlüssel schon in der Tür kommt ihm der Gedanke, dass er noch vor Kurzem auch das Banjo gehört hätte und die Stimme seiner Mutter. Jetzt singt nur Jeanie, allein.
Nach seinem langen Spaziergang trifft ihn die Wärme in der Küche wie eine Wand – unangenehm überheizt und stickig. Jeanie sitzt auf einem Küchenstuhl, ihre Gitarre auf dem Schoß. Sie ist so klein, denkt er, wie ein Kind; sie unterbricht ihr Spiel und blickt zu ihm auf, voll drängender Hoffnung, als könnte er ihr die Nachricht überbringen, dass es ein Irrtum gewesen sei, ihre Mutter am Leben und alles beim Alten. Ihm fällt nichts Tröstendes ein, doch die Stille in diesem Zimmer verlangt nach Worten, deshalb sagt er: »Der Schnee ist fast weg. Ist aber immer noch klirrend kalt da draußen.« Er tätschelt Maude, die aufgestanden ist, um ihn zu begrüßen, und krault sie zwischen den Ohren.
Als Jeanie die Gitarre wegstellt, weiß er, dass etwas kommen wird, etwas Schlimmes. Sie sagt immer noch nichts.
»War der Doktor hier?«, fragt Julius. Auf dem Feldweg hat er Reifenspuren von einem größeren Fahrzeug gesehen.
»Der Doktor hat gesagt, es war ein Schlaganfall. Sie ist an einem Schlaganfall gestorben. Nicht am Sturz. Ich bin zur Praxis, und Bridget hat gemeint, sie hätte schon zwei Mini-Schlaganfälle gehabt. Oder mehr. Ich weiß es nicht. Ich kann nicht glauben, dass sie uns nichts davon erzählt hat. Das hat der Doktor als Todesursache genannt, Schlaganfall.«
Julius zieht einen Stuhl unter dem Tisch hervor und setzt sich. »Herrje.« Erneut fragt er sich, ob sie noch eine Zeit lang gelebt hat, als sie auf dem Küchenboden lag, und ob sie noch leben würde, wenn er runtergegangen wäre, nachdem er den Lärm vom Kaminbesteck gehört hat. Er weiß, dass Jeanie genauso denkt, kann es ihr im Gesicht ablesen. Dieses Gesicht kennt er gut, er weiß, was sie denkt, das war schon immer so.
Sie schweigen, meiden es, einander anzusehen, beide sind sich bewusst, dass da eine Leiche im Haus liegt, im Zimmer nebenan. Als Julius sich umständlich von seinen Arbeitsstiefeln befreit, ohne die Schnürsenkel zu lösen, muss er daran denken, wie oft seine Mutter ihn deswegen ermahnt hat, er solle das lassen, es leiere die Schuhe aus und wo solle bitte das Geld für neue herkommen? Er zieht die Socken aus, da ist ein Loch an der Ferse, und massiert sich die vom langen Gehen schmerzenden Füße.
»Ich hab kein Abendessen gemacht. Mir nicht mal überlegt, was ich kochen könnte.« Jeanie erhebt sich. Wenn er von der Arbeit heimkommt, steht immer schon das Essen auf dem Tisch, wird von Dot oder Jeanie auf Teller verteilt, sobald er durch die Tür kommt. An jedem Tag seines Lebens ist das so gewesen, bis auf heute.
»Setz dich. Mach dir keine Sorgen wegen dem Abendessen«, sagt er, aber sein Magen knurrt so laut, dass Jeanie es hört und lächelt, er lacht mit, und die Spannung löst sich.
Jeanie setzt sich wieder und greift nach der Gitarre, ihre Finger produzieren Akkorde, aus Gewohnheit zupft sie die Saiten. »Hast du Craig doch noch mit dem Badezimmer geholfen?«, fragt sie.