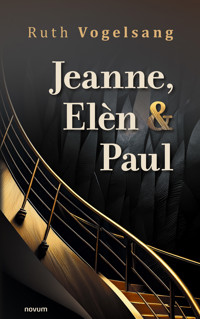
15,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: novum Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
"Ich habe mein Leben lang auf Sie gewartet", geht ihr durch den Kopf, als sie sich vor einem warmen Sommerregen in den Straßen von Paris in ein Café flüchtet und ein Fremder sich zu ihr an den Tisch setzt, der sich als Paul vorstellt. Aber nicht nur der Fremde kreuzt ihren Weg, sondern Elèn trifft auch ihre alte Freundin Jeanne wieder. Die Bedeutung dieser zufälligen Begegnungen erschließt sich für die Protagonisten erst im Laufe der Geschichte, denn bereits vor Jahrzehnten sind sie sich unabhängig voneinander schon einmal begegnet. Die Pyrenäen, Paris und Tanger, ein Dorf in Südfrankreich und Toronto sind die Stationen, in der sich die bewegende und spannende Erzählung von später Liebe und tiefer Freundschaft voller Verbundenheit auf schicksalhafte Weise entspinnt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 275
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Impressum
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie.
Detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://www.d-nb.de abrufbar.
Alle Rechte der Verbreitung, auch durch Film, Funk und Fernsehen, fotomechanische Wiedergabe, Tonträger, elektronische Datenträger und auszugsweisen Nachdruck, sind vorbehalten.
© 2025 novum publishing gmbh
Rathausgasse 73, A-7311 Neckenmarkt
ISBN Printausgabe: 978-3-7116-0558-0
ISBN e-book: 978-3-7116-0559-7
Lektorat: Tobias Keil
Umschlagfoto: Ruth Vogelsang
Umschlaggestaltung, Layout & Satz: novum publishing gmbh
www.novumverlag.com
Kapitel eins
In den Pyrenäen
Jeanne musste fliehen. Sie versteckte sich seit über einer Woche in den Pyrenäen, denn Francos Geheimdienst war auf sie aufmerksam geworden, weil sie sich in Rodriguez’ Bar mit anderen Mitgliedern der örtlichen Résistance traf. Einer ihrer Freunde war bereits unter Beobachtung und so geriet auch sie 1975, noch im letzten Jahr des Regimes von General Franco, in das Raster seiner Schergen. Unter diesen gab es üble Gesellen, denen es außerdem Vergnügen bereitete, einer jungen Frau, nachzustellen, die nicht nur attraktiv war, sondern in deren Augen unverschämt und auf provozierende Weise ihre Unabhängigkeit zur Schau trug. Das passte nicht in deren Weltbild. Jeanne war gerade 18 Jahre alt geworden.
Ein Informant ließ ihr die Nachricht zukommen, dass sie so schnell wie möglich von der Bildfläche verschwinden müsse, denn es gäbe Pläne, sie aus dem Verkehr zu ziehen. Was das bedeutete, war allen in ihrer Gruppe klar. Zu viele verschwanden und die wenigen, die zurückkamen, waren nicht mehr dieselben wie zuvor.
Ihre Freunde versorgten sie mit dem Nötigsten: Käse, Brot, gerauchtem Schinken, ein paar Fischkonserven und einem dunkelgrünen Canvas-Rucksack. Sie packte warme Kleidung, ein Stück englischer Seife, Zahnputzzeug, Unterwäsche, ein Schweizermesser, eine Karte von Nordspanien/Südfrankreich ein und ein feines Satinträgerkleid. Sie wusste nicht, ob sie die Flucht unversehrt oder gar lebend überstehen und jemals würde zurückkehren können, doch sie wollte sich ein letztes Andenken ihrer Weiblichkeit erhalten.
Vor ein paar Jahren war sie mit Freunden in den Pyrenäen gewandert und dabei übernachteten sie in einer Hütte, die halbverlassen schien, aber im Besitz der linientreuen Familie ihres damaligen Freundes war. Niemand würde vermuten, dass sie sich ausgerechnet dort verstecken würde. Es war eine Hütte, die seit Ende des 19. Jahrhunderts nie eine Erneuerung erfuhr. Einfacher, kärglichster Steinbau, einst ein ärmlicher Bauernhof. In einer Ecke eine Feuerstelle auf dem Boden. Ein alter, wackeliger Tisch, drei ebenso wackelige Stühle, ein angeschlagener schwarzer Emaille-Topf, etwas Geschirr aus gebranntem Ton, eine Feldbett-Pritsche. Ein Brunnen vor dem Haus, mit dem man das Wasser händisch hochpumpen musste, aber er war funktionstüchtig. Wilde Apfelbäume.
Für ihre natürlichen Bedürfnisse musste sie ins Freie. Es war nicht bequem, doch der Frühherbst verwöhnte glücklicherweise immer noch mit sommerlichen Temperaturen und machte den Aufenthalt in der Hütte, so spartanisch sie auch eingerichtet war, erträglich. Sie war sich bewusst, dass es bald ungemütlich werden würde, wenn die ersten Herbststürme aufkämen und Regen gegen die verbliebenen Glasscherben in den Fensterluken prasseln würde. Daran erlaubte sie sich nicht zu denken.
Sie musste sich irgendwie verpflegen ohne aufzufallen. Noch nach Tagen ihrer Ankunft fiel sie abends in tiefen Schlaf, obwohl sie tagsüber nicht viel machte, außer Äpfel und ihre Gedanken einzusammeln.
In einer Seitentasche ihres Rucksackes fand sie ein Büchlein, mit Gedichten, das offensichtlich in Handarbeit gebunden war. Einer ihrer Freunde hatte es ihr unbemerkt zugesteckt. Sie mochte ihn sehr, weil er ihr gegenüber immer sehr zuvorkommend und charmant war, doch jetzt erst verstand sie, dass er verliebt in sie war. Sie war ihm unendlich dankbar dafür, denn seine Worte, seine Gedichte waren es, die sie noch an Menschlichkeit glauben ließen, und sie bedauerte, dass sie ihm nicht danken konnte und nicht eher begriffen hatte, was für ein wunderbarer Mensch so lange in ihrem nächsten Umfeld an ihrer Seite war, ohne ihre Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen.
Es war noch früh am Morgen. Ein sonderbares, dumpfes Geräusch ließ sie hochschnellen, was die Federn des Feldbetts sofort mit lautem Quietschen quittierten. Sie rappelte sich auf, blickte vorsichtig aus einer Fensterluke und konnte nicht wirklich ausmachen, was sie sah. Zwischen den alten, verwilderten Apfelbäumen befand sich etwas, das aussah, als hätte sich eine Wolke dort niedergelassen. Mit angehaltenem Atem versuchte sie ihren Blick zu schärfen. Schließlich erkannte sie, dass es sich um einen Fallschirm handeln musste, und bemerkte, wie Bewegung in die Stoffblase kam. Sie sah einen Mann sich aufrappeln, sich orientierend umsehen. Das Herz blieb ihr stehen. Es war kein Franquist, das war klar, aber wer war er?
Er stolperte, noch leicht benommen, auf die Hütte zu. Sie duckte sich schnell vom Fenster weg, geriet in leichte Panik und doch irgendwie auch nicht. Ihr Bauchgefühl sagte ihr, dass sie keine Angst zu haben brauchte. Dennoch langte sie nach ihrem Schweizermesser, das sie unter der Matratze versteckt hatte, und stellte sich hinter die Holztüre, der nur ein Riegel vorgeschoben war und die nicht abgeschlossen werden konnte. Als die Tür knarrend aufging und er eintrat, sprang sie ihn von hinten an, hielt ihn fest –, es muss wie eine Umarmung ausgesehen haben dachte sie später – und hielt ihm die Klinge ihres Messers an den Hals. Sie war sich vollkommen bewusst, in was für eine lächerliche Situation sie sich gebracht hatte, aber etwas Besseres fiel ihr nicht ein. Er griff nach ihrer Hand, in der sie das Messer hielt, drehte sich aus ihrer Umarmung und stand überrascht einer kleinen, doch sehr energisch wirkenden Frau mit funkelnden Augen gegenüber.
„Wait a minute! May I say something before you kill me for good?“
Jeanne hörte seinen unerschrockenen, jungenhaften Unterton, der jedoch bar jeder Arroganz war.
„We might even work for the same firm?“
„Identify yourself!“, zischte Jeanne zwischen zusammengebissenen Zähnen.
„Is there a password?“
„Sorry?“, fragte Jeanne verblüfft, entspannte sich dann aber sogleich.
„Sie haben ein schönes Schweizermesser“, sagte er auf Katalanisch. „Sie hat eine hinreißende Figur und gepflegte Hände“, dachte er.
„Möchten Sie Tee?“, fragte sie ein wenig benommen.
„Danke. Captain Paul Bernard von der 13. Airborne. Hatten Sie neulich Feindkontakt?“
Seine förmliche Vorstellung belustigte sie und spontan schlug sie die Hacken zusammen, grinste, salutierte und erwiderte mit übertrieben ernster Stimme: „Gestatten, ich bin Jeanne d’Arc, von Gott gesandt, mein Volk zu retten!“
Alle Anspannung wich nun aus der Hütte, denn sie beide lachten und schauten sich zum ersten Mal von Mensch zu Mensch, oder eher müsste man sagen von Mann zu Frau, in die Augen.
„Entschuldigen Sie bitte den Scherz“, sagte sie wieder mit ernster, doch nun mit leicht verstörter Stimme. Sie hatte ihm einige Sekunden zu lange in die Augen geschaut und dabei vergessen, warum sie eigentlich hier war, bar jeglicher zivilisatorischen Errungenschaften, in robuster Wanderkleidung und groben Wanderstiefeln und Hunger im Bauch. Seit Tagen hatte sie nicht ordentlich gegessen. Paul Bernard erinnerte sie daran, dass sie eine Frau war und das verunsicherte sie.
„Da, wo ich herkomme, hat man ständig Feindkontakt. Sie sind überall. Doch es wurde gefährlich für mich, ich musste fliehen. Paul Bernard, Sie sind vom Himmel gefallen, wie es scheint. Haben Sie etwas zum Essen dabei? Ach so, ich bin übrigens Jeanne Ferrari.“
„Hocherfreut“, sagte er und ergänzte so beiläufig, wie sie ihren Namen erwähnte: „Nein, Essbares habe ich nicht dabei, denn ich ging selbstverständlich davon aus, dass Sie mich mit einer frisch gebackenen Apfeltorte willkommen heißen würden!“
Erst stutzte sie. Sie hatte seit Tagen mit niemandem ein Wort gewechselt und ihre Kommunikationsfähigkeiten waren etwas eingerostet, wie sie selbst feststellte. Dann aber brachen beide wieder in Gelächter aus. Ihre Mägen knurrten.
„Ich werde uns Tee kochen“, sagte Jeanne, als sie sich wieder fing. „Ich habe wilden Salbei, Minze und Lavendel ums Haus gesehen. Das wird uns guttun. Wir haben Wasser und Feuer, und zur Not schmeiß ich uns noch Apfelscheiben ins Teewasser. Das gibt dem Tee einen feinen Geschmack und etwas Festeres für die Zähne. Haben Sie schon einmal Kaninchen gejagt und möchten Sie nicht erst Ihren Fallschirm in Sicherheit bringen? Der könnte uns nützlich sein und ich glaube auch schon zu wissen, wofür.“
Sie wusste, dass ihr Sinn für Pragmatismus oft Grund dafür war, dass ihre Freunde genervt mit den Augen rollten.
„Kaninchen können wir nicht jagen“, sagte Paul, „doch die RAF hat eine kleine Röhre mit Verpflegung abgeworfen, die müsste ungefähr 3 km von hier heruntergegangen sein. In einem kleinen Tal, ich glaube, ich könnte sie finden. Mademoiselle, ich bin sehr unhöflich: Bitte nehmen Sie meine Schokolade. Ich sehe, Sie frieren?“
„Oh ja, tatsächlich ist mir kalt, jetzt, wo Sie es sagen, fällt es mir erst richtig auf! Ich bin so hungrig, dass alles andere nebensächlich geworden ist. Meinen kleinen Proviant habe ich bereits auf dem Weg hierher aufgebraucht und die letzten Tage habe ich mich von kleinen, wilden Äpfeln ernährt, aber gegen das Magenknurren konnten sie kaum helfen. Deshalb, ich schäme mich fast ein wenig, würde ich Ihr süßes Angebot sehr gerne annehmen. Schokolade klingt himmlisch! Nachher, zum Tee, mmmh! Kann ich Ihnen helfen, den Fallschirm zu bergen? Etwas Bewegung brächte Wärme in meine Glieder. Ich dachte, wir könnten die Matratze von der Pritsche nehmen und auf den Boden legen. Darauf könnten Sie schlafen und die Fallschirmseide würden wir als Unterlage auf den Metallrost der Pritsche legen, auf der ich dann schlafe. Wäre Ihnen das recht? Für eine Nacht würde das gehen, denke ich.
Ach, noch was: Welche Verbindungen haben Sie zur RAF? Warum wirft die RAF hier Verpflegung ab und warum wissen Sie davon?“
Jeanne bemerkte vor lauter Umtriebigkeit nicht, dass Paul sie beobachtete und jedes Mal, wenn er ansetzte etwas zu sagen, den Mund wieder zuklappte, da Jeanne ihn nicht zu Wort kommen ließ. Instinktiv versuchte sie der inneren Erregung, die sie in Gegenwart Pauls erfasst hatte und deren Ursprung sie nicht zu denken wagte, mit Aktionismus Herr zu werden. Darüber hinaus war sie auch immer noch misstrauisch. Ihre Erregung blieb und schien ihr alle Energie aus dem Körper zu ziehen. Plötzlich fühlte sie sich derart matt, dass sie dem Fremden am liebsten einfach um den Hals gefallen und sich an seiner Schulter vor Erschöpfung ausgeheult hätte.
So hatte sie sich ihr Leben nicht vorgestellt. Sie war nicht die tapfere Résistance-Jeanne-d’Arc, die sich für politische Ziele vollständig aufgeben konnte. Sie folgte lediglich ihrem Sinn für Gerechtigkeit und Menschlichkeit und konnte die absurden und verbrecherischen Strukturen von Faschismus nicht ertragen, weil sie alles zerstörten, was Menschlichkeit für sie ausmachte. Sie wollte tanzen, sich schön machen, Lippenstift auftragen, mit ihren Freunden und Freundinnen ins Kino, ins Theater gehen, Gespräche führen, sich verlieben.
Sie sah an sich hinab, fühlte sich ungepflegt und unattraktiv in der Gegenwart dieses überaus gut aussehenden Fremden, der ihr gefiel und dessen physische Nähe sie auf eigentümliche Weise nervös machte. Er strahlte eine wohltuende, ruhige Überlegenheit aus, ohne arrogant zu wirken. Zum ersten Mal seit Tagen fühlte sie sich in Sicherheit. Nicht vor sich selbst, aber vor Francos Schergen. Dann sank sie auf den Boden, das Bewusstsein verlierend.
Als Jeanne wieder zu sich kam, roch es in der Hütte nach frisch gebrühtem Kaffee und im Kamin brannte ein Feuer, fachmännisch entzündet und fast keinen Rauch verbreitend. Draußen war es dunkel geworden. Weiße Pünktchen tanzten vor dem Fenster. Jeanne nahm nur langsam wahr, dass es schneite. Paul stand im dunkelgrünen Pullover am Feuer, über dem ein Rost aufgehängt war, und hantierte mit einer kleinen Pfanne. Bald gesellte sich der Duft von Rührei zum Kaffeeduft hinzu. Jeanne schloss wieder die Augen. Sie lag auf dem Feldbett, eingeschlagen in den seidenen Fallschirm, der sie warm hielt, wie ein effektiver Schlafsack.
„Ah, da ist sie ja wieder, die Gottgesandte“, bemerkte Paul schmunzelnd. „Ich bin froh, Sie etwas rotwangig zu sehen. Sie sahen letzthin ganz grau aus.“ Paul kam näher und befühlte ihre Stirn. „Sehr gut. Das Fieber ist auch herunter. Wissen Sie, ich habe mir Sorgen gemacht. Sie sind viel zu attraktiv, um die Heiligen im Himmel zu erfreuen. Wir hier im Tal der Tränen bedürfen auch des Trostes und nicht nur des geistlichen.“ Dann sah er sie offen und freundlich an: „Im Übrigen müssen Sie in dem Seidenkleid, das Sie mitgenommen haben, betörend aussehen. Wie ich an die Verpflegung gekommen bin? Nun, Sie haben ein paar Tage geschlafen. Ich hatte mich aufgemacht und schon am ersten Abend die von der RAF abgeworfene Verpflegungsröhre gefunden. Inklusive Funkgerät. Das ist sehr schön, wissen Sie? Leider können wir aber erstmal nichts tun: Es schneit. Wir können uns hier nicht wegbewegen, ohne aufgespürt zu werden. Lassen Sie sich also Zeit. Ein paar Tage wird es schon dauern, bis Tauwetter einsetzt.“
Als sie die Augen aufschlug, fehlte ihr jegliche Orientierung. Sie wusste nicht, wo sie war, und konnte im flackernden Licht des Feuers, das in der offenen Herdstelle brannte, nichts richtig erkennen. Ausdruckslos folgte sie seinen Worten, die in wohligem Klang in ihre Ohren drangen und deren Sinn sie erst mit Verzögerung verstand. Es schneit, vernahm sie. Ihr Seidenkleid, betörend an ihr. Warum wusste die Stimme von ihrem Seidenkleid und es gab etwas zu essen? Ja, essen. Sie wollte essen. Sie fühlte die Einwölbung in ihrer Magengegend und hatte entsetzlichen Durst.
Nach und nach kam sie zu sich und versuchte sich aufzurichten, es gelang ihr jedoch nicht, weil sie in etwas Weißes eingewickelt war. „Kafka“, schoss es ihr durch den Kopf. Sie war kein Käfer, aber sie hatte sich verpuppt.
Sie gab sich geschlagen und ließ sich wieder in die Horizontale sinken, atmete tief durch, öffnete bewusst langsam die Augen und blickte in die von Paul, der sie freundlich auf sehr charmante Weise begrüßte und ihr noch einmal erklärte, dass sie im Fieberschlaf lag. Gleichzeitig half er ihr, sich aus der Fallschirmseide zu befreien, in die er sie eingeschlagen hatte, um sie warm zu halten.
„Danke“, sagte sie, „danke, dass Sie sich um mich gekümmert haben. Wie lange war ich denn weg? … Aber was ist das!? … Das, was ich da anhabe? Das ist doch eindeutig Feinripp-Unterwäsche für einen Mann! Sie gemeiner Kerl! Was erlauben Sie sich!? … Und verstehe ich das richtig? Sie sind losgezogen, den Abwurf der RAF zu suchen, während ich ohnmächtig in diesem Kokon eingesperrt lag? Ganz allein?! Ich hätte von Wölfen gefressen werden können! Ich hätte von Francos Leuten gefunden werden können und Gott-wer-weiß-wem! Ich hätte sterben können!“, stieß sie mit bebender Stimme, halb verzweifelt, halb entrüstet aus und Tränen stiegen ihr in die Augen, in denen sich Wut, Angst und Scham spiegelten, aber auch ein wenig Dankbarkeit.
Paul war zwar froh, dass die kleine Rebellin wieder zu Kräften gekommen war, aber kurz wünschte er sich die Ruhe ihres Atemrhythmus während des Genesungsschlafs zurück und das mädchenhafte Antlitz, das der tiefe Schlaf in ihre Züge gemalt hatte.
Er antwortete nicht auf ihre Fragen, verstand, dass es für eine Frau, wie sie es war, das Seidenkleid ließ es erahnen, nicht einfach war, sich mit Situationen konfrontiert zu sehen, die in ihrem Lebensentwurf so sicher nicht vorgesehen waren. Sich alleine in unwirtlicher Gegend durchzuschlagen, immer die Angst im Nacken, verraten zu werden, den falschen Menschen Vertrauen zu schenken, Männern zu begegnen, die ihr Gewalt antun könnten … er verstand, dass sie panisch reagierte. Er reichte ihr Tee, setzte sich neben sie auf die Pritsche und legte sehr behutsam eine Hand an ihren Rücken und die andere an die ihm zugewandte Schulter.
„Trinken Sie. Der Tee wird Ihnen guttun und dann essen Sie. Mögen Sie Zwieback? Ich habe über dem Feuer Wasser erwärmt, damit Sie sich frisch machen können. Keine Sorge, ich gehe aus der Hütte, während Sie Ihre Toilette machen.“
Jeanne nahm den Tee und auch den Zwieback dankend an. Mit jedem Schluck und jedem Bissen schlich sich wieder Farbe auf ihre Wangen und auch die Zuversicht, mit der sie im Allgemeinen alles anging, kehrte langsam zurück. Sie fasste nach und nach wieder Vertrauen zu diesem Mann an ihrer Seite, den sie kaum kannte, dessen Anwesenheit sie aber in eine überaus angenehme Schwingung versetzte. Nicht zuletzt, weil ihr in den Sinn kam, dass er ihr sagte, dass sie betörend aussehen musste in ihrem Seidenkleid. Dass sie seine Unterwäsche trug, die lange Hose sogar mit Eingriff, stand in krassem Gegensatz dazu und unter anderen Umständen wäre sie vor Scham in den Boden versunken, aber hier hatte das kaum Bedeutung.
Doch von Bedeutung war, wie sie die Nacht verbringen würden. Die dünne Matratze auf den schmutzigen Boden zu legen war keine Option, zumal sie wegen des Schneefalls einige Zeit in der Hütte würden verbringen müssen, um keine Spuren zu hinterlassen. Eine Weile saßen sie so still nebeneinander, während sie ihren Tee trank, an einem Zwieback knabberte und immer wieder aufseufzte. Plötzlich erhob sie sich behände. „Was ist das, was in der Pfanne dort brutzelt?“, fragte sie und bewegte sich Richtung Herdstelle. Dabei rutschte die zu große Männerunterhose nach unten und gab den Blick auf einen Teil nackter Hüfte frei. Sie bemerkte dies nicht und auch nicht, dass Pauls Blicke ihr folgten und nicht von ihr lassen konnten.
Während der ganzen Zeit, als der Schnee die Hütte umgab, waren sich Paul und Jeanne nicht nähergekommen als am ersten Tag. Sie hatte sich aber bald erholt und setzte sich nun öfters in ihrem Bett auf. Paul hatte auf Moos geschlafen, das er unter den Bäumen des nahen Waldes gesammelt hatte. Er betrachtete sie heimlich mit Wohlgefallen, doch vermieden es beide, sich zu berühren.
Nach etwa zwei Wochen klarten die Schneewolken auf und es setzte Tauwetter ein. Bald war der Schnee zusammengeschmolzen. Paul sah hinaus. Es war Zeit. „Jeanne, ich muss Sie jetzt für eine Weile allein lassen. Wenn die Brücke gesprengt ist, werde ich etwas Ausrüstung von hier holen und dann schnell verschwinden.“
„Es kommt gar nicht in Frage, dass Sie allein gehen“, sagte Jeanne bestimmt. „Ich kann zwar nicht sprengen, aber ich kann die Gegend im Auge behalten und auch etwas tragen.“ Ihre Augen blitzten. Sie sah ihm direkt ins Gesicht. Paul sah sie eine Weile an. Dann entschied er sich. „Gut. Wir gehen in der Dämmerung. Die Brücke liegt etwa fünf Meilen von hier. Das können wir an einem Morgen schaffen.“
Die Brücke war kaum bewacht. Sie war aus Stein errichtet und besaß zwei Pfeiler, unter denen ein kleiner Bach floss. Mitunter sah man ein Militärfahrzeug auf der Brücke patrouillieren. Dann wurde wieder alles ruhig. Dies würde sich ändern, sobald das Dynamit seine Wirkung gezeigt hätte. Paul war deshalb mit einem Fluchtplan beschäftigt, den er sorgfältig mit Jeanne durchsprach. Als die Dämmerung einsetzte, bewachte Jeanne am Waldrand den Detonator, während Paul den Sprengstoff an den beiden Pfeilern anbrachte und dann das Kabel ausrollte. „Gut“, sagte Paul, als er die isolierten Enden der beiden Drähte in den Detonator steckte und festschraubte. „Sobald hier alles hochgeht, trennen wir uns. Jeanne, es war mir eine Ehre“, sagte er, gab ihr die Hand und sah ihr dabei in die Augen. „Unter anderen Umständen hätte ich gerne gesehen, wie Ihnen das Seidenkleid gestanden hätte. Viel Glück.“
Jeanne erwiderte seinen männlichen Griff und versuchte mutig auszusehen. „Paul“, hörte sie sich sagen: „Wenn alles vorbei ist, am 14. Juli, Montmartre, das ‚Papillon‘. Kommen Sie?“
„Ja, ich werde da sein … so Gott will.“ Dann ließ er ihre Hand los, vergaß seine Zurückhaltung und nahm sie fest in seine Arme, hielt sie drei Atemzüge lang, bevor er sie wieder frei gab und sich dem Detonator zuwandte, um die Sprengung auszulösen. Mit einem letzten, flüchtigen Blick in ihre Augen entfernte er sich mit schnellen Schritten.
Sie schaute ihm nach, bis sie ihn nicht mehr sehen konnte, dann begann sie zu zittern und erschauderte von der kalten Wucht, die mit dem Bewusstsein über sie kam, wieder auf sich allein gestellt zu sein, und von dem Nachhall der gewaltigen Detonation, die die Brücke in einer Wolke aus Schutt und Asche versinken ließ und jede Rückkehr unmöglich machte. Jeanne nahm den Rucksack auf, der gepackt neben ihr stand. Für einen kurzen Moment dachte sie, sie könne das Gewicht nicht tragen, und wollte dem Drang nachgeben, kraftlos in die Knie zu sinken, doch entschlossen riss sie sich zusammen, blendete alle Gedanken und kräftezehrenden Zweifel aus und setzte tapfer einen Schritt vor den anderen, immer in Richtung Norden. Bald würde sie die Grenze zu Andorra erreichen, dann erst würde sie vorerst in Sicherheit sein. Stunde um Stunde ging sie, bedacht einen Fuß vor den anderen setzend, entlang steiniger, schmaler Pfade. Es ging jetzt immer bergan und ihr Rucksack lag ihr zunehmend schwerer auf dem Rücken und die Füße taten ihr weh. Je mühsamer der Anstieg wurde, desto weniger gelang es ihr, zu verdrängen, dass ihr auch das Herz schwer war.
Die Tage mit Paul in der Hütte, die Nähe, die sie zueinander fühlten, obwohl sie nur das Allernötigste miteinander sprachen. Obwohl sie beide vermieden, sich zu berühren – und wenn es doch einmal geschah, dann taten sie beide so, als hätten sie es nicht bemerkt. Obwohl sie sich heimlich aus den Augenwinkeln beobachteten, ihre Blicke sich aber schnell zerstreuten, wenn sie sich doch einmal trafen. Obwohl ihre Stimmen leise, warm und zärtlich wurden, wenn sie doch ins Reden kamen. In bemüht nüchternem Ton erklärten sie sich gegenseitig immer wieder, dass es gefährlich für sie sein könnte, wenn sie mehr als ihre Namen voneinander wüssten und wenn sie Nähe zulassen würden. Nun schmerzte es sie, dass sie beide alles der Vernunft opferten und beide alleine ihr Glück versuchen mussten, diesen schlimmen Zeiten zu entkommen. Sie durfte sich nicht in ihren Sehnsüchten verlieren. Sie musste weiter, immer weiter. Die Nacht würde bald hereinbrechen. Ein Platz zum Schlafen musste gefunden werden.
Gerade noch rechtzeitig vor Einbruch völliger Dunkelheit fand Jeanne eine dieser Stein auf Stein gebauten kleinen, von Ziegen- oder Schafhütern gebauten Hütten, die Tier und Mensch vor Sonne, Regen und Kälte schützten. Ein niedriger Eingang sorgte für ausreichend Schutz. Sie hatte Glück. Der kleine Unterschlupf war mit Reisig, Stroh und sogar Büscheln aus Schafwolle ausgelegt. Erschöpft ließ sie sich auf dem Boden nieder und bettete ihren Kopf auf den Rucksack, an den sie die Militärdecke gebunden hatte, die Paul ihr überlassen hatte und ihr nun Schutz gegen die Kälte bot. Sie war so erschöpft vom Anstieg, dass sie sofort einschlief. Dass sich Stimmen näherten, hörte sie nicht mehr. Ein gleißendes Licht auf ihr Gesicht gerichtet, riss sie jäh aus dem Schlaf, der getränkt von düsteren Träumen war, als ob in ihnen schon eine Ahnung wohnte. Grobe Männerhände stießen sie an, rissen sie hoch in einen aufrechten Sitz. Finster dreinblickende Gesichter, die sich durch die Öffnung drängten, starrten sie an und in einem bewegten sich bedrohliche Züge um den Mund, bis er anhob, sie anzuschreien.
Was sie hier zu suchen habe. Ihren Namen wolle er wissen. Er kenne sie. Er habe sie gesehen mit den Widerständlern. Er habe sie auf seiner Fahndungsliste. Er wisse es ganz sicher. Sie solle endlich ihren Namen sagen, er würde es sowieso herausbekommen!
Sie konnte nichts erkennen, er fuchtelte mit einer Taschenlampe vor ihrem Gesicht herum und sie sah nur schwarz. Panik überfiel sie. Sie erkannte die Stimme. Einer aus ihrem Dorf. Einer, der besonders für seine Linientreue und Brutalität bekannt war. Sie war verloren. Francos Leute. Sie hatten sie aufgespürt.
Diese Nacht brannte sich in ihre Seele, doch sie sollte nie auch nur ein Wort darüber verlieren. Für das, was ihr angetan wurde, das Unsägliche, gab es keine Worte. Sie verlor ihre Sprache darüber. Sie verstummte und nie mehr kam ein Wort Katalanisch über ihre Lippen. Es war sogar so, als wäre die Sprache komplett ausgelöscht worden. Sie verstand sie nicht mehr.
Sie wurde verschleppt und als sie wieder zu sich kam, geschunden, mit Blut an ihren Schenkeln, fand sie sich in einem kleinen, dreckigen Gefängnis wieder, bekleidet nur mit ihrem zerrissenen Seidenkleid und einer alten Armeejacke darüber. Einer der Männer muss sich erbarmt und sie vor dem Erschießungskommando gerettet haben, denn es war üblich, dass keine Umstände gemacht und sogenannte Verräter umgehend erschossen wurden. Gnädigerweise hatten sie ihr sogar den Rucksack gelassen.
Sechs Monate verblieb sie in dem Loch, in das die Banditen sie gesperrt hatten, ihr das Mindeste zu Essen gaben und sie nicht weiter beachteten. Das kleine Büchlein, das sie mit sich trug, mit den Gedichten, die in englischer Sprache verfasst waren, half ihr bei Verstand zu bleiben. An jene klammerte sie sich, Satz für Satz, Wort für Wort, Buchstabe für Buchstabe.
Dann, eines Tages, öffnete sich die Tür und jemand in Zivilkleidung sagte ihr, sie sei frei. Man reichte ihr ein geschnürtes Paket mit Kleidung und festen Schuhen, eine Geldnote und ließ sie gehen.
Da stand sie. Von einer Minute auf die andere, unter freiem, blauem Sommerhimmel und wusste nicht, wie ihr geschah. Ihre Augen mussten sich an die Helligkeit gewöhnen und da ihre Stimme noch zu schwach zum Reden war – es kam kein Ton heraus – traute sie sich nicht, einen Passanten anzusprechen. An einem Zeitungskiosk sah sie sich die ausgehängten Illustrierten und Tageszeitungen an und erfuhr so vom Tod des Diktators. Sein Nachfolger, der spätere König Juan Carlos, erließ eine Generalamnestie für alle politischen Gefangenen. Für Jeanne war klar, dass sie das Land, dessen Sprache sie nicht mehr sprach, sofort verlassen wollte und außerdem wartete niemand auf sie. Ihre Eltern hatte sie schon in jungen Jahren auf tragische Weise bei einem Unfall verloren und ihre Großmutter, bei der sie aufwuchs, verstarb im Alter von 82 Jahren, ein Jahr bevor sie der Résistance Gruppe beigetreten war. Auf direktem Weg ging sie zum Bahnhof und kaufte sich ein Ticket nach Frankreich, Toulouse. Ihr Ziel war Paris, Montmartre. Café Papillon.
Kapitel zwei
Café Papillon – Paris
Seit sechs Monaten war Jeanne nun in Paris. Sie fand sofort Anstellung im Café Papillon im 18. Arrondissement. Ihr Französisch war anfangs etwas holprig, aber das gab sich schnell. Kaum einer der Gäste bemerkte, dass sie keine Französin war. Sie wollte Paul wiedersehen, so wie sie es vereinbart hatten und so verband sie das Praktische mit dem Nützlichen. Sie musste leben, Miete bezahlen, essen und was lag näher, als an dem Ort zu arbeiten, an dem sie sich mit Paul verabredet hatte.
Zu Beginn ihrer Kellnerinnentätigkeit rechnete sie jeden Tag mit ihm, doch er kam nicht. Oder sie verpassten sich. Nach und nach vergaß sie, dass sie ursprünglich wegen Paul dort arbeitete, und dachte darüber nach, was sie aus ihrem Leben machen wollte. Viele Männer machten ihr Avancen, aus denen sie sich jedoch nichts machte und über einen Flirt gingen ihre Männerbekanntschaften nie hinaus. Sie wunderte sich selbst, dass sie überhaupt in der Lage war zu flirten. Es war wohl die französische Sprache, die ihr die inneren Schrecken nahm und ihr Leichtigkeit im Umgang mit den Gästen verlieh. Sie war glücklich. An Katalonien dachte sie nicht, und wenn doch einmal Gedanken an das Vergangene sich ihrer bemächtigen wollten, verscheuchte sie sie und stürzte sich noch mehr in Arbeit. Sie hatte lange genug Zeit gehabt, das Erlebte zu verarbeiten, sagte sie sich.
Jeanne lebte bescheiden, sparte ihren Lohn und die Trinkgelder, die sie reichlich erhielt, denn sie bewarb sich an der Sorbonne, um Politikwissenschaften zu studieren. Sie wusste eigentlich gar nicht so recht, warum ausgerechnet Politikwissenschaften. Sicher hatte es damit zu tun, dass es ihr obszön erschien, dass ein paar wenig Mächtige Völker gegeneinander aufwiegeln konnten und ganze Gesellschaften zerstörten, nur um ihre Machtinteressen durchzusetzen. Sie wollte begreifen, wie das funktioniert, und dem etwas entgegenzusetzen haben.
Es war der 14. Juli. Nationalfeiertag in Frankreich. Ein flirrend heißer Sommertag. Menschen in aufgepeitschter Feierlaune zogen durch die Straßen. Alle schienen irgendwie außer Rand und Band. Die bleierne Schwere der Nachkriegsjahre schien sich endlich aufzulösen.
Im Café war die Hölle los. Jeanne wirbelte von einem Tisch zum nächsten, fast als würde sie tanzen, ganz nach ihrer eigenen Choreographie. Lachte über die Scherze der Gäste und gab selbst immer wieder spaßige Kommentare ab. Sie war in Hochstimmung, denn sie hatte die Zusage für ihre Aufnahme an der Sorbonne erhalten. Sie wusste, dass sich nun alle Türen in ein sorgenfreies Leben für sie öffnen würden. Sie würde keine Zeit und Kraft verschwenden an irgendjemand oder irgendetwas, was sie auf ihrem Weg aufhalten könnte. Sie sah sich schon als Studentin mit Büchern und Mappen unter dem Arm beschwingt durch Pariser Parks schreiten, sich auf Bänken niederlassen, um Texte zu studieren und sich dabei wunderbar vorzukommen. Sie bemerkte gar nicht, dass sie verträumt zwischen den Tischen der Außenbestuhlung stehen geblieben war, Passanten nachblickte, ohne sie zu sehen, ein Tablett mit abgeräumtem Geschirr auf der linken Hand balancierend, bis sie von den Rufen eines Gastes aufgeschreckt wurde: „Mademoiselle, s’il vous plaît?“
Der englisch klingende Dialekt amüsierte sie. Es gab nichts Lustigeres, als wenn Engländer französisch sprechen, dachte sie beiläufig und wandte sich dem Tisch des rufenden Herrn zu.
„Was wünschen Sie Monsieur?“, fragte sie, während sie gleichzeitig die noch verbliebenen Tassen und Gläser vorangegangener Gäste auf ihr Tablett stapelte, ohne dem Gast direkt ins Gesicht zu sehen, was sonst nicht ihre Art war. Normalerweise behandelte sie jeden Gast so zuvorkommend, als ob es keinen wichtigeren Menschen gäbe als den, den sie eben im Moment bediente. Das wirkte sich natürlich ungemein positiv auf die Trinkgelder aus, die sie erhielt, aber sie tat das nicht aus diesem Grund. Es war einfach ihre Methode, zentriert zu bleiben, nicht in ein Gedankenkarussell zu geraten und ganz bei sich zu sein. Sie fand, dass ein jeder Mensch einmal am Tag von irgendjemandem wirklich gesehen werden sollte und wenn es auch nur für einen kurzen Augenblick andauerte. Sie war sich sicher, dass sie jeden Tag einem gewissen Prozentsatz von Menschen die einzigen Momente des Tages wahrer Aufmerksamkeit schenkte und dieser Gedanke befriedigte ihre, wie sie es nannte, „interne Statistik“.
Doch heute, am Nationalfeiertag, in der Hitze und im Trubel der Feierlichkeiten und der hohen Frequenz wechselnder Gäste, blieb sie sich nicht treu, ihre Gedanken schweiften immer wieder ab in noch sehr verschwommen gezeichnete Zukunftsvisionen.
„Mademoiselle, entschuldigen Sie bitte, darf ich Sie aus Ihren Gedanken reißen und Sie bitten, mir einen Cortado zu servieren?“
Jeanne schrak auf. Als sie das Wort Cortado hörte, erstarrte ihr ganzer Körper. Sie hielt sich an ihrem Tablett fest und brachte die klirrenden Gläser im Bruchteil einer Sekunde in einen Zustand gefrorener Stille.
„Warum bestellt ein englischsprachiger Gast ein spanisches Kaffeegetränk mitten in Paris?“, schoss es ihr durch den Kopf und ihre Augen richteten sich blitzartig auf die seinen.
Paul erhob sich ganz langsam aus dem Bistro-Stuhl mit sehr kontrollierten Bewegungen, sah, dass Jeanne kurz davor war, die Kontrolle über ihren Körper zu verlieren. Schon einmal sank sie vor ihm zu Boden, als sie sich in einem Zustand emotionaler Überforderung befand. Vorsichtig nahm er ihr das Tablett ab.
„Bitte lassen Sie das, es geht schon wieder! Geben Sie mir das Tablett zurück! In einer halben Stunde ist meine Schicht zu Ende, dann können wir reden. Cortado bieten wir hier übrigens nicht an. Was sonst darf ich Ihnen servieren?“
Sie verstand selbst nicht, warum sie so kühl und distanziert war. Eine normale Reaktion wäre gewesen, dass sie sich darüber gefreut hätte, dass er, wie vereinbart, gekommen war. Dass sie sich gefreut hätte, ihn wiederzusehen, dass sie ihm vielleicht sogar um den Hals gefallen wäre, aber er wirkte fremd auf sie. Als wäre er ein anderer als der, mit dem sie über zwei Wochen in der kargen Hütte in den Pyrenäen verbracht hatte, so wie auch sie eine andere geworden war. Sie wusste nicht, was er erlebt hatte. Im Grunde wusste sie überhaupt nichts über ihn. Ehrlich gesagt wusste sie nicht einmal, warum er als Engländer – oder war er Amerikaner? – überhaupt an katalanischen Résistance-Angelegenheiten beteiligt war. Sie erinnerte sich, dass sie auch nie eine Antwort auf ihre Frage erhielt, was er mit der RAF zu schaffen hatte, und sie wunderte sich, warum sie selbst nie nach seinen Hintergründen fragte.
Doch damals war sie einfach froh, die angstvollen Nächte nach den ersten Tagen der Flucht nicht alleine verbringen zu müssen und sich in Sicherheit zu fühlen. Jede tiefergehende Frage hätte vielleicht zu weiteren Verunsicherungen und Verwirrungen geführt, die sie in dem latenten Schockzustand, in dem sie sich befand, nicht verkraftet hätte. Zu der Zeit wusste sie noch nicht, was ein Mensch in der Lage war, zu ertragen und schon gar nicht sie selbst. Dass er nicht mehr an ihrer Seite war, als sie tatsächlich seines Schutzes bedurfte, lag wie ein Schatten auf ihrer Seele, den sie bislang nicht wagte zu sehen. Doch nun zeigte er sich und sie schauderte.
„Jeanne, kein Problem, es muss kein Cortado sein, bringen Sie mir bitte einfach einen Espresso und Wasser. Ich warte auf Sie, auf Ihr Schichtende, okay?“
Natürlich entging ihm ihr distanziertes, fast abweisendes Verhalten nicht. Er legte eine freundliche, warmherzige Miene auf, seine Augen jedoch blieben unbeteiligt und musterten sie eindringlich. Er war doch einigermaßen überrascht, dass seine Anwesenheit einen derartigen Stimmungswandel negativer Natur bei ihr verursachte. Eine Weile nämlich saß er schon da und bestaunte sie, wie sie sich zwischen den Tischen und den sich in Bewegung befindlichen Gästen behände und leichtfüßig hindurchschlängelte, elegant ihr Tablett balancierte und eine bezaubernde Aura von Fröhlichkeit verströmte. Vielleicht würde es doch nicht ganz so einfach sein, sie für seine Sache zu gewinnen, wie er sich das vorgestellt hatte. Ob sein jungenhafter Charme sie für ihn einnehmen konnte, war ihm jetzt keine Selbstverständlichkeit mehr.




























