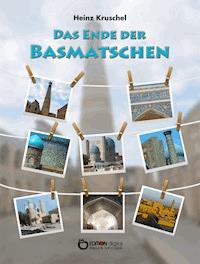8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: EDITION digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Wolfgang Wittig stammt aus einer alten Offiziersfamilie und dient vor dem geplanten Kunststudium als Fähnrich bei der Bundeswehr. Aus humanistisch-ethischen Gründen strebte er ein Verfahren gegen den Soldatenschinder Unteroffizier Lingner an, der wegen seiner Jugend nur eine Bagatellstrafe erhielt. Aber Lingner sinnt nach Rache, die ihm zu gelingen scheint. Nachdem bei einem NATO-Manöver zwei Soldaten aus Wittigs und Lingners Verantwortungsbereich einen gesundheitlichen Dauerschaden erleiden und nur mühsam mit dem Leben davonkommen, gibt es für Wittig nur zwei Möglichkeiten: Die Herbeiführung eines Prozesses zur schonungslosen Aufdeckung der Probleme in der Bundeswehr und damit die Abkehr von der Wittigschen Familientradition. Oder die Nutzung der Beziehungen seines Vaters, um alles im Sande verlaufen zu lassen. Wird Wittig sich von seinem bürgerlichen Elternhaus lösen und vorbehaltlos zu seiner Freundin Doris Rappsilber und ihren in den letzten Kriegstagen desertierten, seitdem durch Ärztepfusch blinden Vater stehen? Wittigs Schulfreund Ingo, Kriegsdienstverweigerer und Redakteur einer sehr kritischen, linken Zeitung, unterstützt ihn dabei. Heinz Kruschel zeigt in dem spannenden Buch die Entwicklung junger Menschen vor dem Hintergrund dramatischer Ereignisse 1968 in der Bundesrepublik Deutschland, wie der Kampf gegen den Vietnam-Krieg, die geplanten Notstandsgesetze und die Durchsetzung der Bundeswehr mit Offizieren aus dem 2. Weltkrieg.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 420
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Impressum
Heinz Kruschel
Jeder Abschied ist ein kleines Sterben
ISBN 978-3-95655-106-2 (E-Book)
Das Buch erschien erstmals 1969 im Deutschen Militärverlag
Gestaltung des Titelbildes: Ernst Franta
© 2014 EDITION digital®Pekrul & Sohn GbR Godern Alte Dorfstraße 2 b 19065 Pinnow Tel.: 03860 505788 E-Mail: [email protected] Internet: http://www.ddrautoren.de
WOLFGANG
Wo bin ich, wer bin ich, wie kann ich mich finden? Was habe ich mir dabei gedacht, Doris zu überreden, mit mir in ein Hotel zu gehen, in dieses christliche Hospiz am Hauptbahnhof mit der Bibel und der Zahlkarte für die Brüderschaft von Herrnhut auf dem Nachttisch? Ich habe sie beleidigt. Ich muss sie ja beleidigt haben, ein Zimmer für eine Nacht bitte, im ersten Stock, Nummer 187.
Schnell an dem alten Portier vorüber. Möchten Sie noch etwas trinken, mein Herr, nur was Alkoholisches haben wir nicht. Die Morgenandacht findet um neun Uhr gleich im Hause statt ...
Doris ist mitgekommen, still, fügsam. An den Zimmertüren vorüber, 182, 183, 185. Hohe Damenschnürschuhe stehen auf dem Gang, sieht traurig aus, so eine Reihe altgedienter Schuhe, die die knittrigen Schäfte hängen lassen, die Schuhe frommer Schwestern. Das letzte Zimmer, Nummer 187. Unser Zimmer, ein Spruch auf dem Radio: „Ich will ihr Trauern in Freude verwandeln und sie trösten und erfreuen nach ihrer Betrübnis …“
Kein Licht machen, Liebster. Aber das Fenster führt nach hinten hinaus, die riesigen Scheinwerfer einer Baugrube erhellen das schmale Zimmer, Maschinen stampfen, die Zahnputzgläser zittern, Bagger beißen in alte Kellermauern, widerwärtiges Geräusch. Vor dem Fenster ist kein Rollo. Doris’ Haut ist weiß und kühl, sie zieht die Decke bis zum Hals und hat die Augen geschlossen. Da hast du deinen Willen, Fähnrich. Meinen Willen? Wirklich meinen Willen? Ich liebe dich, ich schäme mich.
Ich drücke auf die Taste des Radios. Jazzmusik, eine Frauenstimme singt, der Gesang ist unsentimental und herb, es ist die Fitzgerald; sie möchte ich einmal formen, eine Kleinplastik der Negersängerin, die Musikalität dieser kraftvollen Frau erfassen und gestalten können ..., aber das ist ein Traum, nichts als ein Traum. Warum denn ein Traum? Was hindert mich, wer hindert mich, das zu tun, wenn ich den Dienst hinter mir habe? Ich werde Doris heiraten, die Kunsthochschule besuchen, das ist möglich, und das werde ich tun ... Ein Traum. Ist Doris vielleicht ein Traum?
Mein Vater ist dagegen, meine Mutter auch. Das ist klar, Mutter hat Vaters Meinung. Sie sind gegen meinen Wunsch, Bildhauer zu werden. Und auch gegen Doris. Das hat Vater nie direkt gesagt, aber ich weiß, dass er gegen sie ist. Nichts gegen die Freundschaft, aber alles gegen dieses kleine Mädchen aus dem Buchladen. Aber was kümmert mich mein Vater? Er lebt ohne mich sogar zufriedener. Bei Doris ist das was ganz anderes, ihr Vater ist blind, und er braucht sie ...
Doris schlägt die Augen auf und sieht mich an. „Komm endlich von diesem Fenster weg und mach den Mund auf“, sagt sie, „was ist los mit dir? Du hast doch was, ich kenne dich …“
Ich setze mich auf den Bettrand und küsse sie und streichele sie, aber sie schiebt mich weg. „Bitte, Wolf“, sagt sie, „was ist geschehen?“
Geschehen. Geschehen ist eigentlich nicht viel. „Du erinnerst dich an Lingner?“, frage ich. „An diesen widerwärtigen Kerl? Er ist wieder da, er ist mir zugeteilt worden, als wohlbestallter Unteroffizier. Das ist doch Schikane …“
„Ich erinnere mich gut“, sagt sie, „es kann ein Zufall sein.“
Sie kennt die Gepflogenheiten nicht. Vor einem Jahr, ich war noch Gruppenführer, war ein junger Rekrut ins Krankenhaus eingeliefert worden, ich besuchte ihn und sprach mit dem Arzt. Der Rekrut hatte eine Bauchwunde und gab vor, hingefallen zu sein. Dem Arzt erschien das seltsam, mir auch. Ich sprach mit dem Rekruten. Er kam mir verängstigt vor, aber er blieb bei seiner Begründung.
Ich redete mit seinen Kameraden. Es stellte sich heraus, dass der Unteroffizier Lingner ihn bestraft hatte. Der Rekrut hatte im Unterricht versagt und die Himmelsrichtungen verwechselt. Daraufhin ließ ihn Lingner unter den Stühlen nach Osten, Süden, Norden und Westen kriechen und bestellte ihn nach dem Unterricht zu sich.
Ich ging wieder ins Krankenhaus und quetschte die ganze Geschichte aus dem Jungen heraus. Während der Rekrut fünfzig Liegestütze absolvieren sollte, war Lingner unaufmerksam oder tat nur so, als wäre er unaufmerksam, jedenfalls blieb der Soldat auf dem Bauche liegen und zählte nur noch. Lingner merkte das, ließ den Soldaten noch zwanzig Liegestütze nachholen und hielt ihm dabei das aufgeklappte Taschenmesser unter den Bauch. Der Rekrut machte schlapp und fiel in das Messer.
Ich nahm mir den Unteroffizier vor und verlangte von ihm Rechenschaft. Lingner war erst achtzehn Jahre alt und sagte: „Ich bin auch so hart ausgebildet worden, und heute will ich gute, harte Soldaten ausbilden, der Formal-Dienst verlangt den Leuten viel zu wenig ab.“ Ich war einigermaßen entsetzt, weil ich erwartet hatte, einen zerknirschten Ausbilder anzutreffen, ich wollte mit ihm die Angelegenheit bereinigen, denn der Rekrut hatte mich gebeten, die Sache auf sich beruhen zu lassen, weil er Angst hatte. Aber nun machte ich eine Meldung und verlangte die Bestrafung Lingners. Nicht allen meinen Vorgesetzten war das recht, der Nagold-Prozess war erst vorbei, die Presse überschlug sich noch, das Ausland schlachtete die Vorfälle aus, nicht nur der Osten, auch unsere Verbündeten, und so wurde das Verfahren schnell „abgewickelt“. Fast alle Zeugen - bis auf den Unteroffizier Baer - rückten von mir ab, und der Unterausbilder wurde vom Oberamtsrichter für vier Wochen in den Jugendarrest geschickt. Er kam so milde davon, weil das Gericht der Meinung war, dass er „als Jugendlicher die Tragweite seiner Taten noch nicht recht begreifen konnte“. Ich verstand das nicht.
Ich begriff auch nicht die Rekruten, die mir gegenüber immer verschlossener wurden. Aber Baer sagte zu mir: „Die Rekruten betrachten dich nicht als Freund, das werden sie nie tun. Du wirst bald versetzt, ein anderer wird kommen. Für die Rekruten bist du Offizier, die Obrigkeit, die Macht. Du setzt dich für sie ein. Aber davon hast du doch keinen Schaden. Sie haben nur den Schaden, wenn du dich für sie verwendest ...“ Baer stellte nach dem Prozess den Antrag, als Wehrdienstverweigerer anerkannt zu werden, und er schaffte es auch. Nach langen Verhandlungen kam er damit durch. Ich aber ließ mich in der Rüstzeit von Pfarrer Branstner, dem Geistlichen der Truppe, überzeugen, nichts zu unternehmen. Nun aber war Lingner wieder da, Unteroffizier Lingner ... Ich gebe zu, inzwischen hat sich manches in der Truppe geändert; die Ausbildung eines überzeugten Soldaten steht im Vordergrund, sagt der Kommandeur, Lingner aber ist ein Platzeck.
„Du hättest sehen sollen, wie er vor mir stand, als er sich bei mir meldete, nein, er griente nicht, aber er hatte einen Ausdruck im Gesicht wie eine Eule bei Nacht. Ich habe das Gefühl, dieser Mann hat sich nicht geändert …“
„Er ist doch jung, er kann sich geändert haben, du bist ganz einfach fertig, Wolf“, sagt Doris.
Sie küsst mich, ich möchte mich bei ihr entschuldigen, dass wir in dieses dämliche Hotel gegangen sind, aber ich vergesse das, während sie mich küsst, während das Radio den Straßenzustandsbericht sendet, während die Bagger schrappen und die Scheinwerfer ihr grelles Licht in das Zimmer gießen ...
Ich liebe dich, ich liebe dich, Doris, morgen werden wir mit dem Wagen wegfahren, ich hole dich ab, wir fahren gleich los und sind am späten Nachmittag schon an der Küste, und das eine Wochenende wird sich dein Vater mal behelfen können. Wir werden zusammen sein, als gäbe es nichts weiter auf dieser Welt, keine Eltern, keinen Dienst, keinen Lingner.
DORIS
Wolf kann sich nicht verstellen! Ich merke ihm seine Gefühle an, und ich spüre seine Gedanken. Mein Gott ja, mir ist es auch nicht lieb, in ein Hotel gegangen zu sein wie eine ... na ja, aber wir sind nicht verheiratet und können nicht zu seinen Eltern gehen. Vielleicht könnten wir hingehen, aber ich will das nicht, mir reicht das Gehabe des Professors schon, wenn wir uns irgendwo mal begegnen. Uns trennt eine ganze Welt. Aber ich bin sehr froh, dass Wolfgang dieser Welt immer weniger angehören will ... Er mag seinen Vater nicht.
Wir hätten zu uns gehen können. Vater würde nichts dagegen sagen, wenn ich Wolf mit in mein Zimmer nähme. Er würde nichts sagen, aber was würde er denken?
Wolfgang schläft. Im Radio spricht Grzimek, der für die Erhaltung der Kängurus eintritt: „Es sträuben sich einem die Haare, wenn man liest, in welch ungeheurem Ausmaß das Wappentier Australiens sich jetzt in Schuhleder und Hundefutter verwandelt ...“ Ich möchte abschalten, aber Wolfgangs Kopf liegt auf meinem Arm. Er könnte wach werden, wenn ich mich bewege.
Wie spät ist es? Ich möchte Vater noch abholen, er findet zwar den Weg allein, aber ich muss mit ihm in aller Ruhe die Fahrt an die See besprechen können ... Schrecklich grell, dieses Scheinwerferlicht, schrecklich das ganze Zimmer, der handgemalte Spruch über dem Bett: „Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben, niemand kommt zum Vater denn durch mich!“ Sehr sinnig, einen solchen Spruch übers Bett zu hängen.
Du gehörst mir, Wolfgang. Wie kann ich dir das übelnehmen? Was ist schon ein Hotel. Die zwei Tage an der See werden uns guttun, wie freue ich mich darauf. Wir brauchen nicht in ein Hotel zu schleichen, um zusammen sein zu können. Und auch Vater wird sagen: „Da kommst du endlich mal ’raus Dor, Frau Biswanger wird sich schon um mich kümmern ...“ Vater. Ich finde, er wird immer kleiner in den letzten Jahren. Ich habe ihn nur als blinden, sehr geduldigen und liebevollen Menschen kennengelernt, der in der Fensterecke der kleinen Mietswohnung saß und Blockflöte spielen lernte oder aus Stoffresten Puppen bastelte, um mir selbst erdachte Märchen vorspielen zu können, ernste Märchen, frohe Märchen, die meist in der Zukunft spielten: Es wird einmal gewesen sein.
Wir lebten in einer mitteldeutschen Stadt, die Ende des vorigen Jahrhunderts direkt über den reichen Kali- und Salzvorkommen erbaut worden war. Die Besitzer der Gruben waren reich geworden, aber sie hatten nicht daran gedacht, auch für die Sicherheit der Bergarbeiter und ihrer Wohnungen zu sorgen. Die Stollen wurden ausgebeutet und dann verlassen. Riesige Hohlräume entstanden unter der Stadt, allmählich sackte die Erde nach, Senken und Talstraßen bildeten sich, Häuserwände wurden rissig, Mauern neigten sich, und sogar das einzige Wahrzeichen der Stadt, der SCHIEFE TURM, wurde schiefer als der Turm von Pisa und musste zum Bedauern der Einwohner abgetragen werden, da er die umliegenden Häuser gefährdete.
Mein Vater war nicht immer blind. Er war ein begeisterter Motorenbauer, ein Spezialist für Diesel, und später Montagemeister in den Junkers-Flugzeugwerken. „Besser als auf Menschen verstand er sich auf Maschinen“, erzählte meine Mutter. Nach dem Kriege arbeitete sie in einer Miederwarenfabrik, während Vater unentwegt übte. Die Blockflöte wurde von anderen Instrumenten abgelöst: der Klarinette, dem Saxofon und der seriösen Konzertflöte. Der blinde Mensch erzwang sich einen zweiten Beruf.
Im April des Jahres 1945 war Vater noch zum Volkssturm geholt worden, ich war damals drei Monate alt. Im Mai führte eine Rote-Kreuz-Schwester meine Mutter in einen Klassenraum der Bismarckschule, die als Lazarett diente. Mutter musste sich erst an das Halbdunkel des Raumes gewöhnen, in dem über zwanzig stöhnende, weinende, murmelnde Blinde lagen. Vaters zitternde Finger tasteten über ihr Gesicht, als müssten sie das Bild der eigenen Frau völlig neu entdecken, sie war von nun an die Frau eines Blinden und konnte sich daran nie gewöhnen. Sie war erst fünfundzwanzig Jahre alt.
Mein Vater machte in den fünfziger Jahren schon Musik im Konzerthaus Ramsch. Jeden Mittwoch, Sonnabend und Sonntag spielte er zum Tanz. Ich kam in die Schule, lernte gut und leicht. Meine Mutter verdiente gut, denn alle Frauen wollten endlich wieder schicke Miederwaren tragen, die Fabrik lieferte ihre Produkte in dreißig Länder und konnte sich vor Aufträgen nicht retten; unser graues Mietshaus, das in der Abbruchzone stand, mussten wir verlassen, wir bekamen eine sonnige, schöne Neubauwohnung am Rande der Stadt - es hätte so bleiben können, denn es war gut so. Aber meine Mutter überredete Vater, alles im Stich zu lassen und in den Westen zu gehen. Sie konnte es nicht mehr aushalten, sie wollte was vom Leben haben, all die Dinge, die sie drüben im Werbefernsehen zeigten, sie wollte wie „die drüben“ leben ... Mir erzählten sie davon nichts. Ich war in der neunten Klasse. Wir fuhren nach Westberlin, angeblich um Tante Claudia zu besuchen, eine Nenn-Tante meiner Mutter. Als wir am Bahnhof Zoo ausstiegen, sagte mir Mutter, dass es keine Rückkehr für uns gäbe. Was sollte ich tun? Ich hätte zurückfahren können, Onkel Paul hätte mich aufgenommen. Aber sollte ich Vater verlassen? Vielleicht ahnte ich damals schon etwas. Ich blieb. Vater sprach mit mir nie über die Gründe, die ihn bewogen hatten, die Heimat zu verlassen, ich wusste aber, dass er Angst hatte, seine Frau zu verlieren. Und im Jahre 1960, wenige Monate nach unserer Ankunft in der niedersächsischen Stadt, verließ Elisabeth Rappsilber ihren blinden Mann, um einen betagten Mitinhaber der Derial-Sonnenkosmetik aus dem Hause Drugofa zu heiraten.
Wie ich sie hasse! Vater hatte Mutter aus Liebe geheiratet, sie war zwanzig Jahre jünger als er. Es traf ihn hart. Ich hatte viel geahnt und manches gesehen: die großen und kleinen Lügen meiner Mutter; die forschenden Blicke, mit denen sie den Blinden betrachtete („Vielleicht ahnt er etwas, aber er kann doch nichts wissen, ich bin vorsichtig gewesen!“ Blicke wie Schlangenbisse); die schmierige Kunst, für ein paar Stunden ein treues Eheweib oder eine liebevolle Mutter zu spielen; die ausgehöhlten, routinierten Ratschläge; die durch Boten abgegebenen Blumensträuße und die duftenden Briefe aus dem Hause Drugofa, das ganze groteske Getue einer verliebten Vierzigerin ...
Hatte Vater nichts geahnt? Er hatte nichts gewusst, und ich wagte keine Andeutung. Seinetwegen wagte ich es nicht. Glaubte ich, dass sich diese Ehe wieder normalisierte? Ich wusste es nicht, ja ich wusste nicht einmal, ob ich es wünschte oder hoffte, ich hatte genug mit mir selber zu tun, ich war nicht gerade glücklich. Ich ging wieder in eine Oberschule, aber ich konnte mich nur schwer einleben. Das hatte nichts mit Gewöhnung zu tun, alles war anders. Meine eigenen Maßstäbe und Ansichten galten nichts, oder sie wurden mitleidig belächelt. Für viele Mitschüler war ich eben die Kleine aus der Zone. Andere Republikflüchtige gaben mir weise Ratschläge und gebärdeten sich westdeutscher als die eingeborenen Westdeutschen. Ja, alle gaben sich Mühe, o ja. Der Geschichtslehrer nahm mich mit Klippschulfragen dran, um es mir nicht so schwer zu machen. Alle bemühten sich, aus mir einen anderen Menschen zu machen. Aber keiner fragte mich, ob ich denn überhaupt ein anderer Mensch werden wollte. Vater meinte traurig, dass ich mit der Zeit schon Kontakt und Freunde gewinnen werde. Er hatte recht. Aber die Lehrer ärgerten mich, sie taten so, als hätte ich noch nie eine ordentliche Schule von innen gesehen.
Ich lernte wie eine Maschine. Manches war eine Wiederholung für mich. Ich lernte ohne Widerspruch. Ich begann schon, anders zu werden. Vater quälte es, er machte sich Vorwürfe, aber über sich selber sprach er nicht, bis vor einigen Monaten hat er nicht über sich selber gesprochen ...
Ich war gerade sechzehn geworden, als Mutter von ihrer neuen Arbeitsstelle, einer Drogerie, nicht mehr nach Hause kam, sondern einen schwülstigen Abschiedsbrief schickte, in dem sie Gott und die Nenn-Tante Claudia beschwor und versicherte, alle Kosten für die Scheidung übernehmen zu wollen. Ich musste Vater den Brief vorlesen, zweimal, dreimal. Er begriff ihn nicht. Er saß, gekrümmt, grausträhnig, bleich, alt, vor mir, seine Lippen bewegten sich, und ich hatte Tränen in den Augen und schämte mich für diese Frau, die meine Mutter war, die leider Gottes meine Mutter war. Ich hasste sie von Stund an, während sie mir vorher nur gleichgültig gewesen war. Ich wünsche ihr heute noch, dass sie am Sonnenöl ihres alten Galans ersticken möge.
Vater ging von nun an in ein kleines Café, Abend für Abend, musizierte und spielte auf Wunsch der Gäste sogar Passagen aus Verdi-, Wagner- und Mozartopern. Ich sollte die Schule nicht verlassen, über einen vorzeitigen Abgang war mit ihm nicht zu reden. Und so lernte ich weiter gut und lernte auch einzusehen, was für mich nützlich und was schädlich war.
Zugegeben, ich wäre damals noch gern zum Bahnhof gegangen, hätte gesagt: „Einmal Magdeburg bitte, ohne Rückfahrt“, um dann von der betriebsamen Stadt an der Elbe aus noch eine Dreiviertelstunde lang durch die flache, fruchtbare Börde bis in die kleine graue Salzstadt zu fahren, aus der mir noch Bärbel Kükenbusch und „Pakel“ Wollner schrieben, meine Freunde, mit denen ich mich auch einmal in einer Autobahnraststätte bei Genthin getroffen hatte und die an der Humboldt-Universität studieren wollten.
Aber ohne Vater? Nie. So verblasste dieser Wunsch. Und die Briefe der Freunde kamen spärlicher und verpuppten sich dann zu nichtssagenden Festtagsgrüßen.
Ich aber lernte Ingo Timm kennen, den Redakteur der Schülerzeitung FÄLLE, den disputgewaltigen, klugen Abiturienten, den sogar der Geschichtslehrer, ein ehemaliger Hauptmann der Wehrmacht, respektierte. Manchmal verbot die Schulleitung seine Zeitung, dann kursierten die beanstandeten Artikel als Flugzettel, und so ließ man es sein und fand sich mit der Existenz des frechen Blättchens ab. Ingo kämpfte immer. Er war lässig gekleidet, hatte eine bleiche Gesichtsfarbe, kohlschwarze Haare und lange, schmale Hände mit rauchgelben Fingerspitzen. Die Schule strengte ihn nicht an.
Ingo faszinierte mich. Er wurde von manchen Lehrern verhöhnt, er lachte darüber. Im Kollegium verlangte man in jedem Jahre einmal seine Relegierung, es schien ihn nicht zu kümmern. Auf einer Wahlkundgebung des dicken Professors schrie er sich stockheiser und nahm das hin wie einen Sieg. Als sich die Alt-Nazis trafen, prügelte er sich, verlor zwei Vorderzähne und ging nach Hause, um seinen Artikel zu schreiben. Er begriff alles mit seinem logischen Verstand. Als ich in seinem Redaktionskabuff auftauchte, erregt und sehr verlegen, begann er mit mir über die Gefahren der Automation, über Entfremdung und Max von der Grüns Buch zu diskutieren, als wäre ich deswegen gekommen.
Ich brauchte ihn. Glaubte ich damals, dass auch er mich brauchte? Er war nicht arm an Gefühlen. Er konnte sich an der Ordnung eines harmonisch geäderten Herbstblattes begeistern, dem Farbenspiel der untergehenden Sonne zuschauen, er empfand das Aufblühen einer Wasserrose unter wärmenden Strahlen als eine spannende Angelegenheit. Aber alles um sich herum, aber auch alles gliederte er in Probleme auf. Es war interessant und anstrengend, mit ihm zusammen zu sein. Ich lernte durch ihn, den Blick wieder auf die Gesamtheit zu richten und das Banale vom Wesentlichen zu trennen, es war, als würde Verschüttetes frei.
Wenn wir in einen Jazzkeller gingen oder zum Tanzen, nahm Ingo einen Freund mit. Weil ich gern tanzte. Und weil er es nicht konnte. Er fand es unsinnig, zu shaken und die Hände zu schütteln, „als wollte man Wäsche aufhängen“.
Bei einer solchen Gelegenheit lernte ich seinen Freund Wolfgang Wittig kennen. Ich wunderte mich über das ungleiche Freundespaar. Ich täuschte mich in Wolfgang, glaubte zuerst, er sei ein affektierter Angeber, das machte seine äußere Erscheinung. Aber dann merkte ich, dass er ein anständiger Junge war, ein Kamerad. Er hatte Minderwertigkeitskomplexe. Ingo war da ganz anders, der kannte seinen eigenen Wert, er überschätzte sich nicht, aber er taxierte sich auch nicht unter Wert. Er kannte sich eben. Real und sachlich schätzte er andere Menschen ein, nicht nach ihrer zur Schau getragenen Totalität, nein, Ingo erkannte sie an simplen, manchmal geringfügigen Äußerungen oder Handlungen, die wie Witzbolde aus den Taschen der „Totalität“ herauslugten und sich nur ihm - wie es schien - zu erkennen gaben.
„Wolfgang müsste aus dem stinkvornehmen Chloroformhaus seines lieben Papis heraus“, meinte Ingo. „Es ist ein guter Junge, aber du musst ihn immer antippen, von allein kommt er nicht darauf, etwas in seiner Umgebung oder in seinem Leben zu verändern …“
Wolfgang verliebte sich in mich. Ingo merkte es und billigte es. Damals standen die Jungen im Abitur. War ich mir meiner Gefühle von Anfang an klar? Bewahre. Eine Tatsache war mir bewusst: In Ingos Leben war ich ein Auch-Etwas, er zählte zu jenen Menschen, die sich nie über Einsamkeit beklagen werden. Wolfgang dagegen war ein Suchender, und das ist er heute noch, er betrachtet das Leben mit großem Abstand und hat seinen Platz darin noch nicht gefunden. Und ich? Mein Gott, meine Gefühle wären bei Ingo Timm zu kleinen Sehnsüchten verkümmert, und es ging Ingo auch nicht nahe, als wir uns trennten. Ingo ist ein starker Mensch.
Mir ist klar: Ich liebe Wolfgang. Ich liebe ihn nicht nur, weil ich mich an ihn gewöhnt habe, an seine höfliche Zärtlichkeit, an seine Korrektheit, die er auch nicht verliert, wenn er sich unsicher oder minderwertig fühlt. Und er fühlt sich oft minderwertig, dieser große Junge, der viel zu sensibel ist, um militant sein zu können, der davon träumt, Plastiker zu werden, studieren zu können, und der manchmal glaubt, zu viel Zeit zu verlieren und eines Tages nicht mehr den Ton formen zu können ...
Ich warte eine ganze Woche auf den Sonnabend, kurz vor achtzehn Uhr kommt er in den Buchladen. Als letzter Käufer ersteht er eine neue Sagan, einen Cronin, Salinger oder Braine, begrüßt der Reihe nach alle Verkäuferinnen, die mich um den gut aussehenden jungen Mann beneiden, und draußen steht sein kleiner Fiat, seit einem Jahr nicht mehr der alte Dixi mit dem Geranien-Blumenkasten unterm Heckfenster, nein, ein neuer, vanillefarbener Fiat, in den wir uns setzen, um irgendwohin zu fahren, zu essen, zu tanzen, zu trinken, zu küssen ...
Werd wach, mein Freund, es geht auf Mitternacht, ich will Vater aus seinem Café holen und nach Hause bringen.
Wolfgang bewegt sich, ich küsse ihn. Plötzlich ist er hellwach, stützt sich auf. „Was ist denn?“, fragt er. „Ist was geschehen?“
„Natürlich“, sage ich, „natürlich ist etwas geschehen, du Dummer, hoffen wir, dass nicht zuviel geschehen ist …“ Ich stehe auf und gehe zum Spiegel und schalte das Licht über dem weißen Waschbecken ein. Er sieht argwöhnisch zum unverdunkelten Fenster.
„Du könntest ...“, sagt er.
„Kein Rollo ...“
„Dann lass doch das Licht...“
„Ach, Wolf, wozu? Draußen ist nur die Baugrube.“
„Und die Arbeiter, sie könnten dich so sehen, wie du bist, ohne was …“
„Wie bin ich denn?“
„Schön bist du.“
„Wenn du mich so ansiehst, dann schalte ich das Licht wieder aus. Lies doch in der frommen Schrift auf dem Nachttisch, Liebling.“
„Du bist ein frivoles Geschöpf.“
„Mit dem du morgen an das kalte Wasser willst.“
„Vorher möchte ich noch Ingo bei seinen Irren besuchen.“
„Tu das, es ist gut, wenn du mit ihm sprichst, wir hätten uns schon längst mal wieder um ihn kümmern sollen ...“
„Kommst du mit?“
„Vielleicht.“ Ich lasse das kalte Wasser in meine hohlen Hände fließen und halte das Gesicht hinein. Das tut gut. Würde ich gern mit Ingo sprechen? Ich weiß es nicht, vielleicht möchte ich es, nur dürfte Wolf dann nicht dabei sein.
INGO
Es ist verdammt voll hier, voll und laut, die Menschen sind froh, an diesem Abend draußen sitzen zu können, auf den Terrassen des Cafés Kröpcke, und sie nehmen keine Rücksicht auf mich. Still, Ruhe, Leute, hier sitzt ein angehender Journalist, der Hilfspfleger Timm, sprecht leise, ich muss nachdenken und einen Artikel schreiben, der euch erschüttern wird, einen Artikel über einen Abgeordneten, der aus Liebe zur Politik den geliebten bunten Rock ausziehen und in den Landtag einziehen wird, die Geschichte des Hauptmanns Gaul, eines Mannes der neuen Partei, von der ihr noch einiges erleben werdet. Ja, es geht euch an! Dich da, Mädchen am Nachbartisch, du schreibst den ersten Antwortbrief an deinen Liebsten, und deine Mutter sitzt dabei und sagt dir, wie und was du zu schreiben hast, schreib ihn allein, diesen Brief, lass dir nicht dreinreden, es ist doch dein Liebster und nicht ihr Liebster ... He, und ihr, Mädchen, ihr Drallen, geschminkt und gebadet, die ihr zu dieser Stunde kurz vor Mitternacht vor die Türen der Kongo-, Antillen-, Florida- und Heubodenbars tretet, wartet nur, eure Kundschaft wird zackiger werden, wenn erst der Hauptmann im Landtag und bald in der Regierung sitzen wird ... Pst, du grauhaariger Dirigent im Barocksaal der Königlichen Herrenhäuser-Gärten, der du zu dieser späten Stunde die Athalia, das dritte Händel-Oratorium, dirigierst, es geht um deinen Sohn, du hast ihn falsch erzogen, hast ihm gesagt, wir trügen die Schuld am letzten Kriege, der Gaul hat’s bestritten, aber dein Sohn, Dirigent, kommt ja bald in die Wehr und wird seine schlappen Ansichten ad acta legen müssen ...
Noch hören mich die Leute nicht. Sie denken, da sitzt einer am Cafétisch, trinkt seit einer Stunde an einem Mokka und einem Kognak, kritzelt viele Zettel voll und hat wohl Langeweile. Hat sich was, Langeweile. „Ober, noch einen Asbach- Uralt, bitte!“
Ihr hört mich noch nicht, aber ihr werdet mich lesen, ihr sitzt hier und löffelt Schlagsahne und habt einen sonnigen Tag gehabt, um euch herum rollen die Autoschlangen, klingeln die Straßenbahnen, flirren die Lichtreklamen: Pack den Tiger in den Tank! Stahl von Hoesch! In Geldsachen Volksbank! Pigalle! Ein Abend im „Jenseits“ nicht teurer, aber besser! Sehen und gesehen werden mit einem VW! Nichts zwickt und zwackt im Götzburg-Hemd mit Achselstretch! Vorhang auf für das tägliche Leben, das packendste Spiel, das es gibt!
In Stahl und Beton steht heute der Platz am Kröpcke, hochstöckige Häuser, in denen nur noch wenige von denen leben, die vor zwanzig Jahren wie Tiere unter der Erde hausten und mit angekohlten Holzstempeln ihre Wohnlöcher stützten. Das Leben geht weiter, mitmachen, dabei sein, festhalten ... Teufel, das ist doch ein Aufhänger für den Artikel! Nach dem Luftangriff meldeten sich im Zentrum dieser Stadt noch zweihundertsechzehn verängstigte Menschen, zweihundertsechzehn von fünfundvierzigtausend, um ihre Lebensmittelmarken zu empfangen und wieder zurück in die Keller zu kriechen. Ihr habt es vergessen, jawohl vergessen, ihr erinnert euch nicht mehr, ihr zeigt heute den prächtigen Maschsee, den Prunkbau des Rathauses, den modernen Marktplatz, den restaurierten Beginenturm, das protzige Hochhaus der Gummiwerke, die Fußgängertunnel und Hochstraßen, ihr könnt und sollt das auch zeigen, aber vergesst doch den Gaul nicht und nicht die andern ... Wer wird das schon lesen? Unser Blatt wird nicht ausgeschrien. Die Kioskbesitzer hängen es nicht an die Sichtfront ...
Der Ober bringt den Kognak. Hubert könnte eigentlich hier sein. Ich muss morgen früh um fünf in meiner lieben Anstalt erscheinen und will heute Nacht noch den Artikel schreiben. Morgen Mittag will Wölfchen kommen, ihn müsste ich mal fragen, ob er den Hauptmann Gaul kennt ...
Manche Menschen erinnern sich an ihr viertes Lebensjahr. Ich war zwei Jahre alt, als eine Streife der Feldgendarmerie den kleinen Pferdewagen stoppte, auf dem meine Eltern ein paar Habseligkeiten und Erinnerungsstücke verstaut hatten. Die Gendarmen forderten Vater auf, auszusteigen und sich einem Volkssturmbataillon anzuschließen. Vater war während eines Fallschirmabsprungs über Kreta zum Krüppel geschossen worden, er weigerte sich, den Wagen zu verlassen. Er würde keine Waffe mehr in die Hand nehmen. Da erschossen sie ihn auf der Stelle. Mutter lud den Toten in den Wagen und fuhr westwärts weiter, mit einem toten Mann und einem kleinen fieberkranken Jungen. Ich weiß nicht, ob ich mich bewusst daran erinnere. Aber Mutter hat mir so oft davon erzählt, dass ich meine, mich selber genau daran erinnern zu können.
Ein zweites Ereignis nahm ich schon bewusst wahr. Wir lebten auf dem Hofe eines Bauern an der Saale, hatten ein Bett in einer Bodenkammer, und Mutter tat alle Arbeit, die anfiel. Sie scheuerte, wusch, sortierte Kartoffeln, fuhr den Mist aufs Feld, fegte den Hof, kochte für die Knechte. Eines Abends torkelte der Bauer in die Kammer und griff nach Mutter. Sie wehrte sich. Ich schrie, klammerte mich an den Bauern, der mich in eine Ecke der Kammer schleuderte, wo ich wimmernd vor Schmerzen liegen blieb und ansehen musste, wie die Erwachsenen miteinander rangen. Was noch geschah an diesem Abend, wusste ich nicht, ich war nicht mehr bei Besinnung. Seit diesem Tage habe ich meinen runden Rücken, meine Schulter war verletzt worden. Wir aber fuhren wieder weiter.
Als ich 1950 in die Schule kam, lebten wir schon in dieser Stadt, Mutter arbeitet seit dieser Zeit in Körners Hotel, damals trug sie Speisen aus, half mal in der Küche, vertrat auch die Köchin, bis die Körners merkten, wie gut Mutter zu kochen verstand. Sie rückte zur ersten Köchin auf. Sie erzog mich ohne jede Illusion, prüfen sollte ich alles, nur mit eigenen Augen sehen, nichts auf Treu und Glauben hinnehmen, misstrauisch sein gegen jedermann. Von ihr hörte ich nie wundersame Geschichten oder Märchen ...
Mutter heiratete nicht wieder, aber einige Zeit lebte sie mit dem Werkzeugschlosser Arno Holtz zusammen. Durch ihn lernte ich, die Welt ein wenig freundlicher zu sehen. Holtz war Kommunist und glaubte an eine Perspektive für die Menschheit, an eine Ordnung ohne den Krieg.
Als ich in die Oberschule kam, sagte Holtz zu mir: „Du hast es nicht nötig, im Windschatten derer zu leben, die das Geld und die Macht haben. Du darfst nicht in ihre Fallen gehen, die sie an den Schalthebeln der Presse, des Funks, der Schule, des Films stellen. Sie wollen ja, dass ihr ’rumgammelt, James-Deans-Jacken tragt, tobt und krawalliert. Tut ihr das, so haben sie euch in der Hand und lassen euch nach ihrem Willen tanzen. Denke selber, lass es dir nicht abnehmen ...“
Fünf Jahre lang lebten wir zusammen, dann brachten Arnos Arbeitskollegen ihn eines Tages nach Hause. Während einer Reparatur an einer fünfzölligen Heißwasserleitung hatte er sich die Brust verbrüht. Er lebte noch vier Tage, ich ging während dieser Zeit nicht in die Schule, lauschte den Worten des Schwerverletzten und war bei ihm, als er einschlief, sich aufbäumend, denn er wollte nicht sterben, er hatte viel Kraft.
Ich vergesse Arno Holtz nicht. Ich kann mir noch heute seine Worte vorsagen. Als Junge schon stellte ich mir meine Zukunft vor: Ich will nie ein zufriedenes Leben führen, ich will lernen, das Wort zu beherrschen, Artikel zu schreiben, immer gegen das Unrecht angehen, in welcher Form es auch auftritt.
Ich war ein verdammt unbequemer Schüler. Es fiel mir nicht leicht. Manchmal wäre ich lieber bequem gewesen, und es war gut, dass Mutter mich unterstützte. Mutter hasste den Krieg. Als der Krieg in Vietnam sich verschärfte, sagte sie:
„Hätte ich die Macht eines Papstes, der Präsident der USA wäre schon lange von mir verflucht worden!“
Als die Werber in die Penne kamen, stimmten fast alle Primaner zu, Offizier zu werden. Ich nicht. Ich habe ihnen so einen auswendig gelernten Satz gesagt: „Ich will nicht der verlängerte Arm der Mörder meines Vaters sein, lieber rot als tot.“ Das hat sie ganz schön geschockt. In der Pause sagte Wolf zu mir: „Denen hast du es aber gegeben!“ - „Und du?“ fragte ich. „Du bist auch zu Ostern mitmarschiert, was lockt dich denn an diesem Betrieb?“
Er druckste. „Nimm an, ich war zu feige. Nimm an, ich gehe hin, weil es vielleicht eines Tages einen militanten Humanismus geben wird ...“
„Sprüche machst du“, sagte ich ärgerlich, „wie Monsignore Müller im ,Wort zum Sonntag‘ ...“ Mit mir ging‘s dann los.
Als ich auch noch den normalen Wehrdienst verweigerte, hieß es: „Welche Gründe bewogen Sie, Herr Timm? Moralische, politische, religiöse? Ist es ein Gewissensentscheid?“ Ich studierte Verhandlungsprotokolle, ich wusste, dass sie viele reingelegt hatten. Mich sollten sie nicht aufs Kreuz legen.
„Sie junger Spund“, sagte der Vorsitzende des Prüfungsausschusses zu mir, „was reden Sie von einem Angriffskrieg. Sie wissen ja, dass es um den Schutz einer bedrohten Lebensordnung geht. Sie können ja gar nicht davon ausgehen, dass Sie als Soldat einmal an einem Angriffskrieg teilnehmen müssten …“
Ich lachte frech. „Wenn über Angriffskriege bei uns weder geschrieben noch diskutiert wird“, sagte ich, „dann darf es also keine mehr geben? Schutz einer Lebensordnung! Solche Töne gab es bei den Nazis schon. Dann hat sich Deutschland gegen Holland und gegen die Sowjetunion verteidigen müssen? So müssen sich wohl die Vereinigten Staaten gegen Vietnam verteidigen?“
„Sie sind jung, also auch leichtfertig“, sagte der Vorsitzende. Er war so einer von der Sorte, die von der Vergangenheit nicht reden und von der Zukunft nichts wissen, aber uns vor ihrem Karren haben wollen.
„Ich sehe Ihnen manches nach. Was würden Sie tun, wenn Sie nicht nur von mir, sondern auch von anderen Instanzen als Kriegsdienstverweigerer abgelehnt würden?“
„Ich würde immer verweigern, solange sich hier nichts geändert hat ...“
„Sie würden immer verweigern? Das kenne ich. Wenn Sie erst im Bau sitzen, überlegen Sie sich das sehr genau …“
„Lieber im Bau sitzen oder in einer Anstalt Idioten pflegen, das kommt mir menschlicher vor“, sagte ich. Und das musste ich dann tun und tue es noch ...
Dem Ober verzehre ich anscheinend nicht genug. Tut mir auch leid, würde gern noch einen Asbach trinken, aber die Moneten lassen es nicht zu. „Entschuldigung“, sagte der Ober, „sind Sie Herr Ingo Timm?“
„Ja, bin ich.“
„Sie werden am Telefon verlangt. Ich glaube, ein berühmter Schauspieler will Sie sprechen.“
Am Telefon ist Hubert. „Heute wird es nichts mehr“, sagt er mit seiner amüsant heiseren Stimme, „ich schaffe es nicht, sitze mit dem Wagen bei Peggy fest. Wie war es denn bei dir? Lohnt es sich, über diesen Gaul was zu machen?“
„Allemal“, sage ich, „da kommt was auf uns zu. Der Mann liebt Bismarck, Friedrich den Großen und Feldmarschall Schörner, hält Stauffenberg für einen ganz Schlimmen und behauptet, die Tschechen hatten selber schuld, dass Hitler in ihr Land einfiel ...“
„Himmel, hör schon auf“, sagt Hubert, „da der Mann ja nicht zu deinen Idioten zählt, müssen wir sogar was machen, aber schnell, wir müssen am Montag schon zur Druckerei mit der neuen Ausgabe unseres Weltblatts. Schaffst du das?“
„Na klar.“
„Aber mach die Geschichte spannend, will sagen, lesbar, kein Leitartikel wieder, Ingo …“
„Was denkst du von mir?“
Hubert lacht. „Ich kenne dich doch. Du träumst doch davon, Leitartikler zu werden!“
Wie der mich kennt ...
HUBERT
Ich, Hubert Möller, Jahrgang 1927, sitze schon die fünfte Stunde im Atelier Peggy Pücklers, schlürfe verdünnten Sprit und lasse mich aus fünf Tonsäulen, die im ganzen Raum versteckt sind, per Stereo berieseln. Unentwegt plärren die Rolling Stones. Ich habe Kopfschmerzen. Aber was soll man machen, Peggy behauptet, sie brauche das, sonst schaffe sie heute die Gestaltung nicht mehr. Verrücktes Weib, eine normale Grafikerin wäre mir lieber, aber woher nehmen und nicht stehlen? Peggy macht die ganze Gestaltung für vier Hefte pro Monat und verlangt fünfhundert Mark. Wir finden keinen anderen, der das so billig macht. Und dann hat sie mitunter sogar Einfälle, wenn sie getrunken hat.
Wenn nur diese sogenannte Musik nicht wäre, könnte ich sogar den Sprit und Peggy ertragen ...
Sie trägt einen schwarzen, eng anliegenden Hausanzug, ist mit Farbe bekleckst und qualmt eine Zigarette nach der anderen.
„Noch ein paar Sachen, Chef“, sagt sie, „was machen wir denn mit dieser Geschichte, in der ein Boy aus der Zukunft in die Gegenwart zurückkehrt und von den Menschen erschossen wird? Eine schöne Geschichte, schön verrückt, ich verstehe sie zwar nicht, aber sonst ...“
„Das macht nichts, Peggy“, sagte ich, „du verstehst manches noch nicht, trotz deiner fünfundzwanzig Jahre. Mach mir nicht zu viel damit, den Titel DUNKLES ZWISCHENSPIEL nur mit Schriftlösung und auf der nächsten Seite vielleicht so eine Fratze des Sheriffs, der diesen Mörder versteht, der den Burschen aus der Zukunft erschossen hat ...“
„Hem, vielleicht geht das“, meint Peggy, gießt sich ein Glas Sprit ein, kippt Wasser dazu und fragt laut: „Was steht denn hier? ,Ich hab einfach rot gesehen. Er hat meine Schwester geheiratet, mit ihr geschlafen. Ich war so irrsinnig vor Wut, dass ich mich nicht einmal daran erinnere, das Gewehr geholt zu haben!‘ Vielleicht nehmen wir diese Zeile mit in den Titel rein, Hubert. Machen wir mal ne Pause, überleg dir, ob das dann alles ist ...“
Sie macht sich auf der Couch breit. Breit ist nicht der richtige Ausdruck, sie ist ja schlank wie so ein knabenhaftes Mannequin aus Frankreich, und ich überlege. Ja, ich überlege, die Peggy lässt mich kalt, die könnte sich ausziehen, sie ist nicht mein Typ, ihr fehlt etwas, ich habe noch nie erlebt, dass ihr irgendwas mal naheging, sie nimmt das Leben, wie es ist und wie es kommt, sie hat ja auch einen reichen Herrn Papa, der ihr sogar den Spleen erlaubt, für fünfhundert Mark im Monat für eine radikale Zeitschrift zu arbeiten.
Ich denke nach. Die Geschichte über den Porsche Carrera, fertig. Die Story über amerikanische Abhörsender, „Vorsicht Wanzen“, auch gestaltet; sehr gut hat sie das gemacht. Eine Glosse über die Bundeswehr, mit Karikaturen, die wir aus einer satirischen Zeitung geklaut haben, auch in Ordnung. Die Protestsongs über Vietnam fertig. Der Artikel „Ehe mit roten Mädchen“, den ich von der „Komsomolskaja Prawda“ bekam, lässt sich mit den Fotos illustrieren, die ich aus der DDR mitgebracht habe. Stuckmanns „Schülerliebe“ mache ich mit intimen Bildern auf. Der Sportbeitrag? Kein Problem, da gibt es Fotos in Hülle und Fülle. Peggy könnte noch eine Zeile dazu zeichnen. Filmbilder sind ausreichend da. Die Anzeige für die Kundgebung auf dem Cheruskerberg. Das wäre alles ... Nein, zum Teufel, ich habe ja den Timm zu der Pressekonferenz mit diesem NPD-Fritzen geschickt, ich bin mit dem Jungen im Kröpcke verabredet, das habe ich vergessen, aber ich bin nicht weggekommen, die Peggy hat erst seit einigen Stunden ihren Alkoholpegel, bei dem sie arbeiten kann. Ich muss ihn anrufen.
„Ich telefoniere mal mit Hannover“, sage ich zu Peggy.
„Bitte, du machst wieder ein Wesen um dein Blättchen ...“
Es geht schnell mit der Verbindung.
„Aber mein Herr“, sagt eine Frauenstimme am Telefon, „bei uns ist Hochbetrieb, wie sollen wir einen Herrn Timm finden, wir können ihn schließlich nicht ausrufen lassen, wir sind das Café Am Kröpcke und nicht irgendein ...“
„Hier spricht Alain Delon, verstehen Sie, Alain Delon …“
„Der Filmschauspieler ...?“
„Natürlich, avanti, presto, hasta la vista, nun geben Sie mir schon Mister Timm …“
„Einen Moment, bitte.“
Sie holen ihn, ich kann mir vorstellen, wie sie ihn suchen. Aber da ist die Frauenstimme schon wieder. „Mister Delon, wie sieht er aus, der Mister Timm, sagen Sie bitte?“
Wie sieht er aus, wie ein Mensch sieht er aus. „Schwarz, ein wenig gebeugt, hager, fast dünn, ja, er wird wahrscheinlich viele kleine Zettelchen vollmalen, mein Freund ist Dichter, Poet, verstehen Sie?“
„Wir werden ihn finden.“
Die Platte ist abgelaufen, Peggy schleicht schon wieder zum Plattenspieler. „Moment, Herzchen“, sage ich, „Vater telefoniert doch.“
„Ich weiß auch nicht, was ich an dir habe“, mault sie und stellt sich neben das Telefon und lehnt sich gegen mich. Ich knöpfe ihr die schwarze Bluse zu. „Denk lieber noch ein bisschen nach, Peggy“, sage ich.
„Ich will aber nicht mehr.“
„Vielleicht nehmen wir doch keinen Sheriff.“
„Dann viele kleine süße Marsmenschen mit Antennen auf dem Schädel ...“
„Quatsch. Moment mal, ja, hallo, Timm, wie war es denn? Lohnt es sich, über diesen Gaul was zu machen?“
Und ob es sich lohne, meint er, der Hauptmann scheint ein Miststück zu sein.
Ich sage: „Aber mach die Geschichte spannend, will sagen, lesbar, kein Leitartikel wieder, Ingo ...“
Was ich von ihm denke, will er wissen ...
„Ich kenne dich, du träumst doch davon, Leitartikler zu werden!“
Schluss, Ende, der Ingo wird liefern, auf ihn ist Verlass, er wird einmal ein guter Journalist werden, so wahr ich Hubert heiße, er hat einen Riecher für Stoffe und einen Stil, wie wir ihn brauchen, intelligent, verständlich, dialektisch geschult.
Liebe Peggy, du musst noch einmal ’ran, wir knobeln eine Überschrift aus, wir werden noch einen Pfiff für die Gestaltung finden, ohne die Geschichte zu kennen. Himmel, ich habe ihm nicht gesagt, wie viel er schreiben kann, fünf Seiten, nicht mehr, Ingo möchte immer viel machen.
„Also, Peggy, da wäre noch eine Sache ...“
„Weiß schon, von diesem Timm, heißt er auch noch Ingo mit Vornamen ...?“
Nanu, denke ich, Ingo hat doch nicht viel übrig für solche Peggys ... „Kennst du ihn?“
„Nicht direkt, nur vom Hörensagen, seinen Freund kenne ich gut ...“
„Den Doktorensohn etwa?“
„Genau den, ein toller Junge, leider schüchtern und vergeben, unsere Eltern sind befreundet und hatten den Wunsch ...“
Ich halte ihr den Mund zu. „Nun erzähle mir nicht noch, was in euren großbürgerlichen Katen ausgeheckt wird. Lass dir was einfallen zu einer Story über einen wilden jungen Hauptmann der Bundeswehr, der dieser Nazipartei angehört und in den glorreichen Landtag einzieht. Also kein Alt-Nazi, einer von unserer Zeit erzogen, verstehst du das? So einer, der gegen den linksunterschwelligen Drall schimpft. Warte mal, mir fällt das eine Wort ein, dass er im SPIEGEL von sich gegeben hat: ,Wir haben zwanzig Jahre lang bewiesen, dass wir anständige Kerle sind. Wenn ein Kriegsverbrecher nicht von der Justiz gefasst worden ist, dann hat er eben Glück gehabt.‘ Fällt dir dazu was ein?“
„Nein“, sagt Peggy, „darauf muss ich erst einen trinken, der Mann ist doch bloß dumm, lohnt sich denn da der Aufwand?“
„Deine Ahnungslosigkeit ist strafbar, also pass auf, ich denke mir die Sache so …“
Sie trinkt. „Hör auf, deine Vordergründigkeit kenne ich, leg dich hin und lass mich machen. Im SPIEGEL, sagst du? Weißt du die Nummer noch?“
„In einem Februarheft, glaube ich ...“
„Du glaubst?“ Sie wühlt schon in einem Zeitschriftenberg, findet das Heft, nimmt Schere und Bleistift. „Ein Gesicht wie’n Kassierer“, sagt sie zu Gauls Konterfei. Ich lasse sie in Ruhe, sie wird daraus was machen.
Ich, Hubert Möller, Jahrgang 1927, Junggeselle, Chefredakteur ohne Redakteure, liege auf der Couch Peggy Pücklers, als ob ich nichts Besseres zu tun hätte. Das ist eine Sache der Erfahrung. Wäre ich nicht hier, bliebe die neue Nummer ohne Gestaltung, Peggy ist nun mal so, ich habe es aufgegeben, sie zu agitieren. In jeder Woche opfere ich eine Nacht, sause nach Göttingen und kontrolliere sie bei der Arbeit. Ohne mein Dabeisein würde sie nichts tun oder bloß Pfusch im besten Falle.
Hubert, Hubert, das glaubt dir kein Mensch, dass du hier nur so auf der Couch ’rumliegst, während das Mädchen gestaltet und schon wieder die Bluse aufgeköpft hat. Aber Ehrenwort, zwischen uns ist nichts gewesen, und es wird nichts sein, oder ich müsste schon sehr blau sein ... Da habe ich meinen Eigensinn. Den hatte ich schon als Junge.
Ich stamme aus Kassel, meine Eltern schickten mich auf die Mittelschule. Vater war bis zu seinem Rentenalter in einer Lederfabrik, alter Gewerkschaftler, ist er heute noch. In der letzten Klasse hörte ich manchmal mit meinen Freunden London oder Moskau, und wir sagten uns: Das ist eine Schweinerei, davon erfahren wir nichts, wir müssen es allen sagen. Das war beileibe kein Widerstand gegen die Nazis, nein. Aber es ging gegen unsere Auffassung von Gerechtigkeit, und so schrieben wir die Sendung mit, verfassten Kommentare und verteilten die Blätter, auf Heftseiten geschrieben, in der Schule. Es gab Untersuchungen und Strafen, aber sie wussten nicht, wer da schrieb. Vielleicht wussten es doch einige Lehrer und wollten es nicht sagen, Dummejungenstreiche, nichts weiter. Aber dann verfeinerten wir das System, tippten auf einer alten Schreibmaschine nach Ladenschluss in der elterlichen Kolonialwarenhandlung eines Freundes, sodass die Sache immer brenzliger wurde und sich die Geheime Staatspolizei einschaltete. Wir beschlossen: Abhauen, wir verduften in die Schweiz, sonst schnappen sie uns und bringen uns in ein Lager. Alle waren dafür. Meinen Eltern erzählte ich nichts, sie waren vorsichtig geworden und wollten das Ende des Krieges noch erleben. Als es losgehen sollte, war ich der einzige, der am Treffpunkt erschien, die anderen hatten es mit der Angst bekommen. Ich wartete einen halben Tag in einer Feldscheune, dann trampte ich allein los, kam auch über die Grenze, doch dann schnappte mich die liebe Polizei der neutralen Schweiz und sperrte mich in ein Lager. Ich hatte ja kein Konto dort und keine Einnahmen. So verbrachte ich den Krieg in einem Internierungslager. Das hatte auch sein Gutes, im Lager waren deutsche und österreichische Kommunisten, die aus meiner schlechthin humanen Haltung eine Weltanschauung mit Hand und Fuß hämmerten. Nach dem Kriege lernte ich Maurer, besuchte ein Bautechnikum, schrieb nach Feierabend die Artikel und kam zu meinem neuen Beruf wie der Bäcker in die Fischbratküche ...
„Darf ich stören, großer Meister?“, fragt Peggy. „Guck dir an, was sich die bedeutendste Grafikerin deines Blattes ausgedacht hat ...“
Teufel noch mal, das hätte ich nicht gedacht, das wird ein Schlager. Sie hat das Gesicht dieses Hauptmanns ausgeschnitten und auf eine Schlange gesetzt und diese Schlange mit Hakenkreuzen verziert, also wirklich, Klasse. „Dafür kriegst du einen Kuss.“
„Muss das sein?“ Sie hält mir den Mund hin, also, sie nähert sich mir, versprochen ist versprochen, Kuss darauf.
„Kannst du mir nicht gleich das Honorar zahlen?“, fragt sie.
„Das macht keine seriöse Zeitschrift.“
„Deine ist auch nicht seriös ...“
„Ich lege dich übers Knie …“
„Tu’s doch!“
Jetzt wird’s brenzlig, ich gebe ihr hundert Mark, Vorschuss.
„Den Rest weise ich nächste Woche an.“
„Okay, wieder mal Ruhe bis zum nächsten Freitag, ach, was bin ich müde, du auch?“
„Auch, aber ich muss noch nach Hannover zurück.“
„Jetzt noch?“
Es klingelt. „Lass doch das dämliche Telefon“, sagt Peggy und geht zum Bad.
„Es ist nicht das Telefon, es klingelt an der Tür, du schlaue Eule, das gilt mir …“
„Ach Gott, dieses geschraubte Redakteurdeutsch, das gilt mir, traun fürwahr, na, leb wohl, Alain Delon …“ Sie schmeißt die Tür des Badezimmers hinter sich zu.
Ich öffne die Tür. Draußen steht, groß und breit, in Lederjacke und Jeans, Karlheinz Fricke und sagt: „Können wir?“
„Wir können. Willst du noch einen Schluck trinken, die Genossin Pückler wird nichts dagegen haben …“
„Genossin ist sehr gut“, lacht er, „hier gibt’s doch bloß Sprit mit Wasser, ein Kaffee wäre mir lieber ...“
„Den kann sie nicht mehr.“
„Und du?“
„Sie stellt den Kaffee jedes Mal woanders hin und sucht ihn dann lange, um schließlich doch wieder zu Sprit und Wasser ...“
„Ich sehe, du willst nicht“, sagt er.
„Erraten, Kaha“, sage ich, „vielleicht unterwegs in der Gaststätte, einverstanden?“
„Klar.“ Fricke ist in Ordnung, er fährt bei Continental einen Schwerlaster und hat dieses Wochenende frei, er fährt sicher und schnell, zu Kaha habe ich festes Vertrauen.
Ich raffe die Manuskripte, Aufrisse, Spiegel und Zeichnungen zusammen und trommle gegen die Badezimmertür. Aber dahinter rauscht es nur.
HUBERT UND KAHA
„Willst du schlafen, Hubert? Mich stört’s nicht, ich fahre gern nachts.“
„Wo denkst du hin? Du fährst, und ich penne, was? Ich beleidige dich doch nicht.“
„Bei mir haben schon ganz andere Leute geschlafen.“
„Wie war es bei dir heute, Kaha?“
„Ach, weißt du. Ich hatte solche Hemmungen, vor diesen Studenten zu sprechen, aber es ging besser, als ich dachte. Sie wollen sogar Kontakte mit uns ... Schlachte das aber nicht gleich aus, Gewerkschaftsjugend und sozialistische Studenten und so ... So weit sind wir noch lange nicht. Ein bisschen ängstlich kamen sie mir vor, als es um den Bericht über unsere Fahrt nach drüben ging, den sie eigentlich schreiben wollten …“
„Aber drüben waren sie doch beeindruckt ...?“
„Das ist es ja. Im Magdeburgischen zum Beispiel standen sie erschüttert vor den Resten einer Feldscheune, in der man Hunderte von Gefangenen und Fremdarbeitern umgebracht hatte, und im Museum sahen sie ein Foto, das den Bundesheini mit Nazigrößen bei der KZ-Besichtigung zeigte. Sie wollten das Bild haben, eine Kopie mindestens, es wurde ihnen versprochen, sie werden es bekommen ...“
„Und doch?“
„Und doch möchten sie sich nicht schriftlich festlegen, das heißt, sie wollen es sich noch einmal überlegen. Weißt du, diese Intellektuellen haben so viel Einwände. Und wie sie eine Sache nach allen Seiten drehen, bis sie ganz abgenutzt ist und nicht mehr glänzt, entschuldige, dass ich so rede, aber du bist ja auch kein richtiger Intellektueller.“
„Schönen Dank. Ob das nun ein Kompliment ist ...“
„Nimm’s mit Haltung.“
„Wie das auch ausgegangen ist heute, es ist gut, dass ihr endlich mal den Anfang gemacht habt, jeder wurschtelt bei uns für sich, gemeinsame Ansichten müssen doch endlich ...“
„Kenne deine Meinung, gemeinsame Aktion, sind noch weit davon entfernt, Hubert, nächste Woche, die Kundgebung gegen die Notstandsordnung, das wird ein Erfolg …“
„Glaubst du?“
„Weiß ich. Über zwanzig Professoren und zehn Schriftsteller sind mit von der Partie.“
„Nicht beschreien. Was machst du in diesem Jahr im Urlaub? Fährst ins Salzkammergut, wie? Fütterst Schwäne? Sammelst kitschige Postkarten? Oder bevorzugst du eine Nordseeinsel mit deiner Mieze?“
„Hat sich was, mein Lieber. Mieze sagt, da kommt was, wir heiraten ...“
„Ach? Kaha wird Vater, kaum vorzustellen ...“
„Naja, es ist erst im zweiten Monat, noch gar nicht so genau 'raus; aber Mieze sagt, es kommt, sie hat’s im Gefühl.“
„Klar. Frauen wissen so was.“
„Da ist kein Urlaub drin.“
„Nanu? Du verdienst doch gut.“
„Noch, es gibt im Betrieb schon Umsetzungen, nicht dass ich glaube, so schnell arbeitslos zu werden, aber wir möchten eine Wohnung haben, du kennst die frommen Preise …“
„Na schon ...“
„Wenn du Lust hast am Sonntag, komm mal ’rum, Hubert, wir spielen Canasta oder Maumau zusammen bei mir …“
„Eine herrliche Perspektive. Aber schönen Dank, ich muss die Zeitschrift fertigmachen, am Montag geht sie in Druck, überziehe ich um einen Tag, kostet das was, entweder Verzögerung oder bare Münze, woher nehmen …“
„Na gut, wir wollten uns man bloß um so einen alten Junggesellen kümmern, sonst kommt Peggy noch auf den Gedanken …“
„Da sei Gott vor.“
„Schalte doch mal das Radio ein.“
„Eine Zigarette?“
„Gern. Rauchst du nicht?“
„Ich hab’ genug Qualm geschluckt heute ...“
„Wie spät ist es eigentlich?“
„Kurz vor zwei Uhr, halb drei liegst du im Bett.“
DORIS
Ich beobachte ihn schon eine Weile, er scheint heute guter Dinge zu sein. Zuerst sieht er den Straßenmusikern in der Krümpergasse nur zu, dem trompetenden Jungen in der offenen Wildlederjacke (das ist Jonny, ich kenne ihn aus dem Jazzkeller) und seinem bärtigen Kameraden mit dem Akkordeon, der auf dem Schaufenstersims des Teppichhauses Germania sitzt.
Wolfgang ist in Uniform. Als die Musiker eine Pause einlegen, unterhält er sich mit Jonny, wischt über das Mundstück der Trompete und beginnt selber zu blasen. Ein Fähnrich bläst „II silenzio“. Ist er verrückt geworden? Die Leute schmunzeln und werfen ihre Geldstücke in die Mütze des sammelnden Jonny.
Wolfgang bläst mit geschlossenen Augen, er macht das recht gut. Autos vermindern ihre Geschwindigkeit, die weiche, zärtliche Melodie hallt von den Häuserwänden wider und lockt die Menschen an die Fenster. Aus einem offenen Sportwagen ruft ein Oberleutnant etwas, ich kann nicht verstehen, was er ruft, aber Wolfgang scheint auch nichts zu hören, der Sportwagen fährt weiter.
Ein Spaß ist das, ein Heidenspaß. Inge und Sonja stehen mit mir am Fenster. Als Wolfgang das Instrument absetzt, sagt Sonja: „Na, geh schon, wir machen das, der Chef lässt sich nicht mehr blicken, er ist schon ins Grüne gefahren ...“
Ich gehe über den Damm, ein paar Autos hupen, ich gehe auf meinen Musiker zu, küsse ihn und sage: „Straßenmusikant! Troubadour!“
„Ich wollte dich nur aus dem Laden blasen“, sagt er.
„Hier habe ich dir ein Büchlein mitgebracht“, sage ich und stecke ihm ein schmales Bändchen zu, „das Geld gibst du mir später, zweisechzig, Uwe Johnson, weißt du, es ist nicht mehr neu ...“
„Handelt wovon?“
„Geteiltes Deutschland, Schicksal von drüben und so, ich habe es mal diagonal gelesen …“
„Deine Haare werden immer kürzer …“
Ist das eine Antwort auf den Johnson? Wir gehen nebeneinander her, ich trage mein Haar streichholzlang wie ein Schuljunge, der sich nicht gern kämmt. Ich bin so groß wie er, wenn ich hohe Absätze trage. Die Leute schauen uns nach.
Der Weg zur Klinik ist nicht weit. Die Anlage, weiß getünchte zweistöckige Häuser, von einem englischen Park umgürtet, liegt in einer ruhigen Kastanienallee.
„Kommst du mit ’rein?“, fragt Wolfgang. Wir stehen in der kühlen Eingangshalle.
„In den Park schon, ich warte draußen auf dich.“
„Aber warum denn?“
„Ich kann die Schreie der Irren nicht ertragen.“
„Die sind hier harmlos und schreien nicht, im Park sind auch welche.“
„Wenn schon.“ Ich sehe ihn an. „Du möchtest doch mit Ingo reden, lass mich nicht zu lange warten.“
Er bringt mich zu einer unbesetzten Bank im Geviert einer akkurat geschnittenen Buchsbaumhecke. „Wohl ist mir nicht dabei, dich zurückzulassen …“ Er umspannt zärtlich meine Oberarme, ich trage einen ärmellosen weißen Rollkragenpullover, viel zu warm für den heutigen Tag.
„Was willst du? Ich werde vielleicht Nebukadnezar treffen oder die Neuberin oder Pompadour. Nun marschiere schon, Fähnrich.“
Er geht. Ich blicke ihm nach. Die Uniform steht ihm gut. Seine Aufforderung ist bloße Höflichkeit. Auf Ingo ist er heute noch eifersüchtig, wenn er’s auch nicht zugibt. Ich würde zwar gern mit Ingo reden, aber zuletzt war er mir immer fremder und auch ein bisschen unheimlich geworden. Nie habe ich erlebt, dass er etwas Undurchdachtes gesagt hätte, dabei ist er nicht älter als Wolfgang.
Ich versuche, mir die beiden in diesem Moment vorzustellen, den schlanken Fähnrich und den hageren Hilfskrankenpfleger Ingo Timm. Worüber werden sie reden? Was soll’s, Gespräch unter Männern, vielleicht ist es gut für Wolfgang, mal wieder mit dem Freund zu schwatzen.
Ich setze die Sonnenbrille auf, lehne mich behaglich zurück und schließe die Augen. Frau Biswanger hat versprochen, sich um Vater zu kümmern, wir fahren an die See, an die See, an die See ... Es ist schön, in der Sonne zu sitzen, von fern das Bimmeln der Bahn zu hören oder leise Schritte auf dem Kiesweg, zu wissen, jetzt schaut dich einer an. Wir werden zwei schöne Tage haben, uns braun brennen lassen, nicht sprechen, kaum denken, bloß existieren, du und ich und der blanke Himmel, deine Küsse, meine Träume ...
Ein Schatten fällt auf mein Gesicht, ich schlage die Augen auf und erschrecke. Vor mir steht ein dicker, großer Mann in Anstaltskleidung und legt grüßend die Hand an den runden, glatt rasierten Schädel. „Darf ich mich setzen?“
Ich zupfe mir den Rock übers Knie. Der Mann wirkt gutmütig und etwas einfältig. Wulstige Nase, herabgezogene Mundwinkel, Doppelkinn und Wangengrübchen. Er sieht aus wie der Priester aus Hogarths „Schlafender Gemeinde“, der in den Ausschnitt der sanft schlummernden Schönen schielt.
„Bitte“, sage ich. Mir fehlt der Umgang mit solchen Kranken, man kann ja nie genau wissen, ob sie gutartig oder hinterhältig sind. Aber dieser Dicke darf schließlich draußen frei herumlaufen ...
Der Mann setzt sich. „Ich bin der Ritter, wissen Sie.“ Er zupft den Stoff seiner groben Hose, als wolle er sie vor Falten bewahren. „Ich bin durch den Kellerausgang 'raus, müssen Sie wissen, schönes Fräulein.“
Also doch kein Harmloser. „Unsichtbar gemacht“, sage ich und kneife ein Auge zu. Was tun? Auf den Ton dieses Mannes eingehen? Das ist am vernünftigsten. Ich bin unsicher und spähe den Gang entlang, Wolfgang könnte endlich kommen.