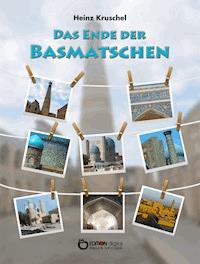7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: EDITION digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Alle sind neu in diesem 11. Schuljahr. Innerhalb von drei Jahren werden sie ihr Abitur machen und dazu noch die Prüfung zum Chemiefacharbeiter. Dette gehörte mal zur Spitze in seiner Klasse, aber jetzt scheint es, als gäbe er sich mit der Drei, der Eins des kleinen Mannes, zufrieden. Doch den Ton in der Klasse gibt die selbstbewusste Rikki an, die Dette nicht ausstehen kann. Aber immer wieder taucht ihr Name in seinem Tagebuch auf. LESEPROBE: Weder Fisch noch Fleisch. Jawohl. Heute habe ich meinen Vortrag gehalten. Nicht gut. Klebach sagte: „Sie hatten über vier Wochen Zeit. Hätten Sie diesen Vortrag aus dem Stegreif halten müssen, dann wäre er gut gewesen, so aber ..., eine Drei, Detlev.“ Weder Fisch noch Fleisch. Vor der nächsten Stunde sagte Fleischer grinsend: „Die Eins des kleinen Mannes ist eben doch die Drei, siehst du das endlich ein, du Prediger?“ Ich stieß ihm wütend die Faust vor die Brust. Er schlug zurück, Firsow trennte uns. Sacke ich denn ab? Das bedrückt mich. Ich will nicht absacken. Was stimmt nicht bei mir? Ich habe ein Gefühl wie in der siebenten Klasse nach Ostern, da hatte ich Vater eine Zigarre geklaut und sie auf dem Boden geraucht. Mir wurde schlecht, ich habe nur mit Mühe das Klo erreicht. So ein Gefühl hatte ich heute. Abends nahm ich mir ein Herz und erzählte alles zu Hause, natürlich erst, nachdem mein Bruder Dan im Bett lag. Dessen Meinung hätte ich nicht ertragen können. Mutter schüttelte den Kopf, sie erregt sich leicht, sie wollte fragen, aber Vater unterbrach sie beschwichtigend und sagte zu mir: „Niederlagen und Enttäuschungen gehören zum Leben eines jeden Menschen, man kann nicht vorankommen, ohne Niederlagen eingesteckt zu haben. Aber eine Niederlage muss anspornen, man muss einen neuen, besseren Anlauf nehmen, nur die schwachen Menschen resignieren. Wie man solche Niederlagen überwindet, darin zeigt es sich, ob man ein Kerl ist oder nicht ...“ Recht hat er. Ich habe mich schon darauf verlassen, Spitze zu sein und zu bleiben, ohne viel zu tun. Heike hatte Kinokarten besorgt, wir sahen einen Monsterfilm mit vielen tapferen guten Rittern und vielen bösen feigen Rittern; das Marmeladenblut floss, aber ich war nicht bei der Sache, die Devisen hätte sich die DEFA sparen können. Ich spürte, dass ich auch Heike gegenüber ungerecht war, sie versuchte ihr Bestes, um mich abzulenken, aber ich reagierte schroff, ich wäre lieber allein gewesen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 243
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Impressum
Heinz Kruschel
Mein elftes Schuljahr
ISBN 978-3-95655-134-5 (E-Book)
Das Buch erschien erstmals 1971 im Verlag Neues Leben, Berlin.
Gestaltung des Titelbildes: Ernst Franta
© 2014 EDITION digitalaramondItcT-Light",serif'>®Pekrul & Sohn GbR Godern Alte Dorfstraße 2 b 19065 Pinnow Tel.: 03860 505788 E-Mail: [email protected] Internet: http://www.ddrautoren.de
25. August
Der Koffer ist gepackt. Morgen reisen wir zurück. Ein letztes Mal ist unsere Klasse zusammen, dann wird es sie nicht mehr geben. Komisches Gefühl. Ob alle so denken? Vor zehn Jahren haben wir mal Buchstaben gemalt und Wörter schreiben gelernt und Brottaschen vor dem Bauch getragen. Das scheint noch gar nicht so lange her zu sein.
Nun liegt die Prüfung der zehnten Klasse hinter uns. Darauf kann man sich gar nichts einbilden.
Und was liegt vor uns? Theoretisch weiß das jeder. Aber wer weiß schon, ob der Beruf, den er gewählt hat und den er lernen will, für ein Leben lang der richtige sein wird? Man möchte doch nicht als Dreißigjähriger sagen: Mein Beruf macht mich nicht froh, ich bin unzufrieden, die andern haben mich falsch beraten, ich habe mich nicht richtig entschieden, ich möchte überhaupt nichts auf die andern abschieben.
Vorgestern konnten wir weder ins Waldbad noch in die Berge, es goss in Strömen, der Sturm knickte armdicke Äste, von der alten Lauenburg rollte ein Steintrumm bis in den Wurmbach hinein. Da habe ich mir diese Kladde im Konsum gekauft, ich will ab heute ein Tagebuch führen. Versucht habe ich es früher schon öfter, es aber immer wieder aufgegeben, diesmal möchte ich durchhalten. Zunächst nur für ein Schul- und Lehrjahr, ich nehme eine Lehre in dem VEB „Justus von Liebig“ auf und werde in drei Jahren das Abitur in der Tasche haben. Chemiefacharbeiter werde ich dann sein. Wer weiß, vielleicht studiere ich noch Chemie und arbeite in zehn Jahren schon an der Herstellung biochemischer Maschinen zur Nahrungserzeugung. Oder an einem Verfahren, wie man das Meerwasser in großen Mengen und zu erschwinglichen Preisen entsalzen kann. Alles ist drin. Mein lieber Schwan, ich habe Rosinen im Kopf, was? Vielleicht werde ich nach zehn Jahren dieses Tagebuch lesen und überprüfen können, was aus mir geworden ist. Ich werde meine Ansichten und Vorstellungen von heute anders überdenken, über meine Sorgen lächeln und mich erinnern, wie dumm und naiv ich einmal gewesen bin.
Naiv ja, naiv bestimmt.
Gestern haben wir auf der Lauenburg Abschied gefeiert, es war kein öffentlicher Tanz, aber wir haben die Musikbox aus der Gaststube in den Saal gerollt und jede Platte dreimal abgespielt. Und Bier mit Brause gemischt, um lange trinken zu können, denn viel Geld hatten wir nicht mehr. Ich habe mit Hanne Lösch getanzt, meistens mit ihr. Eigentlich tanze ich nicht gut. Ich sei ein Latscher, sagen die Mädchen, aber Hanne tanzt fabelhaft, und sie sagt nicht Latscher zu mir. Sie hat einen Sonnenbrand, der ärgert sie, sie wollte braun werden. Für Afrikaner schwärmt sie. So wie die müsste man tanzen können, sagt sie. In den Pausen gingen wir raus, blickten auf das kleine Dorf hinunter und suchten unter den Lichtern unsere Jugendherberge heraus. Ich spazierte mit Hanne den Waldweg entlang, der zu den Resten einer alten Königsburg führt, einmal kamen wir an einem Paar vorüber, das sich küsste. Ich redete, aber Hanne blieb still. Ich glaube, ich redete vor lauter Angst.
Hanne sagte nach einer langen Weile: „Du könntest mich eigentlich mal küssen, Dette.“
Ich sagte, dass die Sterne toll wären heute, dass der Mensch zu ihnen vordringen würde, von dieser Galaxis zu anderen Systemen, aber Hanne blieb stehen. „Willst du nicht? Traust du dich nicht? Ich mag dich nämlich, du.“
Sagte ich: „Du gefällst mir auch.“
„Na also.“ Sie legte mir die Arme um den Hals und küsste mich. Ich spürte ihre Lippen und ihre Zähne. Sie küsste mich fest und ließ mich eine ganze Weile nicht los. So viel Luft hatte ich vorher gar nicht geholt. Es war mir nicht angenehm, doch ich wollte nicht unhöflich sein. Ich habe eine etwas schmale Nase und atme meistens durch den Mund. Das konnte sie natürlich nicht wissen. Dann ließ sie mich los. Wir atmeten tief durch. Sie fragte: „Na, wie war das?“
Eine blöde Frage. Ich habe ihre Lippen und ihre Zähne gespürt, aber irgendein Gefühl hatte ich nicht dabei. Ich sagte, es sei ganz schön gewesen. Aber das war ihr natürlich nicht genug, Hanne forderte mich auf, sie zu küssen. Hartnäckiges Mädchen. Ich wollte sie erst fragen, warum ich sie küssen sollte, aber dann dachte ich daran, dass ich sie kränken könnte, und ich drückte ihr einen Kuss auf die Lippen, so einen Schmatzer, wie ihn mir Großmutter immer zu Weihnachten und am Geburtstag verpasst, so einen, bei dem man sich hinterher den Mund wischt.
Hanne sagte: „Deine Technik ist reichlich altmodisch.“
Was denn für eine Technik? Die spielt sich aber auf, dachte ich, vielleicht sieht sie sich Liebesfilme im Fernsehen an oder im Kino. Mich langweilen solche Filme meistens.
Ich sei naiv, sagte sie. Sie war eingeschnappt.
„Ich bin doch ein hübsches Mädchen, nicht wahr?“
Das bestätigte ich.
„Na und? Wenn du mit mir allein sein kannst, geht da nichts in dir vor? Ich meine, spürst du da nichts?“
Nun wurde ich doch ärgerlich. Natürlich gehe ich gern mit einem hübschen Mädchen aus, zum Baden oder ins Kino, aber besondere Gefühle brauche ich deswegen doch nicht zu haben, auch wenn ich mich freue, wenn andere Jungen uns nachsehen.
Dann lachte sie, sie schien nicht mehr böse zu sein, ich aber sagte, wenn das anderen Spaß mache, dann sei es für mich kein Grund, das nachzuäffen, ich wollte so sein, wie ich bin, und keinen anderen Menschen spielen.
Liebe? Liebt man, wenn man ein Mädchen küsst? Küsst man, weil man liebt? Das weiß ich nicht.
„Hör auf“, sagte sie, „bei mir ist das anders, ich bin ein Mädchen.“
Wir gingen zurück, die andern tanzten schon wieder oder saßen an dem langen Tisch und blickten uns entgegen. Es war, als ob sie auf uns gewartet hätten. Die Mädchen blinzelten Hanne zu. Na, ist er auf deinen Daumen gehüpft, wie du es gewollt hast? Sollten sie blinzeln, nur kaltes Blut bewahren. Und Hanne erzählt schon nicht, dass es bei mir mit der Liebe noch ewig und drei Tage dauern wird.
Für meine letzte Mark tanzten wir La Bostella, dann zogen wir singend hinunter in die Herberge.
26. August
In zwei Stunden werden wir abgeholt, mit einem Bus des Patenbetriebs fahren wir zurück. Ich bin allein in der Herberge. Die andern bummeln noch einmal zur Radiumquelle.
Für das Tagebuch brauche ich ein Motto. Auf dem Abreißkalender im Speiseraum stehen sinnige Sprüche. Vom gestrigen Tag: Unbesiegbar ist derjenige, der nicht fürchtet, dumm zu erscheinen. Und von heute: Aufrichtig zu sein, kann ich versprechen, unparteiisch zu sein, aber nicht.
Die Sprüche stimmen auch. Nicht nur, weil sie von den Klassikern stammen. Aber ich suche so ein Motto, das zu mir passt, das aussagen könnte, worum es mir geht. Mir ganz persönlich. Ich schreibe das Buch ja nicht zum Zeitvertreib, es soll einen Sinn haben, einen Nutzen, ich bin immer für den Nutzen. Was nicht nützlich ist, will ich erst gar nicht tun. Für mich schreibe ich, das Tagebuch soll mir eine Antwort auf die Frage geben können: Wer bin ich, was ist das für einer, dieser Detlev Kramer?
Kurz vor der Prüfung behandelten wir in Literatur eine Geschichte des amerikanischen Arbeiterschriftstellers Mike Quinn. Die hat mir gut gefallen. Ich habe die Unterrichtsstunde nicht vergessen. Und auch nicht die Diskussion darüber. Unser Lehrer sagte: „Es geht, so meint der Autor, um das vernünftige Einrichten im Leben eines Menschen, der heute und hier lebt. Es geht um eine feste weltanschauliche Plattform, die man braucht, wenn man schwer heben will.“
Als ob wir das nicht gemerkt hätten. Aber die Lehrer halten oft den Zeigefinger hoch: Was lehrt uns das? Didaktik nennen sie diese Art.
Die Geschichte ist wirklich gut und könnte zu einem Motto werden. Da sollen zwei Philosophen unterschiedlicher Richtungen als Leuchtturmwärter auf einer unbewohnten Insel arbeiten. Der eine sagt: „Das ist ja eine gottverlassene Gegend, aber ich werde mich schon zurechtfinden, meine Philosophie ist stark genug und mein Glaube auch.“
Der andere ist nicht dieser Meinung. Er widerspricht: „Wir selber sind doch Menschen und in der Lage, uns nach unseren Bedürfnissen einzurichten. Wir müssen planen und arbeiten und konsequent bleiben, angestrengt arbeiten und Beharrlichkeit üben.“ Da lacht der erste ihn aus.
Für die Philosophen beginnt die Praxis. Die Betten sind zum Beispiel zu klein. Der Materialist fängt an, das Bett entsprechend seiner eigenen Größe umzubauen. Der Idealist aber glaubt, seine Größe auch ohne Umbau des Bettes den veränderten Verhältnissen anpassen zu können. Glaube versetzt Berge. Also legt er sich in kaltes Wasser, um kleiner zu werden. Als das nichts nützt, erwägt er sogar, sich die Beine abzuhacken. Er denkt: Das Schicksal will eben, dass ich leiden soll, es will mich auf die Probe stellen, ich muss demütig sein und durchhalten, Hilfe wird schon kommen.
Und er legt sich in das kleine, unbequeme Bett. Ein Bild für die Götter, Herkules im Spankorb. Aber er kann darin nicht einschlafen. Mitten in der Nacht, während der Materialist schon gut in seinem umgebauten Bett schläft, steht er auf, rüttelt den Fleißigen wach und sagt zu ihm: „Du bist sehr egoistisch. Lass mich in dein Bett, es ist groß und reicht für uns beide, ich möchte auch gut schlafen können.“
Der Materialist rückt zur Seite. Aber vor dem Einschlafen sagt der Idealist, nun bequem seine Glieder ausstreckend: „Eins will ich noch betonen. Falls das einer eurer kommunistischen Propagandatricks sein sollte, will ich dir sagen, dass ich meine eigenen Ideale habe, die ich mir nicht nehmen lasse, ich werde mir auch nichts vorschreiben lassen. Das Bett wird ohnehin spätestens morgen zusammenbrechen. Komme mir aber dann nicht damit, ich hätte dich nicht gewarnt.“
Ich, Detlev Kramer, möchte mich weder in ein gemachtes Bett legen noch erwägen müssen, mir die Beine abzuhacken oder mich in kaltes Wasser zu legen ... Aber ich kenne mich. (Oder kenne ich mich von den Einschätzungen meiner Lehrer, von der Meinung meiner Eltern her?) Dass ich manchmal schwierig sein soll (in meiner Beurteilung steht: „neigt zum Starrsinn“), das unterschreibe ich, das stimmt. Aber wenn ich so bin, manchmal, dann doch nicht ohne Grund. Das Lernen in der Schule ist mir bisher nie schwergefallen. Ich interessiere mich für viele Gebiete, ich würde zum Beispiel auch gern Tiere züchten oder Biologie studieren oder ein Kameramann werden.
Ich weiß nicht, ob ich ein aktiver Mensch bin, ich glaube - nein. Aber darin sind sich Lehrer und Eltern nicht einig. Nach der Meinung der Schule brauche ich eine zu lange Zeit, um von allein aktiv zu werden. Ich soll die Dinge auf mich zukommen lassen und zur Bequemlichkeit neigen. Aber das wäre ja purer Egoismus.
Meine Eltern meinen, dass ich nicht egoistisch sei. Vater hat einmal gesagt, ich würde zu häufig fragen: Was nützt das? Wozu brauche ich das? Aber fragen, so meine ich, kann man nicht häufig genug. Nehmen wir an, dass die Lehrer und die Eltern recht haben und dass die Wahrheit irgendwo zwischen den beiden Einschätzungen liegt.
Das Motto ist schon richtig. Ich will mich einrichten können im Leben, ich will sein wie jener Materialist auf der einsamen Insel, der konsequent ist. Lächerlich sind doch erwachsene Menschen, Familienväter, die darüber jammern, dass sie etwas verpasst haben, eine Entscheidung etwa. Oder auch darüber, dass sie eine Entscheidung zu vorschnell gefasst haben. Und dann werden sie mäklig und mickrig, und die Familie leidet darunter, ich kenne solche Nappsülzen.
1. September
Es ist Abend. Ich sitze in meinem Zimmer und überdenke den Tag.
Heute wäre ich fast zu spät in die Schule gekommen. Vater ist auf einem Lehrgang, Mutter musste um sechs Uhr im Kindergarten sein, ich sollte Dan noch in die Schule schicken. Aber das Brüderchen schläft gern lange. Ich lockte also, rief und drohte, aber Dan drehte sich immer wieder um und hielt die Bettdecke fest. Da kitzelte ich ihn mit seinem Teddy wach, er griff sich das geliebte Stofftier und warf es in hohem Bogen ins Zimmer. Aber wach war er jedenfalls. „Das tut dem doch weh“, sagte ich. „Ach wo“, meinte Dan, nahm die Brille aus dem Regal und setzte sie auf die Nase, er ist nämlich kurzsichtig (beiderseitig drei Komma fünf Dioptrien), „der ist schon auf Weltraum trainiert.“ Mein Bruder Dan heißt eigentlich Dankwart, aber alle rufen ihn Dan. Mutter meint, Vater sei vor zehn Jahren in die mittelhochdeutsche Sprache verliebt gewesen. Dan wird elf Jahre alt und geht ab heute in die fünfte Klasse. Von ihm wird bestimmt noch die Rede sein. Meiner Meinung nach ist er frühreif. Er liest immer, wenn er Zeit hat, am liebsten liegt er dabei längelang auf dem Tisch oder kniet auf dem Fensterbrett. Und er hat immer viel Zeit.
Die Betriebsberufsschule liegt an der Elbe. Mit dem Fahrrad brauche ich fünfunddreißig Minuten, aber mit der Straßenbahn eine dreiviertel Stunde, und ich müsste einmal umsteigen. Alles schon in den Ferien ausprobiert. Ich kam auf den letzten Drücker, als letzter, zusammen mit dem Lehrer. Das verdanke ich Dan.
Die Klasse heißt 11s, wir sind neun Jungen und acht Mädchen, im ersten Lehrjahr haben wir in der Woche vier Tage Theorie und einen vollen Tag Praxis im Lehrlabor. Der Sonnabend ist frei, eine Errungenschaft! Die Lehrer wurden uns vorgestellt, unser Ordinarius heißt Paul Klebach, ist Brillenträger, spricht schnell und soll schon seit einigen Jahren an seiner Dissertation arbeiten. Wirkt sympathisch und überhaupt nicht verkrampft.
Die Namen der anderen habe ich vergessen, nur den des Lehrobermeisters weiß ich noch: Krause, ein guter deutscher Name.
Während der Feierstunde betrachtete ich die Truppe, mit der ich nun drei Jahre lang die Schulbank drücken oder Gift mischen werde. (Unser Betrieb stellt Unkraut- und Schädlingsbekämpfungsmittel her.) Aber einen Bekannten entdeckte ich nicht darunter. Ein großer Dicker heißt Fleischer. Eine zierliche Schwarze trug einen roten Hosenanzug, von ihr habe ich mir den Vornamen gemerkt, weil der so exklusiv klang, sie heißt Ricarda. Einer stellte sich gleich mit seinem Spitznamen vor: Fips Hauer. In Wirklichkeit heißt er Anton, den Namen wolle er nie hören, er sagte, den habe sein Vater im Suff ausgesucht. Fips passt schon besser zu ihm, scheint ein pfiffiger Kerl zu sein. Einer heißt Firsow, er sieht sogar aus, als wäre er ein Bruder des berühmten Eishockeyspielers aus der sowjetischen Nationalmannschaft.
Wir haben mehrere Vorträge gehört. Eine feierliche Rede des Werkleiters Doktor Münster (Mister-Higgins-Typ), die trotzdem sehr knapp und sachlich war und mir darum gefiel. Dann Vorträge über den künftigen Beruf; von allen Schülern erwartet man, dass sie gute Facharbeiter werden, diszipliniert, bewusst, aktiv. (Wie oft hört man das noch, diesen aufgewärmten Brei.) Es folgten Kurzreferate über Arbeitsschutzanordnungen und Sicherheitsvorschriften, das waren die längsten Darbietungen. Nachlesen können wir das in Broschüren, die jeder bekommen hat.
Dann Besichtigung des Lehrlabors. Jeder hat seinen Arbeitsplatz und ist für ihn verantwortlich. „Für Silvester braue ich mir dieses Jahr die Knallkörper selber zusammen“, meinte Fips Hauer.
Ein Fazit kann ich nach diesem ersten Tag noch nicht ziehen. Eine unbekannte Welt hat sich mir noch nicht aufgetan. Dann haben wir uns noch den Betrieb angesehen. Dr. Münster musste weg, ein junger schwarztollliger Mann mit lustigen Augen hat uns geführt. Ich bin mit einem Elbdampfer schon mal an dem Betrieb vorbeigekommen, aus der Ferne sieht alles so geordnet aus. Aber man kann sich verlaufen. Und diese Baustellen!
Der junge Mann, der Klein heißt und Betriebsleiter sein soll (dabei ist er keine dreißig Jahre alt), nannte die Namen der Anlagen und Hallen und Systeme, das rauschte nur so an uns vorbei, X-Y-Z-Anlage nach den A-B-C-D-Methoden. „Der Geruch? An den gewöhnen Sie sich. Wenn Sie ausgelernt haben, haben wir vielleicht die Geruchsbelästigung abgeschafft!“
Wir liefen über eine Stunde, dann standen wir vor einem riesigen Gebäude, dessen Fenster leer gähnten. „Durch Rationalisierung freigesetzt“, sagte Klein, „es wird umgebaut, wir haben ein neues Verfahren entwickelt. Kennt ihr Lindan?“
Nein. Er winkte ab. „Ein Hexachlorzyklohexan, also ein Insektengift. Abkürzung HCH und HCC, auch Präparat 666 genannt ...“
Mir schwirrt jetzt noch der Kopf. Was der alles wusste.
Und vor zehn Jahren soll der Klein erst unsere Schule abgeschlossen haben ...
3. September
Von den alten Vorstellungen des Experimentierens müssen wir uns wohl lösen. Hier wird nichts zusammengekippt und gemischt, dass es kracht und brennt und stinkt. Wir fangen ganz von vorn an, lernen Laborgeräte kennen und arbeiten zunächst nur mit Wasser.
Es muss streng nach Vorschrift gearbeitet werden. Unsere Lehrmeisterin ist eine blonde Frau, die Ingenieurpädagogin Kunze. Sie sagte: „Bilden Sie sich nicht ein, aus rotem Phosphor und Kaliumchlorat irgendwelche Knallfrösche zu basteln, Sie sind hier, um einen Beruf zu erlernen. Die Sicherheit für Sie alle geht über alles. Sollte das jemand nicht begreifen wollen, so setzt er seinen Lehrberuf aufs Spiel.“
Finde ich richtig. Ich weiß nicht, ob die andern auch so denken, noch ist der Kontakt nicht da. Die meisten Schüler wohnen im Internat und kommen aus vielen Gegenden der Republik, nur der dicke Fleischer, die blasse Heike Sommer und ich stammen aus Werbenburg. Heike wirkt so sauber wie eine Katze nach dem Putz.
9. September
„Wir werden viel von Ihnen fordern, weil wir Sie achten“, sagte Klebach heute. Bei ihm haben wir Deutsch und Staatsbürgerkunde, letzteres heißt in diesem Jahr Philosophie.
Man denkt über ein Wort des Lehrers nicht gleich nach. Viel fordern, weil er uns achtet, na ja, es geht um einen guten Klassendurchschnitt, davon fällt der Glanz auch und besonders auf den Lehrer.
Aber in diesen ersten Tagen haben wir alle das Gefühl, wir werden unsere mitgebrachten Leistungen nicht halten können. Die Lehrer sind anstrengend hier. Wenn Herr Thorn, unser Chemielehrer, über den Wasserstoff spricht, so entwickelt er zugleich an diesem Komplex dialektisches Denken. Und Plast- und Faserchemie hat, wie er meint, auch etwas mit sozialistischer Kooperation zu tun. Wollen die uns etwa beweisen, dass unsere bisherigen Lehrer alles Nieten waren? Das wäre unfair. Und stimmt auch nicht.
12. September
Klassenarbeit bei Klebach geschrieben, quer durch den Stoff der polytechnischen Oberschule. Aber anders, als wir das gewöhnt waren, mehr mit eigenen Einschätzungen und Folgerungen. Bin gespannt, was daraus geworden ist.
Mein Bruder Dan will uns alle zu Hause überzeugen, einhundertdreißig Jahre alt zu werden. Er hat von einem Freund einen Pilz mitgebracht, ein blumenkohlähnliches Gebilde. Darüber wird abgekochte Milch gegossen, Kefir also. Zwölf oder vierundzwanzig Stunden stehen lassen und dann trinken, dreimal täglich.
„Aber das machst du allein“, sagte Mutter, „Geschirr abwaschen und so weiter.“
Dan tat verwundert. „Wollt ihr denn nicht mehr auf dem Meeresgrund spazierengehen?“, fragte er.
Mutter sagte: „Das muss nicht unbedingt sein, aber meinetwegen.“ Dan ist schon eine ulkige Nudel, der lässt sich nicht die Butter vom Brot nehmen.
15. September
Klebach gab die Arbeit zurück. Keine Eins. Durchschnitt: drei Komma zwei, also mies. Er sagte: „Sie können alle mehr. Aber Sie wollen anscheinend mit einem Minimum an Zeit- und Kraftaufwand die Grenze des Geforderten erreichen. Sie werden erst dann einen gangbaren Weg kennen, wenn Sie diese Einstellung aufgegeben haben …“
Nach zwei Wochen kommt er schon zu diesem Schluss. Ein bisschen fix, finde ich. Voreilig, der Mann, die Sache hier lässt sich gar nicht so gut an.
Denken verlangt er, mitdenken, nicht nachbeten. Aber von heute auf morgen lernt man das nicht.
In der neunten Klasse hatte ich mal einen Lehrer, der liebte das Schema über alles. Was ist sozialistischer Realismus? „Das ist erstens die Parteilichkeit für die Arbeiterklasse und für den Fortschritt, zweitens die revolutionäre Romantik, drittens der Blick in die Zukunft, viertens ...“ Bei dem war es wie im Biologieunterricht, wo man nur runterschnurren musste: „Eine Teichmuschel besteht aus After, Darm, Herz, Mantel, Magen, Eierstock, Fuß, Mundlappen, Schließmuskel, Nervensystem und Nieren.“ Lernten wir das Schema der Teichmuschel oder des sozialistischen Realismus auswendig, dann bekamen wir gute Noten. Denken brauchten wir nicht dabei, das gewöhnten wir uns beinahe ab.
Vater ist wieder zurück. Mit ihm sprach ich darüber. Muss man denn nicht mit möglichst geringem Zeit- und Kraftaufwand arbeiten? Denken ist ja nicht ausgeschlossen, im Gegenteil. Aber Vater meinte: „Mit geringem Aufwand, aber um das Beste, das Effektivste zu erreichen. Hat das mit dir zu tun?“
Ich verneinte. Aber zu den neuen Lehrern habe ich noch keine Einstellung gefunden, obwohl mir an Klebachs Haltung manches gefällt. Sein Unterricht ist straff, man muss sich konzentrieren. Zu der Disziplin Betragen hat er zum Beispiel seine eigene Meinung. Nulpen, die bloß dasitzen und sich berieseln lassen wollen, bekommen bei ihm keine guten Betragensnoten, sagt er, lieber seien ihm Schüler, die initiativreich wären, die schöpferisch arbeiten, wenn sie auch manchmal übers Ziel hinausschießen und Unruhe in die Klasse bringen. Finde ich gut. Es gibt welche, die ziehen den Kopf ein, damit sie nicht gesehen und aufgerufen werden. Das ist eine dämliche Methode, solche kommen dann erst recht dran.
16. September
Im Labor gewesen und keine tolle Sache erlebt. An „Chemikalien“ durften wir H2O verwenden. Eichen eines Standzylinders und das Ablesen des Meniskus. Wahnsinnig öde. Das Wasser aus dem Becherglas in die fettfreie Pipette saugen, sonst saugt man natürlich nicht, aber H2O ist weder ätzend noch giftig, dann legt man den angefeuchteten Zeigefinger auf die obere Öffnung der Pipette. Sind keine Luftbläschen in dem Gerät, richtet man den unteren Meniskus auf die Eichmarke. Wenn dunkle oder gefärbte Flüssigkeiten vorhanden sind, wird der obere Meniskus als Richtmaß genommen. Ablesen in Augenhöhe! Dann noch Eichen mit der Bürette: Betätige nach dem Einspannen ins Stativ den gut gefetteten Hahn, und lass das H2O vorsichtig in den Standzylinder übergehen ... Und das einen ganzen Tag lang. Mir gegenüber stand Ricarda. Sie hat braune Augen und ein interessantes Gesicht, fast kubanisch, finde ich. Hübsch ist nicht der richtige Ausdruck dafür. Ich hätte gern mal einen Witz gemacht. Oder mit ihr über irgendetwas gesprochen, so sehr langweilte mich das alles. Aber sie tat so, als arbeite sie an einer bedeutenden Forschungsreihe, auf deren Ergebnis die ganze Menschheit warte. Sie saugte mit Hingabe.
Über das Eichen und Ablesen müssen wir nun noch ein ausführliches Protokoll anfertigen, das wird zensiert. Ob ich wirklich den richtigen Beruf gewählt habe? Meerwasser wollte ich einmal entsalzen!
Zu Hause trinken wir jetzt alle Kefir. Und Dan braucht natürlich wieder mal nicht die Milch abzukochen, das Sieb zu reinigen, die Pilze zu pflegen, das Geschirr abzuwaschen. Mutter nimmt es ihm ab, wie immer.
18. September
Deutsch. Es ging in der Diskussion um eine philosophische Frage. Der dicke Fleischer äußerte dazu eine ulkige Meinung: „Nathan ist weise, weil er so lebensfremd war.“
Ich meldete mich und sagte: „Das ist völlig falsch, absurd ist das …“ Vielleicht war das ein bisschen schroff.
Klebach wies mich zurecht. Ich solle zunächst daran denken, dass der Mensch neben mir recht haben könnte, bevor ich ihn abqualifiziere. Ich solle meine Meinung gründlich untersuchen, ehe ich eine Gegenbehauptung aufstelle. Behauptung kontra Behauptung, was solle denn das werden? Der Beweis sei gültig.
Ich habe Klebach nichts getan, aber er hackt auf mir herum, ich begreife ihn nicht. Ich melde mich selten. Fleischers Meinung war wirklich falsch, das stellte sich noch heraus. Ich hätte das ja auch erklären können, Klebach aber ärgert mich blass und blau wegen einer Behauptung. In jeder Stunde stellen andere auch Behauptungen auf und werden nicht vor der Klasse abgekanzelt. Ich bin wütend auf Klebach.
Nachmittags fuhren Fleischer und ich zusammen mit der Straßenbahn in die Stadt zurück. (Mein Fahrrad hat einen Platten.) Ich sagte: „Tut mir leid, ich wollte dich nicht kränken …“
Er griente. „Lass dir keinen Bart drum wachsen. Ich habe gewusst, dass meine Antwort falsch ist, ich habe das sogar vorher gewusst.“
Ich staunte.
„Ja. Ich rede immer, ich melde mich auch dann, wenn ich nicht die richtige Antwort weiß. Man muss nur immer aktiv sein und eine lange Brühe um etwas machen, weißt du. Die Mitarbeit zahlt sich in Noten aus, auch dann, wenn die Antworten falsch sind, Erfahrungssache.“
„Besuch mich doch mal, Dicker, ich möchte dir nicht gleich wieder meine Meinung sagen. Oder ich besuche dich, wenn du willst.“
„Lieber nicht.“
„Warum nicht?“
„Ich habe kein eigenes Zimmer. Und mein Vater hockt nur vor dem Fernseher und wird grantig, wenn er gestört wird. Der sieht sich alles an: Ratschläge für die Eltern, Pittiplatsch und sein Blabla, Reportage, Fernsehspiel, Singelieder, Aktuelle Kamera. Reden kann der gar nicht mehr richtig. Er braucht nur noch so viel Wörter, wie zum Leben unbedingt notwendig sind, ich meine zum Essen, Trinken und Schlafengehen. Manchmal hält er mir eine Predigt, wenn ich was angestellt habe, aber dann denke ich mir: Rede du nur, Alter, wenn ich dir meine Meinung sagen würde, würdest du platzen, rede dich ruhig aus ...“
„Und deine Mutter?“
„Die schaut nur auf ihren Mann und tut, was er will, und sagt, was er denkt.“
Schlimm so etwas.
20. September
Mit meinen Eltern ist das ganz anders. Mit Mutter kann ich völlig gleichberechtigt reden. Sie hat nur Bange, ich könnte schon mit „Mädchengeschichten“ kommen. Aber da kann sie beruhigt sein (siehe Hanne).
Und Vater? Bis vor wenigen Jahren war ich noch der Meinung, mein Vater sei unfehlbar. Er ist Direktor einer Schule. Auch heute denke ich noch: Du kommst mir mit deiner Erfahrung, deinem großen Wissen, deinem geschulten Verstand, deiner Dialektik, du zerschneidest rasch mit deinem philosophischen Skalpell das, was ich mir mühsam herangezüchtet habe. Ich rede und streite, aber ich kriege selten recht, er hat meistens die besseren Argumente. Ich habe auch schon gemerkt, dass er es gewohnt ist, recht zu haben. Ein Direktor ist eine Autorität, dagegen kommt man nicht an.
Ich achte ihn, aber ich wünschte mir, er würde auch mal zugeben, nicht allwissend zu sein. Denn von Autos versteht er nicht so viel wie ich.
Einen Fernseher haben wir natürlich, aber der flimmert ziemlich selten, wir haben alle unsere Beschäftigungen und unsere Probleme. Mutter (Kindergärtnerin), der kleine Dan, der je Woche zwei Bücher liest und über jedes lange diskutieren will, Vater mit seiner Schule und ich, na ja, wir brauchen uns alle gegenseitig in der Familie. In dieses Buch schreibe ich es: Beispiele sind Vater und Mutter schon für mich. Das würde ich ihnen nie sagen, das wäre kitschig und würde schmecken wie obergäriger Wein. Ich bin, auch das muss ich schreiben, fortschrittlich erzogen worden. Meine Eltern sind beide in der Partei.
23. September
Vieles ist eine Wiederholung. In Physik Wärmelehre. English for you, Lesson one. Begriff der Kybernetik, Spieltheorie. Im Labor stellen wir Lösungen verschiedener Konzentrationen durch Verdünnen und Mischen her, Suspensionen und Emulsionen. Das weiß man doch noch von der polytechnischen Oberschule. (Fräulein Kunze: „Sie brauchen Kenntnisse über die wichtigsten Grundoperationen der chemischen Technik sowie Fähigkeiten und Fertigkeiten im Rahmen dieser Grundoperationen. Sie sollen selbstständig und verantwortungsbewusst an Aggregaten arbeiten, Zusammenhänge erkennen lernen, Schlussfolgerungen ziehen. Das ist Kleinarbeit. Ohne Kleinarbeit geht es nicht.“) Sie redet immer so trocken, weise und wahr.
Vorschläge für die Wahl der FDJ-Leitung: Fips Hauer, die braune Ricarda, dann Marlene Kurzgut, deren Vater ein berühmter Schachtbauer ist, Nationalpreisträger sogar, und Ete Naumann, der perfekt Gitarre spielen kann. „Einen aus der Stadt bitte noch!“ Ich machte mich klein und wurde prompt vorgeschlagen, von dem dicken Fleischer natürlich.
Aber ich lehnte ab. Eltern berufstätig, kleiner Bruder, um den ich mich kümmern müsse. Ob sie mir glaubten, dass ich keine Zeit hätte? Jedenfalls wurde Heike Sommer gewählt.
Es ärgerte mich, dass sie so schnell einen anderen Vorschlag hatten ... Hätte man mich gebeten ...
Auf dem Kalender steht heute ein Satz von Kljutschewski, einem russischen Historiker: „Den Lehrern ist das Wort nicht dazu gegeben, um das eigene Denken einzuschläfern, sondern um das fremde zu wecken.“ Das tun unsere Lehrer, besonders Klebach. Bei aller Kritik, das muss ich ihm zugestehen. Dieses Steckenpferd reitet er mit Vergnügen. Aber nicht zu unserem Vergnügen.
25. September
Ricarda scheint nur aus Prinzipien zu bestehen. Sie hatte eine Auseinandersetzung mit Heike Sommer, die ihre Hausaufgabe vor Beginn des Unterrichts von Hauer abgeschrieben hatte. Du liebe Güte, Moralin war das. Kann doch jedem mal passieren. Heike wurde knallrot, so verlegen war sie, so peinlich war ihr das, immerhin ist sie ja in der Gruppenleitung.
Heute Mittag wollten wir alle schnell in die Mensa der Ingenieurschule (da essen wir), aber zwei Reporter mit Mikrofon hielten uns im Gang auf und fragten: „Seid ihr stolz darauf, Deutsche zu sein?“
War heute schon der elfte Elfte, elf Uhr elf?
Solche Frage auf nüchternen Magen. Alle hatten wir Hunger, dachten an Nudelsuppe oder an Roulade mit Rotkohl, sieben Stunden Unterricht lagen hinter uns, und dann so eine Gewissensfrage. Die Antworten waren entsprechend. „Na klar.“ - „Indianer wäre mir lieber.“ Ricarda sagte unwillig zu einem Reporter: „So geht das nicht. Das ist keine Frage, auf die man in einem Satz antworten kann.“
Das stimmte, ich hörte zu, wie Marlene sagte: „Es gibt wohl Deutsche und Deutsche, nicht wahr? Wie wäre es, wenn sie zu unserer FDJ-Versammlung kämen? Haben Sie Lust?“
Der eine Reporter sagte: „Lust, wenn es danach ginge.Übermorgen soll eine Seite zu dem Thema gemacht werden, da müssen wir die Meinungen im Kasten haben.“
Der andere Reporter aber sagte: „Das muss zu machen sein. Es ist besser, eine solche Frage auszudiskutieren.“ Am Abend erzählte ich Vater und Mutter alles. „Wenn sie kommen sollten, dann redet gefälligst nicht wie die Transplakate“, meinte Vater.
„Worauf du dich verlassen kannst.“ Eine Belehrung hat mein alter Herr immer parat oder wenigstens einen Hinweis, das ist nun mal sein Metier. Nieder mit dem Zeigefinger!
27. September
Die Wahl ging schnell und unbürokratisch vor sich. Alle vorgeschlagenen Kandidaten kamen in die Leitung. Ricarda leitet unsere Gruppe, das unterstützte auch Klassenleiter Klebach.
Dann schalteten die Reporter ihre Geräte ein und sprangen von einem zum andern, um die geäußerten Meinungen einzufangen. Sie kamen ins Schwitzen und mussten sich sputen, wir waren ganz schön in Form.
Der Waldi Hängebarth, der täglich in Anzug und Binder zur Schule kommt, begann. Er empfinde keinen besonderen Stolz, meinte er, das sei eben so, ändern könne und wolle er daran nichts.
„Das ist Fatalismus“, sagte Fips zu ihm. Waldi zuckte mit den Schultern. Bin ich eben Fatalist, schien er zu denken, leckt mich am Ärmel.
„Fatalismus ist schlimmer als Böses tun“, sagte Ricarda, „Fatalismus ist Böses dulden.“
Das waren für Waldi böhmische Dörfer, aber recht hatte Ricarda, obwohl das ziemlich aufgebläht klang.
Ete Naumann wollte seinen Beitrag von einem Zettel ablesen, aber das lehnten wir ab, da verzichtete er auf seine Wortmeldung. Dann kamen die Reporter zu mir, was sollte ich machen, drücken wollte ich mich nicht, aber blamieren auch nicht.
Ich sagte: „Es gibt für mich viele Gründe. Goethe, Einstein und Beethoven, Marx und Heine und Thälmann. Aber ich bin nicht stolzer auf mein Land als ein Ungar auf Ungarn oder als ein Pole auf sein Heimatland.“
„Amen“, sagte Waldi.
„Sie interessiert das ja nicht, Herr Kollege Wassersemmel“, sagte ich zu ihm.
„Was heute ist, interessiert mich schon. Für die Vergangenheit kann ich nichts.“
„Kann man es sich so leicht machen und sagen, das gehe uns nichts an, weil wir später geboren sind und heute hier leben ...?“, fragte Ete.
Auch Ricarda griff mich an. „Du bist also nur stolz, weil es eine positive Vergangenheit gibt? Aber so war es doch gar nicht, es gab den Faschismus. Bist du nur auf die Leistungen der Großen stolz, die auf den Denkmalsockeln stehen?“
„Natürlich“, sagte Heike Sommer, „du etwa nicht?“
„Schon, aber ..."