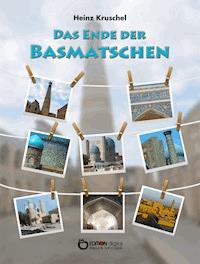4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: EDITION digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Conrad Blenkle an sein Kind: „Ich muß von Dir scheiden, lebe wohl! Ich habe den letzten Nachmittag verlebt und gehe dem Ende ruhig entgegen. Als Kämpfer habe ich gelebt und werde als Kämpfer sterben. Für eine Idee eintreten zu können, ist eine große, ehrenvolle Sache. Das gibt mir Kraft bis zum letzten. Du bist der Mensch, der mir am nächsten steht. Deine Liebe und Verehrung waren für mich das Wertvollste. Wenn ich mein Leben rückschauend betrachte und Bilanz ziehe, so kann ich im großen und ganzen zufrieden sein. Aber auch ich war ein Mensch mit Schwächen und Fehlern. Trotz alledem weiß ich, dass mein Leben wertvoll war und ich Nützliches geleistet habe. Meine letzte Mahnung an Dich ist: Handle immer verantwortungsbewusst, arbeite unablässig an Deiner Vervollkommnung, schone Dich nie, wenn es um Großes geht und Du Dich einsetzen musst! Lebe wohl und denke immer an Deinen Dich innig liebenden Vater.“ Der letzte Tag vor der Hinrichtung von Conrad Blenkle, Funktionär des Kommunistischen Jugendverbandes. Er arbeitete in der Nazizeit illegal in Deutschland, Dänemark, Holland und in der Schweiz. LESEPROBE: Conrad schrak nicht zusammen, als sich die Tür wieder öffnete und Poelchau hereintrat. „Lassen Sie sich durch mich nicht stören, ich setze mich still hin und lese, aber sie kontrollieren die Zellen, Sie dürfen ungefesselt nicht allein sein.“ „Dann lassen Sie mich wieder fesseln.“ „Bin ich Ihnen so zuwider, Herr Blenkle?“ Conrad lächelte. „Entschuldigen Sie, Doktor, bleiben Sie hier, Sie stören mich nicht mehr, ich bin darüber hinweg.“ Er aß wieder eine Scheibe Brot und trank einen Schluck Tee. Es lag ihm fern, Poelchau zu beleidigen, der Pfarrer war ein tapferer Mann, der viel für die Todgeweihten riskierte. „Sie schreiben noch nicht? Ich finde das nicht überraschend, ich habe so viele Menschen in den letzten Stunden ihres Lebens kennengelernt, und viele, die hier sterben mussten, haben nicht dumpf geschlafen vorher oder sich betäubt oder getobt und geschrien, das habe ich früher bei kriminellen Häftlingen erlebt, Sie sind von anderer Art, Sie und Ihre Freunde haben viel Kraft und holen sich nicht den Zuspruch eines andern, nein, Bestätigung und Zuspruch werden aus dem eigenen Leben entnommen, meine Hochachtung, Herr Blenkle, entschuldigen Sie ...“ Der Pfarrer, verlegen die letzten Worte murmelnd, vertiefte sich in die Bibel. „Sie ... geben mir selber ... viel, Blenkle.“
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 83
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Impressum
Heinz Kruschel
Sein letzter Tag
Die letzten Stunden von Conrad Blenkle
ISBN 978-3-95655-120-8 (E-Book)
Das Buch erschien erstmals 1981 im Verlag Neues Leben, Berlin (Heft 414 der Reihe „Das neue Abenteuer“).
Gestaltung des Titelbildes: Ernst Franta
Sein letzter Tag
Schiefergraues Licht in der engen Zelle, draußen nicht mehr Tag, aber auch noch nicht Nacht.
Conrad stand auf dem Hocker und sah hinaus. Körniger Schnee stob über den Platz. Die hohe Mauer war von einer Eiskruste bedeckt. Hinter dieser Mauer lag die große Stadt, seine Stadt, versteckt unter dem Kältenebel, und in dieser Stadt würde in ihrem Zimmer Gertrud sitzen, tränenlos, leergeweint.
Er rieb sich die steif gewordenen Finger, drehte sich langsam um, weil die Schmerzen im Nacken sich wieder meldeten, stieg vom Hocker herab und stellte ihn wieder an den Tisch.
Ein Wintertag wie vor zwei Jahren, als sie ihn verhafteten.
Er hörte, wie die Beamten durch den Gang gingen, sie trugen zwar Schuhe mit Gummisohlen, aber an diesem kalten Tag drangen alle Geräusche in die Zelle. Sie gingen nur draußen vorbei; wenn sie einander begegneten, redeten sie nicht miteinander.
Es war still, tödlich still.
Die Stille vibrierte in Conrads Ohren und schwoll zu einem Rauschen an. Seine Stirn fasste sich schweißfeucht an, obwohl es kühl in der Zelle war. Er wollte nicht starr werden unter der Gewissheit, er wollte ruhig werden.
Die Zelle war ein hallender Saal, eine dunkle, dröhnende Schlucht. Die Todeszelle.
Morgen also, morgen sollte es sein, es wird nur noch einen Morgen geben, endgültig. Er zwang sich zu einem Lächeln. Die Wörter „endgültig“ und „marxistisch“ passen nicht zueinander, dachte er, sie sind unvereinbar, aber für mich ist es endgültig vorbei. Es gibt noch einen Morgen für mich, einen sehr kurzen Morgen, für mich ist die Zeit bedeutungslos geworden.
Er könnte essen. Der kurzbeinige Beamte hatte ihm die Fesseln abgenommen und ein Tablett auf den Tisch gestellt, die Henkersmahlzeit, Brot und Wurst und Käse und eine Scheibe Fleisch. Im ersten Moment hatte Conrad noch heißen Appetit verspürt, denn sie hatten ihn hungern lassen. Er hatte einen Bogen Packpapier in der Zelle versteckt, von dem er täglich ein paar Stücke abgerissen und langsam gekaut hatte. Er rührte das Essen nicht an.
Er wollte nachdenken, er hatte nicht mehr viel Zeit. Kätes Gnadengesuch war abgelehnt worden, aber mit einer Sondergenehmigung des Volksgerichtshofes hatte ihn seine ehemalige Frau viermal besuchen können, und sogar Gertrud hatte eine Möglichkeit gefunden: Als Fürsorgerin begleitete sie seine alte, schwer kranke Mutter, die nicht mehr begriff, was um sie herum geschah. Vater war nun schon tot.
Nun würde keiner mehr kommen.
Doch, der Wärter, der alte Block, dessen Uniform so aussieht, als bügele sie ihm seine Frau täglich. Er lächelte nie, er redete Conrad nur dienstlich an, vor einer Woche hatte er allerdings mit ihm gesprochen. „Bei Stalingrad, Blenkle, es war mein letzter Sohn, der erste ist als Flieger über der Nordsee abgestürzt, der zweite hat unter Rommel gedient und ist in seinem Panzer verbrannt, und nun liegt der dritte irgendwo in der Steppe oder in den Ruinen. Für uns leben sie, wir werden ihren Geburtstag feiern, und jede Woche stellt meine Frau frische Blumen vor ihre Bilder, und dann sprechen wir sogar mit ihnen und hören ihre Stimmen.“
Conrad wusste nicht, was in Block vorging, aber der wortkarge Block war ihm angenehmer als der stets lächelnde, stets schwitzende Gelbke, der sich verabschiedet hatte, bevor Block seinen Dienst antrat: „Irgendwie erwischt es uns alle, Blenkle, in fünfzig Jahren sind wir alle vergessen und verfault. Du bist keiner von den Greinern gewesen, aber hochmütig bist du, Blenkle, ich bin für dich ein Stück Dreck, ja, ich kenne deine Meinung, von mir hättest du die Bücher nicht bekommen, aber der Pfarrer kann sich hier eben immer noch aufspielen. Wenn es nach mir ginge, Schwamm drüber. Lesen betäubt, finde ich, du hättest nur nachdenken sollen, nur grübeln, verstehst du, verrückt werden davon …“
Das alles mit diesem Lächeln. Sie sind zufrieden, dachte Conrad, Block könnte sogar froh sein. Er wird einen Kommunisten auf seinem letzten Gang begleiten, im Kampf gegen die Kommunisten ist doch sein dritter Sohn gefallen. In drei oder vier oder fünf Stunden wird er, gemeinsam mit dem Pfarrer, den zum Tode verurteilten Kommunisten Blenkle holen und in den fensterlosen, auszementierten Raum bringen, der acht mal zehn Meter groß sein soll. Das weiß er von Gelbke. Es gibt einen Verkündungsraum, in dem ein mit schwarzem Tuch bedeckter Tisch steht, und einen Vollstreckungsraum, beide trennt nur ein schwarzer Vorhang. Der Scharfrichter würde melden, dass die Hinrichtungswerkzeuge in einem ordnungsgemäßen Zustand sind und dass er und seine Gehilfen bereit wären, dann würde der Leiter der Vollzugshandlung die Begründung des Urteils verlesen. Sie werden dem Verurteilten die Schultern entblößen, der vielleicht noch die Reihe der gestapelten Särge sehen wird, alle mit roter Farbe gestrichen, Särge in zwei Größen, die eine Ausführung fünfzehn Zentimeter kürzer als die andere: eine Sorte für die Enthaupteten, eine für die Gehenkten.
„Auf dem Schafott drehen viele durch“, hatte Gelbke gesagt, in einem Tonfall, als erzählte er von einer bevorstehenden Mahlzeit, „sie toben, wenn sie das Blut des Vorgängers sehen.“
Conrad saß auf dem harten Schemel, das Gesicht zum Fensterschlitz gewandt, und presste den Rücken fest gegen die Kante des Tisches. Er griff nach dem Brot, brach ein Stück ab, formte es zwischen den Fingern zu einem kleinen Kloß und steckte den Bissen in den Mund. Das Brot war klunschig, aber er kaute es langsam, bis er den süßen Geschmack wahrnahm. Alle seine Sinne sollten funktionieren.
Ruhe, nur Ruhe, denke nicht an das Geschwätz Gelbkes und nicht an die Rache des kleinen Block.
Er musste das Summen in den Ohren loswerden, er möchte die Gedanken ordnen können. Er saß still da und spürte nicht einmal, wie das schiefergraue Licht seinen halb blinden Augen guttat, wie der Druck auf den Sehnerv nachließ. Die Gedanken lebten stärker als sein Wille, viele Gedanken bestürmten ihn, er wollte sie bezwingen und sagte halblaut: „Ich bin zweiundvierzig Jahre alt. Ich fühle mich nicht so alt. Es liegt Schnee draußen. Die Kinder werden auf dem Eis der Gassen schlittern und ihre Schlitten aus dem Keller geholt haben wie damals in Kopenhagen, als ich die Laube verließ, um zu Markeprand zu gehen ...“ Er stemmte sich gegen den Tisch, als stemmte er sich gegen Stimmen und Gedanken, seine eigene Stimme dröhnte in dem hohen, schmalen Raum wie in einem Dom, die Stille vibrierte weiter ... „Ich muss ruhig werden. Der Tod ist immer da. Er kann in vielerlei Gestalt kommen.“
Schnee draußen.
Auf dem Kopf der Göttin Gefion lag auch eine Schneekappe vor zwei Jahren, und die Hörner ihrer vier in Ochsen verwandelten Söhne glitzerten weiß und bereift, als ich die Langelinie entlangging, um in die Straße Vejrögade zu gelangen, und alles war still an diesem kalten Tag. Ich bin in eine Falle gegangen. Hiob hat sie mir gestellt. Warum bin ich ausgerechnet in ihre Falle gegangen? Ich habe Hiob gesehen, und ich war der einzige, der ihn kannte, darum musste ich Curt warnen und die andern. Aber was änderte das schon? War dieser Grund zwingend, das Versteck zu verlassen? Trotz des Versprechens, keinen Treff aufzusuchen?
Conrad hatte oft über diesen Tag nachgedacht, über jede Handlung; dieser Tag hatte sich in sein Gedächtnis eingebrannt, er konnte sich an das rote Gesicht der Fischerfrau erinnern, an die Rufe der Kinder, an Magdas große Augen und an den Geruch des frischen Brotes in Österbro. Er hätte warten und länger durchhalten können. Aber Hiob war ein gefährlicher, ein gerissener Mann. Conrad kannte ihn, nur er, er allein. Hiob war einer ihrer Spezialisten. Es war seine Pflicht gewesen, die anderen Genossen zu warnen.
Und Conrad hatte die beiden Argumente in die Waagschalen gelegt, mal stieg, je nach Stimmung und Ansicht, die eine, mal die andere. Nun aber, an diesem Abend, da die Stille dröhnend auf ihn einhämmerte, sagte er sich, dass sie Ejner laufen lassen mussten, dass sie Curt nicht greifen konnten und Marius nicht gefunden haben, dass sie denken müssen, er sei der letzte Mann gewesen. Du hast keinen gefährdet, sagte er sich, stand auf, trat wieder unter das Fenster und rieb sich die Handgelenke, die von den Fesseln angeschwollen waren. Das schiefergraue Licht hinter den Gitterstäben war schwarz geworden, eine einzelne Schneeflocke fiel durch den Spalt, klebte ein Weilchen wie ein stummes Flügelwesen auf der betonierten Leiste und schmolz dicht vor seinen Augen. Dann wischte der Zeigefinger eines Scheinwerfers über das Geviert und blendete ihn. Er schloss die Augen und drückte die Fäuste gegen die Ohren. Die Stimmen, die verfluchten Stimmen.
Sie sind der Typ des fanatischen Kommunisten. Ja, ja, ja.
Rede doch, dann könnten wir alle überleben. Nein, nein, nein.
Hüte dich vor Wiatrek und Helms.
Clara, sag Vater, wie es bei Stalingrad steht.
Warum liest mir Tante Grete das Märchen von dem Mann vor, in dem das Mädchen den Mann liebt, der sich des Geldes wegen ein steinernes Herz einpflanzen ließ, dafür das eigene, pochende hingebend?
Mensch, ich werde noch verrückt, Conrad, du bist doch kein Holländer, ich muss etwas tun, ich werde noch verrückt.
Mijn naam is Frederiks.
Arend kann nicht auf den Kran mit seinen verkrüppelten Händen.
Es jammert mich, dass wir uns nicht aussprechen können, Thorvald, die dänischen Genossen sind misstrauisch geworden.
Lasst ihn doch laufen, er wird hingerichtet, wenn sie ihn bekommen.
Du könntest höchstens noch präzisieren, da bist du besser informiert, es hat alles keinen Zweck mehr, es ist taktisch falsch, länger zu schweigen.
Die Helligkeit stach in die Zelle, das schneidende Licht: Sie hatten die Glühbirne unter der eingekerbten Ventilatorklappe eingeschaltet. Das kreischende, schrille Geräusch: Ein Mann schloss die Tür auf.
Conrad stand da mit geschlossenen Augen und öffnete sie spaltbreit, das Licht tat seinen Augen weh. Poelchau und Block kamen herein. Block stellte ein kugliges Glas blauer Tinte auf den Tisch, schob das Tablett mit dem Essen zur Seite und legte Papierbogen und einen Federhalter hin. Der Pfarrer schickte Block wieder hinaus.
„Möchten Sie eine Beruhigungstablette, Herr Blenkle?“
„Nein.“ Er wollte sich nicht betäuben, er wollte allein zur Ruhe kommen. Poelchau wirkte, wie er ihn jetzt ansah, weil er sich an das Licht gewöhnt hatte, hilflos auf ihn. Conrad dachte: Nun kann er die paar Bände Weltgeschichte wieder mitnehmen.
„Sie dürfen drei Briefe schreiben. Wollen Sie sich aussprechen? Es ist meine Pflicht, dort zu sein, wo es am schwersten ist, das habe ich auch Ihrer früheren Frau gesagt. Ich will nur noch die Feder ausprobieren ...“
Conrad spürte ungläubig, wie das Dröhnen schwand, wie er innerlich ruhiger wurde. Er blieb aber misstrauisch dieser eingetretenen Ruhe gegenüber, als wäre sie eine Täuschung der Sinne.