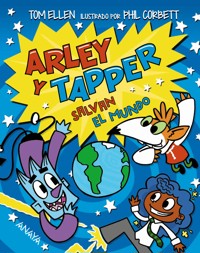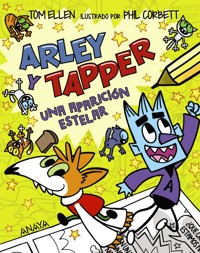9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Goldmann Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Zwei Fremde. Ein Anruf. Ein unverhoffter Neuanfang ...
Will arbeitet für ein Krisentelefon und ist ein ausgesprochen guter Zuhörer. Über sein eigenes Leben spricht er jedoch so gut wie nie – vor allem nicht über das, was vor fünf Jahren in Paris geschah. Die Journalistin Annie braucht dringend ein offenes Ohr: In ihrer Beziehung kriselt es, im Job ebenso, und das Verhältnis zu ihrer Familie ist angespannt. Als sie bei Will anruft, fühlt sie sich verstanden wie lange nicht mehr. Und auch er spürt eine ungewohnte Verbundenheit mit der Fremden am Telefon. Immer wieder wählt Annie Wills Nummer, und mit jedem Anruf werden ihre Gespräche vertrauter. Kann daraus echte Freundschaft werden – oder sogar Liebe?
»David Nicholls für die junge Generation.« The Times
»Ein modernes ›Schlaflos in Seattle‹ – bezaubernd!« Press & Journal
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 473
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Buch
Einst war Will der gefeierte Sänger einer Indieband – bis eine Katastrophe sein Leben zerstörte. Heute jobbt er in einem Londoner Elektronikgeschäft und arbeitet nebenher für ein Krisentelefon.
Die Journalistin Annie landet eher zufällig in Wills Leitung. Weil es in ihrem Privatleben gerade ordentlich kriselt, schüttet sie ihm ihr Herz aus. »Jack« und »Pia«, wie die beiden sich am Telefon nennen, spüren sofort eine besondere Verbindung zueinander.
Immer wieder wählt Annie Wills Nummer, und mit jedem Anruf werden ihre Gespräche persönlicher. Doch erst als Annie ein Treffen vorschlägt und sie sich im Pub gegenüberstehen, erkennen sie, dass sie sich schon einmal begegnet sind …
Autor
Tom Ellen stammt aus London und ist Autor und Journalist. Als Co-Autor hat er mehrere preisgekrönte YA-Romane veröffentlicht. Seine Bücher werden in zahlreiche Sprachen übersetzt und erscheinen in 20 Ländern. Außerdem schreibt er für Zeitschriften wie Cosmopolitan, Glamour und Stylist.
Tom Ellen
Jedes Wort von dir
Roman
Aus dem Englischen
von Ulrike Werner-Richter
Die englische Originalausgabe erschien 2024 unter dem Titel »The Lifeline« bei HQ, an imprint of HarperCollins Publishers Ltd, London.
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Deutsche Erstveröffentlichung September 2025
Copyright © 2024 by Tom Ellen
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2025
by Wilhelm Goldmann Verlag, München,
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Straße 28, 81673 München
(Vorstehende Angaben sind zugleich
Pflichtinformationen nach GPSR.)
Translated under licence from HarperCollins Publishers Ltd.
Umschlaggestaltung: UNO Werbeagentur, München
Umschlagmotive: Roberta Murray / arcangel images; FinePic®, München
Redaktion: Susanne Bartel
LS · Herstellung: ik
Satz: KCFG – Medienagentur, Neuss
ISBN 978-3-641-32396-7V001
www.goldmann-verlag.de
Für Carolina und Maud
PROLOG
26. Februar, vor fünf Jahren
Paris, Frankreich
Sie wissen beide, dass er gehen muss.
In der letzten Stunde haben sie davor die Augen verschlossen. Sind drum herum getänzelt. Es war nicht nur ein Elefant im Raum, sondern vielmehr eine ganze Herde dieser Viecher, die hinter ihnen durch die französische Hauptstadt trampelte. Aber jetzt können sie sich nicht mehr verstecken. Es gibt kein Entrinnen mehr. Es ist so weit.
»Also«, sagt er.
»Also«, antwortet sie.
Sie stehen auf dem Pont Alexandre III – derselben Brücke, die sie sechs Stunden zuvor gemeinsam überquert haben. Erstaunlich, denkt sie, was in sechs Stunden alles passieren kann. Im Westen sieht man den Eiffelturm, im Osten die Place de la Concorde, und als die Sonne untergeht und die Seine in ein tiefes Rotgold taucht, ist es, als stünden sie in einer Postkarte. Einen Moment lang bleibt ihr vor Bedauern, dass es das jetzt war, fast die Luft weg.
»Tja, ich sollte wohl …«, sagt er.
»Jep. Stimmt. Unbedingt.« Sie nickt. »Du darfst deine Fans nicht im Stich lassen.«
Er lacht, und sie tut alles, um locker zu wirken. Als ob es keine große Sache wäre. Aber mehr als alles andere wünscht sie sich, dass es nicht vorbei wäre. Dass sie wenigstens noch eine Stunde zusammen hätten.
Er bläst die Backen auf, schiebt die Hände in die Taschen seines Mantels. »Ehrlich gesagt würde ich den Auftritt am liebsten absagen.«
Sie nickt wieder und fragt sich zum wohl hundertsten Mal, warum er sie nicht einfach zu diesem verdammten Konzert einlädt. Hat es vielleicht mit der Frau von vorhin zu tun? Der mit dem Pony? Hat sie die ganze Situation falsch verstanden?
Paranoia macht sich in ihr breit, und als hätte er ihre Gedanken gelesen, sagt er: »Also, ich glaube, du hast genug Material über mich gesammelt, oder? Für deinen Artikel?«
Für den Bruchteil einer Sekunde fühlt es sich an, als hätte sie einen Schlag in den Magen bekommen. Doch dann wird ihr klar, dass er einen Scherz gemacht hat.
Er grinst sein breites Grübchengrinsen und präsentiert ihr dabei die eigenartig attraktive Lücke zwischen seinen beiden Vorderzähnen. »Verbringst du immer den ganzen Nachmittag mit deinen Interviewpartnern?«, fragt er und stupst sie mit dem Fuß an.
»Sag mal, hast du mich gerade getreten?«
»Nur angetippt. Spielerisch angetippt.«
»Na, wenn du meinst.« Cool bleiben, denkt sie. Bleib cool.
»Wie wirst du mich in deinem Artikel denn beschreiben?«, fragt er.
»Vermutlich als ›nervig‹. ›Will, der nervige Frontmann der Band …‹«
»Hm. Okay. Könnte passen. Oder eher ›sexy‹?« Seine Zunge spielt mit der Zahnlücke. »›Will, der sexy Frontmann der Band …‹?«
»Treffen wir uns doch in der Mitte«, sagt sie. »›Nervtötend sexy‹?« Er lacht – ein breites, offenes Lachen –, und plötzlich ist sie sehr froh, dass ihre Wangen schon von der Kälte gerötet sind.
Nervtötend sexy. Das ist wirklich die perfekte Beschreibung für ihn.
Sein Telefon klingelt. Er holt es heraus, schaut aufs Display. Einen Moment lang starrt er es an, sein Gesicht ist ausdruckslos. Dann steckt er das Telefon zurück in seine Jeans, ohne das Gespräch anzunehmen. »Ich sollte jetzt echt mal gehen«, sagt er. Aber er tut es nicht.
Er kratzt sich das stoppelige Kinn und blickt stirnrunzelnd in die untergehende Sonne. Warum lädst du mich nicht zu diesem Konzert ein?, denkt sie. Tu es doch einfach, du nervtötender, sexy Trottel.
»Was ist so lustig?«, fragt er, als sie über ihren eigenen inneren Monolog lachen muss.
»Nichts, entschuldige.« Sie nimmt sich zusammen. Er hat offensichtlich nicht vor, sie zu fragen. Sie sollte lieber als Erste gehen, dann wird sie sich im Zug nach Hause weniger erbärmlich fühlen. »Also, weißt du – das heute hat wirklich Spaß gemacht, und …«
»Ich habe gerade überlegt …«, sagt er. »Wie lange bist du noch in Paris?«
»Äh …« Sie kräuselt die Nase. Ihr Eurostar fährt am Gare du Nord in genau einer Stunde und achtundvierzig Minuten. »Ich weiß noch nicht genau.«
»Okay.« Er schaut auf seine Schuhspitzen. »Also, ich hab ja keine Ahnung, was du später vorhast, aber ich dachte, vielleicht könnten wir nach meinem Auftritt noch ein bisschen zusammen abhängen? Wenn du magst.«
Sie muss sich auf die Zunge beißen, um nicht zu breit zu grinsen. »Ja. Vielleicht. Du willst mich aber nicht nur wieder treten, oder?«
Er lacht, aber er kann ihr immer noch nicht in die Augen sehen. »Nein, ich wollte … Weißt du, das heute war richtig schön. Und ich würde mich freuen, wenn es nicht vorbei wäre. Jedenfalls noch nicht. Wenn du magst …«
Er bricht ab, stolpert über seine Worte, und ihr Herz klopft laut in ihrer Brust.
Sie tut, als müsste sie nachdenken. »Hm, ja. Also gut. Das wäre nett.«
Er fährt sich mit der Hand durchs Haar, sichtlich erleichtert. »Cool. Prima. Wie wäre es, wenn wir uns um dreiundzwanzig Uhr wieder hier treffen?«
»Hier auf der Brücke?«
»Genau hier. Dann reden wir weiter. Es wird sein, als wäre ich nie weg gewesen.«
Sie lacht. »Einverstanden. Hier auf der Brücke.«
»Um elf.«
Um elf? Normalerweise ist sie um elf im Bett. Aber das sollte man dem Frontmann einer erfolgreichen Indieband vielleicht besser nicht auf die Nase binden.
»Dann also bis später«, sagt sie.
Sie fragt sich, ob er sie küssen wird. Hoffentlich küsst er sie. Oder vielleicht sollte sie ihn küssen?
»Bis dann.«
Immer noch grinsend dreht er sich um und geht. Sie atmet langsam aus und befiehlt sich, sich nicht zu sehr reinzusteigern. Schließlich kennt sie diesen Typen kaum. Andererseits: Warum sollte sie sich nicht reinsteigern? Hat sich der heutige Tag nicht wie … etwas Besonderes angefühlt? Wie der Anfang von etwas Neuem? Sie greift nach dem Brückengeländer. Mir egal, denkt sie. Ich steigere mich rein.
Die Sonne versinkt im Fluss. Sie geht zurück zum linken Ufer und überlegt, wie sie die nächsten vier Stunden totschlagen soll.
KAPITELEINS
Will
26. Februar, Gegenwart
Büro von Green Shoots, Limehouse, London
Das Telefon klingelt.
Ich schiebe die Tupperdose mit meinem Abendessen beiseite – einem klebrigen Klumpen Restenudeln mit Thunfischsoße – und spüre, wie sich meine Brust zusammenzieht, als ich den Hörer abhebe.
»Green-Shoots-Hilfetelefon, hallo?«
»Oh, hallo … Ist dort Jack?«
Die Anspannung löst sich, als ich meinen Decknamen höre. Es ist eine Stimme, die ich kenne. »Hallo, Eric«, sage ich.
»Oh, Jack. Schön, Sie zu hören. Ich versuche es schon seit einer Weile. Ich hatte befürchtet, nicht durchzukommen.«
»Tut mir leid. Heute Abend war viel los.«
Das ist eine Untertreibung. Schon seit fast fünf Jahren arbeite ich ehrenamtlich bei Green Shoots und weiß daher, dass keine Schicht der anderen gleicht. Aber der heutige Abend war wirklich anstrengend. Manchmal sitze ich stundenlang in diesem schmuddeligen kleinen Kellerbüro, und das Telefon klingelt kein einziges Mal. Und an anderen Abenden – wie heute – habe ich kaum Zeit, mir zwischen den Anrufen eine Tasse Tee zu machen.
Aber eigentlich ist das ganz gut so. Keine Zeit zum Nachdenken. Keine Zeit, mich vom heutigen Datum runterziehen zu lassen.
Bisher hatte ich neben zwei regelmäßigen Anrufern drei ziemlich schwierige Neulinge: einen jungen Mann mit ernsthaften Geldsorgen, eine Frau, die vermutet, dass ihr Mann sie betrügt, und einen weinenden Vater, der Angst hat, dass seine Tochter sich etwas antut. Da ist es eine Erleichterung, eine vertraute Stimme zu hören: die von Eric. Es ist eine Erleichterung, zu wissen, dass dieses Gespräch nicht so heftig werden wird.
Ich klemme das Telefon mit der Schulter an mein Ohr und beginne, den Anruf auf dem Computer zu protokollieren.
»Wie geht es Ihnen heute Abend, Eric?«
»Eigentlich nicht schlecht, Jack. Ich kann mich nicht beklagen. Obwohl ich Sie ja normalerweise anrufe, um genau das zu tun.«
Er lacht. Ich lache. Es ist unser kleines Ritual: der gleiche scherzhafte Austausch, mit dem wir in den letzten fünf Jahren jede Unterhaltung eröffnet haben. Ich weiß nicht genau, wie lange Eric schon bei dieser Krisenhotline anruft, aber er hat es auf jeden Fall schon getan, bevor ich hier anfing. Wie für so viele der anderen Stammanrufer ist Green Shoots für ihn eine Art Rettungsleine. Seine einzige Verbindung zur Außenwelt. Er sagt mir oft, dass er den ganzen Tag über noch keine andere als meine Stimme gehört hat.
»Haben Sie schon zu Abend gegessen?«, frage ich und wähle aus dem Drop-down-Menü im Computer unter »Alter« »60 – 70« und bei »Art des Anrufs« »regelmäßiger Anrufer«.
»O ja. Mikrowellen-Biryani. Das beste Gericht, das es bei Morrisons gibt.«
»Ausgezeichnet.«
»Und gleich will ich mir MasterChef anschauen.«
Im Drop-down-Menü klicke ich auf »Grund für den Anruf« und wähle »Einsamkeit«.
»Ach ja? Neue Staffel, nicht wahr?«
»Genau. Die neuen Kandidaten sehen ganz nett aus. Heute Abend müssen sie Desserts machen. Ich wünschte, ich hätte mir etwas Süßes zum Nachtisch gekauft.«
Er versucht zu lachen, aber es gelingt ihm nicht ganz.
»Geht es Ihnen … okay, Eric?«
Obwohl ich keine Ahnung habe, wie Eric aussieht oder wo er wohnt – und er nicht einmal meinen richtigen Namen kennt –, telefonieren wir seit fast einem halben Jahrzehnt ziemlich regelmäßig miteinander. Daher merke ich jetzt schon an der kleinsten Schwankung seiner rauen Stimme, wenn etwas mit ihm nicht stimmt. Und heute Abend stimmt definitiv etwas nicht mit ihm.
Und das, als ich gerade noch gehofft habe, dass dies ein einfacher Anruf wäre.
»Tja, schon. Nur … ich fühle mich ein bisschen melancholisch, Jack«, sagt er. »Albern, wirklich. Ich habe eine Kleinigkeit getrunken und über ein paar Sachen nachgedacht.«
Ich starre auf den Computerbildschirm. Das Wort »Einsamkeit« im Menü flackert mich an.
»Gibt es etwas, worüber Sie reden möchten?«
»Na ja, ich …« Seine Stimme zittert, und er holt tief Luft, um neu anzusetzen. »Ich habe dieses Curry in die Mikrowelle gestellt und mir dabei die Hand in der Tür eingeklemmt. Es klingt vielleicht seltsam – ich habe meine Hand angeschaut, und … es war die Hand eines alten Mannes. Mit den Adern eines alten Mannes und den Leberflecken eines alten Mannes. Ich weiß, das hört sich komisch an. Ich meine, schließlich bin ich ein alter Mann. Aber manchmal … holt es einen einfach ein. Man fragt sich, wo all die Jahre geblieben sind. Man fragt sich, wie man hier gelandet ist.« Ich höre, wie er einen Schluck von seiner »Kleinigkeit« nimmt. »So allein.«
»Mhm«, sage ich sanft. »Verbales Nicken«, so wurde dieses Geräusch in unseren Schulungen genannt. Es soll dem Anrufer bedeuten, dass man noch in der Leitung ist. Und dass man immer noch zuhört.
»Ich hätte nur nie gedacht, dass ich so enden würde.« Seine Stimme ist jetzt so leise, dass ich ihn kaum verstehen kann. Ich presse den Hörer an mein Ohr. »Aber vielleicht geht es ja von Zeit zu Zeit jedem mal so. Keine Ahnung. Haben Sie jemals auf Ihr Leben zurückgeblickt und Dinge bereut, Jack?«
Jeden einzelnen Tag. Immer, seit …
Meine Augen wandern zum heutigen Datum in der Ecke des Bildschirms, und mein Magen schlägt einen Salto. Ich muss schwer schlucken, um wieder normal zu atmen. »Ach, Eric – Sie wissen doch, dass ich nicht über persönliche Dinge sprechen darf. Über nichts, was mich selbst betrifft. Bei diesem Anruf geht es um Sie. Wir sind nur zum Zuhören hier.«
Er lacht traurig. »Ich weiß. Man sollte meinen, dass mir das nach all den Jahren klar ist.« Ich höre, wie er einen weiteren Schluck nimmt. »Ich glaube, ich sollte besser auflegen.« Er seufzt. »Da draußen gibt es Menschen, die Sie dringender brauchen als ich.«
»Eric, Sie wissen, wie gerne ich mich mit Ihnen unterhalte. Unsere Gespräche sind immer ein Lichtblick in meiner Schicht.«
»Sie sind ein guter Kerl, Jack. Ehrlich.«
Glaub mir, Eric, das bin ich nicht.
»Vielen Dank.«
»Ich meine es so«, sagt er, und seine verwaschenen Worte klingen jetzt härter, ernster. »Sie alle bei diesem Hilfetelefon – Sie opfern Ihre Freizeit, um mit alten Knackern wie mir zu reden. Und mit Menschen, die noch viel Schlimmeres durchmachen. Sie können echt stolz auf sich sein.«
Ich versuche zu sprechen, aber mein Mund ist zu trocken. Obwohl die vorherigen Anrufe schrecklich waren, erscheint mir dieser plötzlich noch schlimmer.
Seit alles zusammengebrochen ist, genau heute vor fünf Jahren, habe ich vieles empfunden. Aber Stolz gehört mit Sicherheit nicht dazu. Mein Gesicht glüht, und ich spüre ein Brennen hinter den Augen. Ich kann so etwas heute nicht hören. Nicht ausgerechnet heute.
»Okay, Eric. Passen Sie auf sich auf.«
»Sie auch, Jack. Wir telefonieren bald wieder. Auf Wiederhören.«
Das Freizeichen bohrt sich in mein Ohr, und ich kann wieder durchatmen. Ich bin ganz allein in diesem feuchten, engen Büro. Regen hämmert gegen das Fenster, das Wort »Einsamkeit« blinkt immer noch auf dem Computerbildschirm.
Eric weiß nicht, warum ich das hier wirklich mache. Warum ich mich freiwillig dafür gemeldet habe. Warum ich immer wieder zurückkomme, Jahr für Jahr.
Manchmal verspüre ich den verrückten Drang, es ihm zu erzählen.
KAPITELZWEI
Annie
3. März
Shoreditch, London
KEINEVAGINATORTE!
Außer dieser Betreffzeile enthält die E-Mail kein einziges Wort, ist aber mit dem roten Ausrufezeichen für »Hohe Priorität« gekennzeichnet.
Ich spähe über den Rand meines Bildschirms und sehe, dass die Absenderin – meine Freundin und Kollegin Lexi – mich unverwandt anstarrt. Ich drücke auf »Antworten« und tippe:
Was meinst du, Süße?
Von der anderen Seite des Schreibtisches höre ich einen dramatischen Seufzer, dann das Klappern der Tastatur. Lexis Antwort kommt eine Sekunde später:
Keine Torte, die wie eine Vagina aussieht! Keine Ahnung, wie ich mich noch deutlicher ausdrücken soll. KEINEVAGINATORTE!!
Obwohl wir uns acht Stunden am Tag direkt gegenübersitzen, kommunizieren Lex und ich bei der Arbeit hauptsächlich per E-Mail. Das liegt zum Teil daran, dass wir gerne obskure GIFs von der Sitcom Schitt’s Creek austauschen – was schwierig ist, wenn man miteinander redet –, aber vor allem wollen wir in unserem Großraumbüro den Anschein erwecken, dass wir produktiv arbeiten. Auch wenn wir uns eben nur obskure Schitt’s-Creek-GIFs mailen.
Oder, wie in diesem Fall, über Lexis Babyparty diskutieren.
Gibt es wirklich Torten, die wie eine Vagina aussehen?, schreibe ich und klicke auf »Senden«.
Klar, schreibt sie zurück. Google mal.
Schon klar. Auf meinem Dienstcomputer. Willst du, dass ich gefeuert werde?
Ich höre, wie sie prustet, sich aber schnell wieder beruhigt, als die anderen sich umschauen.
Außerdem: Wer organisiert diese Babyparty?, schreibe ich. Ich oder du?
Du natürlich, antwortet sie. Aber ich denke, es sollte eine Grenze für akzeptable Dinge geben, und Vaginatorten sind diese Grenze. Sie fügt ein GIF hinzu, auf dem David Rose aus der Serie Schitt’s Creek »Äußerst peinlich und unangenehm« sagt.
Ich dachte, du wolltest überrascht werden?, tippe ich und füge ein GIF von Moira Rose aus derselben Serie beim Aussuchen einer besonders lächerlichen Perücke hinzu.
Will ich auch! Aber es soll eine GUTE Überraschung sein, keine grauenhafte Vaginatorten-Überraschung. GUCKMAL!
Zwei Sekunden später landet eine weitere E-Mail in meinem Posteingang. Ich öffne sie und zucke halb lachend, halb angewidert zusammen, als ich das Foto sehe, das Lexi angehängt hat: eine dreistöckige Sahnetorte, die beunruhigend realistisch den Austreibungsprozess einer Geburt darstellt.
»Du liebe Zeit, Annie, was schaust du dir denn da an?«
Ich drehe mich um und sehe meinen Boss Matt – den Chefredakteur von Marker Media –, der hinter mir steht und mit einer Grimasse die Marzipanvagina anstarrt, die meinen halben Bildschirm einnimmt.
»Entschuldigung, ich … Entschuldigung.« Ich werde rot und verkleinere das Foto, während Lexi mir gegenüber in stumme Hysterie verfällt. »Das ist nur Recherche … für einen Artikel.«
Matt hebt die Augenbrauen. »Ach so. Nun, dann freue ich mich, bald deine Top Ten der Albtraumtorten zu sehen.«
Er zupft an den Kordeln seines Hoodies. Wie die meisten Männer, die im Bereich digitale Medien arbeiten, zieht sich auch Matt an Tagen ohne offizielle Termine immer noch an wie ein Schuljunge, obwohl er bereits Ende dreißig ist. Heute trägt er den neongrünen Hoodie und eine Low-Waist-Jeans, die uns eine halbe Arschbacke seiner Boxershorts mit den Hauptcharakteren der Serie Rick and Morty präsentiert. Mit besagter Arschbacke setzt er sich auf die Kante meines Schreibtisches, beugt sich vor und senkt die Stimme. »Übrigens, Annie«, fügt er hinzu, »ich würde gern morgen kurz mit dir über etwas sprechen. Wann immer es dir passt.«
Aus den Augenwinkeln sehe ich, wie Lexis Kopf über dem Monitorrand wie ein Erdmännchen hüpft.
»Ja, natürlich«, sage ich zu Matt. »Klingt gut.«
»Coolio.« Er klopft mit den Fingerknöcheln auf meinen Schreibtisch und schlendert davon.
Lexi hat immer noch ihre Worum-ging-es-da-gerade-Miene aufgesetzt, also schicke ihr ein GIF von David Rose, in dem er sagt: »Ich empfinde dieses tiefe, schmerzende Gefühl des Grauens.«
Sie antwortet sofort: Frühes Mittagessen?
#
»Was glaubst du, worüber will er mit dir reden?«, fragt Lex, als wir uns die Shoreditch High Street entlang in Richtung einer Pret-Filiale schlängeln.
»Keine Ahnung«, sage ich. »Wahrscheinlich will er nur mit mir brainstormen oder so. Er redet schon seit Wochen davon, dass er ein paar neue Ideen für die Website braucht. Oder vielleicht …« Ich starre sie mit gespieltem Entsetzen an. »Du glaubst doch nicht, dass er mich wegen des Vaginatortenfotos feuern würde, oder?«
Sie prustet vor Lachen, während wir um die Ecke biegen. »Vielleicht will er wirklich über die Idee mit den Albtraumtorten diskutieren. Ich kann mir so etwas hundertprozentig auf unserer Seite vorstellen.«
»Ich auch.«
Die Website, für die wir arbeiten – Marker Media –, ist eigentlich ein Abklatsch von BuzzFeed: alberne Listen, witzige Quizfragen, schräge Nachrichten, Wissenswertes und Promitratsch, um die Mittagspause aufzulockern. In unserer siebenköpfigen Redaktion bin ich Senior Writer: ein Titel, der beeindruckend klingt, aber eigentlich nur dazu dient, mich daran zu erinnern, dass ich gut fünf Jahre älter bin als alle anderen hier, außer Lexi und Matt.
Nicht dass ich mich beschweren würde. Im Großen und Ganzen macht mir meine Arbeit wirklich Spaß. Sie stresst mich definitiv nicht und verursacht mir auch keine schlimme Schlaflosigkeit oder Herzrasen wie die Jobs einiger meiner Freunde. Aber es gibt eben Momente, in denen mich eine innere Panik fast lähmt und ich mich frage, ob ich mit vierzig immer noch Listen mit den zehn besten Love-Island-Memes erstellen werde. Dann erinnere ich mich daran, dass ich vor acht Jahren mit dem Traum nach London kam, eine richtige Autorin zu werden. Alles in allem bin ich aber immer noch froh, dass ich meinen Lebensunterhalt mit Schreiben verdienen kann.
»Das war übrigens mein Ernst«, sagt Lexi, während wir einem Paar ausweichen, das Selfies vor einem Banksy-Graffiti macht. »Bitte bestelle mir keine Vaginatorte für meine Babyparty.«
»Alexie«, seufze ich, »dir ist hoffentlich klar, dass diese Party erst in fast einem Monat stattfindet, oder? Wahrscheinlich fange ich frühestens am Abend vorher an, ernsthaft über die Torte nachzudenken.«
Sie bleibt mit entsetztem Gesicht mitten auf der Straße stehen.
»Das war ein Scherz! Ich mache nur Spaß!« Ich packe ihren Arm, damit sie weitergeht. »Ich weiß, dass dich nichts mehr stresst als Aufschieberitis.«
Sie zieht eine Miene. »Ich will doch nur, dass es schön wird, Annie! Schönes Essen, schöne Getränke, schöne Spiele; einfach eine schöne Zeit.« Sie umfasst ihren dicken Bauch durch die Jacke und lächelt mich an. »Du wirst es bestimmt verstehen, wenn du selbst mal so weit bist …«
Wenn ich mal so weit bin. Ich erwidere ihr Lächeln, obwohl ich bei diesem Satz ehrlich gesagt einen leichten Stich verspüre. Ich bin einunddreißig, und Dom und ich sind jetzt seit fast drei Jahren zusammen; ich nehme an, ich sollte allmählich mal darüber nachdenken, wann ich so weit bin. Aber immer wenn ich mir vorstelle, wir würden heiraten oder Kinder bekommen … Ich weiß nicht. Das Bild bleibt immer verschwommen.
Als wir Pret erreichen, ärgert sich Lexi. »Mist. Brechend voll. Und ich dachte, wir könnten dem Ansturm entgehen, wenn wir früher als sonst hier sind.« Sie holt tief Luft und krempelt ihre Ärmel hoch. »Ich hoffe, es gibt noch Falafel-Wraps, sonst mache ich einen Aufstand.«
Wie sich herausstellt, gibt es keine mehr, und sie macht tatsächlich einen Aufstand. Ich bezahle mein Sandwich und mein Getränk und sage ihr, dass ich draußen auf sie warte, bis sie damit fertig ist, die Pret-Mitarbeiter anzufauchen, sie sollten besser auf Schwangere mit Heißhunger auf Hummus vorbereitet sein.
Als ich auf den Bürgersteig trete, entdecke ich auf der anderen Straßenseite ein Geschäft. Eine Buchhandlung. Ich bin bestimmt schon tausendmal daran vorbeigelaufen, aber bis heute ist sie mir nie aufgefallen. Es ist die Art von Buchladen, die man heutzutage immer seltener sieht: abblätternde Farbe, ein verwittertes Schild, das knarrend über der Tür hängt, und ein nicht ganz sauberes Schaufenster mit einer wahren Fundgrube an verstaubten, gebrauchten Büchern.
Genau die Art Buchhandlung, die Dad geliebt hätte.
Mir stockt der Atem. Es ist zwar schon über ein Jahr her, aber es schockiert mich immer noch, wie plötzlich – und wie heftig – einen dieses Gefühl noch überfallen kann. An manchen Tagen spüre ich, dass ich ihn vermisse, nur als dumpfen Schmerz – als eine Art Hintergrundgeräusch. Dann wieder fühlt es sich an wie ein Würgegriff. Etwas, das dich an der Kehle packt, wenn du es am wenigsten erwartest.
Ohne nachzudenken, überquere ich die Straße und spähe durch die offene Tür des Ladens. Sogar der Geruch der Bücher erinnert mich an ihn. In so vielen meiner schönsten Erinnerungen stehen wir beide in Läden wie diesem nebeneinander und stöbern schweigend in den Regalen, bis einer von uns plötzlich einen Freudenschrei ausstößt, weil er auf literarisches Gold gestoßen ist.
Er hat mich zur Leseratte gemacht, und er hat auch einen großen Teil dazu beigetragen, dass ich Schriftstellerin werden wollte. Alle meine Erinnerungen an das Schreiben sind mit ihm verbunden. Wir spielten Consequences, wobei man einen Lückentext ergänzen muss; lange nachdem meine Mutter und meine Schwester sich gelangweilt verzogen hatten, saßen mein Vater und ich immer noch auf dem Wohnzimmerteppich, tauschten die Zettel aus und lachten wie verrückt über den Spaß, uns gegenseitig zu überraschen und der Geschichte eine völlig unerwartete Wendung zu geben.
Bei der Erinnerung daran, wie sehr er sich darüber freute, als ich nach London zog, um aus dem Schreiben einen Beruf zu machen, fühlt es sich an, als würde mir jemand den Magen zusammendrücken. Er war völlig aus dem Häuschen, als ich den Job bei Marker bekam. Ich zeigte ihm die Website und erklärte ihm, dass es sich dabei nicht um »richtiges« Schreiben handeln würde – eher um das Ausdenken von albernen Quizfragen und Listen. Aber er wollte nichts davon hören. Alles, was er sagte, war: »Annie, ich bin so verdammt stolz auf dich.« Er hat mich immer unterstützt. Immer, immer.
»Annie!«
Lexis Stimme holt mich mit einem Ruck in die Realität zurück. Ich drehe mich um und sehe, wie sie aus dem Deli kommt und einen Falafel-Wrap in die Höhe hält. Einen Moment lang fällt es mir unendlich schwer, den Schalter umzulegen und so zu tun, als ginge es mir gut. Ich fühle mich einfach total … müde. Aber ich schlucke, kralle meine Nägel in die Handballen, und die Erinnerungen lösen sich auf, der Würgegriff lockert sich.
»Kommst du, oder was?«, ruft Lexi.
Ich atme tief ein und setze mein Lächeln wieder auf, während ich über die Straße auf sie zugehe.
KAPITELDREI
Will
3. März
Tottenham Court Road, London
Wie es Tradition ist, komme ich zu früh zur Arbeit, und Dev ist zu spät dran. Ich lehne mich an die mit Graffiti beschmierten Fenstergitter von MicroShop und beobachte die Pendler, die in Mäntel und Schals eingemummelt vorbeischlurfen, den Blick fest auf ihre Telefone geheftet.
Damals, als ich als Kind ab und zu in die Londoner Innenstadt kam, gab es in der Tottenham Court Road fast ausschließlich Geschäfte wie MicroShop – riesige, chaotisch unordentliche Elektronikläden mit Namen, die immer am Rand der Urheberrechtsverletzung lavierten. Hier konnte man jedes erdenkliche Gerät kaufen, und Feilschen wurde nicht nur geduldet, sondern sogar eingefordert.
Aber jetzt ist unser Laden der letzte seiner Art. Er wirkt schäbig und deplatziert zwischen all den neuen Cafés und eleganten Inneneinrichtungsgeschäften. Wie lange wird es wohl noch dauern, bis MicroShop den Weg von AppWorld, iStore, MacPalace und von all den anderen geht? Wie lange noch, bis Dev mich beiseitenimmt und sagt: »Tut mir leid, Will, aber ich muss dir kündigen«?
Aus irgendeinem Grund kommen mir Erics Worte von unserem letzten Gespräch in den Sinn: Man fragt sich, wo all die Jahre geblieben sind. Man fragt sich, wie man hier gelandet ist. So allein.
Ich bin mir nicht sicher, was ich mir vorgestellt habe, wo ich mit zweiunddreißig Jahren sein würde. Aber sicher nicht hier. Und nicht so.
In meinen Zwanzigern habe ich nie so weit vorausgedacht. Mein Leben war eine einzige lange Party. Das klingt wie ein Klischee, aber es stimmt. Ich habe ausschließlich in der Gegenwart gelebt – ich habe mich kugelsicher, unsterblich gefühlt –, und wenn ich überhaupt einmal an die Zukunft gedacht habe, habe ich sie mir als noch hellere, glänzendere Version dessen vorgestellt, was ich bereits erlebte.
Nie hätte ich mir träumen lassen, dass mein Leben einmal so klein sein würde. Ich hätte der nächste Alex Turner werden sollen, oder der nächste Liam Gallagher. Jedenfalls mehr als … das hier.
»Hey!«
Ein harter Schlag auf meine Schulter und das blecherne Kreischen elektronischer Musik sind Zeichen dafür, dass Dev endlich aufgetaucht ist. Ich drehe mich zu ihm um. Die Kapuze seines Parkas ist hochgezogen, auf seinen Ohren sitzen riesige Beats-Kopfhörer, und ein breites Grinsen teilt seinen Bart in zwei Hälften.
»Mein neuester Mix!« Er schreit so laut, dass sich ein vorübergehender Geschäftsmann fast an seinem Flat White verschluckt. »Hab ich letzte Nacht gemacht – den musst du dir reinziehen, Mann!«
Er nimmt die Kopfhörer ab und setzt sie mir auf. Sofort wird der hupende Verkehr in der Tottenham Court Road von den dröhnenden Rhythmen von »DJ Devilish« – auch bekannt als Devindra Nayar, fünfunddreißigjähriger Geschäftsführer eines Elektronikgeschäfts – übertönt. Mir ist, als würde sich ein Pressluftbohrer durch mich hindurcharbeiten. Dev nickt mir eifrig zu, seine Miene heischt wenig subtil nach Komplimenten.
»Ausgezeichnet!«, brülle ich. »Der bisher beste!« Zufrieden nimmt er mir die Kopfhörer ab, und meine Ohren atmen erleichtert auf.
»Ich habe die ganze Nacht daran gearbeitet«, sagt er und schiebt die Gitter vor den Schaufenstern hoch. »Vielleicht musst du gleich mal allein die Stellung halten, während ich hinten ein kleines Nickerchen mache.«
Genau genommen ist Dev mein Chef, aber sein Führungsstil ist so entspannt, dass ich mich eigentlich auf Augenhöhe mit ihm fühle. MicroShop gehört seinem Onkel, und Dev sieht seine Rolle als Geschäftsleitung eher als Sprungbrett auf seinem Weg zu einer Karriere als weltberühmter Drum-and-Bass-DJ. Für ihn ist dieser Job eine Warteschleife, ein Warteraum für größere und bessere Dinge. Für mich ist er die Endstation. Ich hatte meine Chance auf Größeres und Besseres, und ich habe sie gewaltig vermasselt.
Der Job ist eigentlich gar nicht so schlimm. Aber nachdem die andere Sache in die Hose gegangen war, hatte ich keine andere Wahl. Ich habe keinerlei Qualifikation, denn die Uni habe ich ein paar Monate vor dem Abschluss abgebrochen, weil ich nie gedacht hätte, dass ich den je brauchen würde. Alle haben mich gewarnt, wie dumm es wäre, die Abschlussprüfung nicht zu machen – Mum, Dad, Joe –, aber ich habe nicht auf sie gehört.
Die Gedanken schlagen mir auf den Magen. Ich darf nicht zulassen, dass sie in diese Richtung abschweifen. Ich muss mich beschäftigen.
»Tee?«, frage ich und gehe in die Küche, während Dev die Kasse öffnet.
»O ja, bitte. Und William, ich glaube, ich brauche vier Stück Zucker. Heute lass ich es mal richtig krachen.« Er holt sein Telefon aus der Tasche und verbindet es mit dem Laptop hinter dem Tresen. »Ich habe überlegt, meinen Mix über die Stereoanlage des Ladens laufen zu lassen. Mal sehen, was die Kunden dazu sagen.«
»Mach das«, sage ich, obwohl ich ahne, dass die Kunden wahrscheinlich denken werden: Warum werde ich gezwungen, aggressiven, lauten Techno zu hören, wenn ich nur ein paar SCART-Kabel kaufen will?
Dev nickt. »In Ordnung. Es sei denn, du willst etwas auflegen? Wobei eigentlich ja immer ich die Musik aussuche, die hier läuft.« Er stupst mich mit einem Finger an. »Was würdest du denn gern hören?«
Ich zucke mit den Schultern. Früher habe ich nur für Musik gelebt und sie geatmet, aber nach allem, was passiert ist … Sagen wir einfach, sie ist in den Hintergrund getreten. Wie auch immer, soviel ich weiß, hat Dev keine Ahnung, dass ich jemals in einer Band war, und wenn es nach mir geht, wird er es auch nie erfahren.
»Wenn ich aussuchen darf«, sage ich, »würde ich gern mehr von deinem Mix hören.«
Er nickt nüchtern, als ob er wüsste, dass es immer darauf hinauslaufen würde. »Du hast einen tadellosen Geschmack, William, das muss ich dir lassen.«
Sein neuester Mix explodiert durch die teure Anlage, lässt die Schaufenster klirren und jagt eine Wolke Tauben in den Himmel.
»Ich mache jetzt den Tee!«, schreie ich gegen den Lärm an. Ich bin schon halb zur Tür raus, als Dev die Musik leiser stellt. »Ach ja, Will, ich wollte dich eigentlich fragen, ob du Lust auf einen schnellen Drink nach Feierabend hast. Ich treffe mich mit einem Kumpel im Rose & Crown um die Ecke.«
Ich drehe mich nicht um. Ich bleibe einfach in der Tür stehen. Dev versucht nun schon seit fast zwei Jahren, mich zu einem After-Work-Drink zu überreden. Ich weiß nicht, was mich davon abhält. Ich mag Dev. Sehr sogar. Aber ich finde mein Leben ohne andere Leute einfacher. Ein gemeinsamer Drink würde bedeuten, dass wir uns tatsächlich näher kennenlernen, und ich bin mir nicht sicher, ob Dev das, was er dabei entdecken würde, gefiele.
»Oh, heute Abend kann ich nicht, Mann. Tut mir leid. Vielleicht nächstes Mal.«
»Kein Problem, Will«, sagt er. »Nächstes Mal.«
KAPITELVIER
Annie
3. März
Ladbroke Grove, London
Als ich die Wohnungstür öffne, nehme ich sofort zwei Dinge wahr: einen köstlichen Essensduft, gefolgt von einem Anflug intensiver Zuneigung zu Dom.
Da er normalerweise länger arbeitet als ich, mache fast immer ich das Abendessen. Heute jedoch scheint Dom diesen Trend zu durchbrechen, und nach dem Tag, den ich hinter mir habe, liebe ich ihn dafür umso mehr.
Es war wirklich merkwürdig – nachdem ich den Buchladen gesehen hatte, musste ich den ganzen Nachmittag an Dad denken, ich bekam ihn einfach nicht mehr aus dem Kopf. Ich saß da, tippte ein paar Artikel und schickte ab und zu ein GIF als Antwort auf eine von Lexis E-Mails, aber die ganze Zeit hindurch fühlte es sich an, als würde eine Art Flut in mir aufsteigen. Irgendwann beschloss mein fieses Gehirn, Erinnerungen an Dad in seinen letzten Wochen hervorzukramen – dünn, gespenstisch blass, aber immer noch lächelnd –, und ich musste schnell auf die Toilette, weil ich Angst hatte, mitten im Büro in Tränen auszubrechen. Und während ich mir kaltes Wasser in mein heißes Gesicht spritzte, dachte ich nur: Wann wird das endlich leichter? Es muss doch irgendwann leichter werden, oder?
Irgendwo habe ich mal gelesen, dass Trauer ist wie Wetter: ständig wechselnd und unmöglich vorherzusagen. Zum Beispiel erwartet man einen blauen Himmel, aber stattdessen hängen über einem dann Gewitterwolken. Der Vergleich kommt in etwa hin. Aber ich weiß nicht, wie lange ich es noch aushalte, nie genau zu wissen, wann mich strömender Regen überrascht.
Jetzt, als ich meinen Mantel aufhänge, tritt ein warmes, kribbelndes Gefühl an die Stelle des hohlen Schmerzes in meinem Innern. Nach einem derart beschissenen Tag ist es genau das, was ich gebraucht habe: ein leckeres, selbst gekochtes Essen, literweise Wein, Kuscheln mit Dom und dabei irgendwelchen Mist im Fernsehen anschauen. In solchen Momenten bin ich wirklich froh, dass ich ihn habe.
Was er wohl kocht?, überlege ich, während ich dem Duft durch den Flur folge. Grünes Thai-Curry? Irgendwas mit Kokosnuss …
»Hier riecht es unglaublich lecker …«
Als ich die Küche betrete, bleibt mir der Satz im Hals stecken. Denn ich sehe keine Pfannen auf den Herdplatten, in denen es vor sich hin blubbert, keine Zwiebelstückchen auf dem Schneidebrett, keine auf dem Tisch ausgebreiteten Kochbücher. Da ist nur Dom, der sich direkt aus einer Plastikschale ein Curry in den Mund schaufelt und dabei sein Telefon anstarrt.
»Von Waitrose«, sagt er, ohne aufzublicken. »Ich habe dir auch eins mitgebracht. Fertiggericht, zwei zum Preis von einem. Entschuldige, aber ich muss mich mit dem Essen beeilen.«
»Oh.« Mein in Plastik verpacktes Abendessen versetzt mir einen Stich der Enttäuschung. »Gehst du weg?«
»Mhm. Quizabend.«
Der nächste Stich. Mein perfekter Abend ist endgültig dahin. »Aber Quizabend ist doch donnerstags, oder?«
Er wischt mit einer Scheibe Weißbrot die Soße auf. »Clare hat rausgefunden, dass eine Kneipe um die Ecke auch einen veranstaltet. Wir dachten, wir gehen mal hin, um ein bisschen zu üben. Es macht dir doch nichts aus, oder?«
»Nein, natürlich nicht.« Doms wöchentlicher Quizabend mit Kollegen von seinem alten Job war schon Tradition, ehe wir zusammenkamen. Die fünf waren jahrelang in derselben PR-Firma, arbeiten jetzt aber alle in verschiedenen Agenturen und genießen die regelmäßige Gelegenheit, zu tratschen und zu fachsimpeln. Früher hätte ich mich vielleicht darüber geärgert, dass er mich nicht gefragt hat, ob ich mitkommen möchte. Aber nachdem ich ein paar frühere Quizabende miterlebt habe, weiß ich, dass ich ihnen die ganze Zeit nur zuhören müsste, wie sie über Leute lästern, die ich nicht kenne. Außerdem müsste ich meine heimliche Abneigung gegen die schrille Posh-Clare verbergen, deren Schrill- und Poshheit mit jedem Glas Rosé zunimmt.
Dom steht auf, um seinen leeren Behälter in den Mülleimer zu werfen, und bemerkt meinen Gesichtsausdruck. »Du willst nicht, dass ich gehe, oder?«, sagt er und runzelt die Stirn.
»Nein, nein, geh nur«, sage ich zögernd. Ich bin mir sehr bewusst, dass ich nicht so eine Freundin bin. Seit wir zusammen sind, hat Dom immer wieder betont, wie wichtig es ist, eigene Freunde und Interessen zu haben und nicht alles zusammen zu machen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das an seinen Eltern liegt, die offenbar jede wache Minute miteinander verbracht hatten, ehe sie sich kurz vor unserem Kennenlernen völlig überraschend und verbittert scheiden ließen. »Ich hatte mich nur auf einen Abend mit dir gefreut, das ist alles«, füge ich hinzu.
Sein Stirnrunzeln vertieft sich. »Ich kann hierbleiben, wenn du willst. Allerdings fehlt dann einer im Team …« Er holt sein Telefon heraus und beginnt zu tippen. »Ich sage nur kurz Bescheid, dass ich nicht kann.«
»Dom! Hör auf! Natürlich musst du hingehen. Ich bin okay!« Naiv hoffe ich insgeheim, dass er trotzdem absagt, durch die Küche stürmt, mich küsst und mir sagt, dass er sowieso viel lieber den Abend mit mir verbringen möchte.
Aber er zuckt nur mit den Schultern und sagt: »Wie du meinst. Ich habe übrigens den Ofen angelassen, falls du dein Essen reinstellen willst.«
»Und da wird behauptet, es gäbe keine Ritterlichkeit mehr.«
Er lacht. Sein dunkles Haar wippt. Er trägt ein rotes Flanellhemd von Muji – seine Garderobe besteht fast ausschließlich aus Flanellhemden von Muji –, und seine Bartstoppeln sind gerade von »kratzig« ins Stadium »angenehm und kuschelig« übergegangen. Ich möchte zu ihm gehen und ihn umarmen – ich möchte mich getröstet fühlen, geliebt, weniger allein. Aber die Idee kommt mir plötzlich irgendwie erbärmlich vor. Zu anhänglich.
»Wie war dein Tag?«, fragt er und lässt sein Besteck klirrend in die Spüle fallen.
»Ganz okay«, sage ich. »Allerdings ist etwas Seltsames passiert …«
Ich breche ab. Ganz ehrlich, was gibt es da schon groß zu erzählen? Dass ich einen Laden entdeckt habe und meinen toten Vater vermisse? Na toll. In den letzten fünfzehn Monaten habe ich Dom ständig damit in den Ohren gelegen, dass ich Dad vermisse. Aber dadurch fühle ich mich keinen Deut besser, und ich bin mir sicher, dass das für ihn nicht besonders aufregend ist. Wozu also die Mühe?
Er hört ohnehin nicht mehr zu. Er schaut auf sein Telefon und kichert über eine Textnachricht, die er gerade erhalten hat. »Gut, ich bin dann mal weg«, sagt er und lässt sein Smartphone in die Tasche gleiten. »Das Quiz fängt um halb acht an.«
»Okay. Viel Glück.«
Er drückt mir einen nach grünem Curry schmeckenden Kuss auf die Lippen. »Bis später.«
Ich schiebe mein Fertiggericht in den Ofen und frage mich, welche Netflix-Serie mich am besten von Dad ablenken könnte. Als ich den Kühlschrank öffne, um eine Tüte Salat herauszunehmen, sehe ich zwei unangebrochene Flaschen Chardonnay.
Kein leckeres selbst gekochtes Essen und keinen Freund zum Kuscheln. Aber wenigstens habe ich eineinhalb Liter Wein.
KAPITELFÜNF
Will
4. März
Harrow, Middlesex
In einer Sonntagszeitung habe ich einmal einen Artikel gelesen, in dem ein Hollywood-Schauspieler seine Morgenroutine beschrieb. Natürlich war es zum Totlachen. 2:30 Uhr: Aufstehen, 15-Kilometer-Lauf, 4:30 Uhr: Grünkohl-Smoothie in der Kältekammer, so etwas in der Art. Trotzdem hat es mich dazu gebracht, mein eigenes Aufwachritual zu überdenken. Es ist zwar ebenso peinlich genau geplant, aber meiner Gesundheit definitiv weniger förderlich.
Nachdem ich den Snooze-Knopf meines Weckers gedrückt habe, scrolle ich normalerweise fünf Minuten lang lustlos durch die Guardian-App, bevor mich mein benebeltes Gehirn jedes Mal dorthin führt: zu meinen Kontakten.
Sie bestehen aus 742 Nummern, und heute Morgen – mit müden Augen und halb im Kissen vergrabenem Gesicht – durchstöbere ich die Namen mit dem Buchstaben L:
Len the Legend
Levi Sony
Linden Flat Cap
Liv Fit
Liz Irish
Liz Not Irish
Lolly B
Lonnie New Number
Lorna
LOUDKATE
Die Liste geht weiter und weiter und weiter. Vielleicht reicht es, zu sagen, dass ich mich an keinen dieser Menschen erinnern kann. Vermutlich sind die meisten von ihnen Chefs von Plattenfirmen, Presseagenten, Musiker, Models, Groupies, One-Night-Stands und Leute, die um zwei Uhr nachts in irgendeinem Club für kurze Zeit meine allerbesten Freunde auf der ganzen Welt waren, bis ich sie am nächsten Tag prompt wieder vergessen habe. Tatsächlich stehen von den 742 Kontakten in diesem Telefon nur zwei auf meiner aktuellen Liste von eingehenden Anrufen: meine Eltern und mein nerviger Vermieter Gareth.
Ich wische weiter und sehe dabei zu, wie die gesichtslosen Namen vorbeiziehen. Ich kann mir kaum vorstellen, dass ich einmal mit 742 Menschen zu tun hatte – wenn auch nur kurzzeitig. Es ist, als würde ich durch eine Vergangenheit wandern, von der ich nicht recht glauben kann, dass sie zu mir gehört. Gelegentlich fahre ich mit dem Finger über einen zufälligen Namen und stelle mir vor, wie es wohl wäre, diese Person anzurufen. Ob sie gehört hätte, was passiert ist? Oder hätte sie mich ebenso vergessen wie ich sie?
Gerade stelle ich mir ein hypothetisches Gespräch mit LOUDKATE vor (bei dem sie mich hauptsächlich anschreit), als mein Wecker zum fünften Mal piept und mich daran erinnert, dass es allerhöchste Zeit ist, aufzustehen und zur Arbeit zu gehen.
Als ich von meinem winzigen Schlafzimmer in die noch winzigere Wohnküche stolpere, fällt mir auf, wie seltsam es ist, dass eine so kleine Fläche so vollgestopft sein kann. Meine Wohnung liegt in Harrow, ganz außen auf dem U-Bahn-Plan. Fünfundzwanzig Quadratmeter Gipskartonwände und sich ablösendes Linoleum, deren Miete ich mir nur leisten kann, weil ich absolut kein nennenswertes Sozialleben habe.
Ich mache einen halbherzigen Versuch, aufzuräumen, ehe ich mir eine Schüssel Porridge genehmige und meinen schlecht erzogenen Kater Milligan füttere. Ich kippe eine halbe Dose Whiskas in seinen Napf und häufe drum herum einen Ring aus Dreamies-Leckerlis an. Er bedankt sich mit ein paar sanften, schnurrenden Kopfstößen gegen meine Schienbeine.
Milligan war ein Geschenk von Mum und Dad zu meinem Einzug. Nachdem alles den Bach runtergegangen war, zog ich für sechs Monate wieder zu ihnen – sechs Monate Therapeuten, Pillen und Dunkelheit –, und als ich mich endlich stark genug für eine eigene Wohnung fühlte, waren sie verständlicherweise besorgt, ich könnte vereinsamen. Sie drängten mich, in eine WG zu ziehen, aber ich bestand darauf, allein zu leben. Mit Milligan haben wir uns in der Mitte getroffen. Ehrlich gesagt bin ich froh darüber. An manchen Tagen ist er das Einzige, was mich durchhalten lässt.
Mein Telefon auf dem Tisch summt und verkündet den Eingang einer neuen E-Mail. Sie kommt von Green Shoots. Linda, eine andere Ehrenamtlerin, kann heute ihre Spätschicht nicht machen und fragt, ob jemand einspringen könnte.
Ich schreibe sofort zurück, dass ich übernehme. Es wird meine dritte Spätschicht in fünf Tagen. Ich bin sicher, dass die anderen Freiwilligen mich für etwas seltsam halten – wir sind nur zu einer Schicht pro Woche verpflichtet. Die Vorstellung, mich nach einem ganzen Tag bei MicroShop noch einmal quer durch ganz London schleppen zu müssen, lässt mich kurz überlegen, ob meine Zusage vielleicht doch zu voreilig war. Aber ich weiß ganz genau, dass ich mich um achtzehn Uhr darüber freuen werde. Und darauf, Erics Stimme und die der anderen Stammanrufer zu hören; auf die Vertrautheit und die Routine. Ich werde mich freuen, irgendwo anders hingehen zu können als in diese leere Wohnung, wo nur eine weitere einsame Nacht auf mich wartet, in der die Stille mein Gehirn an Orte lockt, von denen ich weiß, dass es sich besser nicht dorthin verirren sollte.
Die Wahrheit ist: Green Shoots ist nicht nur Erics Rettungsleine und seine einzige Verbindung zur Außenwelt. Es ist auch meine.
KAPITELSECHS
Annie
4. März
Shoreditch, London
Ich habe den Mantel schon fast an, als Matt den Kopf aus seinem Büro streckt und mich anschaut.
»Annie? Ich weiß, es ist fast sechs, aber hättest du noch Zeit für das Gespräch, um das ich dich gestern gebeten habe? Es geht ganz schnell, versprochen.«
Ich ziehe meinen Mantel wieder aus. »Ja, natürlich. Tut mir leid, hab nicht mehr dran gedacht.«
Ich habe schon den ganzen Tag einen heftigen Kater, nachdem ich gestern Abend allein fast eine komplette Flasche Chardonnay geleert habe. Als Dom zurückkam, lag ich längst im Bett, und heute Morgen war er so früh joggen, dass ich ihn nicht einmal gesehen habe. Die Kuhle in der Matratze und der anhaltende Geruch von Bier – India Pale Ale – waren die einzigen Anzeichen dafür, dass er tatsächlich neben mir geschlafen hatte.
Ich habe den größten Teil des heutigen Tages damit verbracht, Kaffee zu trinken und an einem Quiz rumzutüfteln, das morgen Mittag online gehen soll. Es heißt »Wie sehr entsprichst du dem Mittelschichtklischee?« – ein »Geistesblitz«, den ich nur aus Verzweiflung beim letzten Ideen-Brainstorming vorgeschlagen hatte. Von den vierundzwanzig Fragen drehen sich derzeit neun um Avocados. Das sind mit Sicherheit zu viele. Ich muss versuchen, sie auf höchstens sechs zu reduzieren.
Ich betrete Matts verglastes Büro, das mit ironischen Plakaten von Super Mario im Andy-Warhol-Pop-Art-Stil dekoriert ist. Neben dem Flipchart steht ein Tischkicker, und in der Ecke gibt es sogar einen Sitzsack, auf den sich Matt während besonders langer Besprechungen gerne mal fallen lässt.
»Setz dich«, sagt er und zeigt dankenswerterweise auf einen Stuhl und nicht auf den Sack. »Also, pass auf, Annie. Ich wollte dich nur ganz kurz über etwas informieren. Wir wollen mehr Markeninhalte bringen – also, Werbung.«
Ich runzele die Stirn. »Aha …«
»Ich weiß, ich weiß«, sagt Matt und bildet mit seinen Händen ein Dreieck, auf dessen Spitze er sein Kinn stützt. »Aber es soll nicht der übliche Werbeschwachsinn werden – ›Zehn Gründe, warum Rice Krispies dein Liebesleben anheizen‹ oder so was in der Art. Für uns ist das die Chance, etwas wirklich Interessantes, etwas richtig Journalistisches zu machen – und dafür ein nettes Sümmchen zu kassieren.«
Das klingt ein bisschen zu schön, um wahr zu sein, aber ich nicke trotzdem.
»Es ist nämlich so«, sagt Matt, »dass unsere Werbefachleute diese neue Jeansmarke namens Shuvvit an Land gezogen haben. Die Typen sind supercool, haben jede Menge Geld und wollen eine neue Serie auf unserer Website sponsern. Aber nicht nur ein Quiz oder eine Liste, sondern etwas, mit dem die Leser wirklich etwas anfangen können. Wir haben uns also zusammengesetzt und festgestellt, dass das, was Marker die meisten Klicks bringt, Nostalgie ist. Leute mit Sackgassenjobs sitzen in ihrer Mittagspause am Schreibtisch und wollen an die Zeit erinnert werden, als sie noch jung, frei, ledig und glücklich waren. Und Marker kann das für sie erledigen.«
»Ein bisschen deprimierend als Alleinstellungsmerkmal unseres Unternehmens, aber gut.«
Er kichert. »Also, pass auf. Die Jungs von Shuvvit haben sich schon eine Serie ausgedacht, die sie sponsern wollen. Sie soll heißen: ›Was wurde aus …?‹ Es soll um Gruppen und Solokünstler aus dem letzten Jahrzehnt gehen, die eine Zeit lang sehr erfolgreich waren und dann in der Versenkung verschwunden sind. Wir werden richtig investigativ arbeiten und längere Artikel produzieren: die ehemaligen Sänger und Bandmitglieder aufspüren, einige verrückte Geschichten aus ihrer Glanzzeit ausgraben und herausfinden, warum die Sache schiefgelaufen ist und was sie heute machen. Perfekt für unsere Leser.« Er lehnt sich in seinem Stuhl zurück und schenkt mir ein breites Grinsen. »Spotify hat mir am Wochenende eine Band ausgespuckt, von der ich denke, dass sie sich gut für die erste Folge der Serie eignen würde.« Er zupft süffisant an seinem Ziegenbärtchen und macht eine Pause wie Gregg Wallace, wenn er jemanden bei MasterChef rauswerfen will. Schließlich sagt er: »Erinnerst du dich an die Defectors?«
Ich blinzele, und es dauert eine Sekunde, bis es bei mir klick macht. Aber als es passiert, ist es, als hätte sich in mir ein Schalter umgelegt.
»Sie waren eine Art mieser Abklatsch der Arctic Monkeys«, fährt Matt fort. »Ziemlich gefragt vor etwa fünf oder sechs Jahren und kurz davor, in die erste Liga aufzusteigen. Doch dann sind sie plötzlich komplett von der Bildfläche verschwunden. Keine Ahnung, warum – oder was mit ihnen passiert ist.«
Er bemerkt meinen Gesichtsausdruck und reißt lachend die Hände hoch. »Okay – du hast mich durchschaut! Du weißt ganz genau, warum ich dir das erzähle. Du hast sie damals interviewt, richtig? In Paris?«
Ich spüre, wie Hitze meinen Nacken hochsteigt und sich auf meinem Gesicht ausbreitet. »Ähm … ich glaube schon. Kann gut sein.«
Matt nickt wie einer dieser Wackeldackel. »He, komm schon, Annie! Nicht so bescheiden. Ich habe mir gestern Abend deinen Artikel auf der Website durchgelesen, für die du früher gearbeitet hast. Er ist brillant. Aber ziemlich brutal. Du hast dem Leadsänger ganz schön den Arsch aufgerissen!«
Ich lache gezwungen. Seit Jahren habe ich nicht mehr an diesen Artikel gedacht. Ehrlich gesagt schäme ich mich immer noch dafür. An die Person allerdings, um die es in diesem Artikel geht, muss ich immer noch regelmäßig denken, ob ich will oder nicht.
»Also, was hältst du davon?«, fragt Matt. »Nachdem du dich schon mal mit den Typen getroffen hast, dachte ich, du wärst die perfekte Autorin dafür. Du könntest ein bisschen recherchieren, ein paar neue Interviews mit ihnen machen, und schon haben wir die erste Folge unserer brandneuen, viralen Hitserie!«
Ich schlucke schwer. »Weißt du, es ist echt nett von dir, dass du an mich gedacht hast, Matt. Aber ich habe schon mit meiner normalen Arbeit ziemlich viel zu tun. Ich wüsste gar nicht, wo ich die Zeit dafür hernehmen sollte.«
Er nickt ernst und stützt sein Kinn wieder auf das Fingerdreieck. »Okay, das verstehe ich. Aber unter uns, Annie, wir haben momentan ein paar Probleme mit den Werbeeinnahmen. Wenn es hart auf hart kommt, ist diese Art von gesponserten Inhalten wahrscheinlich die einzige Möglichkeit, Marker langfristig das Überleben zu sichern.«
»Tja …«
»Deine Texte gefallen mir«, sagt er. »Schon immer. Ich glaube, du wärst genau die Richtige dafür – und wenn der erste Teil mit den Defectors gut ankommt, könntest du am Ende die ganze Serie schreiben. Dann wärst du für einen der wenigen Bereiche der Website verantwortlich, der tatsächlich Geld einbringt!« Er lacht, ohne dass man es in seinen Augen sieht. »Wir reden hier nicht über Entlassungen oder so etwas – noch nicht«, fügt er dann noch hinzu. »Aber einen solchen Auftrag zu übernehmen, würde beweisen, wie wertvoll du für das Redaktionsteam bist. Außerdem ist es eine Chance für dich, richtig journalistisch zu arbeiten. In unseren Brainstormings liegst du mir damit doch ständig in den Ohren. Also: Hier ist deine Gelegenheit.«
Zu meinem Missfallen hat er recht, ich hacke immer darauf herum. Viel wichtiger ist jedoch, dass mich die Erwähnung von »Entlassungen« mit einer so plötzlichen und intensiven Leidenschaft für meinen Job erfüllt, wie ich sie schon lange nicht mehr verspürt habe. Die Vorstellung, mit einunddreißig Jahren wieder arbeitslos zu werden und den ganzen Tag damit zu verbringen, die Jobseite vom Guardian zu durchforsten …
Matt holt sein Telefon aus der Tasche und wirft einen schnellen Blick darauf, ein sicheres Zeichen dafür, dass dieses Gespräch nicht mehr lange dauert. »Aber weißt du, wenn du nicht willst, kann ich auch gerne Zara oder Nick fragen …«
Es ist ziemlich deutlich, was mein Chef mir zwischen den Zeilen sagen will: Nimm mein Angebot an, oder du riskierst, der erste Kollateralschaden zu werden, wenn die Werbeeinnahmen weiter zurückgehen.
Ich kann einfach nicht ablehnen. Ich muss diesen Auftrag annehmen. Aber schon jetzt spüre ich, wie sich in meiner Magengrube ein dicker Knoten aus Angst bildet. Denn ich will nicht in der Vergangenheit der Defectors herumschnüffeln. Ich will nicht wissen, was sie jetzt tun und warum alles schiefgelaufen ist.
Und ich will definitiv nicht mit Will Axford sprechen.
KAPITELSIEBEN
Will
4. März
Büro von Green Shoots, Limehouse
Es gibt nicht viele Dinge, die ich richtig gut beherrsche, aber Lauern ist eines davon.
Im Lauern kann ich es mit den absolut Besten aufnehmen. Wäre Lauern eine olympische Sportart, käme ich problemlos aufs Treppchen.
Es ist vier Minuten vor sechs, und ich stehe am Rande eines schmutzigen Industriegebiets im Londoner Osten, nur wenige Meter von der Tür des Green-Shoots-Büros entfernt, und lauere. Der Regen hat sich gerade von einem leichten Nieselregen zu einem Wolkenbruch entwickelt, und natürlich würde jeder normale Mensch seinen Schlüssel benutzen und ins warme, trockene Büro gehen. Aber wenn ich jetzt – vier Minuten zu früh – reingehe, bedeutet das Small Talk. Sozialen Kontakt. Und ich werde lieber bis auf die Haut nass, als das zu ertragen.
Aus diesem Grund lauere ich.
Ich ziehe mein Handy aus der Tasche und schaue darauf. Drei Minuten vor sechs. Ich würde gerne behaupten, das hier wäre eine einmalige Sache. Dass ich mich einfach heute Abend nicht in der Lage fühle, gesprächig und fröhlich zu sein. Aber ganz ehrlich: Das hier mache ich seit mittlerweile fünf Jahren.
Bevor ich mit dem Ehrenamt bei Green Shoots anfing, ging ich davon aus, dass ein normales Hilfetelefon mit mehr als einer Person gleichzeitig besetzt ist. Ich hatte Fernsehwerbung für die Samariter gesehen, wo ganze Reihen von Freiwilligen mit Kopfhörern nebeneinander in einem Großraumbüro saßen und gleichzeitig Anrufe entgegennahmen. Aber ich begriff schnell, dass Green Shoots kein gewöhnlicher Notrufdienst ist.
Wir sind ein winziges Unternehmen, das sich durch den gelegentlichen Verkauf von gebrauchten Büchern finanziert und dessen Einnahmen kaum für die Gratisteebeutel reichen. Ein Großraumbüro würde das Budget der Charity-Organisation sprengen, sodass wir uns mit einem einzigen schäbigen Raum begnügen müssen, in dem gerade mal ein Schreibtisch und ein Stuhl Platz haben.
Der Tag bei Green Shoots ist in zwei Schichten aufgeteilt – dreizehn bis achtzehn Uhr und achtzehn bis dreiundzwanzig Uhr. Aus den Gruppen-Mails weiß ich, dass eine Tasse Tee und ein Schwätzchen zwischen den Schichten von den anderen Ehrenamtlern sehr genossen werden. Ich hingegen empfinde beides eher als Berufsrisiko. Deshalb lasse ich mich hier draußen lieber bis auf die Knochen durchnässen.
Erneut schaue ich auf mein Telefon. Eine Minute nach sechs. Wie aufs Stichwort öffnet sich die Bürotür, und ich laufe zielstrebig darauf zu, als wäre ich gerade erst angekommen und würde nicht schon seit einer Viertelstunde draußen warten.
»Hey, Will!«
Dem Online-Dienstplan hatte ich entnommen, dass Tanvi heute die erste Schicht hatte. Als sie mich sieht, winkt sie mir fröhlich zu und fummelt an der Kapuze ihres Regenmantels herum, der an den von Paddington Bär erinnert. Sie ist höchstens ein paar Jahre älter als ich, aber den Gruppen-Mails nach ist sie verheiratet und hat drei kleine Kinder.
Sie wirkt immer freundlich und gut gelaunt und scheint sich zu freuen, mich zu sehen. Aber in all den Jahren, in denen wir einander regelmäßig bei unseren Schichten ablösen, habe ich vermutlich höchstens vierzig Worte mit ihr gewechselt.
»Hi, Tanvi. Alles klar?«, sage ich und erhöhe die Zahl auf vierundvierzig.
»Ich ärgere mich, dass ich zu blöd war, einen Regenschirm mitzunehmen.« Kichernd blickt sie in den strömenden Regen. »Und bei dir so?«
»Mir geht’s gut, danke«, sage ich. »Aber ich bin spät dran. Also …«
Ich nicke in Richtung Bürotür, und Tanvi strahlt mich an. »Logo. Nur zu! Ich wünsche dir eine angenehme Schicht, Will.«
Drinnen angekommen, lege ich meine feuchte Jacke auf den rostigen Heizkörper, logge mich in den Computer ein und mache mir eine starke Tasse Tee.
Als ich schließlich auf dem klapprigen Bürostuhl sitze, in eine angeschlagene Bart-Simpson-Tasse puste und darauf warte, dass das Telefon klingelt, atme ich endlich frei durch. Ich habe alles unter Kontrolle. Ich tue etwas Gutes.
So übertrieben es auch klingen mag, das hier – genau das – macht wirklich Sinn.
KAPITELACHT
Annie
4. März
Ladbroke Grove, London
Schon den zweiten Abend in Folge sitze ich allein auf meinem Sofa und bin betrunken. Als ich als Kind davon träumte, wie mein Leben als mondäne Berufsschriftstellerin in London aussehen würde, hatte ich mir das so sicher nicht vorgestellt.
Dom ist wieder unterwegs – Feierabenddrinks mit Kunden –, und ich sehe rumlümmelnd eine Friends-Folge, die ich schon tausendmal gesehen habe, wobei ich mich tapfer durch die zweite Flasche Chardonnay kämpfe.
Ich möchte unbedingt mit jemandem über diese Defectors-Sache reden, aber Lexi geht heute Abend mit ihren Schwiegereltern essen, und meine andere beste Freundin, Maya, ist wieder einmal auf einem Bumble-Date. Einen Moment lang überlege ich sogar, meine Mutter oder meine ältere Schwester Josie anzurufen, bis mir einfällt, dass ich mit beiden seit Wochen nicht mehr gesprochen habe. Ich beschließe, mir stattdessen ein weiteres Glas Wein einzuschenken. Ich fühle mich ruhelos. Aufgewühlt.
Mit Dom kann ich auf gar keinen Fall darüber reden. Ich habe ihm noch nicht einmal von diesem Tag damals in Paris erzählt. Nicht dass es da überhaupt etwas zu erzählen gäbe. Aber Dom wird bei den unbedeutendsten Dingen merkwürdig eifersüchtig. Einmal hat er ein ganzes Wochenende lang geschmollt, weil ich erwähnt hatte, dass ich Keanu Reeves’ Arme schön finde.
Ich hole mein Abendessen aus dem Ofen – Pilzrisotto von vorgestern –, lasse mich wieder aufs Sofa fallen und scrolle halb benebelt durch Instagram. Dom hat bereits ein Foto von seinem Abend gepostet – er und ein Haufen Leute, die ich nicht kenne, grinsen vergnügt am Gartentisch eines Pubs in die Kamera. Unwillkürlich werde ich ein wenig neidisch, dass er sich so gut mit seinen Kollegen versteht. Abgesehen von Lexi kann ich mir nicht vorstellen, mit irgendwem von Marker etwas trinken zu gehen. Und Lex wird sich in ungefähr einem Monat in den Mutterschaftsurlaub verabschieden. Wer weiß, ob sie danach überhaupt zurückkommt? Der Gedanke an acht Stunden täglich ohne sie im Büro lässt mich sofort wieder zur Weinflasche greifen.
Ich schreibe Dom eine WhatsApp, um ihn zu fragen, wann er nach Hause kommt, schicke sie aber dann doch nicht ab. Stattdessen fange ich geistesabwesend an, in meinen anderen Chats herumzustöbern, um vielleicht doch noch jemanden zu finden, mit dem ich jetzt gern sprechen würde.