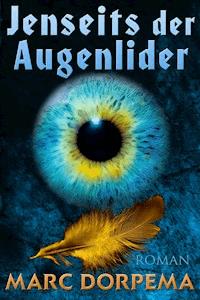
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Als Torabur, der Herrscher der Zwerge, von der einzigen Möglichkeit erfährt, die Heimat der Elfen, Menschen und Zwerge vor einem Verräter zu bewahren, entsendet er drei Auserwählte - Garandor, den ängstlichen, zwergischen Steinmetz; Waldoran, den jahrtausende alten, elfischen Fürst und Dante, den jungen, mutigen Menschenkrieger - auf eine furchteinflößende Mission. Diese drei ungleichen Gefährten sollen den letzten Auserwählten finden, doch wissen nicht wo, um später, geführt von Waldorans äußerst zweifelhaften Instinkten, in die Berge - und das Land der Feinde unter der Kontrolle eines verräterischen Elfen - zu reisen. Doch die Hindernisse verändern die Gefährten für immer. Und nach und nach wird der Weg zum Ziel.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 362
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Marc Dorpema
Jenseits der Augenlider
Garandors Licht
Dieses ebook wurde erstellt bei
Inhaltsverzeichnis
Titel
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI
XVII
XVIII
XIX
XX
XXI
XXII
XXIII
XXIV
XXV
XXVI
XXVII
XXVIII
XXIX
XXX
XXXI
XXXII
XXXIII
XXXIV
XXXV
XXXVI
XXXVII
XXXVIII
XXXIX
XL
XLI
XLII
XLIII
XLIV
XLV
XLVI
XLVII
Impressum neobooks
I
Ein verlorener Sonnenstrahl fiel durch die knarrenden, hölzernen Fensterläden auf Garandors Gesicht. Mit der allmählich schwindenden Verwirrung des öligen Halbschlafes begannen seine Sinne sich zu ordnen. Er schlug zuerst das eine, dann, zögerlich, beide Augen zur selben Zeit auf. Plötzlich war der Zwerg hellwach – heute fand der Steinmetz-Wettbewerb in der Festung Eisenturm statt. Garandor durfte auf gar keinen Fall fehlen; dieser Wettkampf war von immenser Bedeutung für ihn, denn schließlich waren Zwerge zweifelsohne die stolzesten Geschöpfe der Insel und das Erschaffen von beeindruckenden Skulpturen und Gravuren ihre Kunst.
Rasch streifte er sich ein leichtes, braunes Hemd über, zog sich eine abgewetzte, lederne Hose an und griff im Laufen nach Hammer und Meißel. Seine Chancen standen gut, und das wusste er auch. Nur sein ärgster Konkurrent, der stämmige Baldon, war ihm gewachsen. Auf seinem Weg durch die enorme Festung traf er einige Freunde und Bekannte, von welchen ihm beinahe alle Glück wünschten.
Eisenturm war eines der imposantesten und mächtigsten Bollwerke im Osten Santúrs. Die Trollkriege waren seit dreißig Wintern vorbei und das Land und die Bevölkerung genasen allmählich von den Folgen. Glücklicherweise hatten die ärgsten Kämpfe seine Heimat verschont, da die Festung zu weit im Osten der Insel thronte.
Stolz füllte Garandor als er an seinen gemeißelten Verzierungen an den Toren vorbeischritt. Er war ein begnadeter Steinmetz, hatte sogar einige der Kunstwerke in der Festhalle des Königs geschaffen. Doch ihm missfiel das Kämpfen. Dies war zwar ein äußerst ungewöhnliches Attribut für einen Zwerg, doch er befand den ständigen Drang nach Blut und Krieg und toten Orks als abstoßend. Er würde niemals ein Leben nehmen, das schwor er sich. Am beeindruckenden Tor der Halle angekommen, wurde ihm ein wenig mulmig zumute. Er zögerte, bevor er die Pforte aufstieß.
Im enormen Festsaal, in welchem das Turnier ausgetragen werden sollte, herrschte eine lockere Stimmung. Garandor fühlte sich hier stets unheimlich wohl. Er suchte im riesigen Publikum nach einem Gesicht – er hoffte, dass sie heute erscheinen würde. Dort. Er erspähte ihre breiten Schultern in einer der hinteren Reihen, von welcher aus sie Garandor verstohlen anblickte. Er sollte die wilde Bestie seiner Gedanken von ihr fortzerren, um sich auf den bevorstehenden Wettkampf zu konzentrieren, schalt er sich.
Nach einigem Hin und Her und nachdem der dumpfe Donner hunderter gedämpfter Konversationen träge vorüberzog, wurden die zehn Teilnehmer in die Mitte der Halle gerufen. Jeder wurde auf einen der zentral positionierten Marmorblöcke verteilt, damit die zahlreichen Zuschauer das Spektakel von ihrer behelfsmäßigen, semilunaren Arena möglichst angenehm verfolgen konnten.
Auf ein lang gezogenes Hornsignal hin begannen die Steinmetze in der Halle damit, zu hämmern und zu meißeln. Bald übertönte der Lärm der entstehenden Statuen alle anderen Geräusche und die Wände warfen das Echo tausendfach zurück. Garandor wusste schon seit Langem, in was er den unförmigen, marmornen Klotz vor ihm verwandeln wollte. Er würde eine Statue von Balira anfertigen, würde die Tradition, den Kopf des Königs in möglichst feinem Detail zu erschaffen, dem verflogenen Stimmendonner hinterherschleudern. Er liebte sie, seit er sie das erste Mal vor vielen Monden erblickt hatte – obwohl er bisweilen zweifelte, ob das nicht zu romantisch war, um wirklich der Wahrheit entsprechen zu können – doch traute sich nicht, es ihr zu gestehen. Die Idee ihr seine Liebe auf diese Art zu offenbaren, gefiel ihm allerdings. Womöglich gerade weil er so ein hoffnungsloser Romantiker war.
Garandor wagte keinen Blick zu einem seiner Konkurrenten. Die Spannung nährte seine Kreativität, seine unbändige, zwergische Hingabe, redete er sich tapfer zu. Denn in Wirklichkeit warf die Angst handtellergroße Steine in seinen Magen.
Als er das Stadium der Augen erreichte, stahl er doch einen flüchtigen Blick zu Baldons Kreation. Lächelnd widmete Garandor sich erneut Balira. Baldon hatte einen Fehler begangen; hatte die Augen seiner Statue, welche, wie erwartet, König Torabur darstellen sollte, zu weit auseinander gesetzt und nicht mit ausreichend Weisheit versehen. Und solch einen Fehler konnte man sich in diesem Wettbewerb nicht erlauben. Nicht, wenn König Torabur den Gewinner küren würde, nachdem sie alle ihre Kunstwerke vollendet hatten. Garandor würde siegen – da war er sich nun beinahe sicher.
II
„Wir müssen handeln. Sonst gefährden wir unsere Freunde und Geschwister, nicht nur innerhalb der Festung.“ Toraburs warmer, forschender Blick traf jedes Augenpaar an der beeindruckenden Tafel, auf der sich die Ellbogen der unterschiedlichsten Geschöpfe stützten. Elfen, Menschen und Zwerge; sie alle hatten sich versammelt, um die bevorstehenden Zeiten mit Bedacht zu beraten. Torabur hatte gehofft, dass die Nachricht niemals den Eisenturm erreichen würde, hatte sich davor gefürchtet.
„Und was gedenkst du zu tun?“ Grimmdors durchdringende, befehlsgewohnte Stimme zerschnitt die Luft weniger, als dass sie sie niederwalzte, oder zerschmetterte. Der Zwerg war von einer ungeheuer kräftigen Gestalt; überragte den Großteil seines Volkes um beinahe einen Kopf und seine Muskeln pulsierten in massiven Armen. Seine beinahe schwarzen Augen strahlten Kälte aus. Einige mieden ihn aus Angst, fürchteten sich vor den Wutausbrüchen, die er kaum zu kontrollieren vermochte. Man sagte gar über ihn, er habe im Krieg gegen die Trolle zwei seiner eigenen Freunde erschlagen. Doch das hielt Torabur für Unsinn, für Lügen, die einer seiner Feinde innerhalb der Festung erfunden hatte. Er hatte Grimmdor jedoch in all den Zyklen nicht selber gefragt; womöglich weil er die Antwort nicht hören wollte.
Die prächtige Gesichtsbehaarung seines Generals erstaunte Torabur stets aufs Neue. Sein Bart war, wie für alle Zwerge, das Wichtigste im Leben – mit den möglichen Ausnahmen von Met und Krieg. Grimmdor hatte sich prunkvolle Eisen- und Silberringe in den Bart geflochten, welche ihn wie einen wahren Herrscher aussehen ließen. Die Zeiten von Toraburs Bart waren vor einigen Wintern verflogen, was ihn mit Bitternis erfüllte. Auch er hatte einmal einen solchen Bart besessen, doch dieser war den kurzen, ausgedünnten Fransen, die knapp über seiner Brust endeten, gewichen. In einem verzweifelten Versuch zumindest einen Hauch königlichen Prunks zu bewahren, hatte er sich schmale, goldene Ringe eingeflochten, welche aufgrund der Feinheit seiner spröden Gesichtsbehaarung hinunterrutschten. Es half alles nichts.Seine müden, braunen Augen musterten Grimmdor nachdenklich. Der Krieger sah wahrlich wie ein echter König aus.
Zeit sich auf das Dasein als König vorzubereiten, hatte Torabur keine gehabt. So plötzlich war sein älterer Bruder von ihm gegangen, im Trollkrieg. Ihr Vater, Hjálmuron, welcher eine lange und friedliche Zeit als König erlebt hatte, hatte Toraburs Bruder des Öfteren davor gewarnt, sich blind und übermütig in Gefechte zu stürzen. Schließlich musste für die Thronfolge gesorgt sein. Doch Taranúr bestand stets darauf, in der ersten Reihe zu kämpfen. Zuweilen plagte Torabur das Gefühl, sein Bruder wusste, was geschehen würde. Dass das Glück ihn eines Tages in roten Strömen verlassen würde.
In einem der letzten Gefechte der Trollkriege, als Hjálmuron bereits in See gestochen war und Taranúr entgegen aller Warnungen als junger König in der ersten Linie gekämpft hatte, war es schließlich geschehen. Um zwei seiner Untertanen – welche er nicht besser kannte, als den niedrigsten Pferdepfleger – zu retten, war er in eine Gruppe von dutzenden Telénastieren gestürmt. Furchteinflößende Kreaturen für die drei Zwerge ein gefundenes Fressen waren. Dennoch wirkte die Moral, die Stärke, die er ausstrahlte wahre Wunder in den zwergischen Reihen und nach seinem Fall fochten die verbleibenden Truppen umso erbitterter. Mehr als stolze Erinnerungen blieben Torabur allerdings nicht.
Der König musste trotz seiner nicht vollständig überwundenen Trauer schmunzeln. In einer der letzten Wochen vor dem Ausbruch der Trollkriege hatten sie in einer der unzähligen Tavernen der Festung darum gewettet, wer von ihnen innerhalb der kürzesten Zeit die meisten Krüge Met hatte leeren können. Eine törichte Wette, bei welcher der jüngere Bruder seinen damals noch stattlichen Bart eingebüßt hatte. Wie frei er früher doch gewesen war. Daran dachte er gerne zurück, in seinen schlimmsten Momenten. Es half ihm, alles zu vergessen, die Welt und ihre Probleme auszublenden.
„Wirst du mir heute noch antworten, mein König?“
Grimmdor achtete nicht auf Förmlichkeit. Lediglich wenn ihm etwas missfiel, oder wenn er äußerst gereizt war, nannte der General Torabur zynisch mein König.
„Ich weiß nicht, wie wir handeln sollen. Ich sehe keinen Ausweg.“ gestand Torabur ruhig.
Er hatte nicht bemerkt, dass er Grimmdor die ganze Zeit über angestarrt hatte, was ihm nun im Nachhinein ein wenig peinlich war.
„Das hatte ich befürchtet.“ murmelte die für einen Zwerg helle Stimme Paradurs kaum hörbar in den Saal hinein. Doch nicht leise genug. Das Echo verstärkte jedes noch so stille Geräusch.
Nun blickten alle Anwesenden ihn an und es war ihm sichtlich unangenehm, dass solch einschüchternde Augenpaare sich auf ihn richteten. Paradur war einer der Offiziere in Toraburs Heer. Allerdings nicht, weil Grimmdor seine Ratschläge respektierte, sondern weil Torabur darauf bestand.
Der König hielt Paradur für einen ausgezeichneten Taktiker. Allerdings besaß er bei weitem nicht die Kampferfahrung und Kaltherzigkeit Grimmdors. Er hatte trotz seiner Schlachten eine zwergische Wärme bewahrt, hatte die Seele nicht aus den Augen verloren und das war es, was Torabur an ihm schätzte. Paradur hatte nichts Kriegerisches an sich. Furchteinflößende Muskeln zierten seine Arme nicht, sein Körper besaß keine Unzahl an Narben, was daher rührte, dass der Taktiker, wenn er kämpfen musste, stets in einer der hintersten Schlachtreihen focht. Des Weiteren stellte er das Gegenteil Grimmdors dar, da er beinahe einen Kopf kürzer als die meisten Zwerge war. Wache, blaue Augen blickten schüchtern in die Runde aus den Höchsten und Besten der Elfen, Menschen und Zwerge.
„So, hast du das?“ fragte Torabur neugierig.
„Ja – allerdings bin auch ich zu keiner Lösung gekommen.“ Betrübt senkte er den Blick, während ihm die Schamesröte in die Wangen stieg. Grimmdor schnaubte verächtlich; was für eine Schande von einem Zwerg.
„Niemand im Saal weiß eine Lösung.“ setzte Torabur fort. Erneut blickte er jedes Mitglied der Tafel nacheinander an. Schließlich verweilte sein Blick kurz auf dem Elfenfürsten Waldoran.
Waldoran war ein typischer Elf. Seine milchig-weiße Haut wurde von wallenden, blonden Haaren umrahmt und die glasklaren, blauen Augen sogen jede Neuigkeit emotionslos auf. Elfen waren Meister darin, ihre Gefühle zu verheimlichen. Bisweilen frustrierte die Tatsache Torabur, doch er musste ebenfalls einsehen, dass diese Gabe dem Waldvolk einen erheblichen Vorteil in Gesprächen verschaffte. Die typischen, spitzen Ohren lugten zwischen den goldblonden Haaren hindurch. Eine für Elfen aus Antár übliche, leichte Lederrüstung, welche dank seiner elfischen Flinkheit und Wendigkeit selten in den Kontakt mit Waffen gelangte, schützte seinen hochgewachsenen, schlanken Körper vor leichten Schlägen. Ein speerdünnes Kurzschwert mit einem Griff aus Elfenbein, in das ein verschlungenes Muster eingraviert worden war, hatte er neben einem enormen Jagdbogen in eine auf seiner Schulter festgezerrten Scheide gesteckt. Die Klinge des Schwertes bestand aus dem edelsten und robustesten Stahl der Zwerge und türkise Diamanten waren in sie eingesetzt worden. Sie formten einen Namen, Saliana. Der Name seiner Fürstin.
„Von wie vielen dieser ranzigen Bestien ist die Rede?“ Leichtes Nicken und ängstliche Blicke begleiteten Grimmdors Frage. Dieses Heer, das wusste Torabur, war unmöglich zu schlagen. Er zögerte, lediglich für einen Herzschlag.
„Es sind insgesamt über Siebzigtausend. Fünfzigtausend Orks, beinahe fünftausend Telénastiere und – eine unbekannte Anzahl Schatten. Es sind jedoch mehr als fünfzig.“
Schweigen legte sich wie ein Leichentuch über die erblassende Gemeinde.
Die Lage war aussichtslos. Nichts, was sich dieser Armee in den Weg stellen würde, hätte Aussicht auf Erfolg. Orks gewannen Kriege nicht wegen ihrer besonderen Fähigkeiten, sondern wegen ihrer erdrückenden Übermacht. Seine sechstausend Zwerge hätten dreißigtausend Orks allerdings mit Leichtigkeit niedermachen können und gemeinsam mit den Elfen und den Menschen, sollten auch die Telénastiere keine Bedrohung darstellen. Doch die Schatten waren der Inbegriff all ihrer Probleme.
Elfen und Zwerge waren trotz unzähliger Fehden und offen-gezeigtem Hass untereinander ein schrecklicher Gegner, wenn sie Seite an Seite in die Schlacht zogen. Viertausend elfische Bogenschützen machten, bis die Orks und Telénastiere die erste Reihe der Zwerge erreichten, dreißig Schlachtreihen nieder. Wenn die Verbleibenden dann zu nahe kamen, zogen die Elfen binnen eines Augenblickes ihre schmalen, elegant geschwungenen Klingen und begannen ein furchteinflößendes Massaker. Unterdessen stürmten sechstausend wütende Zwerge vor und gruben sich mit ihren monströsen Äxten oder Hämmern durch die Anordnung der Angreifer. Die gegnerischen Flanken wurden von jeweils fünftausend Menschen auf jeder Seite niedergerannt.
Eine unfehlbare Taktik. Außer gegen die Schatten. Die Schatten bestanden lediglich aus dichten, zusammengenähten Rauchschwaden, welche einen Schweif aus grauem Nebel, oder Dunst, besaßen. Sobald sie einem Geschöpf des Ostens zu nahe kamen, war es zu spät. Qualvoll trat das Blut aus jeder einzelnen Pore des Körpers. Man starb einen entsetzlichen Tod. Lediglich die mächtigsten Zauberer vermochten es, Schatten zu vernichten. Von diesen Magiern gab es allerdings nicht mehr als eine Handvoll. Er seufzte innerlich; Verantwortung stemmte ihr lähmendes Gewicht auf Toraburs Schultern, zwang ihn mit aller Macht in die Knie.
Konzentration. Er durfte nicht zulassen, dass solche Gedanken ihm Kopfzerbrechen bereiteten.
Der König brach das Schweigen als Erster.
„Meine Freunde, ich erkläre die Besprechung hiermit für geschlossen. Ihr dürft euch nun zurückziehen. Es wird weitere Treffen geben.“
Torabur benötigte Bedenkzeit; die Weisen waren seine einzige Möglichkeit, befürchtete er. Sie würden gewiss eine Lösung haben. Sie mussten.
III
Waldoran verließ den Saal im höchsten Turm der Festung als Letzter. Ein durchaus gelungener Turm, fand er; wenn auch ein wenig zu schwerfällig und massiv. Kolossale, unfassbar detaillierte Verzierungen aus Marmor und Emaille schmückten die hohen Wände. Doch an die Pracht seiner Heimat reichte selbst die vortrefflichste, zwergische Steinmetzkunst nicht heran.
Der Fürst träumte häufig von den Wäldern Antárs. Dort, in der Geborgenheit der mächtigen Bäume, lebte er seit hunderten von Wintern in Einklang mit seiner Umgebung, in Diskurs mit ihr. Zierliche, geschwungene Linien aus diversen Holzsorten schmückten jeden Stamm und kreierten ein unvergleichliches Mosaik aus den exotischsten Brauntönen. Sie lebten in Baumhäusern aller Größenordnungen und während manche es simpel bevorzugten, verweilte Waldoran in palastähnlichen Residenzen. Die Einrichtung stimmte mit einer Vielzahl der Behausungen des Ostens überein – bis auf die fließende Eleganz, welche das Waldvolk perfektioniert hatte – doch existierten keine Möbel in Materialien, welche nicht dem verschlingenden Wald entstammten.
Ein Feuer zu entfachen, war trotzdem möglich. Jegliche Wände der Baumhäuser wurden mit einem speziellen Serum überzogen, welches feuerabweisend wirkte und aus eine der umliegenden Pflanzen gewonnen wurde. Die Mannigfaltigkeit der exotischen Holzsorten, von welcher alle einen eigenen, betörenden Duft verströmten, überwältigte nicht bloß die Elfen.
Nun zwangen ihn die Umständen des Krieges jedoch dazu, ein Quartier in der Festung Eisenturm zu beziehen und mit den zwergischen Bräuchen kam er nur äußerst mühevoll zurecht. Ozeane an Bier und Branntwein, wenig Schlaf und eine schreckliche Musik, dominiert von enormen, ohrenbetäubenden Trommeln, erklärten seiner noblen Grazilität den Krieg. Doch am stärksten vermisste er seine Fürstin. Saliana war ein sommerlicher Sonnenaufgang über den mysteriösen Küsten der Insel; die Edelsteine Santúrs stritten sich darum, welche ihre Augenhöhlen füllen durften. Kristallklar wie das Wasser selbst, kein Äderchen geplatzt. Wallende, weiß-blonde Locken umrahmten ihr blasses Antlitz. Sinnliche, elfenbeinerne Lippen rundeten ihre Vollkommenheit ab. Sie roch nach frischem Laub und Rosen.
Gemächlichen Schrittes spazierte Waldoran den endlosen Gang im Hauptgebäude entlang. In elfischen Augen amateurhaft gearbeitete Gemälde zwergischer Herrscher verzierten nun den kalten Stein. Mit Farbe und Pinsel waren die Elfen ihren halbwüchsigen Verbündeten immer noch hoffnungslos überlegen. Jedes sah gleich aus, befand der Fürst mit dem Blick eines Kenners und überlegte, ob nicht lediglich jeder Herrscher eine verblüffende Ähnlichkeit zum vorherigen aufwies.
Das hohle Klappern von Stiefeln erklang hinter ihm auf dem marmornen, Mosaik-bedeckten Boden. Bedächtig drehte der Elf sich um. Er erwartete, soweit er wusste, keine Nachrichten. Womöglich gab es Neuigkeiten bezüglich Saliana. Sie hatte in den letzten Monden furchtbar erschöpft gewirkt; ein sicherer Vorbote finsterer Zeiten.
„Waldoran. Wir wissen nun, wer der Heerführer der gegnerischen Truppen ist.“ keuchte ein unscheinbarer Zwerg. „Es ist Latenor.“
„Unmöglich.“ konstatierte Waldoran emotionslos.
Der Zwerg, der ihm die Botschaft überreichte, kam ihm nicht bekannt vor. Wahrscheinlich ein niederer Diener der Festung.
„Unsere Späher in Nahran Thur haben ihn bei seinem Heer gesehen. Er hat eine Rede gehalten. Vor allen Kriegern, siebzigtausend. Ich habe es zuerst Torabur berichtet. Er sagte mir, ich solle alle Mitglieder des Kriegsrates darüber in Kenntnis setzen. Wenn die Sonne am morgigen Tag am höchsten steht, werden alle im Königssaal erwartet.“
„Ich werde erscheinen.“
Die Fassade von kühler Intelligenz und Stärke aufrechterhaltend, nickte Waldoran dem Zwerg dankbar zu. Dieser verbeugte sich und verschwand.
Latenor. Das erklärte sein plötzliches Verschwinden. Allerdings konnte sich der Fürst keinen Reim aus dieser Botschaft machen. Dass Latenor sie verraten hatte, schien unmöglich. Der Elf war ein berühmter Fechter. Er war bekannt, ein Offizier, genoss Ansehen und Respekt.
Bedächtig strich Waldoran zu seinem Schlafgemach. Sie waren einmal Freunde gewesen. Gute Freunde. Doch auf einmal hatte er sich in Luft aufgelöst. Verschwand, von einem Tag auf den anderen. Waldoran und eine Vielzahl anderer Elfen hatten vergeblich nach ihm gesucht. Anfangs hatte Waldoran noch angenommen, dass sein Freund wiederkehren würde. Doch er hatte sein Antlitz nie wieder gezeigt. Auch Waldorans Hoffnungen waren nun erloschen, wie die Kerze an welcher er mit erhobenem Haupt vorbeischritt.
Der Fürst stieß die massive Holztür zu seiner Kammer auf und trat ein. Niedergeschlagen ließ er sich auf sein schmales aber gemütliches Bettchen im Stile Antárs nieder. Ein geschmackvoll verziertes Birkenholzkästchen stand auf dem sonst beinahe leeren Tisch. Lediglich eine Karaffe mit klarem Wasser, ein Glas und ein Stück Pergament mit Feder beschwerten ihn zusätzlich. Der Tisch stand vor dem einzigen Fenster des Raumes.
Waldoran hatte einen Brief an Saliana begonnen, doch sein Geist sträubte sich davor, ihn zu vollenden. Die erschütternde Nachricht über seinen einstigen Freund lenkte ihn zu stark ab.
Eigentlich hasste er die Zwerge nicht. Er verstand nicht, weshalb er in diesem Augenblick an seine Gastgeber dachte, doch irgendetwas lenkte seine Gedanken auf sie. Die Zwerge hatten ihm sogar eigens ein Waldbett aus Antár in seine Kammer transportiert. Ein gerissener Kniff Toraburs, welchen Waldoran zu schätzen wusste.
Er legte seinen herbstfarbenen Jagdbogen und seine sonstigen Waffen ab, entledigte sich seiner Kleidung und begab sich in sein komfortables Bett. Morgen würde er Saliana einen Brief schreiben, das schwor sich der Elf.
Er stellte sich vor, wie sie gemeinsam auf einer Baumkrone in ihrer Heimat saßen. Ihren Kopf an seine Schulter gelehnt, dem fernen Abendrot zusahen, wie es zögernd verschwand. Bis die etwa kirschkerngroße Scheibe pulsierender, rot-orangener Farbe hinter dem Rand Santúrs verrauchte. Mit einem Lächeln auf den Lippen und diesen Gedanken vor seinem inneren Auge, schlief er wenig später ein.
IV
Gellend sang der Stahl der Schwerter sein klagendes Lied, als Dante zu einem Hieb ansetzte, der mit Leichtigkeit pariert wurde. Verflucht! Gegen seinen Lehrmeister gelang es ihm nie, einen Treffer zu landen, obwohl er zweifelsohne der talentierteste Schüler war. Doch kein Mensch konnte es mit einem Elfen aufnehmen.
Seit dem letzten Trollkrieg vor beinahe zweihundert Zyklen, hatten Elfen einige ihrer Krieger zu den Städten der Menschen entsandt, um sie in der Kunst des Krieges zu unterrichten. Dante empfand das als erniedrigend, ebenso wie seine Eltern. Vor allem sein Vater hatte die neuen Gesetze und Regelungen verabscheut. Wir können uns nicht einmal mehr selber auf den Krieg vorbereiten. Wie sollen wir jemals ein eigenständiges Volk werden? Die Elfen meinten, sie wären Götter. Mit ihrer großtuerischen Art ließen sie es einen jedenfalls vermuten.
Mit den Zwergen hingegen kamen die Menschen hervorragend zurecht. Sie tranken wie Fässer, machten obszöne Späße und versprühten stets eine phantastische Stimmung. Außerdem ließen sie bisweilen zu, dass man sie erwischte. Die Elfen wichen jedem Hieb elegant aus. Nie verzog Solúnis sein Gesicht. Dante fragte sich, ob der hochgewachsene, schlanke Elf unter den Seinen ein ebenso herausragender Fechter war, oder ob sie ihn bloß nach Neustein geschickt hatten, um ihre wichtigsten Krieger zu schonen; oder als Strafe.
„Du musst die Geschwindigkeit deiner Schläge steigern, sonst wirst du nie einen herausragenden Fechter abgeben.“ Solúnis war nicht anzumerken, ob es ihn interessierte, wie sich Dantes Leistungen in Wirklichkeit entwickelten. Trotzdem erfüllte das Fechten den jungen Menschenkrieger mit Stolz. Er hatte alle in seinem Alter hinter sich gelassen; hatte erst sechzehn Sommer gesehen und gehörte somit zu den jüngeren Lehrlingen des arroganten Elfen. Sein Vater hatte ihm früher häufig erzählt, wie leicht es sei, alt zu werden; wie hinterlistig die Winter sich an einem vorbeischlichen.
Wehmütig starrte Dante ins Nichts. Sein Vater war vor einem Sommer gestorben. Eine unbekannte Krankheit hatte ihn von innen heraus zerfressen.
„Dante. Sieh zu, wenn ich dir etwas erkläre.“ Solúnis' schneidende Stimme riss ihn harsch aus seinen Erinnerungen. Wütend funkelte Dante den Elfen an, doch dieser hatte lediglich abschätzende Blicke für ihn übrig.
„Reiß dich zusammen, Dante. Ich möchte nicht, dass du dir im Kampf gegen einen Ork den Kopf abschlagen lässt. Das wäre schließlich eine Beleidigung meiner Kunst als Lehrer.“
Dass Solúnis diese Worte mit ein wenig Barmherzigkeit über die Lippen glitten, überraschte Dante für einen Augenblick, bevor er sich schalt, nicht auf die Tricks der Elfen hereinzufallen.
Die zwei kräftigen Arme spannten sich. Dante fand, dass er eine beachtliche Figur besaß. Exzellent beschaffen war er, hoch gewachsen, doch kein Riese. Seine Augen leuchteten in einem warmen Braun. Er besaß jedoch etwas zu schmale Lippen. Mittellanges, braunes Haar hing dem jungen Krieger in Strähnen von seinem Skalp in die Augen. Er schob seinen Unterkiefer ein wenig nach vorne, um sich der störenden Haare durch kräftiges Pusten zu entledigen. Abschneiden konnte er sie auf keinen Fall. Sie waren ein Zeichen seiner Männlichkeit. Als folgenden Gegner hatte Solúnis Loriel auserwählt. Ein schwächlicher, zahmer Junge mit sonnengebräuntem Gesicht. Runde, blaue Kulleraugen und volle Lippen verliehen ihm einen gewissen Charme. Dante wusste, dass Loriel ausgezeichnet bei den Mädchen ankam. Zuweilen beneidete Dante ihn für diesen unfairen Vorteil, doch dafür besaß Loriel keine Begabung mit der Klinge.
Die Sonne stach Dante unbarmherzig in die Augen. Er befand sich auf der falschen Seite des Kreises, in dem sie den Schaukampf austragen sollten. Wenn das Zeichen zum Angriff erklang, musste er versuchen, seinen Gegner auf diese nachteilige Seite zu drängen, oder zumindest einen der hohen Burgtürme in den Weg der Sonne zu schieben. Im windgeschützten Innenhof, in welchem der Unterricht täglich stattfand, gab es einige dieser Türme; Überbleibsel aus dem Krieg mit den Trollen. Nun stand ein weiterer Krieg vor den östlichen Toren.
Es begann. Sie umkreisten sich pirschend, wie zwei Raubtiere bereit zum Sprung. Loriel stach als Erster zu. Sein Rapier verfehlte Dante äußerst knapp, als dieser dem vorhersehbaren Stoß auswich. Geschickt konterte er mit einem Hagel aus rapiden Stichen auf diverse Körperteile. Loriel konnte sich glücklich schätzen, dass sie nur mit Holzschwertern übten, sonst wäre er nun, innerhalb weniger Herzschläge, durchlöchert worden. Dante grinste. Die Anderen waren keine Herausforderung mehr für ihn. Alle waren ihm unterlegen.
„Der Kampf ist entschieden.“ Solúnis musste Stolz auf Dante sein. Eines Tages, das schwor sich Dante, würde er den Elfen besiegen.
„Die heutige Stunde ist beendet, ihr dürft euch zurückziehen.“ begann der Elf mit bedächtiger, beinahe neugieriger Stimme. „Außer du, Dante. Ich habe Nachrichten für dich.“
Verwundert blickte Dante sich um. Er war versucht zu gehen, doch fiel ihm kein sinnvoller Grund dazu ein. Womöglich wollte sein Lehrmeister ihn bloß loben. Eins wusste er allerdings. Dass Solúnis bislang noch Niemanden zurückgehalten hatte. Es musste von ungeheurer Bedeutung sein und er würde sich dem stellen müssen. Was immer es sein mochte.
V
„Haltet ihn! Haltet den Dieb.“ schrie eine schrille Stimme hinter ihm. Die Beute entfernte sich in einem rasenden Tempo von ihrem früheren Besitzer. Grinsend blickte der Träger sich um. Dieser fette, alte Wirt würde sein Gold nie wieder in die Finger bekommen.
Nachdem Lannus in dem Gewirr aus Gassen untertauchte, erlaubte er sich eine flüchtige Pause, um wieder zu Atem zu kommen. Er erhaschte einen ersten Blick in den Beutel, den er soeben glanzvoll ergattert hatte. Solch eine Menge Gold. Er konnte sich Waffen der legendären, zwergischen Schmiede kaufen, oder in eines der Hurenhäuser Mentéls einziehen. Oder er konnte es sparen. Nein, Letzteres eher nicht, doch die ersten beiden Optionen klangen äußerst verlockend.
Nun sollte er sich allerdings schleunigst aus dem Staub machen, sonst könnten seine himmlischen Träume binnen Sekunden dem feuchten, eisigen Dreck einer Zelle weichen.
Raschen Schrittes huschte Lannus durch die schmalen Gassen. Nach einigen Wendungen, gelangte er auf den öffentlichen Marktplatz mit einer Vielzahl kleiner und großer Stände, welche allerlei bunte Waren ausstellten. In der Menge befand er sich vorerst in Sicherheit. Seine Augen erspähten unzählige, exotische Schätze, seine Nase sog sich mit dem Duft ferner Orte voll. Trotz all der fremden Köstlichkeiten entschied sich Lannus für einen saftigen, roten Apfel in welchen er genüsslich hineinbiss. Endlich hatte der Hunger ein Ende; endlich besaß er Gold. Über die sich dadurch ergebenden Möglichkeiten musste er sich später den Kopf zerbrechen, denn vorerst sollte er ein wahrlich sicheres Versteck finden. Noch war ihm sein liebstes Metall nicht vollkommen gewiss.
Als Lannus vor einem Gasthof mit dem wenig-sagenden Namen "Zum Hufschmied" anhielt, um das verfallene, heimelige Gebäude näher zu betrachten, schlich sich die Vermutung, dass dies nicht der richtige Weg war in seinen Geist. Er überdachte flüchtig, ob er fortsetzen sollte, entschied sich jedoch dagegen. Schließlich wollte er sein Gold nicht an irgendeinen anderen Räuber verlieren.
Hastig wendete er auf den Fersen und flüchtete eilig aus der zwielichtigen Gasse. Erst als der Dieb erneut zu einem Teil der Menschenmenge des Marktes verschwamm, fühlte er sich halbwegs sicher. Seine Schritte beruhigten sich, sein Herzschlag zog nach. Er fühlte sich überaus glücklich. Seine Sorgen zertrat er unter den abgetragenen Sohlen. Sollten die restlichen Bewohner ihn doch zweifelnd, angewidert und missmutig anstarren. Es gab Nichts, das Lannus seiner Freude berauben konnte.
Die nächste Gasse in die er einbog, wirkte weitaus nobler. Die Häuser stützten sich nicht morsch und zerbröckelnd auf die Schultern ihrer Nachbarn, sondern machten den Eindruck, als seien sie neu erbaut worden. Erstaunt blickte Lannus sich um. Er hatte seine gesamten vierundzwanzig Winter in Mentél verbracht, doch in diesen Bezirk hatte er sich noch nie verlaufen. Er fragte sich, wer in einer solchen Gegend hauste.
Die Häuser wurden stets prächtiger. Bald ähnelten sie eher den prunkvollen Palästen eines Königs als Gasthöfen und Wirtshäusern. Hier gehörte er nicht hin, dieser Ort gehörte den wohlhabenden, respektierten Menschen der Stadt. Doch, fiel Lannus mit einem breiten Grinsen ein, er war reich. Dennoch kroch ein mulmiges Gefühl in seinen Magen, dessen Knurren der Apfel fürs Erste bändigte. Hier gehörte er nicht hin. Der Dieb gedachte umzudrehen, entschied sich schließlich doch dagegen. Zur Sicherheit zückte er dennoch seinen Kurzdolch und versteckte seine linke Hand unter dem weiten, braunen Mantel, zerfressen von Motten und Alter.
Er stolperte stets tiefer den gepflasterten Weg entlang. Nach einigen hundert Schritten verbreiterte sich die Straße, um in einem enormen Tempel zu enden. Merkwürdig. Er schüttelte bereits seinen Kopf und kehrte um, als eine flüsternde Stimme ihn zurückhielt.
„Du bist hier nicht falsch, mein Freund. Glaub mir.“
Ein breites Grinsen schwebte gegenüber Lannus‘ Gesicht, nachdem er sich ruckartig zum Geräusch gedreht hatte.
„Ich – Ich habe mich wohl verlaufen. Ich wollte soeben wieder verschwinden.“ antwortete der Dieb zögernd.
„Mach dir keine Sorgen. Du siehst aus, als hättest du nichts Besseres vor. Folge mir.“ Der Unbekannte lächelte einladend.
Nach kurzem Zögern durchschritt Lannus das offene Tor, welches auf den immensen Hof des Palastes führte. Blumenbeete und sprießende, blühende Apfelbäume schmückten den Weg zu einer imposanten Tür aus Eichenholz. Springbrunnen in verschiedenen Formen und Größen prangten ohne erkennbarem Muster zwischen den Blumen. Wem auch immer dieser Palast gehörte, er musste ungeheuer wohlhabend sein.
Ohne weiter darüber nachzudenken, folgte Lannus dem Fremden durch ein beeindruckend verziertes Portal in eine gewaltige Eingangshalle. Hier verharrten sie kurz.
„Wer lebt hier?“
Die simple Eleganz des Raumes beeindruckte Lannus zutiefst. Die Wände waren bis auf zwei eigenartige Gemälde – jeweils eines an der Wand rechts und links von ihrem Eintrittspunkt – leer. Während das eine die gesamte Stadt aus der Vogelperspektive zeigte, schmückte ein schwarzer Seraph mit zusammengeklebten Flügeln, aus der Froschperspektive beobachtet, das zweite Gemälde.
„Das hier, mein Freund, ist das Hauptquartier des Zirkels der schwarzen Serafim. Wir sind die reichsten und mächtigsten Räuber Mentéls.“ Er vollführte eine ausholende Geste mit beiden Armen. „Hier treffen wir alle wichtige Entscheidungen über unsere weiteren Vorhaben. Hast du von dem Überfall auf die Villa des Stadtverwalters gehört?“ Der seltsame Fremde wartete nicht auf eine Antwort. „Das waren wir.“
Lannus hatte von dem Überfall gehört. Es war so viel Gold gestohlen worden, dass man damit eine neue Stadt hätte errichten können.
Er war er also an eine Räubertruppe geraten. Er spielte flüchtig mit dem Gedanken zu verschwinden, doch kam zu dem Entschluss, dass er hier reich werden könnte. Sah die Möglichkeiten vor seinen Augen. Ein Mann von seinen Fähigkeiten konnte es an einem Ort wie diesem unfassbar weit bringen, davon war Lannus vollkommen überzeugt. Des Weiteren würde man ihm hier mit Sicherheit Schutz gewähren, falls er in Schwierigkeiten geraten sollte; eine Möglichkeit, die man nicht ausschließen konnte.
Womöglich war er auch direkt in eine Falle getappt. Womöglich hatte der Flüsterer sein Gold erspäht und ihn nur deshalb in den Palast geführt. Um ihn zu töten und anschließend auszurauben. Lannus spürte wie sich salzige Perlen auf seiner Stirn bildeten.
„Ich habe davon gehört.“ nickte er bedächtig. Jedes Wort einzeln betonend.
„Gut, jeder hat davon gehört. Aber niemand weiß, dass wir etwas mit der Sache zu tun haben. Es wird nicht mehr lange dauern, bis wir der mächtigste Zirkel im gesamten Osten der Insel Santúr sind.“ Lannus zuckte zusammen. Die Stimme des Mannes vibrierte fanatisch, seine Augen funkelten.
„Dein Name – „ begann Lannus.
„Der tut nichts zur Sache.“ Der Mann winkte ab. Lannus schüttelte den Kopf und folgte dem Namenlosen durch einen Torbogen gegenüber der Eingangspforte.
Der nächste Raum war ein wenig kleiner als die Eingangshalle, jedoch mit ähnlichem Dekor versehen. Er war rund und an seinem Ende führten zwei Wendeltreppen auf einen Balkon, welcher den gesamten Umfang des Saales abdeckte. Eine breite Glasfront gab am Ende des imposanten Raumes, dort wo die Wendeltreppe auf den Balkon führte, den Blick auf einen wunderschönen Garten mit friedvollen, grünen Teichen frei, in denen sich Fische tummelten; auf perfekt gemeißelte Statuen, farbenprächtige Blumen und magisch anmutende Springbrunnen. Dem Jetzt haftete ein unechter Hauch an. Lannus hatte noch keine andere Person erblickt, seit er sich auf dieses Areal verirrt hatte.
Um in den nächsten Raum zu gelangen, mussten sie eine der beiden Treppen hinaufsteigen und durch das Tor, welches sich direkt oberhalb der Eingangstür zu diesem Teil des Palastes befand, spazieren. Schweigend, die Pracht des Gartens genießend, folgte Lannus dem blassen, dürren Mann mit den Segelohren und den langgliedrigen Händen. Die Proportionen stimmten nicht überein, weswegen sein Aufzug – keine Maßanfertigungen, dachte Lannus bei sich – misslich und plump wirkte. Die weiße Bluse war zu knapp, während seine schmalen, kastanienbraunen Strumpfhosen unelegant an seinen krummen Beinen hingen und sich mehrere Male am Schienbein falteten. Lannus folgte seinem schweigsamen Führer durch den steinernen Bogen in den nächsten Saal.
Auch dieser war beinahe leer. Lediglich ein weicher, roter Teppich füllte den blanken Boden aus. An den Seiten des Raumes befanden sich jeweils sechs Türen und Lannus versuchte angestrengt eine Erklärung für ihre Existenz zu finden. Diesem Fanatiker traute er allenfalls zu, einen feuerspeienden Drachen hinter einer der Türen zu verstecken, um Eindringlinge abzuschrecken.
Lannus vernahm gedämpfte Stimmen. Sie drangen aus dem Saal, auf welchen sie geradewegs zu spazierten. Nun sah er auch, was er enthielt. Ein langer Tisch aus Granit, geschmückt mit einem aus Gold eingravierten Namen vor jedem Stuhl. An den Wänden standen dutzende Kerzen, eingeschlossen von kunstvoll verzierten Kästchen aus Kristallglas. Die Tür, durch die sie gekommen waren, schien der einzige Ein- und Ausgang zu sein.
Auf der gegenüberliegenden Wand des Zimmers paradierte ein kolossaler, schwarzer Seraph aus einem Lannus unbekanntem Gestein. Goldene Kugeln füllten die Augenhöhlen. Er maß sechs Schritte in der Höhe und drei in der Breite. Seine enormen Flügel ragten dem durch eine gläserne Kuppel ausgesperrtem Himmel entgegen. Lannus stockte der Atem, als er sich fragte, wo im Namen Eldanas‘ er gelandet war.
An dem imposanten Tisch standen zwölf Stühle. Jeder von ihnen eine einmalige Anfertigung, was mühelos an den merkwürdigen Mustern und den verschiedenen Intarsien auf den Lehnen zu erkennen war. An neun der zwölf Stühle hatten Personen Platz genommen, von welchen zwei an den beiden Tischenden ruhten, während auf der linken Seite vier saßen, ihnen entgegenblickend drei. Auf den ersten Blick erkannte Lannus zwei Frauen unter den Sitzenden. Der Dieb nahm an, dass die Gestalten an den Tischenden diese Sitzung, oder was auch immer dies sein mochte, führten.
Der Mann, der direkt im Schatten des Seraphen tagte, wirkte wie der Anführer und musste furchtbar alt sein. Tiefe Falten gruben Krater um seine Augen und seinen Mund; ein langer, grauer Bart hing von seinem Kinn herab. Bei Lannus‘ Anblick breiteten sich die Furchen bis zur Stirn des blassen Greises aus. Beinahe ein Dutzend Augenpaare richteten sich auf Lannus, als sei er ein fremdes Geschöpf, emporgestiegen aus dem Meer. Lannus‘ Wangen röteten sich. Mit Ausnahme einer der Frauen vermutete der Dieb, dass er die wenigsten Zyklen erlebt hatte.
Lannus zwang sich zur Ruhe.
„Ich möchte keine Bewegung sehen.“ Sein Begleiter wanderte zum Anführer und begann, ihm etwas ins Ohr zu flüstern, doch er sprach zu leise, als dass Lannus die Botschaft hätte mitbekommen können. Nach einigen Augenblicken entfernte sich der Flüsterer vom Ohr. Der graue Mann schien kurz zu grübeln, bevor seine Worte Lannus entgegenbrausten.
„Erzähl mir ein wenig von dir.“ Seine Stimme war kräftiger als Lannus vermutet hatte und verdeutlichte, dass man sich vor diesen Menschen in Acht nehmen sollte.
„Das ist nicht von Belang.“ antwortete Lannus, urplötzlich gereizt, entsetzt von seiner eigenen, respektlosen Antwort. „Ich weiß nicht einmal, wer ihr seid, oder wo ich bin.“ fuhr in einer ängstlichen, ruhigen Stimme fort.
„Wir, Lannus, sind die Streiter des Zirkels der schwarzen Serafim. Mein Name ist Teranon. Ich bin der Anführer dieses Zirkels. Wir wissen, dass unser Handeln nicht ruhmreich scheint. Wir sind Diebe, Räuber. Man könnte behaupten, wir seien gierig und unser Handeln sei schändlich, doch wir nehmen uns bloß zurück, was die reichen Adeligen dieser Stadt unseren Vorfahren nahmen. Unsere Familien wurden ausgebeutet und nun rächen wir uns.“ Das Gewicht des Schmerzes schien sich an der Stimme festzuklammern.
„Ich begreife euer Leid, doch bin ich kein Teil von euch.“ Lannus verstand nicht, wie ihm geschah. Er hatte sich verlaufen und nun unterhielt er sich mit einem Fremden, der seinen Namen kannte.
„Du musst dem Zirkel nicht beitreten, wenn du nicht möchtest. Allerdings bietet er dir äußerst verlockende Vorteile wie Schutz, Reichtum oder Kontakte. Treffe deine Wahl mit Bedacht. Du kannst es hier zu größerem Ruhm bringen als auf der Straße. Ich weiß, dass du ein Räuber bist, Lannus. Ich kenne alle Diebe dieser Stadt.“
Ohne eine Antwort abzuwarten, stand der Greis auf und eilte schnellen Schrittes zu der Statue des mit Ruß überzogenen Seraphen und stellte sich direkt vor sie, bevor er beschwörend die Hände erhob. Teranons Lippen spielten kaum merklich mit undeutbaren Worten, während seine Augenlider sich schlossen. Auf einmal bewegte die Statue ihren linken Arm, dann den Rechten. Sie packte sich mit beiden Flügeln an den Bauch und stieß einen markerschütternden Schrei aus. Der Kopf des Seraphen senkte sich, als blicke er auf eine Wunde an seinem Magen. Die Hände öffneten eine verborgene Klappe, welche die scheinbaren Innereien der Statue offenlegte.
Entsetzt wohnte Lannus dem Schauspiel bei. Ein plötzlicher Lichtstrahl stach gleich tausend Dolchen nach seinem Antlitz. Seine Hand fuhr ruckartig vor die geblendeten Augen, um sie vor der Erblindung zu bewahren. Der entsetzliche, gleißende Schein ließ nach wenigen Momenten wieder nach und der Schmerz verging.
Behutsam entfernte Lannus die Arme von seinem Gesicht. Im Inneren des Seraphen war ein Hebel zum Vorschein gekommen. Teranon betätigte ihn mit Macht. Schwerfällig bewegte er sich in Richtung des Oberhauptes. Mit einem leisen Klicken rastete er schließlich ein.
Der alte Zirkelmeister trat einen Schritt zurück und wartete spannungsvoll. Nur einen Augenblick später tat der Seraph einen Schritt nach links und stand unverzüglich wieder still. Teranon musste ein bewanderter Zauberer sein, denn die Tür auf welche er nun zuschritt, besaß kein Schloss. Stattdessen zierten fremde Symbole und Zeichen ihre Oberfläche.
Der gesamte Saal bebte, als Teranon unverständliche Worte rief. Lannus fürchtete, dass die gläserne Kuppel ihn unter einem Hagel aus Splittern begraben würde, doch als er sah, wie gelassen die Anderen blieben, entspannten seine Muskeln sich ein wenig.
Mit einem grausamen Rattern fügte das Tor sich Teranons Willen und gab den Blick auf einen pechschwarzen Gang frei, in welchem er seine Hand nicht vor den Augen sehen konnte. Der Zirkelmeister schien gedämpft zu fluchen, doch plötzlich erhellte sich der Gang, obgleich Lannus keine Fackel entdecken konnte.
„Wenn du mir nun folgst, Lannus, wirst du in die Geheimnisse unseres Zirkels eingeweiht. Wenn du sie kennst, musst du uns beitreten. Überlege es dir gut.“ Seinen letzten Worten verlieh der bejahrte Mann mit der bodenlangen, nachtschwarzen Robe besonderen Nachdruck.
VI
Es bestand also doch eine Möglichkeit, die Schatten zu besiegen. Schwer war es allemal, doch nicht unmöglich. Er würde es schaffen, die vier Auserwählten zu finden. Von zweien wusste er den Aufenthaltsort bereits. Sie befanden sich in seiner Nähe und wussten noch nichts von Toraburs schicksalhafter Begegnung mit den Weisen. Die anderen Beiden würde er durch seine Späher suchen lassen.
Torabur mochte die Weisen nicht besonders. Obwohl sie zweifelsohne mit einem unheimlichen Intellekt und einem immensen Wissen ausgestattet waren, zerfraß die Gier sie von innen heraus, schwärzte ihr Ansehen als ehrwürdige Weise. Für jede noch so unbedeutende Information musste man mindestens fünf Goldstücke auf den Tisch legen. Unerhört – doch er hatte ihre Hilfe benötigt und dieser erstickende Funken Hoffnung, diese eine Möglichkeit womöglich einhundert Schatten zu besiegen, war die fünfzig Goldstücke wert. Schließlich hatten die Weisen ihn bereits aus so mancher aussichtslosen, verschlingenden Situation befreit.
Müdigkeit hing sich an Toraburs Augenlider; er sollte sich in seine Kammer zurückziehen. Morgen zur Mittagsstunde fand die bedeutsame Sitzung statt, in der er die anderen beiden Völker über sein Gespräch mit den Weisen in Kenntnis setzen würde. Die Verantwortung, schwerer als alle Felsen seiner Festung gemeinsam, folterte seinen zermürbten Geist in diesen aussichtslosen Zeiten.
„Mein König. Es ist etwas Schreckliches geschehen.“ Torabur fuhr herum und blickte in das vom Krieg gezeichnete Antlitz Grimmdors. Er hatte ihn nicht kommen hören. Die Kälte hatte sich aus den Augen des Generals geschlichen, war durch eine pochende Angst vertrieben worden.
„Grimmdor, so erzähl mir was du sahst.“ Noch nie hatte der König Grimmdor in Panik erlebt. Es musste irgendetwas unvorstellbar Grauenhaftes passiert sein, um diesen furchtlosen, kaltherzigen Krieger in eine solche Furcht zu versetzen
„Davon musst du dir selbst ein Bild machen. Folge mir.“ Torabur nickte und folgte dem verstörten General in Schweigen gehüllt. Grimmdor führte ihn geradewegs auf eine der enormen Festhallen zu, in denen die wichtigen Feiern veranstaltet wurden und in welcher sie alle wichtigen Treffen hielten.
Sie kamen dem Festsaal stets näher. Torabur hatte einen gerieften Stein im Magen, dessen Masse mit jedem Herzschlag zunahm. Jeder Schritt wurde zur Qual. Schließlich standen sie beide, wie Torabur es erwartet hatte, vor den Toren der Festhalle. Eine prachtvolle Axt und ein riesiger Hammer kreuzten das Tor in der Mitte. Die Klingen der Axt und der Kopf des Hammers waren vollständig aus Karneol gefertigt.
Wann immer Torabur vor diesen Toren stand, wurde er von Stolz erfüllt. Sein Volk brachte wahrlich meisterhafte Steinmetze hervor. Diesmal jedoch nicht; diesmal tobte ein Krieg in seinem Schädel und er wusste nicht, was er antreffen würde. Auf einmal schoss ihm ein Gedanke durch den Kopf. An diesem Tag fand ein Wettbewerb statt; der Wettbewerb der Steinmetze.
Hastig stießen Torabur und Grimmdor die gewaltigen Torflügel auf. Der König lief schnellen Schrittes und mit gesenktem Haupt hinein. Wenige Augenblicke später blieb er stehen, um sich umzusehen. Und er wünschte sich, dass sie die Torflügel nie aufgestoßen hätten.
VII
Ihre weißen Gewänder, vom Schnitt denen eines Priesters ähnlich, verdeckten ihre gesamten Körper. Die pechschwarze, an der Hälfte in ein tiefes Rot übergehende Schlange prangte auf der Vorderseite einer jeden Robe und wies die Träger als Klanglose Klingen aus. Jedenfalls für jene, die mit ihrer Verschwörung vertraut waren.
Glücklicherweise gab es lediglich eine Handvoll Mitwisser. Der Großteil der Bevölkerung nahm sie bloß als unbedeutende Mönche wahr, die mit gefalteten Händen durch die Städte pilgerten. Die Klanglosen Klingen flossen in keiner geordneten Formation durch die Menge, doch achteten stets darauf, sich nicht zu verlieren. Das wäre überaus hinderlich für das Hauptziel.
Die weiße Truppe bewegte sich rasch auf den überragenden Turm der Festung Eisenturm zu, in dem sich ihre Opfer in diesem Augenblick bestens vergnügten. Morpheus verstand nicht, weshalb man nicht schlichtweg vor die Herrscher der Lande trat, um ihnen direkte Hilfe anzubieten. Stattdessen würden sie in die Burg des zwergischen Herrschers einbrechen und bei irgendeinem Wettbewerb alle bis auf einen umbringen. Vollkommen sinnfrei, in Morpheus‘ Augen. Das ist zu groß für dich, war jedoch alles, was er seinem Kommandanten entlocken konnte.
Morpheus war ein unerfahrenes Mitglied der Klanglosen Klingen. Mit seinen erst neunzehn Wintern gehörte er zu den Jüngsten. Doch nach den aufreibenden Zyklen, die er bereits als Mitglied hinter sich hatte, hatte er auch gelernt, dass man nicht morden soll, wenn es nicht der allerletzte Ausweg ist. Er hatte gelernt, sich in jeder Umgebung unsichtbar zu machen, aus Knie-erweichenden Höhen zu springen ohne sich zu verletzen, zu schleichen wie eine Katze; und auch zu töten.
Sie erreichten den hoffnungslos überfüllten Marktplatz, welcher für sein unvorstellbares Ausmaß bekannt war. Diverse Stände, welche alles Mögliche zum Kauf anboten, säumten die breite Straße. Sie schafften es lediglich sich unter gewaltigen Anstrengungen durch das dichte Gewimmel zu wringen. Morpheus hatte für den Moment beinahe jeden seiner Freunde aus den Augen verloren, was ihn jedoch nicht beunruhigte, da sie einen genauen Treffpunkt vereinbart hatten. Dort vollzog sich dann der wahre Akt der Anstrengung, der Kunst. Im Schatten des Eisenturms würden zwei Dutzend Klanglose Klingen den mächtigen Turm erklimmen.
Morpheus hatte das Meer aus bunten Ständen beinahe passiert. Nun erspähte er eine größere Zahl seiner Komplizen. Die meisten von ihnen kannte er seit einigen Wintern, doch es waren auch welche dabei, die erst vor kurzem zu ihnen gestoßen waren. Eine Hand berührte die Klanglose Klinge sachte an der Schulter. Er drehte sich ruckartig um und blickte in das Antlitz Claudius'.
„Wir schaffen das.“ munterte sein engster Freund ihn mit gedämpfter Stimme auf.
„Ich fühle mich unwohl bei der Sache. Es kann zu viel schiefgehen. So fürchte ich, die Zwerge in meiner Nervosität nicht auseinanderhalten zu können.“
„Sperre deine Gedanken aus. Alles wird in Ordnung gehen, Morpheus.“
Claudius klopfte ihm fest auf die Schulter.
Nachdem sie ein Gewirr aus Gassen durchquert hatten, erreichten sie den vereinbarten Treffpunkt und wechselten die letzten, flüchtigen Worte, bevor die Ersteigung des Turmes beginnen sollte.
„In wenigen Momenten beginnt es, Männer. Wir werden von allen Seiten, an denen sich Fenster befinden, eindringen.“ Morpheus hoffte, dass er an Claudius' Seite hinaufsteigen durfte. Dieser würde ihm den Mut schenken, den er dringend benötigte.
„Hergehört! Ich gebe nun die Gruppen bekannt, welche sich die jeweiligen Seiten vornehmen werden.“
Der erfahrene Hauptmann mit der befehlsgewohnten Stimme und dem narbenübersäten, braungebrannten Gesicht wies auf drei ältere Offiziere, deren Erscheinungsbilder dem Seinen ähnelten. Die Veteranen nickten und murmelten leise untereinander, wobei mehrmals unterdrückte Lacher hervordrangen. Morpheus beneidete diese Altgedienten um ihre unerschütterliche Ruhe.
„Ihr werdet die Südseite übernehmen.“ fuhr Raspiron fort. Sein rechter Zeigefinger richtete sich auf Armenicus, Christophus und Julius. Sie gehörten zu den Neuankömmlingen ihres Bundes.





























