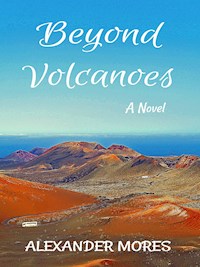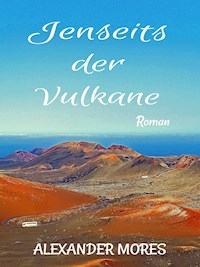
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
In einem Wohnblock am Rande einer Arbeitersiedlung leidet ein 8-Jähriger seit Jahren unter der sich zuspitzenden Ehekrise seiner Eltern, reagiert mit Rückzug und vielfältigen Verhaltensanomalien. Während einer Eskalation der Krise mit kurzfristiger Trennung beginnt sich eine lebensfrohe Tante verstärkt um den Kleinen zu kümmern. Sie lädt ihn zu sich ein und nimmt ihn mit auf die Vulkaninsel Lanzarote. Für den Jungen beginnt eine abenteuerliche Zeit, während die weiter schwelende Ehekrise seiner Eltern auf einen neuen Höhepunkt zusteuert. Alexander Mores erzählt intensiv aber auch humorvoll von einem Kind, das einer wechselvollen familiären Dynamik ausgeliefert ist, zwischen den Extremen zu existieren versucht und am Ende sein ganz individuelles Glück finden muss.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 181
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Jenseits der Vulkane
EpigraphAm AbgrundVeränderungenIkarusImpressumEpigraph
„Man will geliebt werden, mangels dessen bewundert, mangels dessen gefürchtet, mangels dessen gehasst und verachtet. Man will irgendein Gefühl in den Menschen wecken. Die Seele schreckt vor der Leere zurück und sucht um jeden Preis Kontakt.“
Hjalmar Söderberg, Doktor Glas
Am Abgrund
„Alle glücklichen Familien sind einander ähnlich, aber jede unglückliche Familie ist auf ihre besondere Art unglücklich.“
Leo Tolstoi, Anna Karenina
Es war kurz nach zwölf Uhr mittags. Seine Eltern wollten „abrechnen“, so nannten sie es jedenfalls. Abrechnen. Wie immer sonntags, meist nach dem Mittagessen, ohne Nachtisch. Draußen pulsierte das Leben an einem wolkenlosen Spätsommertag, während seine Mutter ihren Spiralkalender aus dem Schlafzimmer holte. Darin wurden die Geldsummen eingetragen, die sie von seinem Vater erhielt, und die er Woche für Woche zu unterschreiben hatte.
Auf ihrem Weg zurück blickte sie für Sekunden unruhig durch den Türspion. Sie betrat die Küche, schloss die Tür und vergewisserte sich, ob auch die Tür zum Wohnzimmer geschlossen war. Nun waren sie ungestört. Kein Nachbar grenzte an dieses Zimmer, außer die schwerhörige Rentnerin in ihrer Ein-Zimmer-Wohnung ein Stockwerk tiefer.
Am kantigen Tisch neben dem Fenster, mit Blick auf den grauen Wohnblock gegenüber, saß bereits sein Vater und kramte einen gut gefüllten Briefumschlag aus seiner Arbeitstasche, das cognacbraune Leder durchzogen von Rissen und Brüchen.
Der Blick seiner Mutter war auf seinen Vater gerichtet, mal starr, mal wandernd und wieder hängenbleibend. Der Blick seines Vaters versank im Umschlag, seine Lippen bewegten sich unmerklich, ein Daumen strich über viele Geldscheine. An der weiß-kahlen Wand wachte ein taschenbuchgroßes, bronzefarbenes Kreuz über allem, verblichen an den Rändern.
Am anderen Ende des Raumes, an der Spüle in der Ecke, stand ein acht Jahre alter Junge. Kurzsichtig und ohne Brille, nicht gedankenverloren wie sonst, sondern aufmerksam. Er kannte das Ritual, hatte Angst. Meist wurde er hinausgeschickt, jedoch aus irgendeinem Grund dieses Mal nicht. Vielleicht war er auch nur vergessen worden, übersehen an der Spüle, wo sich das Geschirr vom Mittagessen stapelte. Sie hatten Blut- und Leberwürste mit Pellkartoffeln und Rosenkohl gegessen, ein Lieblingsgericht seines Vaters. Der Kleine war hartnäckig gedrängt worden aufzuessen, hatte es aber nicht getan, nicht ganz.
Sein Vater streckte seiner Mutter den Briefumschlag mit einem Bündel aus größeren und kleinen Scheinen entgegen. Hastig nahm sie den Umschlag mit der einen Hand an sich, um das Geld mit einem Griff der anderen herauszuholen und vor sich auf den Tisch zu legen. Flink befeuchtete sie den rechten Daumen mit der Zungenspitze und begann zu zählen. Einen Schein nach dem anderen. Ihr Blick haftete mit einer Konzentration daran, als würde sie einen Fisch entgräten. Fertig gezählt, alles noch einmal: Schein für Schein für Schein. Ein tiefer Atemzug. Ein Seufzer. Sie murmelte eine Summe und schaute ihren Ehemann dabei ungläubig an.
„Ist das alles?“, säuselte sie misstrauisch.
Stille.
Jetzt nochmal, jedes Wort von ihr langgezogen: „Ich frage dich: Ist das alles?“
„Ja, das ist alles. Mehr war es diesmal nicht“, antwortete sein Vater standfest, leicht genervt, ohne ihrem Blick auszuweichen. Sie rechnete ihm detailliert vor, wie viel Geld er aufgrund seiner gefahrenen Kilometer bekommen haben müsste, wieviel bei der letzten Spesenabrechnung.
„Was soll ich sagen. Ich muss essen und trinken, ich lebe nicht von der Luft allein. Noch ist das nicht möglich.“
Die Augen seiner Mutter verengten sich, suchten in jenen seines Vaters, wissend aber nicht findend. Irgendetwas schien für sie nicht zu stimmen. Schon wieder diese Stille im Raum. Nach einem Zwinkern formte ihr Mund, ansatzlos, ein Lächeln - wie an Schnüren hochgezogene Mundwinkel, während ihre Augen unberührt davon weiter starrten. Auf einmal wirkte sie amüsiert, fast entspannt.
„Du brauchst gar nicht so zu grinsen“, tönte es ihr entgegen. Das schien sie in keiner Weise zu beirren. Seine Eltern durchbohrten einander mit Blicken.
„Du weist genau, wovon ich rede. Sag mir bitte sofort, wo das ganze Geld geblieben ist. Sofort!“
Ihre Mine hatte sich wieder verfinstert, die Stirn in verästelte Falten gelegt, die Mundwinkel tief abgesunken.
„Du träumst, Frau. Mehr gibt es nicht. Ich kann nicht zaubern“, betonte sein Vater. Ich. Kann. Nicht. Zaubern.
Die Stimmung zwischen ihnen war geladen wie bauschig finstere Haufenwolken vor einem Sommergewitter.
Stille.
„Du Hurenbock!“, schrie sie mit einem Mal.
Ein feiner Sprühnebel schoss aus ihrem Mund, erleuchtet vom Sonnenlicht im Hintergrund, und waberte zu ihrem Ehemann hinüber.
Der Junge im Eck zuckte zusammen, sein Herz schien stehen zu bleiben, für nicht enden wollende Sekunden.
„Was bin ich?“, konterte sein Vater langsam, mehr drohend als fragend. „Wie nennst du mich? Mach nur so weiter, Frau.“
„Ich weiß genau, was du treibst, mich kannst du nicht hinters Licht führen! Welche Hure ernährst du mit dem ganzen Geld?“, setzte sie hysterisch nach.
„Was für eine Hure soll ich ernähren? Was hast du immer mit deinen Huren? Da sind keine Huren.“
„Es gab Huren und es gibt Huren! Viele! Viele müssen da sein.“
„Dann beweise es mir doch. Wo sind die Beweise?“ Fordernd hob sein Vater die Hände mit den Flächen nach oben, unschuldsbeteuernd.
„Ich habe Beweise, und ich werde dich erwischen. Du wirst dich noch wundern. Ich werde einen Detektiv beauftragen. Schon bald.“
„Pass bloß auf. Ich bin doch nicht dein Sklave! Irgendwann bin ich weg. Lange schaue ich mir das nicht mehr an.“
„Was schaust du dir nicht mehr lange an? Wie ich hier tagein tagaus in der Wohnung sitze, während du in der weiten Welt weiß Gott was treibst?“
„Niemand hat dich dazu gezwungen, Frau.“
Da donnerte ihre Faust krachend auf den Tisch. In einem Reflex stieß der Junge gegen die Spüle, sodass das Geschirr klirrte. Ihr Blick ging kurz dorthin und sie entdeckte ihn, gegen die Spüle gepresst, seine Hände instinktiv vor den Kopf haltend. Schon war sie bei ihm, schob ihn aus der Küchentür und schickte ihn in sein zwei mal vier Meter großes Zimmer, während sie prüfende Blicke aus dem Türspion warf, ein Auge zugekniffen, das andere weit aufgerissen, hinaus starrend, als hätte sie dort gerade jemanden auf frischer Tat ertappt.
Der Junge konnte nicht anders, als seine Kinderzimmertür sofort wieder zu öffnen, sobald er gehört hatte, dass die Küchentür geschlossen war. Wie ging es weiter? Auch wenn er es ahnte, er fieberte doch jedes Mal von Neuem mit. Weil es um seine Eltern ging. Weil es um sein Leben ging. Weil es um alles ging. Die Gefahr einer Trennung stieg mit der Lautstärke ihrer Streitigkeiten, mit der Schrillheit oder Tiefe ihrer Stimmen, mit der Gehässigkeit und Entschlossenheit ihres Tonfalls. Manchmal hatte er Angst, einer von beiden könnte den anderen umbringen, ein Funke etwas zur Explosion bringen, was sich lange und tief angestaut hatte, was blitzschnell alles um sich zu zerstören vermochte. Wenn es nur gezündet würde.
Manchmal, wenn sie zwischendurch wieder leiser wurden, ging er zur Küchentür und lauschte direkt davor, nur um sofort wieder zum Kinderzimmer zurückzuweichen, wenn sich die Stimmen erneut erhoben. Die Intensität ihrer Konflikte hatte sich in letzter Zeit verstärkt, das hysterische Schreien seiner Mutter, gekontert vom tiefen Grollen seines Vaters.
Der Kleine schloss die Tür und setzte sich auf sein Bett. Und weinte, schluchzte bitterlich wie schon häufig, sein Gesicht vergraben in seinen Händen. Und betete, dass dieses Mal noch einmal alles gut werden würde, nur dieses eine Mal. Bitte! Die Angst vor dem, was andernfalls geschehen könnte, würgte ihn, erwürgte ihn fast, so dass er anfangs nach Luft ringen musste. Irgendwann wurde aus seinem Weinen ein Wimmern. Irgendwann wurde das Wimmern leiser, und er kippte um aufs Bett. Und niemand kam, um ihn zu trösten.
Er schlief ein aus Erschöpfung, und weil es nichts anderes mehr gab, was irgendwie Sinn zu machen schien.
Es wurde Herbst und die Tage merklich kürzer. An einem Sonntag entschlossen sich seine Eltern etwas Ungewöhnliches zu tun: Gemeinsam Essen zu gehen. Das gab dem Kleinen Hoffnung, genauso wie die zunehmende Stille in der Wohnung. Stille und Streit. Ebbe und Flut. Zwischen seinen Eltern breitete sich nun wieder das Schweigen aus. Zum Glück. Stille war besser als Schreien und Grollen. Und draußen lockte ein wärmendes Meer bunt leuchtender Baumkronen.
Die Vorbereitungen für die Abfahrt verliefen reibungslos, seine Eltern waren wie in Trance. Ihre tonlosen Wege durch die Räume schienen wie von unsichtbarer Hand so gelenkt, dass sie einander nicht in die Quere kamen.
Fürs obligatorische Rasieren richtete sich sein neunundvierzig Jahre alter Vater im Bad martialisch vor dem Flügelspiegel auf, einen Fuß selbstbewusst auf den Rand der Badewanne gestellt, mit den Zehen daran festgekrallt wie ein Habicht an einem Ast. Zügig seifte er sein Gesicht mit einem zottigen Pinsel bis zur Unkenntlichkeit ein, presste die Lippen fest, fast angewidert, zusammen. Seine grünen Augen richteten sich immer wieder skeptisch prüfend weg vom Bart auf sein dichtes, schwarzes Haar, den Kopf dabei nickend und drehend, ein Juwelier über einem Hochkaräter hätte kaum konzentrierter sein können. Am Ende klatschte er ohrfeigenartig Rasierwasser ins stoppelfreie Gesicht, während er das Ergebnis wohlwollend, aber nicht frei von Zweifeln, begutachtete, den Kopf herum wiegend mit unstetem Blick. Das Klatschen des Rasierwassers auf der Haut des Vaters diente dem Kleinen als Weckruf im Ablauf von Abfahrtsvorbereitungen.
Den größten Teil der Zeit verbrachte sein Vater jedoch damit, auf seine Ehefrau zu warten. Während der Fernseher säuselte oder die Zeitung raschelte, schallte er immer wieder aus dem Wohnzimmer: „Wie lange dauert es denn noch?“ oder „Kannst du bitte einen Zahn zulegen?“ Eine Antwort erhielt er auf solche Anfragen meist nicht. Ab und zu kam ihm das zu Bewusstsein und Ärger stieg in ihm auf. Wenn er dann ungehalten nachfragte „Bin ich dir keine Antwort wert?“, kam immerhin stets ein genervt beschwichtigendes „Nein“ zurück, in die Länge gezogen, so wie man einen Hund abwimmelt, der schwanzwedelnd ein Stück Torte ins Visier nimmt.
Seine dreiundfünfzig Jahre alte Mutter hatte ihren eigenen Rhythmus, unaufgeregt, aber nicht wirklich entspannt. Die Sitzung vor dem kippbaren Vergrößerungsspiegel wurde in der Küche erst abgeschlossen, wenn auch alle Poren rein genug waren. Einzelne Strähnen ihrer roten Haare, schulterlang und leicht gewellt, konnten immer wieder störend in ihr Blickfeld baumeln und wurden mit einem Seufzer hinters Ohr geschoben. Sogleich traten ihre großen, braunen Augen wieder hervor, auf der Suche nach Hautunreinheiten oder Augenbrauenhärchen, die aus den schmalen Linien zu tanzen wagten. Die Verkniffenheit, die seine Mutter hier an den Tag legte, war dem Kleinen von Anfang an ein Rätsel, da er schon den Zweck der Übung nicht verstehen konnte. Trotzdem war es ihm lieber als die Haarspray-Orgien, die kurz vor der Abfahrt im Bad veranstaltet wurden. Sie fummelte, einen Sprühstoß nach dem anderen abfeuernd, so lange auf ihrem Kopf herum, bis sich am Ende ein krauser roter Helm manifestierte, der jedem Wind standhalten konnte, ganz so wie in der Werbung versprochen. Benebelnd würziger Geruch drang hustenreizerregend vom Bad aus in jedes Zimmer vor, als hätte ein Flugzeug eine Ladung Pestizide versehentlich über dem Wohnblock statt wie beabsichtigt über einem Maisfeld abgelassen. Dem Kleinen wurde von dem Geruch regelmäßig schwummrig, weswegen das hartnäckige Zischen des Sprays für ihn schon früh in seinem Leben zu einem Warnsignal geworden war, bei dessen Ertönen die Kinderzimmertür unverzüglich und gewissenhaft geschlossen werden musste.
Irgendwann standen seine Eltern an der Wohnungstür wortkarg nebeneinander. Sie, durchschnittlich groß und von ebensolcher Gestalt, in einem dunkelblauen Kostüm mit weißer Bluse. Er, nicht viel größer als sie, aber markant breitschultrig und muskulös unter der seidenen Oberfläche seines weinroten Hemds. Die beige Baumwollhose fiel locker über seine beigen Lieblingsschuhe mit den dicken Absätzen, die von seiner Ehefrau, in geistesabwesenden Momenten, als „Stöckelschuhe“ bezeichnet wurden. Das konnte ihn minutenlang unleidlich werden lassen. Er äußerte dann seine Sorge darüber, diese Bezeichnung könnte ihr in Gesellschaft anderer herausrutschen, und es könnte die Runde machen, dass er gern Stöckelschuhe tragen würde. Wenn ihn die beschwichtigenden Worte seiner Ehefrau dann, wie so oft, nicht überzeugen konnten, stolzierte er hinüber zur Bar im Wohnzimmerschrank und kühlte seine Nerven mit einem Schnaps.
Während letzter Handgriffe vor der Wohnungstür hielt seine Mutter kurz inne. Fehlte noch irgendwas? Hatten sie alles dabei? Geld, Schlüssel, Handtasche? Dann durchströmte sie ein Impuls. Sie öffnete die Tür zum Kinderzimmer und riss den Kleinen aus seinen Tagträumen, in die er beim Warten abgeglitten war. Er zuckte beim Aufspringen der Tür tief einatmend zusammen und benötigte ein paar Momente, um wieder vollständig das Bewusstsein zu erlangen.
Der Ausflug konnte beginnen.
Die Fahrt zum Restaurant führte wie meistens ins nahe Umland, raus aus dem Arbeiterbezirk, vom Stadtrand hinein ins Grüne der rheinischen Hügel und Wälder. Sie mochten die Anonymität unter den Tagestouristen, fern von Wohnblöcken und vertrauten Nachbarn.
Für die Fahrt nahmen sie ihr Auto einer Edelmarke, das sein Vater in einer Nacht-Und-Nebel-Aktion gebraucht gekauft hatte. Das gefühlt drei mal sieben Meter große Gefährt stand kantig und himmelblau in Reih und Glied neben all den anderen Autos in der Siedlung, den Volkswägen und Fords, den Fiats und Renaults. Hätte alles keine Qualität, meinte sein Vater. Am Tag der Anschaffung gab es zwischen den Eltern einen heftigen Streit, aber das Auto, von dem sein Vater felsenfest überzeugt war, wurde schließlich behalten und erhielt schon bald den Spitznamen „Rocky“. Bei dieser Anschaffung hatte er sich „durchgesetzt“, wie sein Vater ab und zu mit breiter Brust zu betonen wusste.
Seine Mutter, die erst mit Mitte dreißig den Führerschein gemacht hatte, schien den Wagen von der ersten Minute an zu hassen. Sie war es, die die meisten Einkäufe allein erledigen musste, während ihr Ehemann, wie sie es gerne süffisant bezeichnete, „doch nur auf seinem Hintern sitzt und in der schönen, weiten Welt herum fährt“.
Bei ihren Fahrten durch die Stadt saß seine Mutter leicht nach vorn gebeugt hochkonzentriert hinter dem Lenkrad, sich daran festklammernd, die Hände lehrbuchmäßig auf „Zehn vor Zwei“. Mit weit aufgerissenen Augen steuerte sie den behäbigen Klotz um die Kurven. Parken konnte zur Millimeterarbeit werden, nur um dann immer wieder feststellen zu müssen, dass eine Lücke zu klein war oder dass eine Tür zum daneben geparkten Auto doch wieder nicht weit genug aufging, um ungehindert oder schadlos aussteigen zu können. Musste sie mal auf die Autobahn, fuhr sie ganz rechts, kaum über hundert Stundenkilometer, und vermied es standhaft zu überholen, insbesondere Lkws. Und aufgrund des schnell schmutzenden Himmelblaus wurde sie Stammkunde in der Waschstraße auf dem Weg zum Supermarkt. Der Kleine hatte damit kein Problem, im Gegenteil, er blieb gern allein im Auto und verfolgte das kraftvolle, automatisierte Schrubben und Wischen staunend von innen.
Es dauerte nicht lange, bis nicht nur sein Vater sondern auch andere Anwohner der Siedlung gefallen an dem Wagen fanden. Eines Tages fehlte etwas am Auto: Der Stern, der vorne die Motorhaube gekrönt hatte. Einfach abgebrochen, gestohlen! Sowas kann vorkommen, meinte sein Vater, und kaufte einen neuen. Wenige Wochen später: Wieder weg! Sein Vater kaufte noch einen Stern, begann sich jedoch mehr als üblich auf dem Schlafzimmerbalkon aufzuhalten, insbesondere abends. Dieser überblickte jene Seite des Parkplatzes, auf dem sein Auto stand. Das Problem war nur: Weil sein Vater werktags die meiste Zeit nicht zu Hause war und häufig auswärts schlafen musste, verpasste er den Dieb bei seinem dritten Coup.
So wenig sich sein Vater bislang hatte anmerken lassen, so sehr eskalierte er, als er an einem Samstag nach Hause kam und erschöpft von der Arbeitswoche die Neuigkeit erfuhr: „Wenn ich den erwische, den bringe ich um! Den mache ich kalt! Der wird nicht mehr wissen, wo links und wo rechts ist! So ein Schwein! So ein verfluchtes Schwein!“ Seine Mutter versuchte ihn zu beruhigen, was seine Wut jedoch, wie üblich, noch weiter steigerte. Schwer schnaufend eilte er ins Wohnzimmer zur Bar im Schrank, packte eine Flasche am Hals und würgte gierig schluckend und blubbernd Cognac in sich hinein, anders als üblich. Sein Vater hatte stilvolle, bauchige Cognacgläser, in denen er den Alkohol schwenkte und bewunderte, bevor er ihn hinunterkippte wie ein Fischreiher eine Kaulquappe, gefolgt von einem langen, zufriedenen Seufzer. Als sich seine Mutter von diesem ungewohnten Anblick abwandte, schmunzelte sie nur und schüttelte kaum merklich den Kopf, als würde sie damit ausdrücken wollen: „Das hast du nun von deiner Nobelkarosse.“
Kaum war die Wut verraucht, hatte sein Vater jedoch bereits einen heimtückischen Plan geschmiedet. Er kaufte vor seinem Urlaub einen vierten, einen „allerletzten“ Stern. Als Köder. Er stellte einen Stuhl auf den parkplatzseitigen Balkon, legte ein Fernglas neben sich und sich selbst drei Wochen lang, Nacht für Nacht, auf die Lauer. Er wollte den Täter auf frischer Tat ertappen, ihn am besten sofort schnappen und sich „zur Brust nehmen“. Dafür hatte er alles, was nötig war. In seinem gelegentlich fast ansatzlos aufflackernden Zorn konnte er blitzschnell und bärenstark zugleich sein, so einschüchternd und Widerstand brechend, dass er, am Ziel angelangt, schnell wieder kräftesparend vom Unterlegenen ablassen und sich selbst abwenden konnte, ohne auch nur einen Blick zu verschwenden. Zu besonderen Anlässen in heiterer Runde konnte er in nostalgischer Stimmung davon berichten, bei welchen Gelegenheiten er sich dieses Können in seinem Leben schon erfolgreich zunutze gemacht hatte. Ein Können, dass er sich in seiner Kindheit auf dem Land durch manchmal sogar stundenlange Beobachtung der Tiere erworben hatte.
Körperliche Fähigkeiten spielten bei seinem Vater auch beruflich eine Rolle. Bevor er bei einem Spezialchemieunternehmen im Rheinland anfing, Gefahrengüter per Lieferwagen durch Westeuropa zu transportieren, hatte er lange Zeit am Bau gearbeitet und sich in dieser Zeit einen ansehnlichen Körper aufgebaut - jeder der ihn aufgrund seiner Größe im Zweikampf unterschätzen würde, könnte den Fehler seines Lebens begehen.
Die Überwachungsaktion wurde vom Jungen sofort bemerkt. Sein Kinderzimmerfenster blickte direkt auf den Balkon, auf dem sein Vater im Dunkeln saß. Wenn er den Vorhang etwas zur Seite nahm, konnte er ihn sehen und die fast rhythmischen Abläufe verfolgen. Ein Nippen an der Bierflasche, die mit einem knappen Klirren wieder auf die weinroten Bodenfliesen gestellt wurde. Ein Griff zum Fernglas und ein sorgfältiges Spähen hinunter vom dritten Stock auf den unverwechselbaren „Rocky“. Blicke hinüber zum Nachbarwohnblock. Mal kürzer, mal etwas länger, je nachdem, in wessen nicht von einem Vorhang verborgenen Leben sich gerade was Sehenswertes abspielte. Sein Vater schien ein unterhaltsameres Abendprogramm auf dem Balkon zu haben als seine Mutter im Wohnzimmer bei der neuesten Folge der „Schwarzwaldklinik“.
Spätestens wenn das Treiben im Wohnblock gegenüber langsam zum Erliegen kam oder der fragend-mahnende Singsang seiner Ehefrau aus dem Schlafzimmer zu sehr an seinen Nerven nagte („Sei doch nicht so dumm!“, „Komm endlich rein!“ oder „Was ist nur los mit dir?“), gab er hin- und hergerissen auf und legte sich widerwillig schlafen.
Irgendwann war schließlich auch der vierte Stern über Nacht verschwunden.
Sein Vater gab auf und platzierte auf der Heckablage zum Ausgleich ein schmuckes, weißes Fell. Er meinte in flink wiedergewonnener Selbstgewissheit, das Fehlen des Sterns würde ohnehin niemandem auffallen, was wohl auch so war. Am Ende wussten vielleicht nur die unmittelbar Beteiligten, die Familie und der Dieb, dass in dieser nach einem Feldherren benannten Straße vier Sterne abhanden gekommen waren.
Das allgemeine Interesse an dem Auto ließ sich dadurch jedenfalls nicht erschüttern. Als links vorne auf einmal eine Radkappe nicht mehr an ihrem Platz war, verlor sein Vater darüber kein Wort mehr. Kein einziges Wort. Er presste seine Lippen zusammen, schob den Unterkiefer bei gleichzeitig weit abgesenkten Mundwinkeln störrisch nach vorne, und lief rot an. Schweigend und schwer atmend stand er eine Zeit lang an der geöffneten Schrankbar im Wohnzimmer. Zwischen den Schlucken murmelte er nur einmal kopfschüttelnd das Wort „Ersatzteillager“.
Der Tanz ums Auto ging in die nächste Runde. Die fehlende Radkappe wurde ersetzt, alle vier mit einer ausgeklügelten Konstruktion aus transparenten Kabelbindern so unauffällig als möglich gesichert, und darüber hinaus penibelst durchdacht, ob nicht noch irgendetwas an diesem Auto in Zukunft Gefahr laufen könnte, unfreiwillig den Besitzer zu wechseln. Sicher sein konnte sich sein Vater diesbezüglich jedenfalls nicht mehr.
Auf dem Weg zum Restaurant herrschte Ruhe im Auto. Der Kleine hasste Autofahren, wenn es lange dauerte. Er bekam Schwindel, Übelkeit und im schlimmsten Fall Erbrechen. Auf dem Weg zur Familie seines Vaters, die nahe der luxemburgischen Grenze ein Weingut besaß, musste regelmäßig ein Zwischenstopp für ihn eingelegt werden.
Noch schlimmer war Busfahren, nicht der Nahverkehr, sondern große Busse, mit denen seine Schulklasse Ausflüge unternahm.
Unvorsichtig glaubte er beim ersten dieser Ausflüge mit seinen Schulkameraden unbeschwert hinten im Bus sitzen zu können, am weitesten weg von den Lehrern, dort wo es während der Fahrt am meisten wogte und wackelte. In all der freudigen Ablenkung und Aufregung, dem Essen und Trinken, kam die Übelkeit so schnell und ohne Gegenwehr über ihn, dass er sein Erbrechen nur mehr halb benommen und doch völlig schockiert registrieren konnte, genauso wie den beißenden Gestank, der sich von der Rückseite des Vordersitzes im Raum verteilte, oder die angewiderten Reaktionen der anderen Kinder. Und als wäre es nicht schon schlimm genug, würzte die Klassenlehrerin diesen Eintopf der Eindrücke noch mit einer gehörigen Prise Hektik.
Der entsetzliche Vorfall war ihm eine Lehre, die Angst wurde zum ständigen Begleiter. Er saß ab sofort bei Schulausflügen weit vorne und war damit beschäftigt, im Kampf gegen das Erbrechen auf jedes Zeichen von Schwindel oder Übelkeit zu reagieren. Atmete tief ein, atmete tief aus, das Grauen vor dem zutiefst Widerwärtigen im Nacken, das Aufsehen erregte und den Kleinen erniedrigte, nicht nur in einer Hinsicht.
Während andere sprachen oder lachten, zählte er die Minuten bis zur Ankunft und versuchte beim Ringkampf, der in Kopf und Eingeweiden tobte, konzentriert zu bleiben, sich trotz seiner Kurzsichtigkeit mit der Landschaft abzulenken.
Kurvige Landstraßen konnten besonders tückisch wirken. Wenn jedoch Serpentinen in Sicht kamen, die sich einen Berg hinauf wanden, begann ihm eine Art Todesangst schweißtreibend die Kehle zuzudrücken. Auf einmal schien das unbemerkt von den anderen mühsam Erreichte wieder auf der Kippe zu stehen, kurz davor wieder ins Unerträgliche zu stürzen. Schon tasteten seine Finger im Rucksack zittrig nach dem Gefrierbeutel mit den belegten Broten, um diese in Sicherheit zu bringen, und um mit dem leeren Gefrierbeutel in beruhigendem Kontakt zu bleiben. Für alles was noch kommen mochte.
Am Ziel der Klassenausflüge starteten viele Schüler froh und neugierig ins Freie, wirkten regelrecht ausgeruht. Der Kleine, erblasst, fast grünlich im Gesicht, fühlte sich wie durch den Fleischwolf gedreht, heilfroh und ein wenig stolz, wenn er die Fahrt wieder einmal ohne Erbrechen überwunden hatte. Bei seinen Schritten die Stufen hinab ins Freie hatte er in etwa die Standfestigkeit eines neugeborenen Kalbs. Doch all seine Erleichterung wich leider bald schon dem Bewusstsein, dass er ja auch wieder zurück musste. Im Bus. Und so war „nach der Übelkeit“ gleichsam „vor der Übelkeit“. Schöne Aussichten.
Das Restaurant, das seine Eltern diesen Sonntag ansteuerten, lag zum Glück kaum fünfzehn Autominuten entfernt. Das reichte gerade mal für das Einsetzen leichter Schwindelgefühle, nicht der Rede wert. Es war eines jener typischen Landgasthäuser mit einem großen Schotterparkplatz und der einen oder anderen Attraktion für Gäste. In diesem Fall war es eine Bowlingbahn im Keller. Zumindest wurde damit geworben, gesehen hatte sie der Junge in Begleitung seiner Eltern bisher noch nicht.
Er saß auf der Rückbank, wie immer hinter seiner Mutter, und beobachtete wie sein Vater mit der Lässigkeit eines professionellen Fahrers steuerte. Ihre Augen trafen sich nie im Rückspiegel. Das einzige Geräusch während der Fahrt war das zarte Brummen des Motors. Keine Stimmen. Kein Radio. Keine Musik. Nur drei Mal Sprachlosigkeit. Leblos. Und am Ziel das Knacken und Prasseln des Schotters unter den Reifen, Gummi auf Stein, was dem Kleinen ganz besonders gefiel.
Fürs sonntägliche Spazierengehen, das meist nicht viel länger als eine Stunde dauerte, bevorzugten seine Eltern drei bis vier wohlvertraute Routen, auf asphaltierten, gut frequentierten Wegen. An diesem Tag war das anders.
Sie trotteten nebeneinander einen idyllischen Waldpfad entlang und unterhielten sich aufgeregt. Wenn ihnen ab und zu jemand entgegen kam, verstummte das gereizte Hin und Her kurzzeitig. Der Kleine verließ manchmal den Weg, wenn die Natur seine Aufmerksamkeit auf sich zog. Meist ging er hinter ihnen, mal weiter, dann wieder näher, abgestoßen von der Kälte und Feindseligkeit in ihren Stimmen und Sätzen, dann wieder angezogen wegen der ängstlichen Neugier, die der Streit der beiden wichtigsten Menschen seines Lebens geweckt hatte. Er konnte ihren wechselweise bedrohlichen und leiderfüllten Stimmen nicht entkommen.
Es ging um Tante Natascha, die jüngere und hübschere Schwester seiner Mutter.
„Hast du was mit ihr oder nicht?“