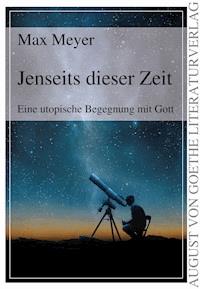3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Es geht darum, aufgrund neuer physikalischer Erkenntnisse den Bezug der Menschheit zum Jenseits anders darzustellen als die Religionen. Verschiedene geschichtliche Vorkommnisse könnten bezüglich des Verhältnisses der Menschen zum Jenseits auch anders interpretiert werden, als sie das bisher wurden. Nicht die Religion sondern die Science Fiction kann helfen, unsere Geschichte zu verstehen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 403
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
JENSEITS dieser ZEIT
Max Meyer
Sumid Press, Bern
Was Leser überJenseits dieser Zeit sagen:
«Woher kommen wir? Wohin gehen wir? Fragen, die der Autor Max Meyer in seinem Science-Fiction Roman «Jenseits dieser Zeit» spannend und unterhaltsam kontrovers beantwortet.»
aus dem Migros-Magazin
«Fantastisch, einzigartig, brillant. Dieses Buch weckt Ihre Neugierde. Sie werden es lesen und wieder lesen wollen!»
M.L. Fuhrer
«Ich habe das Buch zweimal gelesen. Beim ersten Mal habe ich es wie einen Thriller verschlungen…. Beim zweiten Mal gefiel es mir wegen der zahlreichen Hinweise auf die Weltgeschichte, die sich wie ein roter Faden durch den Roman ziehen…. Es ist ein Buch für Intellektuelle, das aber das Zeug zu einem Bestseller hat.»
J. Maler
«Max Meyers Roman verbindet verblüffende Argumente mit überraschenden Ideen. Er holt Galileo Galilei und Pestalozzi in die Gegenwart und hat alle Merkmale eines gut geschriebenen Thrillers.»
F. Buob
«Witzig, spannend, sehr gut gemacht! Ein Buch ist eigentlich erst gut, wenn man es gerne ein zweites Mal liest. Diesen Erstling von Max Meyer habe ich bereits zweimal gelesen! Es kann auch noch ein drittes Mal dazu kommen.!»
J. W. Glutz
«… Das Buch regt zum Nachdenken an und ermutigt dazu, bestimmte ‚alltägliche’ Begebenheiten zu hinterfragen, anstatt die Welt einfach so hinzunehmen, wie sie zu sein scheint. … »
F. Daniel
2., vollständig überarbeitetet Auflage 2022
Copyright © 2022 Max Meyer
Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotografie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Autors reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Cover- und Buchgestaltung: Ida Jansson
Lektorat: Marcel Maier
ISBN Softcover: 978-3-347-67696-1
ISBN E-Book: 978-3-347-67700-5
Druck und Distribution: tredition GmbH, Halenreie 40-44, 22359 Hamburg
Zuvor erschienen als Jenseits dieser Zeit: Eine utopische Begegnung mit Gott bei der Frankfurter Verlagsgruppe, 2012 Besuchen Sie die Website des Autors unter https://www.max-meyer-author.com
Namen, Personen, Orte, Marken, Medien und Begebenheiten sind der Phantasie des Autors entsprungen. Jede Ähnlichkeit mit lebenden oder verstorbenen Personen ist rein zufällig.
Inhalt
Prolog
Einbruch
Michael
Beute
Die Freikirche
Diskette 1
Diskette 2
Verdacht
Pestalozzi
Diskette 3
Das Offizium
Der Vatikan
Professor Bucher
Theorien der Zeit
Konsequenzen
Jenseits dieser Zeit
Erklärungen
Epilog
Für meine Enkelkinder und dieZeitreisenden von morgen
Humans think in stories, and we try to make sense of the world by telling stories.
Yuval Noah Harari
Prolog
Gott ermunterte mich, dies zu schreiben. Aber er zwinkerte mir zu und sagte, niemand würde es veröffentlichen wollen. Welche Anweisungen hätte er mir gegeben, wenn er gewusst hätte, dass die Publikation tatsächlich erfolgt? Hätte er sie verboten und gesagt, die Menschheit sei noch nicht reif dafür? Oder hätte er es als an der Zeit gesehen, dass sich die Menschen mit der vollen Wahrheit und namentlich auch mit Gottes wahrer Identität befassen und die Veröffentlichung dieses Berichts zugelassen?
Nicht, dass ich jemals wirklich gläubig gewesen wäre, wie Sie jetzt sicher denken. Ganz im Gegenteil. Trotzdem, ich kannte Gott, und ich kannte ihn persönlich. Sie werden sehen.
Alles begann, als ich einundzwanzig war. Inzwischen bin ich alt geworden. Wenn ich vor dem Spiegel stehe, blickt mir ein faltiges Gesicht entgegen. Ich erkenne es kaum wieder. Sicherlich ist es nicht mehr das Gesicht des jungen, dynamischen Studenten, der ich damals war. Wenn ich morgens aufstehe, kribbelt es in meinen Gelenken, und jeden Abend schlucke ich drei verschiedene Pillen, damit der nächste Tag erträglicher wird. Ich blicke also auf mein Leben zurück und frage mich, was eigentlich meine Pflicht ist. Muss ich meine Mitmenschen warnen? Soll ich sie wenigstens aufklären, indem ich ihnen meine Erlebnisse schildere, oder diene ich ihnen besser, wenn ich ganz nüchtern und wissenschaftlich darstelle, was auf der Erde wirklich vorgeht? Die Abwägung meiner Optionen gehe ich heute – im vorgerückten Alter – kühl und nüchtern an. Allerdings ‒ und das ist das Wichtigste ‒ werde ich im Geheimen schreiben und niemandem davon erzählen, bis das Werk veröffentlicht ist. Denn ich habe Grund zu der Annahme, dass man mich daran hindern könnte, indem man ganz einfach meine Erinnerung aus meinem Gehirn löscht, ähnlich wie der Speicher eines veralteten Computers gelöscht wird. Das aber möchte ich vermeiden.
Die Geschichte, die ich Ihnen jetzt erzähle, ist eigentlich nicht abgeschlossen, sondern immer noch in vollem Gang. Trotzdem nimmt sie auch heute noch niemand wahr. Wäre ich nicht durch Zufall darauf gestoßen, hätte ich selbst vielleicht nie die Wahrheit gesehen. Aber jetzt, wo ich sie gesehen habe, fühle ich mich gezwungen, davon zu berichten. Es ist, als wäre die gesamte Menschheit blind, gefangen in ihrer bequemen Weltanschauung, die durch die Physik von Galilei, Newton und Einstein geprägt ist.
Diese Sachlage geht auf die Zeit der Griechen zurück, als Ptolemäus uns sein Weltbild schilderte. Er schaute in den Himmel und beobachtete, dass sich einige Sterne gemeinsam in dieselbe Richtung bewegten, und schloss daraus, dass sie in einer Sphäre verbunden sein mussten. Andere Sterne bewegten sich in eine andere Richtung und waren somit in einer anderen Sphäre verbunden. Ptolemäus stellte fest, dass der Himmel aus sieben sich überlagernden Sphären besteht, die sich alle in verschiedener Richtung drehen. Dieses ptolemäische Weltbild mit der Erde im Mittelpunkt, die von sieben Himmelskugeln umgeben ist, hatte jahrhundertelang Bestand. Es erklärte, was die Menschen sahen, wenn sie in den sternenübersäten Himmel blickten. Die Sterne bewegten sich in sieben Richtungen, also musste es auch sieben Sphären geben. Was sie sahen, musste einfach wahr sein. Warum es in Frage stellen? Aber genau das ist das Problem. Wir alle sehen oft etwas und halten es für eine Tatsache, auch wenn unsere Erklärung für das, was wir sehen, eigentlich nicht stimmt. Wir bleiben auch in alten Ideen stecken und ignorieren Beweise für etwas Neues. Das tun wir selbst dann, wenn die Hinweise augenfällig sind.
Diese Geschichte ist nicht erfunden. Ich habe sie erlebt. Zwar habe ich teilweise einige Dialoge und Abläufe rekonstruiert; ich hatte aber gute Quellen so dass auch sie der Wahrheit entsprechen. Im Laufe meines Lebens habe ich viele Abenteuer überstanden. Ich habe gelernt, nur das zu glauben, was ich beobachtet habe, und nur das zu tun, was ich für richtig halte. Ich nehme Leute nicht ernst, die weit hergeholte Geschichten über Geister, übersinnliche Phänomene, ‚Zufälle’, die gar keine sind, oder irgendeinen anderen abergläubischen oder metaphysischen Unsinn erzählen. Ich kann so etwas einfach nicht glauben, denn in der Wissenschaft zählt nur, was konkret beweisbar ist ‒ und nicht, was man einfach glaubt. Deshalb verstehe ich auch wenn Sie meine Geschichte nicht ernst nehmen wollen. Aber ich bitte Sie trotzdem, mich anzuhören. Bleiben Sie beim Lesen wenigstens unvoreingenommen. Wenn Sie mir am Ende immer noch nicht glauben, prüfen Sie mindestens, ob das, was ich erzählt habe, sich so zugetragen haben könnte.
Ich muss jedoch vorsichtig sein. Es darf niemand erfahren, dass ich dieses Buch geschrieben habe. Dort, wo ich herkomme und früher lebte, könnte ich mich kaum an Diskussionen beteiligen, die durch meine Geschichte ausgelöst werden. Das stört mich ungemein. Denn gerne hätte ich alle noch offenen Fragen beantwortet und namentlich allfällige Zweifler, die es unter den Menschen immer gibt, mit weiteren Argumenten überzeugt. Anderseits weiß ich, dass meine Botschaft auch ohne zusätzliche Unterstützung ankommen und jeden nur denkbaren Wirbel verursachen wird. – Manchmal stelle ich mir in Gedanken die Diskussionen vor, die ich heraufbeschwören werde. Dabei sehe ich nicht nur die Wissenschaftler. Sie würden sich schnell auf diese neue Wissensgrundlage einstellen. Nein. Ich stelle mir auch Politiker vor ‒ einschließlich großer Staatsmänner ‒, die glauben, dass sie sich in jeder Rede auf Gott berufen müssen, um ihre eigenen Annahmen und Positionen zu rechtfertigen. Ich sehe Prediger, die sich als Mittler Gottes wähnen und ihre eigentümlichen Ansichten mit ihrer angeblich besonderen Beziehung zu einer höheren Macht rechtfertigen, die nur sie selbst haben. Und schließlich sehe ich religiöse Fundamentalisten hoch oben auf ihren Kanzeln, die Intoleranz praktizieren, alles im Namen Gottes. Ich sehe sie, all jene, deren Weltbild zusammenbricht, wenn sie mit der Wahrheit konfrontiert werden. Wie erbärmlich würden sie reagieren, wenn ich ihnen die wahre Natur ihrer Sache beweisen würde! Was für ein Vergnügen wäre es, sie stürzen zu sehen!
Wie genau mein Manuskript die Zeit übersprang und in die Hände eines Verlegers gelangt war ‒ darüber schweige ich. Selbst der Verleger weiß nicht, wie das geschehen konnte.
So unglaublich Sie meine Geschichte anfangs auch finden mögen, ich denke, dass sich einige von Ihnen schnell an das neue Wissen gewöhnen werden. Die Menschheit hat schon oft große wissenschaftliche Umwälzungen verkraften müssen. Sie wird auch mit meinem Bericht fertig werden. Mit der Zeit werden die Menschen die Informationen vielleicht sogar als selbstverständlich und normal empfinden. Manche werden sagen: „Wie konnten die Menschen nur so dumm sein, dass sie das alles nicht sehen konnten?“ Es wird dasselbe sein wie damals, als die Menschen erkannten, dass die Erde keine flache Scheibe, sondern eine Kugel ist? Waren nicht auch damals die Mächtigen und viele andere gegen die Verbreitung einer solchen ‚Ketzerlehre’, während man sich heute fragt, wie man damals nur so dumm sein konnte, die Wahrheit nicht zu erkennen? Es gab viele Anzeichen dafür, dass die Erde nicht flach ist. Nur ein Beispiel: Schiffe erhoben sich allmählich am Horizont, wenn sie sich dem Land näherten. Zuerst sah man nur den Mast, dann die Segel und je näher sie kamen auch den Bug. Offensichtlich segelten sie auf einer kugelförmigen Erde.
Genauso wird dieser Bericht deutlich machen, dass im Laufe der Geschichte, von der Antike bis heute, die Beweise auf die Wahrheit hinweisen. Wie konnten die Menschen die Beweise nicht sehen und sie dann, wenn sie sie sahen, völlig falsch interpretieren?
***
Ich begann mich mit den Ereignissen, über die ich hier schreibe, erst zu befassen nach der Ermordung von Heinz Roos, dem Assistenten von Professor Bucher am Seminar für Theoretische Physik der Universität Bern (Schweiz). Mein erstes Kapitel erzählt dieses schreckliche Vorkommnis. Damals arbeitete ich als Assistent an der juristischen Fakultät, die sich im selben Gebäude, ein Stockwerk höher, befand. Heinz Roos war ein Kollege und gewissermaßen ein Freund.
Die ersten Hinweise ergaben sich aber während einem Kongress schon vor dem Mord. Doch erst später wurden sie bedeutsam. Der Kongress war von der Abteilung für Ethnologie organisiert worden. Sie hatte nichts mit der juristischen Fakultät zu tun. Das Thema interessierte mich, und so ging ich hin, um an verschiedenen Veranstaltungen des Kongresses teilzunehmen.
Ein Amerikaner namens Alco Sci nahm ebenfalls am Kongress teil. Er war nur zu diesem Zweck in die Schweiz gereist. Er hatte einen Verdacht, einen Verdacht, der später auch in mir aufkam. Leider waren seine Motive jedoch ganz andere als meine.
Alco Sci, ein kleiner, bulliger Mann, hatte einen runden, dicken Kopf mit asiatischen Zügen. Sein Haar war silbergrau und passte zu den buschigen Augenbrauen, die sein Gesicht beherrschten. Mit leicht zu kurzen herabhängenden Armen, von kräftiger Statur und mit federndem Schritt sah er eher aus wie ein japanischer Ringer als ein Gelehrter. Er trug immer einen dunklen Anzug und eine Krawatte und vermittelte den Eindruck eines unerbittlichen, harten und böswilligen Mannes, ein Eindruck, der sich bei meiner kurzen Begegnung mit ihm später bestätigte. Sci stammte, wie ich nach einiger Zeit herausfand, aus Petersburg, Kentucky (USA). Er war anscheinend ursprünglich Professor für Physik, lehrte aber nicht mehr an einer Universität. Ich konnte beim besten Willen nicht herausfinden, was er eigentlich tat. Anscheinend arbeitete er in der Verwaltung einer Freikirche; er war viel zu schweigsam und zu wortkarg, um ein erfolgreicher Prediger gewesen zu sein. Später fragten wir uns sogar, wer ihn überhaupt zum Kongress eingeladen hatte. Aber er war da. Er muss eine Einladung gehabt haben, und jemand muss für seine Reise und die Anmeldung bezahlt haben.
Mit dem Wissen, das ich jetzt habe, rekonstruiere ich seine Ankunft so. Sci landete am Flughafen Zürich und nahm den Zug um 10:02 Uhr nach Bern. Genau sechsundfünfzig Minuten, nachdem der Zug ins Rollen gekommen war, stand er auf dem Bahnsteig im Berner Bahnhof. Er trat aus dem Gedränge heraus, ließ die eiligen Pendler vorbeiziehen und betrachtete seine Einladung. Sie enthielt einen kleinen Plan mit wichtigen Orientierungspunkten. Die Universität lag ganz in der Nähe und war leicht zu Fuß zu erreichen.
Erstaunlich ist, dass Sci allein gekommen war. Er war nicht von einer Eskorte junger Bodyguards begleitet wie bei seinem späteren Besuch. Also musste er sich selbst orientieren. Er stellte fest, dass er nur bis zum anderen Ende der unterirdischen Ebene des Bahnhofs gehen und dann den Aufzug zur Straßenebene nehmen musste. Dort angekommen, würde er sich auf der rechten Seite des wissenschaftlichen Instituts befinden. (Der Bahnhof in Bern war geschickt am Stadtzentrum gebaut worden und befand sich sozusagen direkt unter der Universität.) Der Standort war äußerst praktisch für die Wissenschaftler aus aller Welt, die sich auf dem Kongress versammeln sollten, und von denen kaum einer gerne einen Stadtplan studierte.
Zügig durchquerte Sci die Unterführung in ihrer ganzen Länge. Mehrere Leute warteten vor einem Aufzug. Er schloss sich ihnen an und betrat den Aufzug, sobald sich die Tür öffnete. Überrascht betrachtete er die Wände während der Fahrt nach oben. Sie waren voller Schmierereien und Graffiti und bestätigten seine Ansicht, dass in der westlichen Welt eine dekadente Generation heranwuchs. Der heutigen Jugend fehlte das ethische Rückgrat. Sie hatte keine Maßstäbe, nach denen sie Werturteile fällen konnte, wie sie von seiner Religion vorgegeben wurden. Ora et Labora ‒ bete und arbeite ‒ war das Motto der mittelalterlichen Klöster. Sci hatte es sich zu eigen gemacht. Die Schweiz, einst die Wiege der calvinistischen Werte, hatte ihre Arbeitsmoral und ihren Leistungswillen verloren, ebenso wie Teile seines eigenen Landes, die Ost- und vor allem die Westküste. Die calvinistischen Werte waren diejenigen, die ihm am meisten zusagten, und er vertrat sie mit seinem ganzen Auftreten.
Auf der Straße angekommen, orientierte er sich noch einmal und ging auf das Gebäude zu, in dem der Kongress stattfinden sollte. Er fand das große Auditorium auf Anhieb.
Einige Teilnehmer waren mit ihm vom Flughafen Zürich nach Bern gereist. Da sich die meisten nicht kannten, waren sie in verschiedene Waggons des Zuges gestiegen und hatten sich individuell auf den Weg zur Universität gemacht. Andere Teilnehmer waren mit früheren Zügen angereist und vertrieben sich die Zeit mit einer improvisierten Stadtbesichtigung, bevor sie zur Universität weiterfuhren. Wieder andere waren mit dem Zug aus Genf angereist oder hatten sich einen Tag früher auf den Weg gemacht.
Insgesamt waren etwa fünfzig Wissenschaftler aus der ganzen Welt für zwei Tage zusammengekommen. Es war also keine große Veranstaltung und machte folglich keine Schlagzeilen. Die meisten Teilnehmer waren relativ junge Biologen und Anthropologen, die sich mit der Geschichte der Erde befassten. Ihr Hauptinteresse galt der Frage, wie das Leben auf der Erde entstanden ist, wie sich die heutigen Lebensformen entwickelt haben und vor allem, wie ein so komplexes Lebewesen wie der Mensch entstanden ist. Ziel des Kongresses war es, den Austausch und die Diskussion über die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse auf diesem Gebiet zu fördern. Weder der Kongress noch das Thema waren außergewöhnlich. Es gab keine Verlautbarungen mit bedeutenden Konsequenzen. Aber für mich ist dieser Kongress der Ort, an dem alles begann, denn der Kongress brachte zwei wichtige Personen zusammen, wenn auch nur für kurze Zeit ‒ Alco Sci und Eduard Bucher.
***
Darwins Evolutionstheorie diente als Grundlage für die Diskussion im Kongress. Die Theorie hatte in der wissenschaftlichen Welt lange Zeit die Oberhand behalten, da sie in der Natur eindeutig belegt war. Die meisten Wissenschaftler waren der Meinung, dass die Entwicklung der verschiedenen Arten nicht anders hätte verlaufen können, und für die auf dem Kongress anwesenden Wissenschaftler gehörte sie zu den Grundvoraussetzungen, auf die sie ihre laufenden Forschungen stützten.
Die Debatte über die Einzelheiten des tatsächlichen Ablaufs der Evolution ging jedoch weiter. Es gab zwei ernstzunehmende und eindeutige Theorien über die Entwicklung des Lebens von Einzellern zum Menschen. Die eine Theorie besagte, dass sich die ursprüngliche Lebensform, einzelne primitive Zellen, mehr oder weniger zufällig entwickelte. Diese Zellen veränderten sich dann im Laufe der Zeit durch eine Reihe von Zufallsmutationen. Nach dem Gesetz des ‚Survival of the Fittest’ setzen sich bestimmte Mutationen in einer bestimmten Umgebung gegen andere konkurrierende Lebensformen durch, und durch diesen Prozess entwickelten sich kompliziertere Wesen. Nach Millionen von Jahren dieser Art von evolutionärer Entwicklung entstand schließlich der Mensch. Die Theorie der ‚natürlichen Auslese’ hatte unter den Wissenschaftlern viele Anhänger und war weithin akzeptiert.
Die andere Theorie stützte sich auf statistische Berechnungen und behauptete, dass zwischen dem Auftreten der ersten Lebensform und dem heutigen Tag nicht genügend Zufallsmutationen stattgefunden haben können. Dafür gab es einfach zu wenig Zeit. Es müssen also andere Faktoren im Selektionsprozess vorhanden gewesen sein und die Entwicklung beeinflusst haben. Diese Faktoren entsprachen den in der Natur vorkommenden Mechanismen. Sie lenkten die Evolution in eine bestimmte Richtung, nämlich hin zu intelligenten Lebensformen. Natürlich waren nicht alle diese Faktoren bekannt und stellten die Wissenschaftler vor große und andauernde Forschungsaufgaben.
Einige Wissenschaftler machten sich die Tatsache zunutze, dass wir nicht alle diese Steuerungsmechanismen kennen, und interpretierten die menschliche Unwissenheit als Beweis für das Wirken einer höheren oder göttlichen Macht. Ihrer Meinung nach ist es diese Macht ‒ Gott ‒, welche die Evolution in Richtung intelligentes Leben gelenkt hat. Natürlich erkannten diese Gelehrten die Ergebnisse der wissenschaftlichen Forschung an, aber sie postulierten auch die Anwesenheit einer göttlichen Hand, wo die Wissenschaft keine Erklärung finden konnte.
Die Wissenschaftler, die Darwins Evolutionstheorie ablehnten, nahm niemand mehr ernst. Diese Menschen waren meist religiöse Fundamentalisten, die buchstabengetreu an die Schöpfungsgeschichte der Bibel glaubten und behaupteten, das Leben sei vor einigen tausend Jahren durch einen göttlichen Akt erschaffen worden. Einige lehnten auch die Idee, dass der Mensch vom Affen abstammt, als Gotteslästerung ab. Erstaunlicherweise vertraten sogar vereinzelte Hochschulabsolventen diese Ansicht, als ob es die bisherigen Forschungen und Erkenntnisse nicht gäbe. Am Kongress in Bern wurden diese fundamentalistischen Ansichten nicht einmal diskutiert.
Die Teilnehmer sprachen jedoch eine andere Reihe von Fragen an, die mich interessierten: Würde sich das Leben in der Zukunft weiterentwickeln? Würden sich zum Beispiel die Menschen weiterhin verändern und an die sich ständig verändernden Lebensbedingungen anpassen? Und wenn ja, in welche Richtung würde sich dieser Wandel vollziehen? Die Teilnehmer suchten nach Hinweisen, die auf eine fortschreitende Evolution der Lebensformen hinweisen, insbesondere bei den Menschen in den letzten Jahrzehnten oder Jahrhunderten. Sie wollten in diesem Zusammenhang wissen, was den menschlichen Fortschritt in den letzten paar tausend Jahren ‒ von den Höhlenbewohnern bis zu unserer heutigen Kommunikationsgesellschaft ‒ tatsächlich bewirkt hat. Hatten schlaue Mutationen eine Rolle gespielt? Solche Fragen, wenn sie unvoreingenommen diskutiert wurden, erwiesen sich für religiöse Menschen als besonders schwierig. Unter Wissenschaftlern jedoch waren sie von brennender Aktualität.
***
Der Hörsaal nahm weit mehr als fünfzig Personen auf. Die Teilnehmer setzten sich mit großen Zwischenräumen in die Bänke. Meist grüßten sie sich nur flüchtig, kamen sie doch aus aller Welt und kannten einander kaum persönlich.
Als Sci den Hörsaal betrat, strich er sich leicht verlegen durchs kurzgeschorene silbergraue Haar und blieb im Eingang stehen, um einen Überblick zu gewinnen. Dann setzte er sich in die Reihe neben dem Hintereingang. Er wusste aus dem Programmheft, dass die Veranstaltung ins Deutsche und Englische gedolmetscht würde. Er konnte kein Deutsch. Englisch war seine Muttersprache. Er hatte jedoch nicht die Absicht, sich an den Diskussionen zu beteiligen oder seine Meinung zu sagen und andere herauszufordern. Diese Gruppe von Menschen würde seine Meinung nicht akzeptieren, und alles, was er sagte, würde sie nur provozieren. Auf jeden Fall hatte er keine Lust auf diese modernen, informellen Diskussionen, die heutzutage die traditionellen Vorlesungen an den Universitäten ersetzt hatten. Deshalb setzte er sich in die letzte Reihe. Dort wartete er regungslos während der Viertelstunde bis zum Veranstaltungsbeginn. Er sah sich nicht um und sprach mit niemandem.
Professor Bucher kam ein paar Sekunden vor Beginn des Vortrags herein. Obwohl das Thema wenig mit seinem Fachgebiet zu tun hatte, hatte er sich aus demselben Grund wie ich entschlossen, an der Veranstaltung teilzunehmen. Das Thema interessierte ihn, und er konnte von seinem Büro in der Nähe schnell zu Fuß da sein. Oder war Bucher gekommen, weil Alco Sci anwesend war? Auf jeden Fall nahm er in der letzten Reihe Platz, weil er zu spät kam. Bucher und Sci saßen während mehrerer Vorträge nebeneinander, ohne ein Wort miteinander zu wechseln. Bucher, ein elegant gekleideter, großgewachsener Mann, wirkte energisch und sympathisch, ein krasser Gegensatz zu Sci. Es war Bucher, der schließlich die Initiative ergriff und seinen etwas seltsamen Nachbarn ansprach. Seine Versuche blieben jedoch unbeantwortet, so dass er schließlich aufgab. Er wandte seine Aufmerksamkeit wieder dem Redner zu.
„Die Mutationen von einer Lebensform zur anderen vollziehen sich in sehr kleinen, zufälligen Schritten. Wir können diese beliebigen Zufälle über einen ziemlich langen Zeitraum hinweg zählen. Wir wissen auch aus der Wahrscheinlichkeitsstatistik, wie viele Zufälle für eine vorteilhafte Mutation erforderlich sind. Wir wissen also auch, dass die Zeitspanne zwischen dem Auftreten der ersten einzelligen Lebensformen und dem Auftauchen des Menschen nicht ausreichend ist.“
Der Redner vertrat offensichtlich die zweite oben genannte Theorie, dass die Entwicklung des Lebens durch in der Natur vorhandene Faktoren gesteuert oder ‚gelenkt’ worden sein muss. Der Redner fuhr fort, indem er Beispiele aus der Natur anführte, die die Entwicklung des Lebens in eine bestimmte Richtung beeinflusst haben ‒ Bevölkerungswachstum in Zeiten des Überflusses, sich ändernde Wettermuster, die Notwendigkeit, soziale Gruppen für die Jagd und den Schutz der Jungen zu bilden, und die Planung zur Erschließung wechselnder Nahrungsquellen. Sci hörte aufmerksam zu und schüttelte ab und zu den Kopf, wenn er nicht zustimmte. Nach dem Vortrag wandte er sich plötzlich an Bucher und äußerte seinen Unmut. Die beiden begannen zu reden.
Wie ich später feststellte, hörte niemand das gesamte Gespräch mit. Daher konnte ich es zum Zeitpunkt meiner Nachforschungen nicht rekonstruieren. Das ist bedauerlich, denn sein Inhalt hätte mein Verständnis erheblich erweitert. Von anderen Teilnehmern erfuhr ich jedoch, dass die Diskussion zwischen Professor Bucher und Alco Sci ziemlich intensiv war und bis in die Pause hinein andauerte. Bucher scheint versucht zu haben, Sci auszuhorchen, um herauszufinden, was der bullige Mann wirklich wusste. Seine Gesten hatten sogar die Aufmerksamkeit eines anderen Teilnehmers erregt, der mir später erzählte, Sci habe gesagt: „Könnte es sein, dass die Menschen ihre eigene Entwicklung wirklich von der Zukunft aus gesteuert haben? Ein beängstigender Gedanke! Eine geradezu lächerliche Erklärung für den Fortschritt!“ Sci hatte gezögert und fuhr dann fort: „Dennoch könnte es theoretisch bereits wissenschaftliche Erkenntnisse geben, die eine solche Aussage glaubhaft machen. Können Sie mir mehr darüber erzählen? Könnten Sie Ihre Theorie im Detail erläutern?“ Professor Bucher gab offenbar keine weiteren Erklärungen ab. Als ob er schon zu viel gesagt hätte, beendete er die Diskussion brüsk, wandte sich ab und verschwand in der Pause. Sci warf ihm einen feindseligen Blick zu und soll gemurmelt haben: „Jetzt weiß ich genau, wer Sie sind, Bucher. Und ich weiß, dass Sie mehr über unser Thema wissen als jede andere Person in diesem Saal. Wir werden bald wieder miteinander reden.‒“ Dann, so hörte ich, verließ er den Raum und wurde bei den anderen Sitzungen nicht mehr gesehen. Niemand schien dem, was sich zwischen den beiden Männern abspielte, viel Aufmerksamkeit zu schenken. Ich behaupte jedoch, dass Alco Sci in diesem Moment genau das verstanden hatte, was ich in diesem Buch beschreiben möchte ‒ der Mensch hat seine eigene Evolution gesteuert! Wäre Sci doch nur ein kommunikationsfreudiger Wissenschaftler gewesen und nicht jemand, der nur seine eigenen Interessen verfolgte!
***
Spätere Nachforschungen ergaben, dass Sci ein ‚Creationist’ war, wie die Amerikaner es nennen. Er vertrat die biblische Schöpfungslehre, nach der alles ‒ auch der Mensch ‒ von Gott vor mehreren tausend Jahren in der heute vollendeten Form geschaffen wurde. Das heißt, er gab vor, an diese Lehre zu glauben, zumindest in der Öffentlichkeit. Heute bezweifle ich, dass er das wirklich tat. Immerhin verfügte er über eine solide wissenschaftliche Ausbildung, und es ist gut möglich, dass er seine ‚Religion’ nutzte, um seine eher weltlichen Interessen zu verfolgen. Aber Alco Sci stammte aus Petersburg (USA), der Heimat des Schöpfungsmuseums, einer Hochburg der Anhänger der biblischen Schöpfungslehre. Obwohl die Wissenschaft eine Interpretation der Schöpfung ablehnte, die allein auf der Bibel beruht, glaubten noch erstaunlich viele Menschen daran. In Europa hielt der überwiegende Teil der Bevölkerung Darwins Evolutionstheorie im Wesentlichen für richtig. Das Gleiche galt für die große Mehrheit in Kanada und Australien. In den Vereinigten Staaten war das krass anders. Verschiedenen Umfragen zufolge glaubte etwa die Hälfte (!) der Bevölkerung, dass Gott den Menschen in seiner heutigen Form vor etwa 10 000 Jahren erschaffen hat. Jede andere Auffassung war für sie Gotteslästerung. In dem Land, wo Freikirchen zu einem riesigen Business mit teuren baulichen Zentren und eigenen Fernsehkanälen geworden waren, profitierten viele vom Geschäft mit der Religion. Ihre Führer hielten die religiösen Überzeugungen in der Bevölkerung wach – als Basis für ihr Geschäft. Sci profitierte von einem solchen religiösen Unternehmen. Vielleicht verteidigte er deshalb die biblische Lehre von der Schöpfung.
Einbruch
Der Morgen, an dem alles begann, begann wie jeder andere. Ich wachte früh auf, trank eine Tasse Kaffee und lief gegen 6:30 Uhr die Treppe meiner Wohnung hinunter. Wie immer nahm ich zwei Stufen auf einmal, wobei ich aus wochenlanger Gewohnheit nie einen Tritt verfehlte, obschon ich mir noch den Schlaf aus den Augen reiben musste. Ich war damals durchtrainiert und trittsicher. Die kleine Zweizimmerwohnung im Universitätsviertel hatte ich gemietet, um mein Junggesellenleben alleine weiter zu führen. Ich war kein Student mehr und verdiente jetzt ein wenig Geld als Assistent, so dass ich mir die Wohnung leisten konnte. Für mich damals ein enormer Luxus nachdem ich lange in einer Wohngemeinschaft gelebt und ein einziges Zimmer belegte hatte.
Unten öffnete ich die Haustür. Es war noch dunkel, aber am Horizont zeichnete sich ein schwaches Licht ab. Als ich mich als Jurastudent auf das Staatsexamen vorbereitete, stand ich sogar noch früher auf. Morgens konnte ich besser lernen und hatte mich noch nie zu der Sorte Studenten gezählt, die bis in alle Nacht über ihren Büchern brüten. Die Gewohnheit des Frühaufstehens hatte ich nach dem Examen beibehalten, wenn ich auch nicht mehr ganz so früh aus dem Bett kroch wie damals.
Als ich an meinem Briefkasten vor dem Gebäude vorbeikam, hielt ich an, um nach der Post zu sehen. Ich erwartete nichts, da ich ihn am Abend zuvor geleert hatte. Ich konnte einfach nicht an dem Briefkasten vorbeigehen, ohne ihn zu öffnen. Zu meiner großen Überraschung befand sich darin ein einziger kleiner Umschlag. Ich zog ihn heraus und steckte ihn in meine Tasche. Ich würde ihn später im Büro öffnen. Auf der Straße war es noch zu dunkel, um etwas zu lesen. Ich ging zu meinem Auto, einem alten blauen Fiat mit etwelchen Beulen und einigem Rost. Er würde die nächste Jahresinspektion nicht bestehen, aber bisher hatte er mir gute Dienste geleistet. Ich setzte mich hinter das Steuer, drehte den Schlüssel, löste die Handbremse und ließ den Wagen die leicht abschüssige Straße hinunterrollen. Als ich genug Geschwindigkeit hatte, trat ich die Kupplung ein. Das Auto ruckelte und sprang an. Bis heute halte ich nicht viel von teuren Autos oder anderen Statussymbolen, doch hoffte ich damals schon, mir später einmal, als Anwalt, ein ordentliches Auto leisten zu können, dessen Anlasser funktioniert.
***
Wenn ich auch sehr bescheiden lebte, weil Geld in der Jugend noch keine Rolle spielt und ich also auch nicht damit prahlten konnte oder auch nur wollte, so glaubte ich immerhin damals von mir, gut auszusehen. Ich war trainiert, hatte bisher alle Prüfungen gut bestanden und ich ging eigentlich davon aus, deswegen eine gute Partie für eine Frau zu sein. Aber ich konnte das nicht umsetzen. Die meisten Frauen, die ich interessant fand, hatten ganz andere Werte als ich. Sie lebten von Träumen und bevorzugten Hippie-Typen. Sie hatten wenig Interesse an einem Mann wie mir, der seine Zeit mit harter Arbeit verbrachte und sich auf seine wirtschaftliche Zukunft konzentrierte. Sie bevorzugten Männer, die Spaß daran hatten, die ganze Nacht aufzubleiben und über sämtliche Probleme der Welt zu diskutieren, Probleme, die mich damals nicht interessierten. In der Tat schienen mich die Frauen kaum zu beachten. Da es mir aber nicht an Selbstbewusstsein fehlte und ich mein ganzes Leben noch vor mir hatte, strafte ich genau diese Frauen damit, dass auch ich sie ignorierte. Zwar hatte ich ab und zu eine Freundin, aber aus meiner Sicht nie die Richtige. Rückblickend stelle ich fest, dass ich im Vergleich zu meinen älteren männlichen Kollegen und sogar zu den Frauen selbst unerfahren und geradezu naiv war.
Trotz meines Selbstbewusstseins war meine frühe akademische Laufbahn nicht überragend. Ins Gymnasium schaffte ich es problemlos, war aber dort ein mittelmäßiger Schüler. Ich hatte zu viele andere Interessen. Ich las viel und neigte dazu, mich auf nichts Bestimmtes zu konzentrieren. Außerdem, die Schule nahm kaum meine ganze Zeit in Anspruch. So spielte ich Schach und vertiefte mich in die Feinheiten von Geschichte und Mathematik. Darüber hinaus interessierten mich Naturwissenschaften besonders und ich führte gerne meine eigenen Experimente durch, auch wenn ich dabei nicht sehr methodisch vorging. Die Lehrer verlangten von mir nur, dass ich jedes Jahr mit der Note ‚genügend’ bestand, was mir ohne Schwierigkeiten gelang. Ich sah also keinen Grund, mich besonders anzustrengen. In den Ferien besuchte ich Sprachkurse in anderen Sprachregionen der Schweiz. So lernte ich Französisch und Italienisch. Nach dem Gymnasium ging ich direkt an die Universität. Anfangs konnte ich mich nicht zwischen Medizin und Geschichte entscheiden. Ich schaute bei beiden rein und ging dann in eine dritte Richtung ‒ Jura. Anders als in der Schulzeit konzentrierte ich mich auf mein Studium und schloss es in fünf Jahren mit guten Noten ab. Mir wurde darauf eine Assistentenstelle angeboten. Ich entschied mich aber, sie nicht sofort anzunehmen. Stattdessen ging ich für ein Jahr in die Vereinigten Staaten, um angelsächsisches Recht zu studieren und Englisch zu lernen. Stolz kehrte ich mit einem Master-Abschluss in Jura der Stanford University nach Hause zurück. Nun war ich also Assistent an der Universität hier in Bern und betrachtete die Arbeit als eine Fortsetzung meiner Ausbildung. Zum ersten Mal in meinem Leben hatte ich eine Stelle und erhielt ein Gehalt.
***
Ich beschloss, den Umschlag zu öffnen, während ich an einer roten Ampel wartete. Darin befand sich ein Zettel von einer meiner Freundinnen. Marianne war gestern Abend zu mir gekommen, aber ich war schon zu Bett gegangen und hatte nicht aufgemacht. Jedenfalls wollte ich mich nicht wirklich binden, also war es mir egal, wenn ich sie brüskierte. Erst jetzt wird mir klar, wie einfach es gewesen wäre, ein bisschen netter zu sein und das Leben vielleicht mehr zu genießen. Damals hatte ich ganz andere Werte und Prioritäten.
Als ich den Parkplatz der Universität erreichte, steckte ich den Zipfel meines rotkarierten Polohemdes in die schwarze Jeanshose zurück, aus der es mir im engen Führersitz gerutscht war. Dann ging ich zügigen Schrittes zum Haupteingang Ich öffnete die Tür, betrat das Foyer und fuhr mit dem Aufzug in den vierten Stock. Es war noch dunkel. Aber am Ende des Flurs leuchtete ein Oberlicht hinter einer Tür hervor, was darauf hindeutete, dass bereits jemand am Arbeiten war. Ich ging den halben Korridor entlang und blieb stehen, überrascht, dass das Licht aus meinem Büro kam. Hatte ich gestern Abend vergessen, es auszuschalten? Oder war nach meinem Weggang die Putzfrau gekommen und hatte es brennen lassen? Ich ging auf die Tür zu. Wie üblich war sie nicht abgeschlossen, da sich keine Wertsachen im Zimmer befanden und meine juristische Arbeit keine Geheimnisse barg. Ich öffnete die Tür und blieb auf die Schwelle stehen.
***
„Nächster Punkt: Ordnungsdienst“, Polizeikommandant Herbert Stucki blickte von seiner Traktandenliste auf. Der hochgewachsene Mann in den Fünfzigern strahlte Autorität aus. In der Regel fiel es ihm zu, die wöchentlichen Sitzung des Leitungsstabes der Berner Stadtpolizei zu leiten.
Stucki sah sich in dem spärlich eingerichteten Sitzungszimmer der Hauptwache um. Er studierte die Gesichter der sechs Abteilungsleiter, der Kommissare, vergewisserte sich, dass sein Adjunkt das Protokoll führt und die beiden Spezialisten, die er zur Behandlung bestimmter Themen hinzugezogen hatte, aufmerksam zuhören. Alle waren in Zivil gekleidet, mit Ausnahme des Leiters des Verkehrsdienstes, der seine Polizeiuniform trug. Die Stimmung war nüchtern, sachlich und ruhig wie das Sitzungszimmer selbst. Routinearbeit. Sie waren die wöchentlichen Veranstaltungen in der üblichen Reihenfolge durchgegangen und nun beim Ordnungsdienst angelangt, der in der Regel dem Schutz von politischen Aktivitäten oder von Gruppen, die eine Demonstration oder eine Kundgebung abhielten, galt. Der Ordnungsdienst hatte in der Bundeshauptstadt eine besondere Bedeutung, da viele Aktivitäten hier stattfanden.
„Es ist eine Demonstration der Bauern angesagt“, bemerkt der Adjunkt des Kommandanten, ein junger Jurist.
„Schon wieder eine Demo“, stöhnte der Leiter der Abteilung Verkehr und rollte mit den Augen. Kommissar Paul Lack war seit seinem Eintritt in den Polizeidienst im Verkehrsdienst tätig. Er kannte seine Pflichten in- und auswendig und hatte wenig übrig für Leute, die ihm seiner Meinung nach, die Arbeit unnötig erschwerten. Dazu gehörten Demonstranten, für die er den Verkehr überall umleiten musste.
Der Adjunkt fuhr fort. „Die Organisatoren haben vor einigen Tagen mit mir Verbindung aufgenommen. Sie beanspruchen den Bundesplatz vor dem Parlamentsgebäude, und zwar von 13.00 Uhr an den ganzen Nachmittag.“
„Gegen was protestieren die Bauern diesmal?“, fragte der Leiter der Kriminalabteilung gelangweilt, da ihn die Sache wenig anging.
„Gegen die Verwendung von Gentechnik in der Landwirtschaft“, antwortete der Adjunkt. „Im Parlament soll über ein Gesetz dazu beraten werden.“
„Wieso sind die Landwirte gegen die Gentechnik?“, fragte der Kommissar und schaute auf seine Hände.
„Sie fürchten wohl die Konkurrenz durch billige industrielle Produktion. Dabei nutzen sie geschickt die Ängste des Volkes vor der Gentechnik.“ Der junge Adjunkt klang sarkastisch. Auch für ihn bedeuten Demonstrationen immer Mehrarbeit.
„Schluss damit“, befahl Stucki. „Es ist nicht die Aufgabe der Polizei, Politik zu machen, sondern dafür zu sorgen, dass andere ihre politischen Rechte wahrnehmen können.“ Er machte eine Pause, um die Wirkung zu verstärken, und leitete zum eigentlichen Thema über, „Wirst du die üblichen Verkehrsumleitungen veranlassen, Paul?“
Lack war unzufrieden. „Wir haben drei bis vier Demonstrationen im Monat. Diesen Monat waren es die Kurden und die Kroaten, die gegen den Krieg in ihren Heimatländern protestiert haben, die Frauen gleich zweimal für oder gegen irgendwas, ich kann mich nicht mehr erinnern, die Atomkraftwerk-Gegner und so weiter. Wann hört das auf? Das bringt doch alles nichts. Diese Demonstranten helfen ihrer Sache nicht, wenn sie die Bevölkerung durch Staus belästigen. Gegen Atomkraft oder eine andere neumodische Technologie zu demonstrieren, wird den Fortschritt nicht aufhalten. Uns dazu zu bringen, die Straßen zu blockieren, wird es auch nicht, nicht wahr, Herby?“
Stucki mochte es, wenn seine Kollegen ihn auf Englisch „Herby“ nannten. „Sicher nicht, Paul. Aber das gehört nicht hierher. Wir werden uns bei Gelegenheit nach Feierabend darüber unterhalten. An der Sitzung des Leitungsstabes möchte ich nur Voten zur Sache. Also, wirst du die übliche Verkehrsumleitung organisieren?“
„Selbstverständlich, Herby. Ich schlage vor…“ und der Verkehrskommissar ging die üblichen Maßnahmen durch.
Nachdem Lack geendet hatte, ging Stucki auf den letzten Punkt der Traktandenliste ein: „Sonstige Fragen“. Diesmal ergriff Kommissar Erb das Wort. „Wir haben eine weitere Morddrohung gegen unseren örtlichen ‚Wissenschaftsstar’ erhalten.“ Jeder wusste, wen er meinte.
Trotzdem fragte Kommandant Stucki routinemäßig: „Gegen Eduard Bucher?“
Verkehrskommissar Lack stand auf und verabschiedete sich. Er hatte nichts beizutragen, wenn es um Morddrohungen ging. Zwei weitere Anwesende nutzten ebenfalls die Gelegenheit, den Raum zu verlassen.
„Ja, gegen Professor Bucher. Er hat wieder einmal einen anonymen Brief erhalten, in dem behauptet wird, dass das, was er tut, das ‚Werk des Teufels’ sei und gestoppt werden müsse. Natürlich hat er sich an uns gewandt.“
Nur selten erlangt ein Mitglied einer Fakultät der Universität Bern außerhalb der Schweiz Berühmtheit. Der Physikprofessor Bucher war eine Ausnahme. Er hatte zahlreiche Auszeichnungen und zusätzliche Ehrendoktortitel von drei verschiedenen Universitäten erhalten und war vier Jahre zuvor mit dem Nobelpreis ausgezeichnet worden, was ihn endgültig bekannt machte. Die Polizei nannte intern Bucher ihren ‚Wissenschaftsstar’, weil seine Arbeit so starken politischen Widerstand hervorrief, dass er gelegentlich Polizeischutz benötigte.
„Ein anonymer Brief? Darauf werden wir nicht reagieren.“
„Der Absender doppelte aber telefonisch nach; er rief an, ohne seinen Namen zu nennen, erkundigte sich, ob der Brief eingetroffen sei, und warnte, dass er seine Drohung ernst meine. Wir konnten den Anruf zu einer Gruppe religiöser Eiferer zurückverfolgen.“
„Christen?“
„Christliche Fundamentalisten.“
„Sind sie gefährlich?“ fragte der Kommandant.
„Jedenfalls sind sie ernst zu nehmen.“ antwortete Erb.
Kommandant Stucki spürte, dass er im Begriff war, in den Bereich der Politik vorzudringen, wollte aber sicherstellen, dass er die Situation begriff „Also, schon wieder Leute, die den wissenschaftlichen Fortschritt verdammen, weil sie damit nicht zurechtkommen.“
„Wieso schon wieder?“
„Auch die Bauerndemo ist doch teilweise von dieser Haltung geprägt. Moderne Bauern wehren sich nicht gegen eine neue Technik, sondern nutzen sie.” Erb nickte und Stucki kehrte zurück zum eigentlichen Thema. „Wirst du die Leute überwachen?“ „Ja, ich muss,“ bestätigte Erb.
„Und Professor Bucher orientieren?“
„Nein. Es wird ihn nur von seiner Arbeit ablenken. Übrigens scheint er wieder an etwas ganz Großem dran zu sein.“
„Etwas Großem?“
Erb nickte. „Offenbar bedeutsam” Der Kommissar blickt auf seine Notizen. „Nach Informationen der Grenzpolizei halten sich verdächtige Personen in Bern auf. Die sind als Touristen eingereist, scheinen aber etwas anderes vorzuhaben. Die Polizei glaubt, diese Gruppe sei auf Professor Buchers Forschungsresultate aus. Einer von denen könnte unser Anrufer sein.“
„Auch das noch“, seufzte der Polizeikommandant. „Wenn das so weitergeht, müssen wir eine Spezialeinheit gründen, die sich nur um die Angelegenheiten von unserem Professor Bucher kümmert.“
***
Heinz Roos lag regungslos auf dem Boden meines Büros. Tot. Das Seminar von Professor Bucher lag ein Stockwerk unter meinem, und Roos hatte keinen Grund, in meinem Büro oder gar im vierten Stock zu sein. Ich schaute an ihm vorbei. Mein Magen zog sich zusammen. Zwei Männer in enganliegenden schwarzen Anzügen waren damit beschäftigt, ein Seil am Fenster aufzuwickeln. Schwarze Strümpfe bedeckten ihre Köpfe. Ein dritter Mann, der genauso gekleidet war, kletterte durch das Fenster in den Raum. Woher könnte er kommen? Mein Büro lag ziemlich weit oben. Niemand konnte einfach von außen hereinklettern. Instinktiv zog ich mich in den Korridor zurück. Mein erster Impuls war, etwas Zeit zu gewinnen und zu überlegen, was ich tun sollte. Aber gerade als ich mich wegducken wollte, sah mich einer der Männer.
Er sah mir direkt in die Augen, dann stürzte er quer durch den Raum und schlug mir seitlich auf den Kopf. Ich sackte in die Knie. Er packte mich unter den Armen und zog mich zurück in Richtung Fenster. Mitten im Raum ließ er mich fallen wie ein Sack Kartoffeln. Ich wusste, dass ich gegen alle drei keine Chance hatte. Also schwieg ich und tat so, als hätte ich das Bewusstsein verloren.
In der Gewissheit, dass ich ohnmächtig geworden war, beschäftigten sich die Männer wieder mit dem Seil. Nachdem sie es aufgewickelt hatten, nahm ein Mann das Bündel und warf es sich über die Schulter. Als sie an mir vorbeikamen und aus dem Raum strebten, zuckte ich unwillkürlich zusammen. Hätte ich doch nur stillgehalten! Reflexartig trat ich einem der Männer gegen das Schienbein. Er stolperte und zwei kleine Disketten rutschten unbemerkt aus seiner Tasche auf den Boden. Einer der anderen Männer zog aus seiner Jacke eine Pistole mit einem Schalldämpfer heraus. Er richtete die Waffe direkt auf meinen Unterleib. Ich rollte gerade zur Seite, als er abdrückte. Ich zuckte und stöhnte, dann lag ich still. Die drei eilten zur Tür hinaus.
Ein stechender Schmerz fuhr durch meinen linken Oberschenkel. Langsam und unsicher fuhr ich mit der Hand an meinem Hosenbein hinunter, bis ich die Stelle fand, an der ich getroffen worden war. Ich blutete. Ich erinnerte mich an die beiden Disketten und tastete auf dem Teppich herum, bis ich sie fand. Mühsam steckte ich sie in die Brusttasche meines Hemdes. Ich fühlte nach meiner Wunde und spürte, wie sich das Blut immer weiter ausbreitet. Das Telefon auf meinem Schreibtisch! Mühsam kroch ich darauf zu, stützte mich noch auf einen Ellbogen und schaffte es gerade, mich aufzurichten. Da wurde alles schwarz vor meinen Augen.
***
Professor Eduard Bucher betrat an diesem Morgen weit vor acht Uhr sein Arbeitszimmer. Er schloss die verstärkte Tür mit einem herkömmlichen Schlüssel auf und gab dann einen Code in ein elektronisches Tastenfeld ein, um einen Riegel zu öffnen, der sein Büro und das angrenzende Seminar von innen und außen sicherte. Dies war das einzige Sicherheitssystem dieser Art im Gebäude. Er betrat den Raum und erschrak. Unter einem zerbrochenen Fenster glitzerten Glasscherben auf dem Boden. Schubladen waren herausgezogen und Papiere über seinen Schreibtisch verstreut. Er schloss die Tür, beherrschte sich und sah sich um, jede Einzelheit erfassend. Vorsichtig ging er zum Fenster und blickte auf den Bürgersteig drei Stockwerke tiefer. Keine normale Leiter hätte so hoch reichen können. Die Wände auf beiden Seiten des Gebäudes waren steil und flach, keine Vorsprünge. Er blickte nach oben, konnte aber nichts an der Fassade über ihm sehen. Der Eindringling muss vom Dach herabgekommen sein. Bucher zog sich zurück ins Zimmer und ging zu seinem Computer. Der Bildschirm war im Schlafmodus; jemand muss ihn eingeschaltet haben. Ein beklemmendes Gefühl der Angst kroch in ihm hoch. Er ließ sich in seinen Bürostuhl fallen, drückte die Leertaste und der Computer wachte auf. Die Augen auf den Bildschirm geheftet liess Bucher seine Finger flink über die Tastatur gleiten Er hielt den Atem an. Minuten vergingen. Schließlich hörte er auf zu tippen und lehnte sich zufrieden zurück. Er starrte eine Sekunde lang ins Leere, dann griff er nach dem Regal über dem Monitor, nahm eine Diskette und legte sie in das Laufwerk ein. Er gab eine Reihe von Befehlen ein und wartete. Er lehnte sich wieder zurück und lächelte. Niemand hatte den Code geknackt, nichts war gelöscht worden, und die Dateien mit seiner Arbeit blieben unangetastet. Er seufzte und sah sich noch einmal im Raum um. Das Chaos war gar nicht so schlimm ‒ ein zerbrochenes Fenster, das repariert werden musste, und eine halbe Stunde Aufräumarbeiten sollten genügen, um die Dinge wieder in Ordnung zu bringen.
Er ging noch einmal die Disketten durch und zog eine nach der anderen heraus, um festzustellen, ob jede Diskette in ihrer richtigen Hülle steckte. Hmm, dachte er. Zwei Disketten fehlten, die beiden, die er noch nicht beschriftet hatte. Hatte er sie in das Regal gelegt? Nein, er hatte sie gestern auf seinem Schreibtisch liegen lassen. Bucher schmunzelte. Der Inhalt jeder Diskette war mit einem Protokoll, das nur er kannte, verschlüsselt und komprimiert. Wer sie auch immer gestohlen hatte, musste also ein Vermögen ausgeben, um den Code zu knacken, wenn das überhaupt möglich war. Aber wenn es einem Hacker gelänge, wären die Informationen wertlos, es sei denn … der Dieb könnte sie irgendwie mit Buchers Jugend und Karriere in Verbindung bringen. Bucher schüttelte den Kopf und hielt dieses Szenario für höchst unwahrscheinlich.
Bucher stieß sich von seinem Schreibtisch ab und kehrte zu dem zerbrochenen Fenster zurück. Er blickte hinunter in den Hof direkt unter ihm und sah nichts Ungewöhnliches. Dann hörte er eilige Schritte und gedämpfte Stimmen, die die Treppe hinaufgingen. Er machte ein paar Schritte zurück in den Raum, um zu lauschen. Die Geräusche verschwanden. Dann hörte er Schritte und Stimmen von draußen. Er schaute wieder durch das zerbrochene Fenster. An der Seite des Gebäudes, vor dem Haupteingang, stand ein Krankenwagen mit weit geöffneten Türen. Zwei Sanitäter luden eine Bahre mit einer darüber baumelnden tragbaren Infusion ein. Dann sprangen sie wieder heraus, um zwei weiteren Sanitätern zu helfen, eine zweite Bahre mit einem in ein Laken gehüllten Körper zu beladen. Der Krankenwagen raste mit heulenden Sirenen davon. Bucher wandte sich vom Fenster ab und verließ das Seminar, wobei er alles so ließ, wie es war.
„Dr. Bucher“, sagte jemand. „Ich habe eine schreckliche Nachricht.“
Bucher blieb stehen.
„Heinz Roos ist tot.“
***
In einer Wohnung am Stadtrand von Bern, an einem zerkratzten Holztisch machten sich die drei Einbrecher über ihr Frühstück her. Sie trugen nach wie vor schwarze Hosen und Rollkragenpullover. Vor sich hatten sie eine halb leere Dose Instantkaffee, drei Tassen, ein Teller mit gelbem Käse, eine Packung geräucherter Schinken und ein Laib Brot. Das übrige Mobiliar im Raum bestand aus zwei Stühlen und einem alten Sofa, auf dem zwei Gewehrgürtel und ein aufgerolltes Seil lag. Fahles Sonnenlicht und eine feuchte Morgenbrise drangen durch das einzige Fenster.
Ein Mann rieb sich die Augen. „Wer zum Teufel hätte gedacht, dass jemand so früh zur Arbeit kommt?“ „Man weiß nie, was ein spitzköpfiger Intellektueller tun wird“, sagte der zweite Mann. Er sprach leichtfertig, hatte aber kein gutes Gefühl nach dem, was passiert war.
„Keine Sorge, er hat uns nicht erkannt“, sagte der dritte.
„Bist du sicher, Gus?“
„Herrje, Stan. Keine Sorge, der kann uns nicht verpfeifen. Du und Leroy seid solche Weicheier.“
„Wer nennt hier wen ein Weichei?“, knurrte Leroy. „Du hättest ihn abknallen sollen, wie den ersten Typen.“
Das Telefon klingelte. Gus nahm ab, „Ja.“ Sein Gesicht spannte sich an, als er zuhörte. Er wippte von einem Fuß auf den anderen.
„Nein. Sorry. Wir haben nicht gekriegt, was Sie wollten. Da waren keine Akten, wie Sie gesagt haben. Außerdem wurde es schnell hell.“
Wieder lauschte Gus. Sein Gesicht wurde noch angespannter. „Nein, tut mir leid“, und nach einer langen Pause sagte er: „Keine Ahnung, ob es Komplikationen geben wird. Wir mussten einen Typen loswerden. Er tauchte aus heiterem Himmel auf, als wir uns gerade abseilen wollten. Den anderen haben wir nur ein bisschen bearbeitet, weil wir noch unsere Masken aufhatten. Er konnte nichts sehen.“
Stille breitete sich aus. Gus wurde blass und krächzte: „Nein, der zweite ist wahrscheinlich nicht tot.“ Er lauschte einen Moment lang angestrengt. Das Telefon klickte und der Anrufer legte auf.
Gus setzte sich an den Tisch, entspannte sich und nahm einen Schluck lauwarmen Kaffee. „Das war der Boss. Übrigens habe ich mir zwei Disketten geschnappt, die nicht mehr in meiner Tasche sind. Hast du sie gesehen?“
„Was für Disketten?“, fragte Stan.
„Computerdisketten. Zwei ohne Etiketten. Sie lagen einfach so auf dem Schreibtisch.“
„Meinst du, die haben etwas mit diesem Job zu tun?“, fragte Leroy kratzte sich in seinen Bartstoppeln.
„Vielleicht.“
„Wenn sie wichtig waren, warum wurden sie dann liegen gelassen? Das ergibt keinen Sinn.“ Leroy kratzte sich weiter.
„Da ist was dran“, sagte Gus. „Aber man weiß ja nie.“
„Nun, ich habe sie nicht gesehen“, sagte Leroy.
„Ich auch nicht“, fügte Stan hinzu.
„Na ja. Vielleicht tauchen sie ja wieder auf. Wie auch immer, wir haben heute einiges zu tun, Jungs.“
„Scheiße.“
„Wir müssen zurückgehen, ganz normal, damit wir nicht auffallen. Vielleicht ein paar Leute abholen. Vielleicht dem zweiten Typen im Krankenhaus einen Besuch abstatten. Wir sollen auch Nachrichten hören und Zeitungen lesen.“
***
Mein Puls raste. Wilde Bilder schossen mir durch den Kopf. Ich flog durch die Luft, stürzte ab und landete auf einem Ast. Ich lag im Bett, und unter mir brannte die Erde. Durch die Flammen hindurch sah ich das Gesicht meiner Mutter. Ich sagte etwas zu ihr, aber mitten im Satz wurde alles schwarz. Ich hörte das Heulen einer Sirene ‒ weit, weit weg. Irgendetwas drückte mich gegen die Gurte, als säße ich in einem Rennwagen, der in einer Kurve der Rennstrecke die äußere Fahrbahn entlangfuhr. Die Flammen kamen zurück; ich raste durch sie hindurch und spürte nichts. Ich musste packen. Ich wollte abreisen. Was wollte ich packen? Ich konnte nichts mehr sehen. Die Flammen wurden blau und verschlangen alles um mich herum. Ich rannte weiter durch sie hindurch. Ich musste vorwärtskommen. Irgendwann wurde ich langsamer, und da war nichts mehr.
Als ich Stunden später wieder zu mir kam, hatte ich meine Augen geschlossen. Aber ich fühlte mich wohl und warm. Ich lag in einem Bett. Licht drückte gegen meine Augenlider, und die Dunkelheit wurde heller. Vorsichtig öffnete ich die Augen und tastete den Raum ab, ohne den Kopf zu bewegen. Alles um mich herum war weiß ‒ das Bettzeug, die Wände und das Licht, das durch das Fenster fiel. In meinem Kopf drehte sich alles. Ich schloss die Augen und versuchte, mich zu erinnern. Langsam tauchten die Bilder der letzten Minuten vor meiner Ohnmacht auf. Ich hatte auf dem Boden gelegen, hatte Schmerzen gehabt und geschwiegen. Ein ganz in schwarz gekleideter Mann war gestolpert und halb neben mich gefallen. Ein anderer Mann hatte eine Pistole auf meinen Unterleib gerichtet und auf mich geschossen. Ich hatte mich gerollt und die Kugel war in meinem Bein stecken geblieben. Die Maske des Mannes war nach oben gerutscht, und ich sah die Stoppeln an seinem Kinn. Ich öffnete meine Augen. Ein Lederriemen mit einem Handgriff hing über dem Bett. Ich bin in einem Krankenhaus, dachte ich, und schlief wieder ein. Ein starkes Beruhigungsmittel tat seine Wirkung.
***