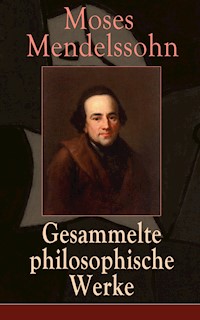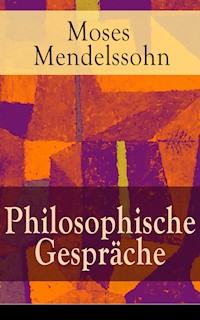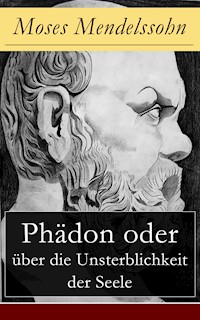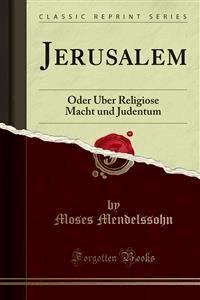7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
"Liebt die Wahrheit, liebt den Frieden!" Mendelssohn entwickelt eine systematische Kritik religiöser und staatlicher Machtansprüche über das menschliche Gewissen. Seine Kernthese: Weder weltliche noch geistliche Autorität besitzt das Recht, in Fragen der inneren Überzeugung zwingend zu wirken. Wahre Religion entspringt der Vernunft und freien Einsicht, nicht äußerem Druck. Diese Ausgabe macht sein philosophisches Hauptwerk von 1783 für heutige Leser zugänglich, ohne den originalen Gedankengang oder die argumentative Präzision zu beeinträchtigen. Überlange Periodenstrukturen des 18. Jahrhunderts wurden in verständliche Sprache übertragen, historische Begriffe behutsam aktualisiert. Das Werk entstand als Antwort auf den Konversionsaufruf des Zürcher Theologen Lavater und entwickelt daraus eine grundsätzliche Theorie der Gewissensfreiheit. Mendelssohn argumentiert für die strikte Trennung von Handlung und Gesinnung: Während der Staat Handlungen regulieren darf, bleiben Gedanken und Überzeugungen der staatlichen wie kirchlichen Einflussnahme entzogen. Ein Schlüsseltext der deutschen Aufklärung, der sowohl für die Religionsphilosophie als auch für die politische Theorie der Toleranz von bleibender Bedeutung ist.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
MENDELSSOHN: JERUSALEM ODER ÜBER RELIGIÖSE MACHT UND JUDENTUM
ERSTER ABSCHNITT
ZWEITER ABSCHNITT
EDITORISCHE NOTIZ
FUSSNOTEN
IMPRESSUM
Titelangaben
Moses Mendelssohn
Jean Delaube (Hrsg.)
Jerusalem oder über religiöse Macht und Judentum
In behutsam modernisierter Sprache

ERSTER ABSCHNITT
Staat und Religion – bürgerliche und geistliche Verfassung – weltliches und kirchliches Ansehen – diese Stützen des gesellschaftlichen Lebens so gegeneinander zu stellen, dass sie sich die Waage halten, dass sie nicht vielmehr Lasten des gesellschaftlichen Lebens werden und den Grund desselben stärker drücken, als was sie tragen helfen – dies ist in der Politik eine der schwersten Aufgaben. Man bemüht sich schon seit Jahrhunderten, sie zu lösen. Und hier und da hat man sie vielleicht glücklicher praktisch beigelegt, als theoretisch aufgelöst.
Man hat für gut befunden, diese verschiedenen Verhältnisse des geselligen Menschen in moralische Wesen abzusondern, und jedem derselben ein eigenes Gebiet, besondere Rechte, Pflichten, Gewalt und Eigentum zuzuschreiben. Aber der Bezirk dieser verschiedenen Gebiete und die Grenzen, die sie trennen, sind noch bis jetzt nicht genau bestimmt. Man sieht bald die Kirche das Markmal weit in das Gebiet des Staats hinübertragen. Bald erlaubt sich der Staat Eingriffe, die den angenommenen Begriffen zufolge ebenso gewaltsam scheinen. Und unermesslich sind die Übel, die aus der Uneinigkeit dieser moralischen Wesen bisher entstanden sind und noch zu entstehen drohen.
Liegen sie gegeneinander zu Felde, so ist das menschliche Geschlecht das Opfer ihrer Zwietracht. Und vertragen sie sich, so ist es getan um das edelste Kleinod der menschlichen Glückseligkeit. Denn sie vertragen sich selten anders, als um ein drittes moralisches Wesen aus ihrem Reiche zu verbannen: die Freiheit des Gewissens, die von ihrer Uneinigkeit einigen Vorteil zu ziehen weiß.
Der Despotismus hat den Vorzug, dass er bündig ist. So lästig seine Forderungen auch dem gesunden Menschenverstand sind, so sind sie doch unter sich zusammenhängend und systematisch. Er hat auf jede Frage seine bestimmte Antwort. Ihr dürft euch weiter um die Grenzen nicht bekümmern. Denn wer alles hat, fragt nicht weiter.
So verhält es sich auch nach römisch-katholischen Grundsätzen mit der kirchlichen Verfassung. Sie ist auf jeden Umstand ausführlich und gleichsam aus einem Stück. Räumt ihr alle ihre Forderungen ein, so wisst ihr wenigstens, woran ihr euch zu halten habt. Euer Gebäude ist aufgeführt. In allen Teilen desselben herrscht vollkommene Ruhe. Freilich nur jene fürchterliche Ruhe, wie Montesquieu sagt, die abends in einer Festung ist, welche des Nachts mit Sturm überzogen werden soll.
Wer Ruhe in Lehre und Leben für Glückseligkeit hält, findet sie dennoch nirgends gesicherter als unter einem römisch-katholischen Despoten. Oder, weil auch hier die Macht noch zu sehr verteilt ist: unter der despotischen Herrschaft der Kirche selbst.
Sobald aber die Freiheit an diesem systematischen Gebäude etwas zu verrücken wagt, so droht Zerrüttung von allen Seiten. Man weiß am Ende nicht mehr, was davon stehenbleiben kann. Daher die außerordentliche Verwirrung – die bürgerlichen sowohl als kirchlichen Unruhen in den ersten Zeiten der Reformation. Und die auffallende Verlegenheit der Lehrer und Verbesserer selbst, sooft sie in dem Fall waren, in Absicht auf Gerechtsame das »Wie weit?« festzusetzen.
Nicht nur praktisch war es schwer, den großen, seiner Fessel entbundenen Haufen innerhalb geziemender Schranken zu halten. Auch in der Theorie selbst findet man die Schriften jener Zeiten voller unbestimmter und schwankender Begriffe, sooft von Festsetzung der kirchlichen Gewalt die Rede ist.
Der Despotismus der römischen Kirche war aufgehoben, aber – welche andere Form soll an ihrer Stelle eingeführt werden? Noch jetzt in unseren aufgeklärteren Zeiten haben die Lehrbücher des Kirchenrechts von dieser Unbestimmtheit nicht befreit werden können.
Allen Anspruch auf Verfassung will oder kann die Geistlichkeit nicht aufgeben. Und gleichwohl weiß niemand recht, worin solche bestehe. Man will Streitigkeiten in der Lehre entscheiden, ohne einen obersten Richter zu erkennen. Man beruft sich noch immer auf eine unabhängige Kirche, ohne zu wissen, wo sie anzutreffen sei. Man macht Anspruch auf Macht und Recht und kann doch nicht angeben, wer sie handhaben soll.
Thomas Hobbes lebte zu einer Zeit, da der Fanatismus, mit einem unordentlichen Gefühl von Freiheit verbunden, keine Schranken mehr kannte. Er war im Begriff, wie ihm auch am Ende gelang, die königliche Gewalt unter den Fuß zu bringen und die ganze Landesverfassung umzustürzen. Der bürgerlichen Unruhen überdrüssig und von Natur zum stillen, spekulativen Leben geneigt, setzte er die höchste Glückseligkeit in Ruhe und Sicherheit, sie mochte kommen, woher sie wollte. Diese fand er nirgends als in der Einheit und Unzertrennlichkeit der höchsten Gewalt im Staate.
Der öffentlichen Wohlfahrt, glaubte er, sei am besten geraten, wenn alles, sogar unser Urteil über Recht und Unrecht, der höchsten Gewalt der bürgerlichen Obrigkeit unterworfen würde. Um dieses desto füglicher tun zu können, setzte er zum Voraus: Der Mensch habe von Natur die Befugnis zu allem, wozu er von ihr das Vermögen erhalten hat.
Der Stand der Natur sei Stand des allgemeinen Aufruhrs, des Krieges aller wider alle, in welchem jeder mag, was er kann. Alles Recht ist, wozu man Macht hat. Dieser allerdings unglückselige Zustand habe so lange gedauert, bis die Menschen übereingekommen sind, ihrem Elend ein Ende zu machen. Sie kamen überein, auf Recht und Macht, insoweit es die öffentliche Sicherheit betrifft, Verzicht zu tun. Sie lieferten solche einer festgesetzten Obrigkeit in die Hände. Und nunmehr sei dasjenige recht, was diese Obrigkeit befiehlt.
Für bürgerliche Freiheit hatte er entweder keinen Sinn, oder er wollte sie lieber vernichtet als missbraucht sehen. Um sich aber die Freiheit zu denken auszusparen, davon er selbst mehr als irgendjemand Gebrauch machte, nahm er seine Zuflucht zu einer feinen Wendung.
Alles Recht gründet sich, nach seinem System, auf Macht, und alle Verbindlichkeit auf Furcht. Da nun Gott der Obrigkeit an Macht unendlich überlegen ist, so sei auch das Recht Gottes unendlich über das Recht der Obrigkeit erhaben. Und die Furcht vor Gott verbinde uns zu Pflichten, die keiner Furcht vor der Obrigkeit weichen dürfen.
Jedoch sei diese nur von der inneren Religion zu verstehen, um die allein es dem Weltweisen zu tun war. Den äußeren Gottesdienst unterwarf er völlig dem Befehle der bürgerlichen Obrigkeit. Und jede Neuerung in kirchlichen Sachen, ohne derselben Autorität, sei nicht nur Hochverrat, sondern auch Lästerung.
Die Kollisionen, die zwischen dem inneren und äußeren Gottesdienste entstehen müssen, sucht er durch die feinsten Unterscheidungen zu heben. Und obgleich noch so manche Lücken zurückbleiben, die die Schwäche der Vereinigung sichtbar machen, so ist doch der Scharfsinn zu bewundern, mit welchem er sein System hat bündig zu machen versucht.
Im Grunde liegt in allen Behauptungen des Hobbes viel Wahrheit. Die ungereimten Folgen, zu welchen sie führen, kommen bloß aus der Übertreibung, mit welcher er sie vorgetragen hat – aus Liebe zur Paradoxie oder den Bedürfnissen seiner Zeiten gemäß.
Zum Teil waren auch die Begriffe des Naturrechts zu seiner Zeit noch nicht aufgeklärt genug. Und Hobbes hat das Verdienst um die Moralphilosophie, das Spinoza um die Metaphysik hat. Sein scharfsinniger Irrtum hat Untersuchung veranlasst. Man hat die Ideen von Recht und Pflicht, Macht und Verbindlichkeit besser entwickelt; man hat physisches Vermögen von sittlichem Vermögen, Gewalt von Befugnis richtiger unterscheiden gelernt, und diese Unterscheidungen so innigst mit der Sprache verbunden, dass nunmehr die Widerlegung des Hobbesschen Systems schon in dem gesunden Menschenverstande, und sozusagen in der Sprache zu liegen scheint. Dieses ist die Eigenschaft aller sittlichen Wahrheiten. Sobald sie ins Licht gesetzt sind, vereinigen sie sich so sehr mit der Sprache des Umgangs und verbinden sich mit den alltäglichen Begriffen der Menschen, dass sie dem gemeinen Menschenverstande einleuchten, und nunmehr wundern wir uns, wie man vormals auf einem so ebenen Wege habe straucheln können. Wir bedenken aber den Aufwand nicht, den es gekostet, diesen Steig durch die Wildnis so zu ebnen.
Hobbes selbst musste die unstatthaften Folgen auf mehr als eine Weise empfinden, zu welchen seine übertriebenen Sätze unmittelbar führen. Sind die Menschen von Natur an keine Pflicht gebunden, so liegt ihnen auch nicht einmal die Pflicht ob, ihre Verträge zu halten. Findet im Stande der Natur keine andere Verbindlichkeit statt, als die sich auf Furcht und Ohnmacht gründet, so dauert die Gültigkeit der Verträge auch nur so lange, als sie von Furcht und Ohnmacht unterstützt wird; so haben die Menschen durch Verträge keinen Schritt näher zu ihrer Sicherheit getan, und befinden sich noch immer in ihrem primitiven Zustand des allgemeinen Krieges. Sollten aber Verträge gültig sein, so muss der Mensch von Natur, ohne Vertrag und Verabredung, an und für sich selbst nicht befugt sein, wider ein Paktum zu handeln, das er gutwillig eingegangen; das heißt, es muss ihm nicht erlaubt sein, wenn er auch kann: er muss das sittliche Vermögen nicht haben, wenn er auch das physische dazu hätte. Macht und Recht sind also verschiedene Dinge und waren auch im Stande der Natur heterogene Begriffe. – Ferner, der höchsten Gewalt im Staate schreibt Hobbes strenge Gesetze vor, nichts zu befehlen, das der Wohlfahrt ihrer Untertanen zuwider sei. Wenn sie auch keinem Menschen Rechenschaft zu geben schuldig seien, so haben sie diese doch vor dem allerhöchsten Richter abzulegen; wenn sie auch nach seinen Grundsätzen keine Furcht vor irgendeiner menschlichen Macht binde, so binde sie doch die Furcht vor der Allmacht, die ihren Willen hierüber hinlänglich zu erkennen gegeben. Hobbes ist hierüber sehr ausführlich, und hat im Grunde weit weniger Nachsicht für die Götter der Erde, als man seinem System zutrauen sollte. Allein eben diese Furcht vor der Allmacht, welche die Könige und Fürsten an gewisse Pflichten gegen ihre Untertanen binden soll, kann doch auch im Stande der Natur für jeden einzelnen Menschen eine Quelle der Obliegenheiten werden, und so hätten wir abermals ein solennes Recht der Natur, das Hobbes doch nicht zugeben will. – Auf solche Weise kann sich in unseren Tagen jeder Schüler des Naturrechts einen Triumph über Thomas Hobbes erwerben, den er im Grunde doch ihm zu verdanken hat.
Locke, der in denselben verwirrungsvollen Zeitläuften lebte, suchte die Gewissensfreiheit auf eine andere Weise zu schirmen. In seinen Briefen über die Toleranz legt er die Definition zugrunde: Ein Staat sei eine Gesellschaft von Menschen, die sich vereinigen, um ihre zeitliche Wohlfahrt gemeinschaftlich zu befördern.
Hieraus folgt dann ganz natürlich, dass der Staat sich um die Gesinnungen der Bürger, ihre Glückseligkeit betreffend, gar nicht zu bekümmern, sondern jeden zu dulden habe, der sich bürgerlich gut aufführt. Das heißt, der seinen Mitbürgern in Absicht ihrer zeitlichen Glückseligkeit nicht hinderlich ist. Der Staat, als Staat, hat auf keine Verschiedenheit der Religionen zu sehen. Denn Religion hat an und für sich auf das Zeitliche keinen notwendigen Einfluss und steht bloß durch die Willkür der Menschen mit demselben in Verbindung.
Ließe sich der Zwist durch eine Worterklärung entscheiden, so wüsste ich keine bequemere. Und wenn sich die unruhigen Köpfe seiner Zeit hiermit hätten die Intoleranz ausreden lassen, so würde der gute Locke nicht nötig gehabt haben, sooft ins Elend zu wandern.
Allein was hindert uns, fragen jene, dass wir nicht auch unsere ewige Wohlfahrt gemeinschaftlich zu befördern suchen sollten? Und in der Tat, was für Grund haben wir, die Absicht der Gesellschaft bloß auf das Zeitliche einzuschränken? Wenn die Menschen ihre ewige Seligkeit durch öffentliche Vorkehrungen befördern können, so ist es ja ihre natürliche Pflicht, es zu tun, ihre vernunftmäßige Schuldigkeit, dass sie sich auch in dieser Absicht zusammentun und in gesellschaftliche Verbindung treten.
Ist es aber so und der Staat als Staat will sich bloß mit dem Zeitlichen abgeben, so entsteht die Frage: Wem sollen wir die Sorge für das Ewige antrauen? Der Kirche? Nun sind wir auf einmal wieder da, wo wir ausgegangen waren. Staat und Kirche. Sorge fürs Zeitliche und Sorge fürs Ewige – bürgerliche und kirchliche Autorität.
Jene verhält sich zu dieser, wie die Wichtigkeit des Zeitlichen zur Wichtigkeit des Ewigen. Der Staat ist also der Religion untergeordnet. Er muss weichen, wenn eine Kollision entsteht. Nun widerstehe, wer da kann, dem Kardinal Bellarmin mit dem fürchterlichen Gefolge seiner Argumente: dass das Oberhaupt der Kirche, zum Behuf des Ewigen, über alles Zeitliche zu befehlen und also, wenigstens indirekt[1] ein Hoheitsrecht habe über alle Güter und Gemüter der Welt. Dass alle weltlichen Reiche indirekt unter der Botmäßigkeit des geistlichen Einzelherren stünden und von ihm Befehle annehmen müssten, wenn sie ihre Regierungsform verändern, ihre Könige absetzen und andere an ihrer Stelle einsetzen müssten. Weil sehr oft das ewige Heil des Staats auf keine andere Weise erhalten werden könne – und wie die Maximen seines Ordens alle heißen, die Bellarmin in seinem Werke »De Romano Pontifice« mit so vielem Scharfsinn festsetzt.
Alles, was man den Trugschlüssen des Kardinals in sehr weitläufigen Werken entgegengesetzt hat, scheint nicht zu treffen, sobald der Staat die Sorge für die Ewigkeit aus den Händen gibt.
Von einer anderen Seite ist es im genauesten Verstand weder der Wahrheit gemäß noch dem Besten der Menschen zuträglich, dass man das Zeitliche von dem Ewigen so scharf abschneide. Dem Menschen wird im Grunde nie eine Ewigkeit zuteil werden: Sein Ewiges ist bloß ein unaufhörliches Zeitliches. Sein Zeitliches nimmt nie ein Ende, ist also ein wesentlicher Teil seiner Fortdauer und mit derselben aus einem Stück. Man verwirrt die Begriffe, wenn man seine zeitliche Wohlfahrt der ewigen Glückseligkeit entgegensetzt. Und diese Verwirrung der Begriffe bleibt nicht ohne praktische Folgen. Sie verrückt den Wirkungskreis der menschlichen Fähigkeiten und spannt seine Kräfte über das Ziel hinaus, das ihm von der Vorsehung mit so vieler Weisheit gesetzt worden. »Auf dem dunklen Pfade« – man erlaube, dass ich meine eigenen Worte hier anführe – »auf dem dunklen Pfade, den der Mensch hier zu wandeln hat, ist ihm gerade so viel Licht beschieden, als zu den nächsten Schritten, die er zu tun hat, nötig ist. Ein Mehreres würde ihn nur blenden, und jedes Seitenlicht nur verwirren.«
Es ist in diesem Sinne nötig, dass der Mensch unaufhörlich erinnert werde, mit diesem Leben sei nicht alles aus für ihn. Es stehe ihm eine endlose Zukunft bevor, zu welcher sein Leben hienieden eine Vorbereitung sei, so wie in der ganzen Schöpfung jedes Gegenwärtige eine Vorbereitung aufs Künftige ist. Dieses Leben, sagen die Rabbinen, ist ein Vorgemach, in welchem man sich so anschicken muss, wie man im inneren Zimmer erscheinen will.
Aber nun hütet euch auch, dieses Leben mit der Zukunft weiter in Gegensatz zu bringen und die Menschen auf die Gedanken zu führen: ihre wahre Wohlfahrt in diesem Leben sei nicht einerlei mit ihrer ewigen Glückseligkeit in der Zukunft. Ein anderes wäre es, für ihr zeitliches, ein anderes, für ihr ewiges Wohl sorgen, und es sei möglich, eines zu erhalten und das andere zu vernachlässigen. Dem Blödsichtigen, der auf schmalem Steige wandeln soll, werden durch dergleichen Vorspiegelungen Standpunkt und Gesichtskreis verrückt, und er ist in Gefahr, schwindlig zu werden und auf ebenem Wege zu stolpern. So mancher getraut sich nicht, die gegenwärtigen Wohltaten der Vorsehung zu genießen, aus Besorgnis, ebensoviel von denselben dort zu verlieren. Und mancher ist ein schlechter Bürger auf Erden geworden, in Hoffnung, dadurch ein desto besserer im Himmel zu werden.
Ich habe mir die Begriffe von Staat und Religion, von ihren Grenzen und wechselweisem Einfluss aufeinander sowie auf die Glückseligkeit des bürgerlichen Lebens durch folgende Betrachtungen deutlich zu machen gesucht.
Sobald der Mensch zur Erkenntnis kommt, dass er außerhalb der Gesellschaft so wenig die Pflichten gegen sich selbst und gegen den Urheber seines Daseins als die Pflichten gegen seinen Nächsten erfüllen und also ohne Gefühl seines Elends nicht länger in seinem einsamen Zustand bleiben kann, so ist er gebunden, diesen Zustand zu verlassen. Er muss mit seinesgleichen in Gesellschaft treten, um durch gegenseitige Hilfe ihre Bedürfnisse zu befriedigen und durch gemeinsame Vorkehrungen ihr gemeinsames Beste zu befördern.
Ihr gemeinsames Beste aber begreift das Gegenwärtige sowohl als das Zukünftige, das Geistliche sowohl als das Irdische in sich. Eins ist von dem anderen unzertrennlich. Ohne Erfüllung unserer Obliegenheiten ist für uns weder hier noch da, weder auf Erden noch im Himmel ein Glück zu erwarten. Nun gehört zur wahren Erfüllung unserer Pflichten zweierlei: Handlung und Gesinnung. Durch die Handlung geschieht das, was die Pflicht erfordert. Die Gesinnung macht, dass es aus der wahren Quelle komme, also aus echten Bewegungsgründen geschehe.
Demnach gehören Handlungen und Gesinnungen zur Vollkommenheit des Menschen und die Gesellschaft hat, soviel als möglich, durch gemeinschaftliche Bemühungen dafür zu sorgen, die Handlungen der Mitglieder zum gemeinschaftlichen Besten zu lenken und Gesinnungen zu veranlassen, die zu diesen Handlungen führen.
Jenes ist die Regierung, dieses die Erziehung des geselligen Menschen.
Zu beiden wird der Mensch durch Gründe geleitet, und zwar zu den Handlungen durch Bewegungsgründe und zu den Gesinnungen durch Wahrheitsgründe. Die Gesellschaft hat also beide durch öffentliche Anstalten so einzurichten, dass sie zum allgemeinen Besten übereinstimmen.
Die Gründe, welche den Menschen zu vernünftigen Handlungen und Gesinnungen leiten, beruhen zum Teil auf Verhältnissen der Menschen gegeneinander, zum Teil auf Verhältnissen der Menschen gegen ihren Urheber und Erhalter. Jene gehören für den Staat, diese für die Religion. Insoweit die Handlungen und Gesinnungen der Menschen durch Gründe, die aus ihren Verhältnissen gegeneinander fließen, gemeinnützig gemacht werden können, sind sie ein Gegenstand der bürgerlichen Verfassung. Insoweit aber die Verhältnisse der Menschen gegen Gott als Quelle derselben angenommen werden, gehören sie für die Kirche, Synagoge oder Moschee.
Man liest in so manchen Lehrbüchern des sogenannten Kirchenrechts ernsthafte Untersuchungen: ob auch Juden, Ketzer und Irrgläubige eine Kirche haben können. Nach den unermesslichen Vorrechten, die die sogenannte Kirche sich anzumaßen pflegt, ist die Frage so ungereimt nicht, als sie einem unbefangenen Leser scheinen muss. Mir kommt es aber, wie leicht zu erachten, auf diesen Unterschied der Benennung nicht an. Öffentliche Anstalten zur Bildung des Menschen, die sich auf Verhältnisse des Menschen zu Gott beziehen, nenne ich Kirche – zum Menschen, Staat. Unter Bildung des Menschen verstehe ich die Bemühung, beides, Gesinnungen und Handlungen, so einzurichten, dass sie zur Glückseligkeit übereinstimmen: die Menschen erziehen und regieren.
Heil dem Staat, dem es gelingt, das Volk durch die Erziehung selbst zu regieren! Das heißt, ihm solche Sitten und Gesinnungen einzuflößen, die von selbst zu gemeinnützigen Handlungen führen und nicht immer durch den Sporn der Gesetze angetrieben zu werden brauchen.
Der Mensch im gesellschaftlichen Leben muss auf manches von seinen Rechten zum allgemeinen Besten verzichten, oder wie man es nennen kann, sehr oft seinen eigenen Nutzen dem Wohlwollen opfern. Nun ist er glücklich, wenn diese Aufopferung aus eigenem Trieb geschieht und er jedes Mal wahrnimmt, dass sie bloß zum Behuf des Wohlwollens von ihm geschehen sei. Wohlwollen macht im Grunde glücklicher als Eigennutz. Aber wir müssen uns selbst und die Äußerung unserer Kräfte dabei empfinden. Nicht, wie einige Sophisten es auslegen, weil alles am Menschen Eigenliebe ist, sondern weil Wohlwollen kein Wohlwollen mehr ist, weder Wert noch Verdienst mit sich führt, wenn es nicht aus freiem Trieb des Wohlwollenden fließt.