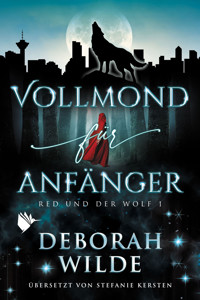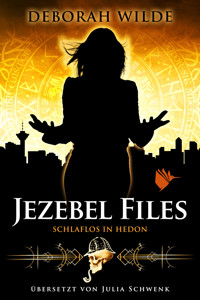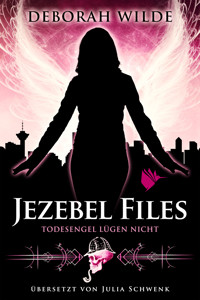
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Second Chances Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Jezebel Files
- Sprache: Deutsch
Endlich geht es für Ash beruflich voran: Sie bekommt den Auftrag, einen Mord aufzuklären – und der wurde angeblich von einem waschechten Todesengel begangen! Dass sie bei den Ermittlungen indirekt für die Herzkönigin arbeiten muss und damit ihrem besten Feind Levi Montefiore in die Quere kommt, macht die Angelegenheit nicht unbedingt leichter. Und dann wäre da die Sache mit ihren Jezebel-Kräften, die sie noch nicht so richtig im Griff hat. Als Ash bei ihren Ermittlungen auf ein magisches Artefakt stößt, überschlagen sich die Ereignisse. Steckt die Schattenorganisation, die Teenagern ihre Magie entzieht, um sie an den Meistbietenden zu verkaufen, hinter dem Attentat? Mit jeder Information, die Ash ermittelt, scheint der Fall komplexer zu werden. Schon bald muss sie sich fragen, wem sie eigentlich vertrauen kann. Und plötzlich steht nicht mehr nur ihre berufliche Zukunft auf dem Spiel, sondern auch ihr Leben …
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 512
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
DEBORAH WILDE
TODESENGEL LÜGEN NICHT
JEZEBEL FILES 2
Aus dem Englischen von Julia Schwenk
Über das Buch
Endlich geht es für Ash beruflich voran: Sie bekommt den Auftrag, einen Mord aufzuklären – und der wurde angeblich von einem waschechten Todesengel begangen! Dass sie bei den Ermittlungen indirekt für die Herzkönigin arbeiten muss und damit ihrem besten Feind Levi Montefiore in die Quere kommt, macht die Angelegenheit nicht unbedingt leichter. Und dann wäre da die Sache mit ihren Jezebel-Kräften, die sie noch nicht so richtig im Griff hat.
Als Ash bei ihren Ermittlungen auf ein magisches Artefakt stößt, überschlagen sich die Ereignisse. Steckt die Schattenorganisation, die Teenagern ihre Magie entzieht, um sie an den Meistbietenden zu verkaufen, hinter dem Attentat?
Mit jeder Information, die Ash ermittelt, scheint der Fall komplexer zu werden. Schon bald muss sie sich fragen, wem sie eigentlich vertrauen kann. Und plötzlich steht nicht mehr nur ihre berufliche Zukunft auf dem Spiel, sondern auch ihr Leben …
Über die Autorin
Deborah Wilde ist Weltenbummlerin, ehemalige Drehbuchautorin und Zynikerin durch und durch. Sie schreibt mit Vorliebe witzige Romane für Frauen in den Genres Urban Fantasy und Paranormal Romance.
In ihren Geschichten geht es um selbstbewusste, toughe Frauen, starke weibliche Freundschaften und Romantik mit einer Prise Charme und Feuer. Sie mag Happy Ends, und es ist ihr wichtig, dass auch der Weg dorthin ihre Leser:innen zum Lachen bringt.
Die englische Ausgabe erschien 2020 unter dem Titel »Death & Desire« bei Te Da Media Inc.
Deutsche Erstausgabe Juli 2022
© der Originalausgabe 2020: Deborah Wilde
© für die deutschsprachige Ausgabe 2022:
Second Chances Verlag, Inh. Jeannette Bauroth,
Eisenbahnweg 5, 98587 Steinbach-Hallenberg
Alle Rechte, einschließlich des Rechts zur vollständigen oder auszugsweisen Wiedergabe in jeglicher Form, sind vorbehalten.
Alle handelnden Personen sind frei erfunden, Ähnlichkeiten mit lebenden oder verstorbenen Personen sind rein zufällig.
Umschlaggestaltung: Frauke Spanuth, Croco Designs,
unter Verwendung von Motiven von xtern, yurkaimmortal, pixel, Maksim Shmeljov, faestock, robin_ph
Lektorat: Stephanie Langer
Korrektorat: Julia Funcke
Satz & Layout: Second Chances Verlag
ISBN: 978-3-948457-34-1
www.second-chances-verlag.de
Inhaltsverzeichnis
Titel
Über die Autorin
Impressum
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Weitere Bücher von Deborah Wilde
Danksagung
KAPITEL 1
Ich hätte nie gedacht, dass Ein Engel auf Erden mal so falsch abbiegen könnte.
»Groß, weiße Robe, weiße Flügel. Umgeben von himmlischem Licht? Haben Sie einen Heiligenschein gesehen?« Manchmal war es schon sehr befremdlich, was für Fragen ich auf der Suche nach der Wahrheit stellen musste.
»Es ist ein Todesengel. Der tötet Menschen.« Husani Tannous, Ende zwanzig, Ägypter, rückte seine Baseballkappe zurecht, um seine beginnenden Geheimratsecken zu verstecken. »Die bekommen keinen Heiligenschein.«
Absolut stichhaltige Logik von einem Mann, der seine fragile Männlichkeit mit der halb automatischen Waffe zu seinen Füßen kompensierte. Passte zusammen wie guter Wein und Käse. Oder Benzin und ein Streichholz.
Dieses Wohnzimmer hätte sich genauso gut auf einem Schlachtfeld befinden können, fehlte nur noch der schlammige Schützengraben. Im oberen Stockwerk lag sogar eine Leiche, und wenn die Feindseligkeiten hier unten eskalierten, würde es noch weitere Opfer zu beklagen geben. Nervosität und Vorfreude verursachten mir ein Kribbeln im Magen.
»Das war nicht sarkastisch gemeint«, erwiderte ich und legte die Fingerspitzen aneinander, während ich mich in dem reich bestickten Sessel zurücklehnte. »Aber ich brauche alle Fakten.«
»Fakt ist, dass er meinen Bruder umgebracht hat!« Er schüttelte die Faust. »Und ich werde ihn rächen!«
Seine Cousine Chione strich gemächlich mit einem Finger über die Pistole auf ihrem Schoß und leckte dabei genüsslich die Butter von ihrem Toast. Ihre Multitasking-Fähigkeiten faszinierten mich ungemein.
»Große Worte, Husani. Und wie willst du diesen Engel finden? Fliegst du ihm nach in den Himmel?«, erkundigte sich Chione mit deutlich hörbarem arabischen Akzent.
»Mach dich nicht lächerlich. Es gibt keine Flugmagie.« Rachel Dershowitz, Anfang fünfzig und die Mutter der Braut Shannon, hatte in dem Gin Tonic, den sie sich hinter die Binde kippte, das passende Getränk zu ihrer verbitterten Lebenseinstellung gefunden. Der protzige Klunker an ihrem Ringfinger hatte weniger Facetten als der verächtliche Blick, den sie Chione zuwarf.
Chiones Finger an der Waffe zuckten, was mich dazu veranlasste, zwischen die beiden Frauen zu treten. »Hatte Omar Feinde? Gibt es einen Grund, warum ihn jemand hätte töten wollen?«
»Omar ist ein guter Junge. Keine Feinde. Das ist ein Hassverbrechen. Diese Hundesöhne haben schon früher unsere Erstgeborenen abgeschlachtet, und sie tun es jetzt wieder!« Vielen Dank an Masika Tannous, die Großmutter und Matriarchin des aus Kairo angereisten Clans. Die kleine alte Dame wirkte so normal, wie sie da an einem Pullover strickte. Doch die Art, wie sie mit ihren Nadeln in der Luft herumfuchtelte, war für mich tatsächlich furchteinflößender als die Uzi zweifelhafter Herkunft, die seitlich an ihrem Sessel lehnte.
Masika, Husani und Chione waren als Vertreter einer Söldnerfamilie besser ausgerüstet als das kanadische Militär, aber wie ich schon immer gesagt hatte: Weltige brauchten keine Magie, um gefährlich zu sein.
Gegen die physischen Waffen der Tannous traten Schlangen aus Lichtmagie an, die sich über dem Tisch in der Luft wanden, bereit, sich auf ein Ziel zu stürzen und es zu zerquetschen.
Am liebsten hätte ich allen Anwesenden ein bisschen Vernunft eingeprügelt, aber mein Job war auch so schon schwierig genug. Außerdem musste ich meine Badass-Fassade aufrechterhalten, damit die beiden Familien nicht aufeinander losgingen.
»Ihr habt den Tod in mein Haus gebracht. Juden sollten sich nicht mit Ägyptern einlassen«, meldete sich Ivan Dershowitz zu Wort. Das korpulente Familienoberhaupt, in dessen Haus wir uns gerade befanden, saß neben seiner Frau und seiner Tochter in einem Sessel mit hoher Rückenlehne und dünnen Beinchen, die unter seinem Gewicht ächzten. Seine Lichtmagie zuckte wie eine Kobra.
Beide Familien warfen sich eine Weile rassistische Beleidigungen an den Kopf, offenbar der diesjährige letzte Schrei bei Hochzeitsvorbereitungen.
Die zierliche Shannon gab einen hysterischen Aufschrei von sich, der vermutlich ihre Kalorienaufnahme von einer Woche verbrauchte. Allerdings war sie auch die Einzige, die sich meiner Meinung nach angemessen verhielt angesichts der Tatsache, dass ihr Verlobter ermordet worden war. Die göttlichen Mächte schienen mir zuzustimmen, denn in diesem Moment brach ein Sonnenstrahl durch die Wolken des grauen Märztags und fiel wie ein himmlischer Segen direkt auf sie.
Was soll ich sagen? Wenn ich recht hatte, hatte ich eben recht.
Ich stieß einen scharfen Pfiff aus. »Angenommen, es ginge hier um die Geschichte von Pessach: Der Todesengel Malach hat alle erstgeborenen Söhne getötet, um die Juden aus der Sklaverei zu befreien. Ja, diese Woche ist Pessach, aber bislang haben wir nur einen Toten zu beklagen – ich behalte das im Auge, falls sich daran etwas ändert.« Ich wandte mich an Masika. »Der Verlust Ihres Enkels Omar tut mir sehr leid, aber ein Mord ist nicht das Gleiche wie eine Massenabschlachtung. Außerdem sitzen die Juden hier in ihrem eigenen Heim.« Sie gehörten zwar nicht gerade zur gesellschaftlichen Elite, doch von Sklaverei konnte trotzdem nicht die Rede sein. »Wir müssen also für alle Möglichkeiten offen bleiben. Vielleicht war es wirklich ein Todesengel, oder aber jemand nutzt eine gute Geschichte und Jahrhunderte des Aberglaubens und des Hasses, um seine wahren Motive zu verschleiern.«
Da legte man einen klaren, nüchternen Fakt auf den Tisch, und schon zuckten alle Finger zum Abzug, und man fand Lichtschlangen und Stricknadeln auf sich gerichtet. Meine Anweisung, sich wieder zu beruhigen, wurde ignoriert. Fantastisch.
In diesem Moment räusperte sich der Mann, der bislang stumm in der Mitte des Raums gestanden hatte, und von einer Sekunde auf die andere zogen sich die Streithähne zornig grummelnd in ihre Ecken zurück.
Er war Mitte vierzig, hatte weiße Haare und trug einen weißen Anzug, der direkt aus den 1970er-Jahren hätte stammen können. Seine Kleidungswahl und die Tatsache, dass er die rechte Hand der Herzkönigin war, hatten ihm bei mir den Spitznamen Karnickel-Mann eingebracht. Eines Tages würde ich ihn auch laut so nennen.
Bei seinem Aufzug hätte man meinen sollen, dass ihm niemand nennenswert Respekt entgegenbrachte, doch das riesige Schwert in seiner Hand ließ die Sache gleich anders aussehen. Echt beeindruckend. Wenn ich damit ein paar Dutzend Leute enthauptete, würde ich die gleiche Reaktion bekommen.
»Könnte jemand mit mir nach oben gehen, damit ich mir den Tatort anschauen kann?«, erkundigte ich mich unter Aufbietung meiner letzten Geduldsreserven. Mein Blick fiel auf das Herzstück des protzigen Wohnzimmers: ein massiver Kronleuchter in Form eines Vogels mit ausgebreiteten Flügeln, der über den Köpfen der Anwesenden schwebte und alles aus verschlagenen Äuglein beobachtete. Selbst die Einrichtung wollte den Raum verlassen.
»Mr Dershowitz«, forderte ich ihn auf.
»Rebbe«, korrigierte er mich.
Ach ja, richtig. Ivan hatte diesen Spitznamen allerdings nicht aufgrund seiner religiösen Bestrebungen erworben, sondern weil er, während er seine Gefängnisstrafe für tätlichen Angriff und Körperverletzung verbüßte, einen anderen Insassen mit einer Ausgabe des Alten Testaments ins Koma geprügelt hatte. War das nicht ein Halleluja wert?
Ich biss die Zähne zusammen. »Rebbe …«
Er ignorierte mich jedoch und schickte seine Lichtmagie zu Boden, wo sie sich im Kreis durch das Zimmer schlängelte. Ich musste dem Impuls widerstehen, die Beine auf den Stuhl zu ziehen. »Diese Heirat war ein Fehler«, sagte Dershowitz.
Nein, der wahre Fehler war es gewesen, auch nur einen Fuß in diesen Misthaufen zu setzen. Andererseits hatte mir die entsprechende »Bitte« auch kaum eine Wahl gelassen.
»Wir können uns hier noch stundenlang über die Existenz von Engeln streiten«, mischte sich der Karnickel-Mann ein, »oder Sie erlauben Ashira, der Privatdetektivin, für die die Herzkönigin persönlich bürgt, sich Omars Zimmer anzusehen. So kann sie herausfinden, was tatsächlich passiert ist.«
Nach ein paar Minuten gegenseitiger Beleidigung der jeweils mütterlichen Familienlinie, gepaart mit äußerst kreativen anatomischen Besonderheiten, die ich sicher nie googeln würde, klingelte Rachel nach einem Hausmädchen. Husani und die Angestellte eskortierten den Karnickel-Mann und mich durch das herrschaftliche Anwesen. Wir gingen einen langen Flur hinunter, der von Bücherregalen gesäumt war, in denen sich kein einziges Buch befand, dafür aber eine umfangreiche und verstörende Sammlung von Vogelfigürchen.
Vögel! Sie sind genau wie wir. Sie bauen Nester, pfeifen und reiben ihre Genitalien lüstern an Grasbüscheln.
»Wäre es zu viel verlangt gewesen, mich einfach zu köpfen?«, raunte ich dem Karnickel-Mann zu.
Ein kaum wahrnehmbares Schmunzeln war der einzige Hinweis darauf, dass er meine Bemerkung amüsant fand, ansonsten blieb sein Gesicht ausdruckslos.
»Ab jetzt kommen wir alleine klar«, meinte ich an Husani und das Hausmädchen gewandt, als wir die Treppe zum oberen Stockwerk erreichten.
Meine Eskorte rührte sich nicht vom Fleck.
»Die Königin bedankt sich für Ihre Hilfe. Ich werde sie gerne wissen lassen, wie nett Sie mir erlaubt haben, den Job zu machen, für den sie mich so großzügig empfohlen hat.« Immer noch nichts.
»Wir geben Ihnen Bescheid, wenn wir Ihre Unterstützung benötigen«, erklärte der Karnickel-Mann.
Natürlich setzten die beiden sich daraufhin sofort in Bewegung.
Ich stapfte die Treppe hinauf und blieb dann im Türrahmen des Gästezimmers stehen, um den ersten Eindruck auf mich wirken zu lassen.
Während meiner Studienzeit hatte ich einen Sommer lang im Büro der Gerichtsmedizin gearbeitet, was hauptsächlich aus Aktenablage und Dateneingabe bestanden hatte. Währenddessen hatte ich jedoch auch die Möglichkeit gehabt, die Ärzte ins Leichenschauhaus zu begleiten. Dort hatte ich meinen ersten Toten zu Gesicht bekommen.
Diesen Menschen so kalt auf dem Tisch liegen zu sehen und mir bewusst zu machen, dass er für immer fort war, hatte mich schwer getroffen. Die Gerichtsmedizinerin hatte mir die tragische Hintergrundgeschichte des Verstorbenen erzählt und wie er unzählige Drogenüberdosen überlebt hatte, nur diese eine eben nicht.
Ich hatte so professionell wie meine Chefin sein wollen, hatte aber enorme Schwierigkeiten damit gehabt und sie deshalb gefragt, wie sie es schaffte, damit umzugehen. Ihre Antwort? Man müsse lernen, auf dem schmalen Grat zwischen Empathie und der Gefahr, mit hineingezogen zu werden, zu balancieren, weil die Toten darauf angewiesen seien, dass man schwimmen konnte und nicht ertrank.
Diesen Rat hatte ich mir zu Herzen genommen. Mit dem Tod hatte ich also kaum noch Probleme, der nackte, haarige Hintern, der mir direkt ins Auge stach, war allerdings schon etwas anderes. Dafür sollte ich eine Gefahrenzulage verlangen. Okay, die Pobacken waren ziemlich stramm, aber dafür waren sie wirklich großzügig dunkel bepelzt. Und natürlich musste ich mir prompt Shannon vorstellen, wie sie beim Sex mit den Fingern durch die Haare strich und sich daran festhielt.
Die aufgedunsene Leiche lag von der Tür abgewandt auf der Seite. Omars Haut war übersät mit violetten und schwarzen Flecken, und er trug nichts als ein weißes Unterhemd und eine ebenfalls weiße Anzugsocke. Die andere Socke lag neben seinem Ellenbogen. Angesichts des Zustands des Leichnams ging meine Vermutung in Richtung Ertrinken, auch wenn nirgendwo ein Tropfen Wasser zu sehen war.
Rasch lief ich an der Wand entlang zum angrenzenden Badezimmer und warf einen Blick hinein. Keine Badewanne. Omar hätte sicher auch in der Dusche ertränkt werden können, indem man den Abfluss verstopfte oder blockierte, um ihn dann anschließend zurück ins Schlafzimmer zu schleppen. Doch die Dusche und der Vorleger waren trocken, und auch der Abfluss lieferte keinen entsprechenden Hinweis.
Strangulation? Es gab keine offensichtlichen Würgemale. Splitter des zerborstenen Oberlichts in der Decke glitzerten auf Omars Haut und dem Teppich mit seinem psychedelischen Rankenmuster in Weiß und Gold. Wenn sich dort irgendwo Vögel versteckten, wollte ich es nicht wissen.
Ich ließ meinen Gedanken freien Lauf, wog verschiedene Theorien gegeneinander ab und berührte dabei den Fensterrahmen mit einer Fingerspitze.
»Keine Schutzzauber«, meinte ich. »Wie dumm muss man denn sein, um so einen Glaspalast nicht entsprechend zu schützen? Insbesondere, wenn man bedenkt, mit welcher Klientel diese Leute verkehren.«
Schutzzauber nahmen feindselige Absichten wahr und hielten potenzielle Angreifer an Ort und Stelle fest. Manche konnten bei Bedarf auch magische Fähigkeiten neutralisieren.
Ich klopfte mir die Hand an meiner schwarzen Jeans ab. »Wenn sie dabei schon so nachlässig sind, fürchte ich ernsthaft um das Weiterbestehen der kriminellen Unterwelt.«
»Äußer dich doch mal laut über die mangelnde Intelligenz des Rebbe«, erwiderte der Karnickel-Mann. »Wenn er es hören kann.«
»Ich verzichte dankend. Ganz sicher werde ich an keinerlei Aktivitäten partizipieren, die dir auch nur im Entferntesten Freude bereiten, weil diese sich mit absoluter Sicherheit nachteilig auf meine Gesundheit auswirken.«
Der Karnickel-Mann zuckte die Schultern. »Trotzdem musst du dich mit ihm auseinandersetzen.«
»Falls ich diesen absurden Fall annehme.«
»Das wirst du. Es juckt dir doch schon in den gierigen kleinen Fingern.«
Ich schnaubte missmutig. Ja, Mord war ein großer – und aufregender – Schritt nach vorn im Vergleich zu den Fällen, die ich seit der Gründung meiner eigenen Detektei bearbeitete, aber diese Nummer hier schien mir ein paar moralische Komplikationen zu viel mit sich zu bringen.
In diesem Moment vibrierte mein Handy in meiner hinteren Hosentasche. Ich griff danach.
Seine Selbstherrlichkeit: Komm sofort ins HQ.
Ich: Beschäftigt.
»Hier geht es um Mord«, entgegnete ich. »Wie wollt ihr die Cops da raushalten? Sowohl Nefesh als auch Weltige.«
»Das ist dein Problem.« Der Karnickel-Mann hielt den Blick weiterhin auf die Treppe gerichtet, um sicherzustellen, dass wir nicht gestört wurden. »Beide Familien haben darauf bestanden.«
Welch Überraschung. Die magisch begabten Kriminellen und die unmagischen Söldner wollten keine Scherereien. Ich machte ein paar Fotos vom Raum und hob mir die genaue Untersuchung der Leiche bis zum Schluss auf. Für Überwachungsjobs brauchte ich eine bessere Kamera, aber bei schneller und einfacher Dokumentation wie hier tat es mein Handy auch.
Eine weitere Nachricht.
Seine Selbstherrlichkeit: Das hier ist wichtiger.
Ich: Meine Fälle > deine Alltagsprobleme.
Nichts in dem luxuriös ausgestatteten Zimmer wies auf einen Kampf hin. Omars Kleidung lag sauber gebügelt auf der weichen Matratze, und außer dem kaputten Oberlicht war alles noch intakt. Sowohl die Möbel als auch das gruselige Ölgemälde von – dreimal darf man raten – Vögeln, die aussahen, als hätten Edgar Allan Poe und Andy Warhol zusammen eine Runde LSD genommen, schienen nicht verrückt worden zu sein.
Seine Selbstherrlichkeit: Ich bin davon ausgegangen, dass dich die Identifizierung der verstorbenen Jezebel interessiert. Aber deine Fälle > …
Ich: Moment mal. Was?!
Stille.
Ich: Levi!
Seine Selbstherrlichkeit: Wir unterhalten uns darüber, wenn du weniger beschäftigt bist.
Ich: Du Mistkäfer.
Seine Selbstherrlichkeit: In dir schlummert die Seele einer Dichterin.
Der Karnickel-Mann zog eine Augenbraue nach oben. »Ich hoffe, das hier verpasst deinem Privatleben keinen allzu großen Dämpfer? Schmiedest du vielleicht gerade Pläne mit deiner entzückenden Mitbewohnerin Priya?«
»Jaja. Du kannst dich an mir rächen, wenn ich auch nur einen falschen Schritt mache.« Mein schnippischer Tonfall überspielte den harten Knoten in meinem Magen. Allein der Gedanke, dass er meiner besten Freundin etwas antun könnte … »Erspar mir die Standardansprache aller Bösewichte.«
»Aber ich musste sie extra auswendig lernen, sonst hätte ich mein Zertifikat nicht gekriegt.«
»Sehr witzig. Ich prophezeie dir eine große Comedy-Karriere. Um auf unseren Fall zurückzukommen: Was ist mit der Tatsache, dass ich offiziell immer noch als Weltige registriert bin?«
»Da das Opfer ein Weltiger ist, wirst du von der Tannous-Familie engagiert«, informierte er mich. »Sollte jemand einen genaueren Blick darauf werfen, wird es keine Hinweise auf widerrechtliches Handeln geben.«
»Irgendjemand wird Omar doch wohl vermissen. Wollt ihr allen erzählen, dass er auf eine einsame Insel im Südpazifik übergesiedelt ist, oder erwartet ihr, dass ich einen Totenschein ausstelle, in dem steht, dass er eines natürlichen Todes gestorben ist? Theoretisch kann ich diesen Fall übernehmen, aber ich werde sicher keine Urkunden fälschen.«
»Nicht nötig. Dein Job ist es nur, den Mörder zu finden und mir zu übergeben. So kompromittierst du deine Lizenz nicht, wenn du die Festnahme vornimmst.« Er breitete die Arme aus. »Deine berufliche Integrität hat für uns oberste Priorität.«
Ich wischte mir eine imaginäre Träne von der Wange. »Ich bin gerührt. Einfach den Mörder an dich übergeben, und schon müssen mich so lästige Dinge wie Recht und Gesetz oder Gerechtigkeit nicht mehr interessieren.«
»Oh, Gerechtigkeit wird es geben.« Der Karnickel-Mann schenkte mir ein kaltes Lächeln, das mir einen eisigen Schauder über den Rücken jagte. »Die Königin hat für deine Diskretion gebürgt. Sie hat den Familien versichert, dass du diesen Fall untersuchst, ohne dass die Polizei oder House Pacifica darauf aufmerksam werden. Und sie war sehr bestimmt bei ihren Anweisungen, dass du deine Magie während dieses Jobs unter allen Umständen im Verborgenen zu halten hast.«
Das war schon das zweite Mal in weniger als zwei Wochen, dass ich mit genau dieser Vorgabe angeheuert wurde. Erst von Levi Montefiore und nun von der Herzkönigin, Herrscherin über Hedon. So langsam fühlte ich mich in meiner Rolle ein bisschen eingeengt.
»Also«, fuhr er fort, »bist du nun zufrieden, oder möchtest du noch weitere moralische Pseudozweifel an diesem Fall äußern?«
Das Interesse des Karnickel-Manns und der Herzkönigin an diesem Vorfall machte den Mörder jetzt schon zu einer lebenden Leiche. Omars trauernde Familie verdiente die Antworten, die es ihnen ermöglichen würden, dieses tragische Kapitel abzuschließen. Selbst wenn mich die Aussicht auf meinen ersten Mordfall nicht so entzückt hätte, wäre ich doch die einzige Privatermittlerin mit den nötigen Fähigkeiten dafür gewesen, der Sache auf den Grund zu gehen. Das war der Moment, in dem ich zugeben musste, dass es ganz praktisch war, für eine Weltige gehalten zu werden, tatsächlich aber eine Nefesh zu sein.
»Wenn ihr mich an Bord holt, damit ich den Fall bearbeite, will die Königin nicht zu sehr darin verwickelt werden. Sonst würde sie ihre eigenen Leute darauf ansetzen. Warum?« Ich machte ein Foto vom Bett.
»Der Angriff fand nicht in Hedon statt, und hier hat die Königin keine Befugnisse.«
Ich schoss noch weitere Bilder aus sorgfältig gewählten Blickwinkeln und zoomte einige Stellen heran, um nichts zu übersehen. »Durch mich kann sie sich einmischen, ohne dass es so wirkt, als würde sie sich einmischen.«
»Du bist die Einzige, die wir hier ins Spiel bringen können. Wenn du den Fall ablehnst, wird keine der beiden Familien zur Polizei gehen – aus offensichtlichen Gründen. Der Mord wird vermutlich nie aufgeklärt werden, und die Spannungen zwischen diesen Leuten im Erdgeschoss werden aller Wahrscheinlichkeit nach zu Blutvergießen und Racheakten führen und …«
»Ist ja schon gut. Ich nehme den Fall an.« Ich zog das oberste Bettlaken über Omars Kronjuwelen. Was auch immer ihm passiert war, der Mann verdiente ein wenig Würde im Tod. »Allerdings entscheidet Levi über den Status meiner Registrierung«, gab ich zu bedenken. »Er ist das Hausoberhaupt, und wenn er das Verfahren vorantreibt, kann jeder auf die Information zugreifen. Dagegen kann ich nicht viel tun.«
Abgesehen davon hatte ich nicht die geringste Lust, meine Fähigkeiten noch lange geheim zu halten. Vor mir lag eine Welt von Nefesh-Mysterien, die es zu erforschen galt.
Der Karnickel-Mann lächelte humorlos. »Ich bin mir sicher, dass du Mr Montefiore vom Gegenteil überzeugen kannst.«
Ich ignorierte seine Andeutung, doch mir fiel auf, wie angespannt seine Körperhaltung war und wie knapp seine Antworten. Er – oder besser gesagt: die Königin – wollte aus einem bestimmten Grund, dass ich mich um diesen Fall kümmerte, und es steckte mehr dahinter als das Offensichtliche. Normalerweise würde ich sofort auf dem Absatz kehrtmachen, wenn ich witterte, dass mich jemand für seine Zwecke benutzen wollte, aber ihr Wissen um meine Blutmagie hing über mir wie ein Damoklesschwert.
Ich warf der rasiermesserscharfen Klinge des Karnickel-Manns einen Seitenblick zu. Der Tod war möglicherweise nicht einmal das schlimmste Schicksal. Gravierender wäre ein Verrat, der einen gebrochen zurückließ und von dem man sich nie wieder richtig erholte. Solange die Königin mich erpressen oder gegen meinen Willen vor aller Welt outen konnte, war ich in diesem Spiel gefangen. Wissen war Macht, und zwar gefährliche. Insbesondere in den Händen Ihrer Hoheit. Doch jeder hütete Geheimnisse. Sie kannte meine, und ich würde ihre herausfinden.
In der Zwischenzeit hatte ich einen Mord aufzuklären. Ich ging neben der Leiche in die Knie.
Abgesehen davon, dass sein Gesicht im Tod zu einer gequälten Fratze verzerrt war, war Omar ein attraktiver Mann. Etwa in meinem Alter, also Ende zwanzig, seelenvolle braune Augen, dunkle, lockige Haare und aristokratische Züge – nur die aufgequollene Zunge, die aus seinem Mund hing, störte ein wenig.
»Was hat die Königin davon?«, erkundigte ich mich.
»Die Hochzeit hätte in Hedon stattfinden sollen.«
»Ist sie etwa unter die Kupplerinnen gegangen?« Eine nähere Untersuchung förderte keine Schuss- oder Stichwunden zutage.
»Sie ist immerhin die Herzkönigin.« Als der Karnickel-Mann nun doch das Schlafzimmer betrat, hatte sich sein Schwert magischerweise in Luft aufgelöst. Mit dem Fuß strich er die Ecke eines Läufers glatt, die nach oben umgeklappt war.
Ich schaute mir Omars Hände an. Die Haut war intakt, die Fingernägel nicht abgebrochen, was sicher der Fall gewesen wäre, wenn er sich verteidigt hätte. »Könnte das ein versteckter Angriff auf die Königin sein? Warum wurde er dann nicht in Hedon umgebracht?«
Der Karnickel-Mann lachte laut auf, verstummte aber, als er meine Verwirrung bemerkte. »Oh. Du meinst das ernst. Niemand wendet sich gegen das Gesetz der Schwarzen Herzen.«
»Wird das von den Wachleuten der Königin durchgesetzt?«
»Nein. Die Wachleute kümmern sich um Hedon als Ganzes, während die Königin selbst und alle unter ihrem Schutz unter das Gesetz der Schwarzen Herzen fallen. Jeder Angriff auf eine solche Person hätte schnelle und schreckliche Konsequenzen. Das ist eine effiziente Abschreckung. Diese Attacke galt zwar nicht Ihrer Hoheit direkt, aber sie wünscht den Erhalt der guten Beziehungen, die sie zu diesen Menschen aufgebaut hat. Wenn schon die Hochzeit nicht stattfinden kann, hat es für sie höchste Priorität, dass die arme Braut und die Familie des Bräutigams damit abschließen können.«
Ich fuhr mir in einer schneidenden Geste mit der Hand über den Hals. »So eine Art von Abschluss?«
Der Karnickel-Mann schaute mich nur ausdruckslos an.
»Glaubhafte Bestreitbarkeit, schon verstanden.« Ich suchte nach Blutflecken, fand aber keine. »Es wird euch allerdings extra kosten, wenn ich Levi davon abhalten soll, die Nefesh- oder Weltigen-Behörden zu alarmieren.«
»Die Polizei aus dem Ganzen herauszuhalten, ist Teil des Jobs, für den die Tannous-Familie dich angeheuert hat«, erwiderte er.
Es waren jedoch nicht sein ruhiger Tonfall und das vernünftige Argument, die mich zustimmend nicken ließen, sondern das Aufblitzen von Wut in seinem Blick, das er nicht ganz verbergen konnte.
»Einen Versuch war es wert«, murmelte ich und machte noch ein paar Fotos von der Leiche, aus unterschiedlichen Perspektiven.
Am Fuß der Treppe wollte Husani lautstark wissen, was wir gefunden hatten.
»Ah, die liebliche Stimme des streitlustigen Männchens«, kommentierte der Karnickel-Mann.
»Hoffentlich wirst du anständig dafür bezahlt«, entgegnete ich, während ich mein Handy in meine hintere Hosentasche schob.
»Es geht nicht immer nur um Geld, Ashira. Entschuldige mich bitte einen Moment, während ich mit Mr Tannous konferiere.«
»Tu das. Omar und ich hängen hier noch ein Weilchen zusammen ab.« Mit einer knappen Handbewegung scheuchte ich ihn hinaus.
Der Karnickel-Mann verließ den Raum und schloss die Tür hinter sich. Ich stellte mich an die gegenüberliegende Wand, um den Tatort aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten.
Die beiden Familien hatten zusammen hier übernachtet, um sich vor dem großen Tag besser kennenzulernen. Irgendwann gegen vier Uhr heute Morgen hatte das Bersten des Oberlichts das ganze Haus geweckt, und die Bewohner und Gäste waren mit Knarren und Magie im Anschlag zu Hilfe geeilt. Allerdings hatte der Engel, ganz dem Hollywoodklischee entsprechend in weißer Robe und mit weißen Flügeln, die Flucht ergriffen. Ich schüttelte den Kopf. Wenn wir es hier wirklich mit einem Todesengel zu tun hätten, hätte niemand dieses Aufeinandertreffen überlebt. Ganz abgesehen davon, dass Engel nicht existierten.
Macht war der größte Antrieb in unserer Gesellschaft. Die Weltigen wollten sie über die Nefesh erringen und die Nefesh übereinander. Wir lebten in einer Welt, in der Magie offen praktiziert wurde, und wenn es übernatürliche Wesen in untoter, gestaltwandelnder oder himmlisch beseelter Form gäbe, hätten diese wohl irgendwann in den letzten paar Jahrhunderten die Gelegenheit genutzt, sich zu zeigen. Immerhin könnten sie den Platz an der Spitze der Nahrungskette einnehmen. Da das jedoch nicht passiert war, ging ich ziemlich sicher davon aus, dass es sie schlicht nicht gab.
Aber ich war auch ein Profi. Sherlock Holmes verfolgte immer zahlreiche Theorien, näherte sich einem neuen Fall jedoch vollkommen unvoreingenommen. Aktuell hatte ich einen Raum voller Zeugen, die alle behaupteten, einen Todesengel gesehen zu haben. Deswegen würde ich diesem Hinweis akribisch folgen, bevor ich ihn ohne jeden Zweifel ausschließen konnte.
Ob ein Engel wohl auf ein in den Himmel projiziertes Flügel-Bild reagieren würde wie auf das Bat-Signal? Leise lachend betrachtete ich Omars Leiche erneut. »Okay, Kumpel, du musst mir irgendeinen Anhaltspunkt liefern.«
Da ich die meisten möglichen Todesursachen bereits verworfen hatte, war Gift die wahrscheinlichste. Vorsichtig drehte ich Omars Kopf zur Seite und untersuchte ihn auf eine Einstichstelle, die darauf hindeuten würde, dass ihm ein Toxin injiziert worden war, oder aber einen Eintrittspunkt, der für Magie spräche. Sein Hals fühlte sich steif und kalt an. Einen Puls spürte ich nicht, aber das hatte ich nun auch nicht erwartet.
Als ich seinen Kopf in die andere Richtung neigte, rutschte seine Zunge mit und enthüllte die weiße Spitze irgendeines Objekts in seinem Rachen.
»Was haben wir denn da?«, murmelte ich und schob meine Finger langsam zwischen seinen Ober- und Unterkiefer. Nur widerwillig gab das Gelenk nach. Das Ding in Omars Rachen war glitschig und der Winkel nicht ideal. Als ich daran zog, tat sich nichts. Es musste dem armen Kerl praktisch in die Kehle gerammt worden sein.
Plötzlich stieg mir der Geruch eines heißen Sandsturms in die Nase, gepaart mit einem Gefühl von trockenen Nächten und Angst. Ich holte das Objekt mit einem kräftigen Ruck heraus und hielt auf einmal eine weiße Feder in der Hand, gut zwanzig Zentimeter lang – echte Zentimeter, nicht männliches Wunschdenken.
Uralte Magie ließ mir die Nackenhaare zu Berge stehen. Nein, das konnte nicht sein. Diese Feder fühlte sich an, als würde sie schon seit Jahrtausenden existieren, als wäre sie älter als die Zeit selbst. Aber Magie, oder zumindest die Magie, die wir kannten, war gerade einmal knapp vierhundert Jahre alt. Sie war im siebzehnten Jahrhundert entfesselt worden.
Doch die Fakten ließen sich nicht leugnen. Die Feder war alt. Magie an sich nicht. Und so stand ich hier mit diesem flauschigen Paradoxon in der Hand, das außerdem blütenrein war, obwohl es eine ganze Weile in Omars Luftröhre gesteckt hatte.
Ich zwang mich, die hochgezogenen Schultern wieder sinken zu lassen, und legte die Feder auf den Boden, bevor ich mich erneut Omars Kopf zuwandte. Vielleicht war da noch mehr in seinem Mund.
In diesem Moment schlug er die Augen auf, und mein putziger kleiner Mordfall wurde auf einen Schlag deutlich komplizierter.
KAPITEL 2
Ich fuhr erschrocken zurück. »Verdammte Scheiße!«
Omars Blick bohrte sich in meinen, und das verzweifelte Flehen in seinen Augen war unübersehbar.
Die Feder hatte ihn offenbar gelähmt und in einer todesartigen Paralyse gehalten, aber nun, da sie nicht länger in seinem Körper steckte, hatte sich ihr Griff so weit gelockert, dass ich die Magie spüren konnte, die Omars Körper umgab wie der Kokon einer Spinne. Sie war unglaublich stark, und ich war mir sicher, dass sie ihn langsam und qualvoll töten würde, wenn ich es zuließ.
Meine einzigartigen Fähigkeiten erlaubten es mir, die Magie abzuziehen und sie zu zerstören. Ich konnte Omar retten.
Dazu musste ich allerdings meine Hand in ein dunkles Loch stecken und hoffen, dass ich nicht gebissen wurde. Wenn diese Feder eine Waffe war, die noch immer mit ihrer Magie in Verbindung stand, würde ich möglicherweise das nächste Opfer werden. Und wer sollte mir zu Hilfe kommen? Keine Chance, als zweiter wiederauferstandener Jude in die Geschichte einzugehen. Ich würde so enden wie Omar.
Er war immerhin von »ziemlich tot« zu »nur noch ein bisschen tot« aufgestiegen. Das war zwar ein Fortschritt, aber der aufgedunsene Körper, die Flecken und die Leichenstarre würden sich nicht gut auf den Hochzeitsfotos machen. Selbst wenn ich in Aktion trat, war nicht gesagt, dass er es komplett zurück ins Land der Lebenden schaffen würde. Sein Atem ging flach und langsam. Ohne mich hatte er keine Chance, aber ihn zu retten, könnte mich das Leben kosten. Und an dem hing ich schon recht stark.
Omars Blinzeln hätte auch ein Morsecode für »Hilf mir!« sein können.
Ich stemmte die Hände in die Hüften und betrachtete das Desaster vor mir kopfschüttelnd. Entscheidung getroffen. Ich würde den Namen meiner Detektei von Cohen Investigations zu Katastrophen ’R’ Us ändern.
»Es wird dich freuen, zu hören, dass ich deinen Tatort gesichert habe«, verkündete der Karnickel-Mann, der sich ausgerechnet diesen Moment ausgesucht hatte, um wieder aufzutauchen. »Die Familien haben sich bereit erklärt, uns nicht zu stö…«
Omar gab einen erstickten Laut von sich.
»Okhuyet!«, fluchte der Karnickel-Mann und hielt mit einer blitzschnellen Bewegung sein Schwert wieder in der Hand.
Stumm wiederholte ich das Wort ein paarmal, um es mir besser zu merken und später zu recherchieren, was es bedeutete und woher es stammte. Das könnte mir einen Hinweis auf die Herkunft des Karnickel-Manns liefern, über den ich bislang rein gar nichts wusste. Oft verfielen Menschen in ihre sprachlichen Wurzeln, wenn sie unter Stress, Alkohol-, Drogen- oder Betäubungsmitteleinfluss standen. Mir war jedes Mittel recht, um mehr Informationen über die Königin zu bekommen.
»Dieses Ding …« Ich deutete auf die Feder. »… besitzt Magie, und wenn du nicht willst, dass ich es Omar wieder in den Hals stopfe, wo ich es gefunden habe, stimmst du besser ganz schnell meinen Bedingungen zu. Gib mir die Phiolen.«
Vor Kurzem hatte ich einen Fall bearbeitet, bei dem jemand Schattenwesen erschaffen und auf die Nefesh-Gemeinschaft losgelassen hatte, wodurch einige magisch Begabte gestorben waren. Die Schatten hatten sich als Magie entpuppt, die ihren eigentlichen Wirten entrissen worden war und nun sterbend verzweifelt nach einem neuen Körper suchte, um am Leben zu bleiben. Zwei von den Dingern, die sich durch Vancouver gefressen hatten, hatte ich zerstören können, aber mit der Entdeckung eines Labors waren auch vierzehn Phiolen mit weiteren Schatten aufgetaucht. Diese hatten an den Meistbietenden verkauft werden sollen.
Das Versprechen von gesteigerter Magie und neuen Fähigkeiten war glatter Betrug. So etwas gab es nicht. Manchmal übersprang Magie eine Generation, aber entweder wurde man mit ihr geboren oder eben nicht.
Ich bildete da die rühmliche Ausnahme von der Regel.
Unglücklicherweise hatte die Königin die Phiolen in Besitz genommen, und auch wenn sie geschworen hatte, dass sie nicht an einem Verkauf interessiert war, mussten diese Dinger ein für alle Mal zerstört werden. Ein Teil von mir hoffte, dass mir der Karnickel-Mann gleich mitteilen würde, dass die Schatten bereits ins Gras gebissen hatten.
Er verengte die Augen ein wenig. »Abgemacht. Als Bezahlung für die Lösung dieses Falls und für Omars Heilung.«
Mein Bankkonto würde von diesem Job nicht profitieren, die Welt aber sehr wohl. Na ja. Vielleicht konnte ich daraus später noch Kapital schlagen.
»Wenn du versagst, wird deine Bezahlung deutlich anders ausfallen«, fügte er noch hinzu und tätschelte dabei die flache Seite seiner Klinge.
»Ich respektiere deine Direktheit und dein Engagement.« Gerade befand ich mich nicht in Köpfreichweite – noch nicht –, und es wäre mir auch lieber, wenn der Karnickel-Mann blieb, wo er war. »Ich muss mich konzentrieren. Könntest du also bitte rausgehen oder zumindest Excaliburs scharfen Cousin da wieder verschwinden lassen?«
Er bezog Posten im Türrahmen, und seine Haltung ließ darauf schließen, dass ihn nicht mal eine Sprengladung von seinem Platz befördern würde. Scheiß drauf. Ich arbeitete unter Druck am besten.
Da ich keine Verbindung zu Omars eigener Magie aufnehmen wollte – er war ein Weltiger und hatte damit keine –, brauchte ich kein Blut von ihm. Von mir selbst allerdings schon. Meine Magie hatte darin ihren Ursprung und wurde davon befeuert.
Ich packte Omars nackte Unterarme. Meine Kräfte schossen in einem seidigen roten Sturm in meine Handflächen, den ich durch seine Haut schickte.
Bei meinem früheren Aufeinandertreffen mit den Schatten war die Konfrontation immer von einem widerlichen Gefühl sich windender Maden auf meiner Haut begleitet worden, weil die Magie im Sterben lag. Die Macht, die Omar umgab, war genauso verzehrend, aber unglaublich lebendig. Es kam mir vor, als würde ich meine Hände in Sternenstaub stecken: die gesamte Geschichte der Menschheit, geschrieben in einer tanzenden Supernova, eine Galaxie explodierender Farben, die mich zu sich lockte.
Ein Kribbeln breitete sich in meinem Körper aus, und ich spürte, wie ich die Augen nach hinten verdrehte. Euphorisch atmete ich aus, ganz versunken in einen Rausch, der etwas von einem Raketenstart hatte. Ich saugte ihn in mich auf und schmeckte den Kosmos.
Ich konnte nicht aufhören. Ich wollte es auch nicht.
Tiefer und tiefer ließ ich mich in die Magie fallen, bis ich mich beinahe darin verlor. Was zunächst verführerisch gewirkt hatte, machte mir nun unendliche Angst. Ich war wehrlos gegen die Übermacht, wurde von heißem Wind und dem kratzigen Gefühl eines Sandsturms gebeutelt. Verbissen wehrte ich mich dagegen und schaffte es schließlich, die Magie von Omar zu lösen.
Sie floss in einem Strahl goldener Staubpartikel aus ihm heraus, und auch wenn ich gerade um mein Leben kämpfte, wollte ich doch noch einmal von ihr kosten. Meine Blutmagie verwandelte sich in ein Kaleidoskop von sich verästelndem Rot, doch sie hielt die fremde Kraft nicht wie sonst an Ort und Stelle, damit ich sie zerstören konnte. Stattdessen zerbrachen die Ströme wie dürre Zweige.
Mein Verstand schrie mir zu, dass ich es nicht schaffen würde, dass ich loslassen musste oder riskierte, dem alles verschlingenden Sandsturm zu erliegen. Es wäre so leicht, einfach aufzugeben. Nur dass in dem süßen Schlaflied auch Zwietracht und Gefahr mitschwangen, die meine Seele mit Eis überzogen.
Ich war eine Kämpferin. Ich überlebte. Das hier würde ich auch überleben.
Mit zusammengebissenen Zähnen widerstand ich der Verlockung und verdoppelte stattdessen meine Anstrengungen, die Form der Magie zu finden, die Omar erwürgte. Ich sammelte jedes Quäntchen von ihr zusammen, bis die unglaubliche Macht komplett von meinen magischen roten Ästen bedeckt war. Tausende weißer Funken tanzten an meinem Dickicht entlang und verschlangen die invasive Kraft.
Folgte man der Theorie, dass Magie wie eine Krankheit war, stellte ich das ultimative weiße Blutkörperchen dar, das Angriffe von außen abwehrte. So weit hergeholt war das gar nicht: Die weißen Funken, die die Magie fraßen, bewegten sich wie die weißen Blutkörperchen in den Wissenschaftsdokus. Das verlieh der Bezeichnung »Blutmagie« eine ganz neue Bedeutung.
Ich blinzelte ein paarmal, da ich meine Umwelt nur verschwommen wahrnahm. Durchgeschwitzt und völlig fertig lag ich halb auf Omar, der zum Glück irgendwann das Bewusstsein verloren haben musste. Sein Puls schlug wieder regelmäßig, und auf seiner hellbraunen Haut war nichts mehr von den violetten und schwarzen Flecken zu sehen.
Natürlich war ich glücklich, dass es ihm gut ging, aber die restlichen neunundneunzig Prozent meines Gehirns waren davon besessen, noch mehr von der Magie der Feder zu bekommen. Tief im Inneren wusste ich mit absoluter Sicherheit, dass das keine gute Idee war, doch mir wurde trotzdem ganz anders, als der Karnickel-Mann sie außerhalb meiner Reichweite ins Licht hielt.
»Gib sie mir«, krächzte ich heiser.
Er schwang die tödliche Klinge durch die Luft und stoppte nur knapp vor meiner Kehle. »Sie gehört jetzt mir.«
Wie bitte? Er konnte Magie nicht schmecken, also brachte ihm die Feder rein gar nichts.
Von einem Augenblick auf den anderen beschwor ich eine stachelige Blutrüstung herauf, riss ihm das Schwert dank meiner erhöhten Kraft mühelos aus der Hand und sprang ihn an.
Der Karnickel-Mann ging zu Boden, landete auf dem Rücken, und sein Schwert erschien magisch sofort wieder in seiner Hand. Er stach nach mir, doch die Klinge drang nicht durch meine Rüstung.
Erneut entwand ich ihm das Schwert und warf es beiseite, bevor ich mit dem Karnickel-Mann um die Feder rang. Als mich das nicht weiterbrachte, trat ich ihm in die Eier. In letzter Sekunde drehte er sich zur Seite und blockte damit einen Großteil der Wucht, bevor er mich mit einem Elektrostoß gegen die Kommode beförderte. Das war seine eigentliche Magie.
Eine Ecke des Möbelstücks traf mich hart am unteren Rücken, aber ich merkte es kaum. Die Rüstung war wirklich der Hammer.
»Ha! War das schon alles, Häschen?«
Bälle aus elektrischer Energie schossen auf mich zu wie aus einer Ballmaschine auf höchster Stufe. Ich warf mich zur Seite, doch meine Rüstung knisterte und schlug trotzdem Funken, und ich spürte einen beißenden Schmerz seitlich am Hals. Blitze stoben gegen die Wand über meinem Kopf und hinterließen dort Brandflecken. Bröckelnder Putz erschwerte mir das Sehen, und eins der gruseligen Vogelgemälde fiel zu Boden. Es löste sich aus dem Rahmen und riss dabei quer in der Mitte durch.
Rachel würde uns umbringen.
Das verdammte Schwert lag schon wieder in der Hand des Karnickel-Manns. Die Waffe passte perfekt zu dem manischen Ausdruck in seinen Augen.
Ich packte den Gegenstand, der mir am nächsten war, und schleuderte dem Karnickel-Mann einen der kleinen Nachttische an den Kopf, traf ihn aber nur an der Schulter.
Er ließ die Feder fallen.
Wir stürzten uns beide darauf. Ich landete auf ihm und beherzigte meine kürzlich erlernten Kampftipps, indem ich meine Faust in die richtige Position brachte und auf die korrekte Ausführung des Schlags achtete. Mit einem befriedigenden Knirschen traf sie auf das Knorpelgewebe seiner Nase, und das Schwert fiel klappernd zu Boden. Tränen strömten dem Karnickel-Mann über die Wangen und nahmen ihm für einen Moment die Sicht.
Ich nutzte seine kurzzeitige Desorientierung aus und griff nach seiner Magie. Sie schmeckte wie das metallische Aroma kühler Luft kurz vor einem Sturm, und obwohl sie im Vergleich zu der vollmundigen Tiefe uralter Magie nur ein verwässerter Snack war, gelüstete es mich ungemein danach.
Ganz schlechte Idee, aus mehreren Gründen. Wenn ich ihm seine Magie nahm, würde ihn das gebrochen zurücklassen, und ich weigerte mich, meiner dunklen Natur ihren Lauf zu lassen, wenn es nicht gerade um Leben und Tod ging. Und eigentlich selbst dann nicht.
»Zurück, oder du verlierst deine Kräfte.« Ich zupfte sacht an seiner Magie. Gott, es wäre so einfach, sie ihm zu rauben. Wie Butter und … nein!
Zum Glück nahm der Karnickel-Mann meine Warnung ernst. Er nickte, woraufhin ich mich von ihm herunterrollte. Die Feder war endlich mein. Als ich sie aufhob, erhaschte ich im Spiegel über der Kommode einen Blick auf mich selbst, wie ich über meiner Beute kauerte. Auf meinem Gesicht lag der gleiche gierige Ausdruck wie auf dem des Karnickel-Manns. Wenn ich jetzt noch »Mein Schatz« murmelte, war ich offiziell zu Gollum mutiert.
Allerdings war es mir völlig egal, wie ich aussah, wenn ich so die Magie der Feder direkt von der Quelle kosten durfte, nicht die verdünnte Version, die Omar umgeben hatte. Und das versetzte mir einen Schock, der ausreichend groß war, um den Wahnsinn zu durchbrechen, der mir den Verstand vernebelte. Ich zwang mich, die Feder loszulassen, und schlüpfte stattdessen aus meiner Lederjacke, um das Artefakt darin einzuwickeln. Es verlangte mir all meine Selbstbeherrschung ab, nicht sofort alle Magie aus der Feder zu saugen wie das Mark aus einem Knochen.
Seit ich vor ein paar Wochen zum ersten Mal Magie gekostet hatte, hatte sich das Verlangen danach wie ein Splitter in meinem Gehirn festgesetzt. Inzwischen konnte ich das konstante Gieren nicht mehr leugnen, das wie eine leise Melodie permanent durch meinen Kopf geisterte.
Levi war der Meinung, dass es eine Möglichkeit gab, diese Gelüste zu kontrollieren, weil man ansonsten längst von Menschen gehört hätte, die anderen die Magie nahmen. Ich hoffte wirklich, dass er recht hatte. Wenn das unterschwellige Summen irgendwann zu einem ohrenbetäubenden Rauschen anschwoll, würde ich nicht mehr in der Lage sein, das Verlangen nur durch Willenskraft und Selbstekel zu beherrschen.
Da mir mein Schuss nun versagt blieb, wollte ich mich am liebsten zu einem kleinen Ball zusammenrollen, bis die Muskelzuckungen und Bauchkrämpfe nachließen. Doch das stand nicht zur Debatte, denn der Karnickel-Mann war ein Raubtier. Er roch Schwäche bei seinem Gegenüber wie ein Hai Blut im Wasser.
Apropos Blut … Schwer atmend zerrte ich eins der Laken vom Bett und warf es dem Karnickel-Mann zu, damit er die Blutung seiner Nase stillen konnte. Mit einem Zischen drückte er sich den Stoff gegen das Gesicht.
Ich setze mich auf den Boden, den Rücken an das Bettgestell gelehnt, die Beine fest an den Körper gezogen, um die Schmerzwellen auszuhalten, die meinen Körper überrollten.
»Vor zwanzig Minuten habe ich noch angenommen, dass jemand aus dem Haus Omar angegriffen hat«, meinte der Karnickel-Mann. »Aber sie hätten der Versuchung der Feder nie genug widerstehen können, um sie zurückzulassen. Engel.« Er fluchte leise. »Das hat uns gerade noch gefehlt.«
»Der Gedanke gefällt mir auch nicht, aber jede Möglichkeit, und sei sie auch noch so unwahrscheinlich, muss in Betracht gezogen werden.« Ich wischte mir den Schweiß mit einem Ärmel vom Nacken. »Die weiße Feder an sich wäre noch nicht einmal das stärkste Argument, das für einen Todesengel spricht. Die uralte Magie, die ihr innewohnt, allerdings schon.«
»Willst du damit sagen, dass Magie vielleicht schon existiert hat, bevor die Menschen sie in die Hände bekamen?«
»Gut möglich. Es ist denkbar, dass es Engel schon vor den Menschen gab, und definitiv vor dem Erscheinen unserer Magie«, erwiderte ich stirnrunzelnd. »Es sei denn, dass die Feder uns nur glauben machen soll, dass ihre Magie uralt ist. Um die Leute von der eigentlichen Fährte abzubringen.«
»Einen Typleser zum Beispiel.«
»Ganz genau.« Mir wurde bewusst, dass ich mich nach vorn in Richtung Feder lehnte, also steuerte ich gegen und richtete mich wieder auf. »Es ist zu früh, um irgendetwas auszuschließen, aber die Feder als Mordwaffe zu nutzen, ergibt keinen Sinn.«
Der Karnickel-Mann schnalzte mit der Zunge. »Oh, natürlich. Einen Mann mit einem Objekt zu töten, das alle in den Wahnsinn treibt, die versuchen, ihn zu retten. Vollkommen abwegig.«
»Ich meine es ernst. Denk doch mal nach. Wenn eine Schlange zubeißt oder ein Skorpion seinen Stachel einsetzt, machen sie das einfach. Raubtiere verstümmeln sich nicht selbst, um ihre Beute zu erlegen. Zu biblischen Zeiten ist sicher kein Todesengel durch die Gegend marschiert und hat sich Federn aus den Flügeln gerupft wie ein depressiver Papagei, um sie dann erstgeborenen Söhnen in den Hals zu stopfen, in der Hoffnung, dass sie das irgendwann umbringt. Die Mordmethode ist in sich nicht schlüssig.«
»Kann sein. Damit bleibt uns nur noch eine weitere unbeantwortete Frage.« Der Karnickel-Mann betupfte seine Nase. »Warum um Himmels willen hast du mich ›Häschen‹ genannt?«
Upsi. Ach, scheiß drauf. »Wenn man sich so anzieht wie du und für die Herzkönigin arbeitet, fordert man so einen Vergleich praktisch heraus. Und wenn dir das nicht passt, könntest du mir ja mal deinen Namen verraten, damit ich dich wie einen normalen Menschen ansprechen kann, Karnickel-Mann.«
Da, ich hatte es getan. Jetzt konnte endgültig niemand mehr behaupten, dass ich leere Drohungen oder Versprechen von mir gab.
Er verengte die Augen ein wenig. Ja, ich hatte genug Selbsterhaltungstrieb, um ihn mir nicht zum Feind zu machen, aber ich war hundemüde, und er hatte angefangen.
Plötzlich fasste mich eine Hand schwächlich am Handgelenk. Mein Puls schoss in die Höhe, und ich riss mich sofort los. Doch es war nicht der Karnickel-Mann, sondern Omar, der bei unserem Handgemenge wundersamerweise nicht verletzt worden war.
»Feder«, flüsterte er. Abgesehen von seinem schockierten Gesichtsausdruck schien es ihm schon viel besser zu gehen.
»Auf gar keinen Fall.« Ich drohte ihm mit dem Zeigefinger wie einem ungezogenen Kind. »Sie haben keine Magie und können sie erst recht nicht schmecken. Die Feder sollte keinerlei Einfluss auf Sie haben.« Das bedeutete wohl, dass das Ding nicht nur Nefesh verführte, sondern auch Weltige – und das hob sein Gefahrenlevel direkt mal auf eine deutlich höhere Stufe. Ich warf dem Karnickel-Mann einen finsteren Blick zu. »Du kannst sie auch nicht schmecken. Warum willst du die Feder überhaupt so dringend haben?«
Der Karnickel-Mann kam unsicher auf die Beine und hob sein Schwert auf. Er unterzog es einer kurzen Begutachtung, bevor er es verschwinden ließ. »Sie hat mir vorgegaukelt, dass sie mir meinen innigsten Wunsch erfüllen wird.«
»Könntest du das ein bisschen näher erläutern?«, fragte ich.
Seine Finger zuckten. »Für einen kurzen, wundervollen Moment dachte ich, ich könnte alles haben …« Er verstummte. Als nichts weiter folgte, trat unangenehme Stille ein, bis ich es aufgab, darauf zu warten, dass er weitersprach.
Stattdessen berührte ich Omars Schläfe mit den Fingerspitzen und schickte meine Magie in seinen Schädel. Die Kräfte der Feder, die ihm die Luft zum Atmen genommen hatte, waren fort. »Seltsam. Es gibt keine Spur von anderer Magie oder einem magischen Zwang.« Mit einer beiläufigen Bewegung schlug ich Omars Hand beiseite. Waren Zwangzauber überhaupt nachweisbar? Im Karnickel-Mann hatte ich auch nichts außer seiner eigenen Magie wahrgenommen. Interessant.
»Wie nahe warst du der Feder, als es passiert ist?«, fragte ich ihn. »Hat dich die Feder direkt beeinflusst, als du in den Raum gekommen bist?«
»Nein, und ich habe sie auch nicht berührt. Ich habe sie mit dem Schwert aus dem Weg geschoben.«
»Also war sie einen guten Meter von dir entfernt?«
»Ungefähr.« Er wich noch ein paar Schritte vor der Feder in meiner Jacke zurück, wahrscheinlich um auf Nummer sicher zu gehen.
»Spürst du ihre Anziehung jetzt auch noch?«
Er schüttelte den Kopf. »Sie ist verblasst.«
»Dann sendet sie das Zwangssignal nicht breitflächig aus, und die Macht, die sie über einen hat, verschwindet schnell wieder, wenn man ihr nur kurz ausgesetzt war.« Omar hatte die Magie der Feder verlassen, doch er stand noch immer unter ihrem Einfluss, als wäre der Zwang, den die Magie ausübte, in seinen ganzen Körper gesickert. »Wir müssen sie irgendwie abschirmen«, erklärte ich. »Irgendeine Idee, wie wir das anstellen?«
»Warte hier«, entgegnete der Karnickel-Mann und löste sich in Luft auf. Er konnte sich nicht teleportieren, trug aber eine magische Münze an einer Kette um den Hals, die ihm von jedem beliebigen Ort aus Zutritt zu Hedon gewährte. Das war ganz schön praktisch, wenn man bedachte, dass der Schwarzmarkt aus kleinen Stücken der Realität zusammengesetzt worden war, aber außerhalb von dieser existierte.
»Omar, was ist passiert?«, fragte ich unser Opfer. »Wer hat Sie angegriffen?«
»Feder«, wiederholte er nur leise.
Ich stieß ein Knurren aus. »Dafür, dass das Ding Sie beinahe umgebracht hat, sind Sie ganz schön scharf darauf. Das kann ich leider nicht unterstützen. Was verspricht sie Ihnen?«
Doch aus ihm war nichts Verständliches herauszubekommen.
Wenig später kehrte der Karnickel-Mann mit einem schmalen Metalletui zurück, in dessen Oberfläche fremdartige Symbole eingraviert waren. Er warf es mir zu, und ich schloss die Feder mit einem erleichterten Seufzen darin ein.
»Kriege ich auch so einen Backstage-Pass?«, erkundigte ich mich.
»Hedon ist kein Ausflugsziel für Möchtegern-Groupies.«
»Ist mir schon klar. Was soll ich auch mit heißen Rockstars, Sex-Eskapaden und einer Geschlechtskrankheit, wenn ich stattdessen Übelkeit, Feindseligkeit und Gefahr haben kann?« Ich wedelte mit dem Etui durch die Luft. »In Hedon gibt es wahrscheinlich Informationen, die ich brauchen werde, um das Rätsel dieses Dings hier zu lösen. Also?«
Der Karnickel-Mann griff in die Tasche seines Jacketts und holte eine Handvoll Bronzemünzen heraus, die er in meine ausgestreckte Hand fallen ließ. »Jede gewährt dir einmal Zutritt zu oder den Austritt aus Hedon. Von überall. Du musst nur daran denken, wohin du willst, und sie bringt dich dorthin.«
Damit musste ich mir nicht mehr extra einen Eingang suchen. Voll VIP. »Und der Preis dafür?«
Der Karnickel-Mann lächelte hintergründig.
Ich strich mit einem Finger über eine der Münzen. Sie sahen so harmlos aus. »Kann ich nicht so eine Goldene wie deine bekommen, um mir die Mühe zu ersparen?«
»Auf gar keinen Fall.«
Na schön, das bestätigte mir wenigstens, dass seine Reisemethode ohne Konsequenzen für ihn ablief. Jedes bisschen Information über Hedon brachte mich weiter.
»Toll. Dann muss ich es wohl beim ersten Mal selbst rausfinden.«
Omar war immer noch ein wimmerndes Bündel Elend. Der Karnickel-Mann sah ebenfalls ziemlich lädiert aus, auch wenn er sich besser hielt als Omar, und von mir brauchte ich gar nicht erst anzufangen.
»Ich würde ja gerne behaupten, dass ich heute viel Spaß hatte, aber ich versuche, so wenig wie möglich zu lügen.« Als ich aufstand, zitterten meine Beine immer noch. Ich deutete auf den Karnickel-Mann. »Zwischen uns alles klar?«
Er bedachte mich mit einem nachdenklichen Blick. »Moran.«
»Ist das Slang? So was wie ›fresh‹? Konsultierst du das Internet, um am Ball zu bleiben?«
»Bist du fertig?«
Ich zuckte die Schultern. »Ich könnte schon noch ein oder zwei raushauen, aber ich lass es. Was ist Moran?«
»So kannst du mich nennen. Ein Name, der dir wohl etwas sagen dürfte, so Sherlock-verrückt, wie du bist.«
Mir stockte der Atem. Colonel Sebastian Moran war ein überaus fähiger Attentäter, der in den Sherlock-Holmes-Geschichten für Moriarty arbeitete. Dass der Kerl wusste, dass ich mit Priya zusammenwohnte, war eine Sache. Aber meine Liebe zu Sherlock Holmes? Gab es irgendetwas, das er und die Königin nicht über mich in Erfahrung gebracht hatten? Und noch viel schlimmer war die Gefahr, die diese Erkenntnis mit sich brachte. Die Königin hatte Interesse an mir. Moriarty war an Holmes interessiert gewesen. Ich schluckte.
»Dann also Moran«, erwiderte ich bewusst gelassen. »Ich werde die Feder an einem sicheren Ort verwahren.«
»Und wo soll das sein?«
Ich zog wortlos eine Augenbraue nach oben.
»Ich frage nicht, weil ich vorhabe, sie zu stehlen«, entgegnete er. »Aber du warst nicht immun gegen die Verlockung. Ist sie denn überhaupt irgendwo ›sicher‹?«
»Deine Erfahrung mit ihr hat sich gravierend von meiner unterschieden. Die Feder selbst hat mich nicht in Versuchung geführt oder mich gezwungen. Als ich sie berührt habe, ist gar nichts passiert. Tatsächlich hatte die Feder keinerlei Auswirkung auf mich, bis ich mit der Magie, die sie in Omar freigesetzt hat, in Kontakt gekommen bin.«
Meine Finger schlossen sich fester um das Etui. Warum war es für mich anders? Noch komplizierter wurde es dadurch, dass es keinerlei Aufzeichnungen, weder offizieller noch überlieferter Natur, zu Blutmagie gab. Das Universum konnte sich meinen Status als ganz besonderes Einhorn gerne nehmen und ihn sich in den Allerwertesten schieben.
»Das Verlangen wird schon schwächer«, log ich, während mich ein weiterer Bauchkrampf heimsuchte. »Ich werde nichts tun, um diesen Fall zu gefährden, und im Moment ist die Feder ein immens wichtiger Hinweis. Vertrau mir, okay?«
Moran musterte mein Gesicht für einen langen Moment. »Nun gut.«
Erleichterung breitete sich in mir aus. Meine mizwa des Tages bestand anschließend darin, Omar mit den Capulets und Montagues im Erdgeschoss wiederzuvereinen. War schon irgendwie süß, wie Shannon klassisch in Ohnmacht fiel und Omar sich in einer Kraftanstrengung aufraffte, um sie aufzufangen. Er drückte sie fest an sich und schmiegte sein Gesicht an ihren Hals.
Allerdings brabbelte er immer noch über die Feder, weswegen Masika mich beinahe mit einer Stricknadel erdolchte. Die alte Dame war fest davon überzeugt, dass ich Omar mit einer Art Voodoo-Zauber belegt und in einen Zombie verwandelt hatte. Meine Erklärung über das Entfernen der Feder, das ihn davor bewahrt hatte, langsam von innen heraus magisch erdrosselt zu werden, während er aussah wie tot, kaufte sie mir nicht ab.
Danach schoss der leicht zu begeisternde Husani mit einem Jubelschrei ein Fenster kaputt, und Rachel hatte einen hysterischen Lachanfall und trank nun direkt aus der Flasche. Damit war der Spaß endgültig vorbei.
Das hatte man nun davon, wenn man Leuten half. Die Szenerie kippte zusehends in galoppierenden Wahnsinn, und alle weiteren Befragungen würden bis zum nächsten Tag warten müssen.
Ich tätschelte Omar den Kopf. »Erholen Sie sich gut, ich komme bald wieder.«
Damit überließ ich ihn Morans teuflisch fähigen Händen und verließ das Haus. Ich musste mich um eine durchgedrehte Feder kümmern und einen Todesengel – egal ob echt oder nicht – finden. Selbst mit den Phiolen als Bonus wurde ich definitiv nicht gut genug für diesen Job bezahlt.
KAPITEL 3
Auf dem Weg zu meinem Auto Moriarty juckte es zwischen meinen Schulterblättern, als würde ich beobachtet werden. Ich drehte mich langsam im Kreis, aber niemand war mir nach draußen gefolgt, und auf der lang gezogenen Einfahrt war bis zum Eingangstor keine Menschenseele zu sehen. Also betrat ich den Rasen, beschwor einen Blutdolch und suchte mir vorsichtig einen Weg zwischen den Büschen hindurch, die in die Form riesiger Rotkehlchen getrimmt worden waren.
Diese Leute sollten echt mit dem Vogelkram aufhören. Es gab einen Unterschied zwischen Gestaltungselementen und einem Hitchcock-Film. Nichtsdestotrotz verursachten mir die Büsche lediglich ein schwaches Unwohlsein – nichts im Vergleich zu dem Stalker-Vibe, den ich von irgendwo anders empfing.
Eine Runde um den Vorgarten förderte jedoch keine herumlungernden Eindringlinge zutage, also ließ ich mich erschöpft auf Moriartys Fahrersitz fallen – nachdem ich das Etui mit der Feder sicher im Kofferraum verstaut hatte – und blinzelte gegen das bläulich weiße Licht an, das mir ins Gesicht schien. Neben dem Auto befand sich eine Art Statue von etwa einem Meter fünfzig Durchmesser an der Basis. Die Spitze des Dreiecks überragte mich, wenn ich stand, und statt aus rauem Stein schien dieses Teil aus einem Stück Himmel gehauen worden zu sein. Es bestand aus purem Licht in bewegungsloser Form. Das war eins von Shannons Kunstwerken. Sie folgte nicht der Familientradition, sondern hatte sich mithilfe ihrer Lichtmagie einen Namen als Visual Artist gemacht.
Ich rieb mir über den rechten Oberschenkel, in dem sich die Metallteile, die den Knochen zusammenhielten, schmerzhaft bemerkbar machten. Das hatte mich seit dem Unfall begleitet, war jedoch mit der Manifestierung meiner Magie erheblich abgeklungen. Heute hatte ich es allerdings eindeutig übertrieben. Ich kramte im Handschuhfach nach der Familienpackung Schmerzmittel und schluckte zwei Tabletten trocken hinunter.
Leider half das nicht gegen das Verlangen nach Magie, und so sackte ich über dem Lenkrad zusammen und atmete langsam ein und aus, während ich alles in meiner Umgebung alphabetisch sortierte: Armaturenbrett, Bremsen, CD-Fach, Drehzahlmesser … Eine Technik aus meiner Jugend, die meine Nerven beruhigte.
Ganz bewusst weigerte ich mich, noch einmal zum Kofferraum zu gehen. Ich konnte Magie zwar schmecken, riechen und zerstören, jedoch leider nicht ihren Typ identifizieren, wenn ich mit ihr in Kontakt kam. Das Vernünftigste wäre es wohl, dem Ding die komplette Magie zu entziehen, damit es niemanden mehr in Versuchung führen konnte, aber bis ich wusste, womit ich es zu tun hatte, wollte ich das eigentlich nur ungern tun.
Das war natürlich der einzige Grund.
Ich verriegelte die Türen.
Meine Magie folgte bestimmten Mustern, doch warum ich ausgerechnet ein Magiestaubsauger war, war nach wie vor ein Rätsel. Ich klammerte mich an das bisschen Wissen über meine Fähigkeiten, das ich besaß, doch die Intensität des Verlangens jagte mir dieses Mal gewaltige Angst ein, auch wenn die Sucht an sich nichts Neues war.
Bei allen vorherigen Erlebnissen war ich vom Kontakt mit lebendiger Magie immer high geworden – im Gegensatz zu den Konfrontationen mit den sterbenden Schatten. Normalerweise verwandelte sich meine psychische Sehnsucht in physische Entzugssymptome, wenn ich die Zerstörung von Magie mittendrin abbrach. Wenn nicht, segelte ich anschließend langsam wieder von meinem Höhenflug runter und war für den Moment befriedigt.
Die Magie der Feder war definitiv lebendig und der Rausch um einiges größer als alle davor. Doch ich wollte mehr, obwohl ich den Teil in Omar bereits weggebombt hatte. Ebenso mysteriös war es, dass Omar weiterhin unter dem Bann der Feder zu stehen schien. Musste ich das Artefakt selbst zerstören, um unser Verlangen danach auszulöschen?
Meine eigene Magie und ihre Herkunft waren mehr als rätselhaft, doch im Moment musste ich Antworten auf drängendere Fragen finden. Versagen war keine Option.
Ich warf dem Armaturenbrett meines Autos einen drohenden Blick zu. »Ich habe heute echt einen Scheißtag, also spring an, oder du kommst in die Schrottpresse.«
Moriarty stotterte einmal protestierend, erwachte dann aber rumpelnd zum Leben. Mein alter grauer Toyota Camry war nicht gerade ein High-End-Modell, brachte aber eine für meinen Job ganz entscheidende Eigenschaft mit: Er war so durchschnittlich, dass ich damit in fast keinem Viertel auffiel. Theoretisch sollte mein Vehikel auch günstig im Unterhalt sein, nicht oft eine Werkstatt brauchen und einen niedrigen Verbrauch mit genug PS kombinieren. Das tat es auch ganz okay, aber richtig gut war Moriarty vor allem darin, mich im Stich zu lassen, wenn er anspringen sollte. Nicht dass mir am Ende noch langweilig wurde.
Ich drehte die inzwischen erneuerte Heizung auf und genoss die Wärme, die wenig später aus den Lüftungsschlitzen strömte. Mein letztes Honorar hatte mich nicht nur meine offenen Rechnungen zahlen lassen, sondern auch diese dringend benötigte Reparatur. Die süße, kuschelige Idylle war allerdings garantiert nicht von Dauer. Bald würde sich das Radio genau dann festhaken, wenn ich es viel zu laut aufgedreht hatte, oder irgendetwas würde kokeln und verbrannten Geruch durchs Gebläse schicken, was den Tanz wieder von vorn beginnen lassen würde. Doch für den Moment war mir immerhin auf der Fahrt zu meinem nächsten Ziel angenehm warm.
Das Blondie’s war meine Lieblingskneipe, trotz der unfreundlichen Bedienungen und der klebrigen Oberflächen. Dort gab es die besten Pommes der Welt und dazu eine einzigartige Songauswahl beim Karaoke. Das gedimmte Licht diente jedoch nicht der Stimmung, sondern der Kaschierung der schartigen Fußböden, von Flecken übersäten Sitzpolster und der Tatsache, dass billiger Alkohol teuer ausgeschenkt wurde.
Tagsüber würde ich normalerweise auf keinen Fall einen Fuß in die Kaschemme setzen, da das ohnehin schon äußerst fragwürdige Essen von den blassen Sonnenstrahlen, die es durch die fettverschmierten Fenster schafften, auch nicht besser wurde. Doch ich hatte eine bestimmte Person im Sinn, deren Magen rostige Nägel und Schuhsohlen verarbeitete und die gerne im Blondie’s frühstückte.
In der Kneipe angekommen, schaute ich mich suchend um und geriet prompt selbst ins Fadenkreuz.
»Ich spendier dir einen Drink, Zuckerpuppe.« Ein Mann in den Sechzigern grinste mich von seinem Barhocker aus dreckig an.
Betrunkene, die es am Vorabend nicht mehr nach Hause geschafft hatten – ein weiterer Grund, das Blondie’s in den Vormittagsstunden zu meiden.
Der Kerl wirkte definitiv nicht mehr wach, trug einen Ehering am Finger und ein fettes Portemonnaie in der hinteren Hosentasche. Er traf im Suff schlechte Lebensentscheidungen, war aber nicht mein Problem. Mit einem Kopfschütteln ging ich an ihm vorbei.
»Komm schon, Süße, lächel doch mal. Du bist so ein hübsches Mädchen.«
Ich blieb stehen. Eine Predigt, ihn ignorieren, ihm eine verpassen – die Möglichkeiten waren alle nicht schlecht. Aber wenn ich damit verhindern konnte, dass er noch eine Frau belästigte, sollte ich mich wohl um ihn kümmern.
Also drehte ich mich um, hakte einen Fuß unter der Quersprosse seines Barhockers ein und zog ihn dem Kerl unterm Hintern weg. Auf selbigem landete er auch prompt unter Gezeter.
Ich ging vor ihm in die Hocke. »Gerade hat nur Ihr Stolz gelitten. Jemand anders könnte mit dem Geld in Ihrer Hosentasche und der Tatsache, dass Sie mindestens zwei Drinks zu viel intus haben, um noch klar zu denken, deutlich mehr Schaden anrichten. Gehen Sie nach Hause.«
Er lallte irgendwelche Unschuldsbeteuerungen und dass ich mich doch nicht so haben sollte. Dann schickte er noch ein »Schlampe« hinterher, um es mir so richtig zu zeigen.