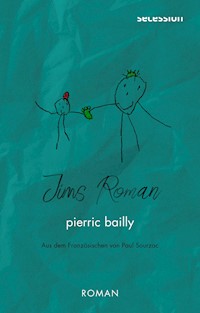
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Secession Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Frankreich, ein abgeschiedenes Gebirgsdorf: Der künstlerisch veranlagte, aber sich als Zeitarbeiter verdingende Aymeric verliebt sich in Florence. Sie ist fünfzehn Jahre älter als er und nach einer Affäre hochschwanger. Kaum auf der Welt, wird der kleine Jim für Aymeric zum Lebensmittelpunkt, zur Kraftquelle des Glücks. Jahre später jedoch taucht der leibliche Vater, Christophe, auf – er hat Ehefrau und Kinder bei einem Unfall verloren. Florence entscheidet sich für Christophe, drängt Aymeric zurück und verhindert durch geschicktes Lügen jeglichen Kontakt zu Jim. Dieser sucht Jahre später seinen einst geliebten Stiefvater auf. Aymeric muss sich entscheiden, ob er die Wahrheit über den für beide so schmerzlichen Bruch aufdecken und die Mutter entlarven will … Pierric Bailly führt uns in die Lebenswelten des Jura, seine Dörfer und Städte, in die kaum porträtierte Realität von Zeitarbeitern, die sich nicht mehr mit der traditionellen Arbeiterklasse identifizieren. Mit seiner dem Milieu abgelauschten Sprache und emotionaler Tiefenschärfe lässt er uns die innersten Prozesse seiner Figuren miterleben und zeichnet ein ergreifendes Bild der französischen Provinz. »Ein Meisterwerk«, wie Frankreichs Presse einstimmig diesen Roman feiert.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 264
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Pierric Bailly
Jims Roman
Aus dem Französischen vonPaul Sourzac
Pierric Bailly
Die Arbeit des Übersetzers am vorliegenden Text wurde mit einemArbeitsstipendium des Deutschen Übersetzerfonds gefördert.
Dieses Buch erscheint im Rahmen des Förderprogramms des Institut français.
Die Originalausgabe erschien unter dem Titel Le Roman de Jim.
© 2021 Éditions P.O.L, Paris
Erste Auflage
© 2022 by Secession Verlag für Literatur, Zürich
Alle Rechte vorbehalten
Übersetzung: Paul Sourzac
Lektorat: Christian Ruzicska
Korrektorat: Peter Natter
www.secession-verlag.com
Umschlagentwurf: Eva Mutter, Barcelona
Umschlag gesetzt aus Isabella und Futura
Satz: Eva Mutter, Barcelona
Inhalt gesetzt aus Arapey und Futura
Herstellung: Daniel Klotz, Berlin
eISBN 978-3-907336-16-8
Inhalt
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
1
Florence ist mit siebzehn von zu Hause weg, ohne ihre Ausbildung zur Optikerin an der Victor-Bérard in Morez zu beenden, Brillen gingen ihr am Arsch vorbei, das Internat ödete sie an, und in ihrer Klasse fühlte sie sich niemandem verbunden. Ihre Eltern sah sie fast gar nicht mehr, die Wochenenden verbrachte sie alle mit Martial, und es konnte vorkommen, dass die beiden mehrere Hundert Kilometer im Transporter schrubbten, um ein Konzert zu besuchen oder Kumpels in der Ardèche oder den Alpen, doch meistens setzten sie keinen Fuß vor Martials Tür und verbrachten ihre Tage mit Rauchen und Trinken, mit Ficken – sie hatte immer ficken gesagt, niemals vögeln oder Liebe machen –, mit Fernsehen auch, aber nur Filme, keine TV-Sendungen, VHS-Filme auf Martials wuchtiger Glotze, die vor seinem Bett aufgestellt war in diesem großen, abgeschiedenen Keller, dem Untergeschoss des Einfamilienhauses, ein fensterloser Raum, den weder die Eltern noch Martials kleiner Bruder je betreten durften. Die Wände waren überall mit Postern beklebt, The Doors, Pink Floyd und, lokal verwurzelt, Hubert-Félix Thiéfaine, von dem es auch ein Poster des ersten Konzerts gab, das Florence miterlebt hatte, in Besançon, im Styx. Sie hatte sich auf die Bühne setzen müssen, hinter die Musiker, an die Rückwand, so gerammelt voll war es gewesen. Martial war etwas älter als sie, und als er ihr eines Tages von der Idee erzählte, der Gegend den Rücken zu kehren und im Transporter zu wohnen, wollte sie prompt, schon tags darauf, Ernst damit machen. Und eigentlich haben sie genau das getan. Fast fünfzehn Jahre lang tourten sie kreuz und quer durch Frankreich, je nachdem, welche Baustelle gerade für Marti anstand, der seine Ausbildung immerhin abgeschlossen hatte, eine Ausbildung zum Steinmetz, was ihm Arbeit in der Instandsetzung denkmalgeschützter Orte und Bauten bescherte. Wenn sie für ein halbes Jahr mal irgendwo sesshaft wurden, liehen oder mieteten sie sich ein kleines Haus, den Rest der Zeit schliefen sie in ihrem umgebauten VW-Bus. Sie haben Hunde gehalten, und manche verloren; vor allem Flo kümmerte sich um die Köter. Sie fand Arbeit als Saisonkraft, erntete Obst oder kellnerte im Restaurant. Zweimal im Jahr rief sie ihre Eltern an, allerdings nur, um die wissen zu lassen, dass sie noch lebte. Das Telefonat dauerte höchstens fünf Minuten, sie stellte ihnen keinerlei Fragen. Sie hielt es für eine nette Geste, fand, dass nicht jeder an ihrer Stelle so aufmerksam gewesen wäre. Dabei war es Martial, der sie gedrängt hatte, sich bei ihnen zu melden, so, wie er es auch bei den Seinen tat.
Flo war in Les Trois Cheminées aufgewachsen, einem von mehreren Weilern auf dem Hautes-Combes-Plateau im Haut-Jura. Der alte Hof ihrer Eltern befand sich direkt am Startpunkt der Langlaufpisten, sodass man im Winter, an Wochenenden mit schönem Wetter, schon mal fünfzig Autos zählen konnte, die an der Straße unterhalb des Hauses parkten. Im Sommer übernachteten die wenigen Wanderer in den umliegenden Hütten, was um einiges erträglicher war. Wenn sie mit Marti durch die Lande fuhr, verschwendete sie keinen Gedanken an ihre Gebirgskindheit, sie betrachtete sie nicht als Teil desselben Lebens, sie hatte, viel eher als den grünen Weiden und Fichtenwäldern, der Familie die kalte Schulter gezeigt. Ganz früh schon hatte sie Abstand von ihren Eltern nehmen wollen, daher auch die Berufsfachschule in Morez statt in Saint-Claude, der nächstgelegenen Stadt. Sie hatten ihr freie Wahl gelassen. Hatten vor ihrer Tochter nie die Beherrschung verloren. Sie gehörten bestimmt nicht zu denen, die sich jammernd fragen, was sie dem lieben Gott denn getan hätten, um so etwas zu verdienen. Sie hatten sie sogar ermuntert, allein klarzukommen, sich ohne sie durchzuschlagen, was Florence dann auch eins zu eins umgesetzt hatte. In all den Jahren auf Achse, wie man damals zu sagen pflegte, hielt Flo ihnen bisweilen, auch wenn sie, was die beiden verkörperten, nach wie vor verabscheute, eine gewisse Flexibilität zugute, von Offenheit zu sprechen, wäre übertrieben, doch zumindest hatten sie ihre Tochter nicht zurückgehalten, sie nicht gebremst, nein, sie hatten sie nicht daheim eingesperrt, sie nicht gezwungen, einem von der eigenen Angst vor der Welt und dem Leben abgesteckten Pfad zu folgen, und so mochten Flo sogar Anflüge von Zärtlichkeit überkommen, Gefühle für sie, die bruchstückhaft aufkamen, oder vielmehr schubweise, zum Beispiel, wenn sie sich mit Marti zoffte und mal ihren Vater, mal ihre Mutter durch sich schimpfen hörte, die beiden in ihren eigenen Reaktionen, ihren eigenen Worten wiedererkannte. Sie hatte diese ruppige Art übernommen, ließ sich wie ihre Eltern nichts gefallen, sich nicht unterbuttern. Die beiden wirkten, zumindest nach außen hin, nicht unterwürfig, sondern wie harte Hunde, wie aktive, umtriebige Leute mit einer großen Klappe, keineswegs schweigsam oder unscheinbar.
Das Ganze ging fünfzehn Jahre, bis Flo und Marti beschlossen, sich zu trennen, weil zu viel Streit, aber auch zu viel Alkohol, zu viel Rausch, zu viel Verrücktheit auf beiden Seiten – es geschah einvernehmlich, verstand sich für beide von selbst, sie wussten, sie würden sich gegenseitig umbringen, wenn sie noch länger zusammenblieben, was kein bloßes Gerede war, nein, sie würden es wirklich tun –, und so ist Florence in den Schoß der Familie zurückgekehrt. Sie brauchte das, und zwar viel eher, als bei Freunden auf der Couch zu pennen, sie brauchte den klaren Schnitt, einen anderen Rhythmus und Rahmen und Umgang, und es tat ihr gut. Sie freute sich, ihre Eltern wiederzusehen, sie wiederzufinden, wieder einen Fuß ins Haus ihrer Kindheit zu setzen und in dieses Umfeld, vor dem sie als Jugendliche die Flucht ergriffen hatte. Wobei es weniger um Versöhnung ging, da das, was hier vorlag, ein klarer Fall von Regression war: In den ersten Tagen hatte sie sich wirklich als das kleine Mädchen erlebt, das Trost in den Armen von Mama und Papa suchte. Das mit Martial war so schlimm geworden, es war so schwer gewesen am Ende, sie war völlig ausgebrannt aus dieser Beziehung raus und brauchte jetzt nur die Wärme des trauten Heims, den umhüllenden Kokon, die beruhigende Wirkung einer Welt, in der alles begonnen hatte und in die sie nun zurückgekehrt war, und die sich eigentlich kaum verändert hatte, eine Rückkehr ohne blaues Wunder, ein Schritt, der ihr keinerlei Anstrengung abverlangte, der folgerichtig war, das Gegenteil des Lebens mit Martial. Das Gegenteil dessen, was sie mit ihm zusammen immer geliebt, wertgeschätzt hatte: das drängende Bedürfnis auszugehen, in Bewegung zu bleiben, Leute zu treffen, immer neue Leute. Das Gegenteil einer furchtlosen, waghalsigen Entscheidung, wirklich nullkommanull Prozent Abenteuer, und seltsamerweise war ihr das nicht zuwider. Bei ihren Eltern verhielt sie sich, wie sie es vielleicht nie mehr getan hatte seit ihrem neunten oder zehnten Lebensjahr, sie ließ sich knuddeln und küssen. Was ihre Eltern auch gut konnten; sie verwöhnen, sie verhätscheln. Sie waren weder gefühlskalt noch zurückhaltend, sondern mitteilsame, liebevolle Leute. Natürlich waren sie Idioten, aber eben nicht nur. Zum ersten Mal war Florence fähig, nicht bloß ihre Scheuklappenmentalität zu sehen, ihre, wie sie es stets ausdrückte, angeborene Dummheit. Gut, man vermied es, heikle Themen anzusprechen, schaltete weder Radio noch Fernseher ein, und der Vater zog sich zurück, um heimlich durch die Zeitung zu blättern; auf beiden Seiten wusste man, dass es etwas zu bewahren gab, versuchte, die Gnadenfrist möglichst auszudehnen, den besonderen Moment galt es auszukosten. Was auch ziemlich gut klappte. Florence ist fünf Monate bei ihnen geblieben, fünf streitfreie Monate, fünf friedliche Monate in diesem Dorf, das keines ist, eher eine Gemeinde, die sich aus einer Summe von Weilern zusammensetzt, wo selbst die Bürgermeisterei ein alleinstehender Bau ist.
Nach fünf Monaten beschloss sie, aktiv zu werden, bloß entfernte sie sich diesmal nur einen Katzensprung. Sie fand einen Job als Kassiererin in Saint-Claude, wo sie eine kleine Wohnung mietete, im Zentrum, in der Rue du Pré, gegenüber vom Musikgeschäft. In den ersten Wochen überkam sie zeitweilig Panik, sie fragte sich, was sie wohl geritten hatte, sich hier einzuigeln, in dieser finsteren Stadt, dieser isolierten, dieser winzigen und leichenblassen Stadt, die sie zurückwarf auf ihre Schülerjahre, aber selbst wenn sie, wie ihr nach einigen Wochen klar wurde, zufällig auf bekannte Gesichter traf, einen Händler, einen ehemaligen Klassenkameraden, so war sie doch nicht mehr diese Schülerin, nicht mehr diese Göre, tja, die Zeit hatte vor niemandem Halt gemacht, egal was man auch sagte, und so fand sie rasch neue Orientierungspunkte, die Stadt begann für sie auf andere Art zu existieren, ihr Alltag einer berufstätigen Frau in den Dreißigern überlagerte Stück für Stück die Erinnerungen aus ihrer frühen Jugend, und letzten Endes ging es weder um die Rückkehr zu den Wurzeln noch um einen abermaligen Fortgang, sondern schlicht um ein neues Kapitel in ihrem Leben.
Damals traf ich sie auch zum ersten Mal, auf der Arbeit, im Casino-Markt. Mit ihrem Look und den Piercings – an beiden Ohren fast ein Dutzend, eins an der Lippe und eins am Kinn – hob sie sich klar von ihren Kolleginnen ab. Sie wirkte vor allem weniger oma-, weniger damenhaft, weniger erwachsen als manche andere, die sogar jünger waren als sie. Trotz des Altersunterschieds haben wir uns gut verstanden, wir freuten uns, wenn wir uns über den Weg liefen, um fünf Minuten bei einem Kaffee zu quatschen. Unsere Gespräche waren keineswegs hochtrabend, wir unterhielten uns nur über die Arbeit, aber mir gefiel ihre Energie, ihr Elan, mir gefiel, dass sie nur so sprudelte, sich widersprach und verstrickte, ich hörte ihr gern zu. Als Kassiererin machst du deinem Unmut über die Kunden Luft, über zu langsame Kunden, unhöfliche Kunden, Kunden, die dastehen und dir von oben in den Ausschnitt glotzen oder den Moment abpassen, wo du dich auf deinem Kassenstuhl drehst, und zack, der schnelle Blick, um drei Zentimeter Schenkel zu erhaschen, die unterm Rock hervorlugen, Kunden, die aus dem Maul und unter den Achseln stinken, Kunden, die im wahrsten Sinne des Wortes genauso schmutzig sind wie ihr Geld, diese Kunden mit ihren Händen und ihren Münzen und ihren speckigen Scheinen … Den lieben langen Tag lang schenkst du ihnen dein falsches Lächeln und wünschst ihnen noch einen schönen Nachmittag, obwohl dir ihr Leben am Arsch vorbeigeht, und außerdem weißt du, dass es an deinem Monatsgehalt nix ändern wird, ob du nun höflich bist oder nicht, aber du fügst dich, gehört halt zum Job dazu. Und dann bist du manchmal gut gelaunt und würdest einen Kunden sogar, nach Aushändigung des Kassenbons, gern auf ein Gläschen einladen, den Moment noch etwas in die Länge ziehen, aber der nächste Kunde wartet schon, du hast nie Zeit, mal einen von ihnen kennenzulernen, und solltest du ihn schon kennen, kannst du nie mehr als zwei, drei banale Sätze über die Familie oder das Wetter wechseln, und selbst da bist du schon glücklich, hast das Gefühl, einen unglaublich intimen Moment mit deinem Kumpel oder deinem Nachbarn erlebt zu haben, deinem ehemaligen Mathelehrer aus der Mittelstufe, der seinen Einkaufswagen inzwischen Richtung Auto schiebt, während du wieder dazu übergehst, deine scheiß Barcodes zu scannen, piep piep piep, sieben, acht, neun Stunden am Tag, piep piep piep, nicht mal Spielraum bleibt dir, um gedanklich abzuschweifen, du musst dem Kunden den Betrag nennen, ihm eine Tüte geben und warum nicht gleich ein Autogramm dazu?, ihm manchmal sogar beim Einpacken helfen, so überfordert ist der Arme mit seinen heulenden Rotznasen und den sich auftürmenden Artikeln, woraufhin du vier Sekunden verschnaufst, und bevor du dann wieder loslegst, blickst du schnell noch auf deine Uhr, um zu prüfen, wie lang es noch hin ist, bis du endlich deine Pause hast, denn du sehnst dich nach ihr, sehnst sie jeden Tag mit derselben Ungeduld herbei, deine Kaffeepause, in der du Bekanntschaft mit dem wirklich netten kleinen Leiharbeiter schließt, dem du all den Stress deiner Schicht klagst, und wenn du dann auf deinen Posten zurückkehrst, wird dir klar, dass du nicht mal Zeit hattest, dich für ihn zu interessieren, für sein Leben, sein mickriges Studentenleben, ach, ja? Bist nur für den Sommer hier, was? Und was studierste so? Doch zu spät. Zeit ist um. Weiter geht’s. Dann vielleicht ein andermal. Ich werd versuchen, nicht so geschwätzig zu sein. Doch das war sie jedes Mal, und nein, es störte mich nicht. Ich glaube, sie beeindruckte mich. Ich fand sie einnehmend, irgendwie faszinierend. So drei-, viermal hatten wir uns in diesem Sommer unterhalten, nicht häufiger. Im folgenden Sommer wurde ich woandershin beordert, bekam neue Aufgaben, Fabrikarbeit. Und bei Casino ging ich nicht einkaufen, war nicht meine Ecke, zumal ich ja auch mein eigenes Leben hatte, mein Leben in Besançon, mein Studentenleben und dann natürlich mein Liebesleben, ich hatte Jenny. Sodass Florence rasch verblasste. In den folgenden Jahren hab ich kaum an sie gedacht, ich hatte andere Sorgen. Moment, ich muss nachrechnen … Sieben Jahre, ja, sieben. So viel Zeit ist zwischen diesem ersten Treffen und unserem Wiedersehen verstrichen.
2
Sieben Jahre später also. Es war nach einem Konzert im La Fraternelle. Wir hielten beide einen Plastikbecher in der Hand, sie trug einen weiten Mantel, weshalb ich nicht gleich merkte, dass sie schwanger war. Es war allerdings auch Februar, alle waren dick angezogen. Und außerdem war ich abgelenkt, nicht besonders aufmerksam, da ich mich in erster Linie fragte, ob sie über mich Bescheid wusste. Doch wie die meisten Leute, denen ich begegnete, seit ich ab und an wieder ausging, schien auch sie nicht informiert zu sein. Oder sie konnte gut schauspielern. Sie lächelte mich an, sie freute sich, mich zu sehen, und war sichtlich überrascht, dass ich mein Studium abgebrochen hatte. Damit sie mich nicht weiter über meinen Werdegang ausquetschte, stellte ich schnell die Gegenfrage: Und bei dir? Woraufhin sie den Mantel öffnete und ich ihr rundes Bäuchlein entdeckte. Sie war im sechsten Monat. Ihre erste und wahrscheinlich letzte Schwangerschaft, sie war gerade vierzig geworden. Sie lebte allein. Und die entsprechende Frage hat sie mit einem einfachen, knappen Satz abgewehrt: Es gibt keinen Vater. Ich bohrte nicht weiter nach. Bei Casino hatte sie schon vor Jahren aufgehört, war nur ein Jahr geblieben, hatte dann ihren Abschluss als Externe nachgeholt, drei Jahre Ausbildung zur Krankenschwester drangehängt und arbeitete inzwischen in der Klinik in Oyonnax. Sie wohnte noch immer in Saint-Claude, und als uns klar wurde, dass wir fast Nachbarn waren, machten wir uns gemeinsam auf den Heimweg. Sie lud mich auf einen Drink zu sich ein, und als ich wieder auf die Straße trat, war’s schon nach drei Uhr morgens. Tags darauf rief ich Romu an, um ihm alles zu erzählen.
Dass sie fünfzehn Jahre älter war als ich, war ihm egal, aber dass sie schwanger war, konnte er nicht fassen. Alter, du hast mit ’ner Schwangeren geschlafen! Hat’s dich nicht gestört, dass sie schwanger ist? Ich mein, der Bauch, hat der dich nicht gestört? Haste ihren Bauch berührt? Haste dich getraut, die Hände draufzulegen? Und hast du’s gespürt? Das Baby mein ich. Hat’s dich gekickt? Aber ich wich ihm nur aus, weil ich nicht auf technische Details eingehen, ihm bestimmt kein genaues Bild zeichnen wollte. Ich hatte keine Lust, unsere Körper ins Spiel zu bringen, ihren nicht und erst recht nicht meinen, meinen nackten Körper, der den nackten Körper einer Frau berührt, für dessen Unförmigkeit ich nichts konnte, unsere zwei nackten, unbeholfenen Körper, und die ganzen Vorkehrungen, die es mit sich brachte, weil wir zum ersten Mal miteinander schliefen, und sie sich auch nicht frei bewegen, sich weder so hinlegen noch mich so aufnehmen konnte, wie es ihr lieb gewesen wäre. Ich antwortete Romu bloß, dass es mich nicht gestört hätte, nein, kein bisschen, dass es mir problemlos gelungen sei, ihren Bauch und das, was sich in ihm befand, zu vergessen – was glatt gelogen war, tatsächlich hatte ich mich damit sehr schwergetan. Romuald schien mich jedenfalls zu bewundern. Du hast echt die Gabe, dich in verrückte Geschichten zu verstricken. Womit er diesmal nicht unrecht hatte.
Er spielte natürlich auf Titi und Odile an, aber auch auf Léa. Ich hatte Romu viel von Léa erzählt. Einer megahübschen jungen Frau, die sich immer heiß angezogen, aber nie gewollt hatte, dass ich sie bei Licht nackt sah. Sie hatte noch nicht einmal gewollt, dass ich sie in Unterwäsche sah, selbst an einen gemeinsamen Tag im Schwimmbad oder am See war nicht zu denken. Geduscht wurde grundsätzlich nur mit doppelt abgeschlossener Tür. Und Liebe wurde nur im Dunkeln gemacht, unter der Decke, und auf keinen Fall durfte ich mit meinen Händen tiefer wandern als bis zu ihrem Bauchnabel. Den Bauch durfte ich berühren, die Brüste, die Arme, überhaupt kein Problem, die Beine und der Po waren hingegen tabu. Ich hatte mir die Cremetuben in ihrem Badezimmerschrank angesehen und schließlich begriffen, dass sie unter Cellulite litt. Ich entdeckte auch eine herausgerissene Zeitschriftenseite, die verschiedene Methoden auflistete, um der Orangenhaut den Garaus zu machen. Eines Tages hab ich das Thema angesprochen, woraufhin sie mir ihre krassen Komplexe gebeichtet hat, denn sie hasste ihre Beine und ihren Hintern. Wo sie doch umwerfend war. Alle meine Kumpels beneideten mich. Und ich muss zugeben, ich empfand einen gewissen Stolz darüber, mit einer so schönen Frau auszugehen. Meinen Kumpels erzählte ich nichts von unserem Sexualleben. Als sie mich anfangs fragten, wie’s mit Léa so in der Kiste lief, sagte ich, dass es der Wahnsinn sei, und sie entschuldigten sich fast schon, mir die Frage überhaupt gestellt zu haben, als ob es sich mit so einer Frau gar nicht anders verhalten könnte. Meine Schwester war vor Romu die einzige Person, mit der ich über Léas Komplexe und die Grenzen unserer Sexualität gesprochen habe. Sie hatte ziemlich dumm reagiert, sich über sie lustig gemacht und mir lediglich geraten, das Badezimmerschloss von außen mit einem Schraubenzieher zu öffnen und den Duschvorhang wegzureißen. Solidarität unter Frauen, na denkste!
Trotzdem blieb ich über ein Jahr mit Léa zusammen. In den letzten sechs Monaten haben wir uns nur noch im Besucherraum gesehen, und da konnten wir wohl kaum verlangen, dass man die Rollläden runterließ. Als ich wieder rauskam, war sie in den Süden gezogen, und ich wusste nicht mal, ob sie weiterhin studierte oder schon arbeitete. Ich hatte ihre Nummer, aber nicht die geringste Lust, sie anzurufen. Zumal es die Zeit vor Facebook war; es gab, wenn man nicht gerade einen gemeinsamen Bekannten auf der Straße traf, keine Zigtausend Wege, an Neuigkeiten zu gelangen.
Zwischen Léa und Florence gab es absolut niemanden. Fast zwei Jahre lang hatte ich keine Frau angefasst. Aber so lang kam mir das gar nicht vor. Es war Teil der Strafe, ich nahm es hin.
Florence wohnte zwei Straßen weiter, und gleich am übernächsten Tag trafen wir uns wieder, und auch am Tag darauf. Es dauerte nicht lang, bis ich ihr von allen erzählt hatte: von Léa, von Titi und Odile, Romu und sogar von Jennyfer, und stundenlang hat sie mir ihre Geschichte mit dem Steinmetz erzählt, und von ihren Rumtreiber-Jahren, wie sie es nannte, ihren Rock’n’Roll-Jahren, einer Bezeichnung, an der ihr viel zu liegen schien und die, ehrlich gesagt, keinen wirklichen Sinn für mich ergab. Rock’n’Roll verband ich mit meinen Eltern, die auf Hochzeiten zu Elvis Presley herumwirbelten, aber ich spürte wohl, dass bei Florence nicht die gleichen Bilder aufkamen, dass sich da andere Welten auftaten, andere Praktiken, dass sich die Bezeichnung auf eine Zeit bezog, die ich nicht gekannt hatte. Mir gefiel diese Kluft, es fühlte sich wie ein frischer Wind an und machte Florence umso anziehender. Ich glaube, vor unserem Wiedersehen hatte ich noch immer irgendwie im Knast gesessen, zumal ich fast täglich mit Romu telefonierte, und so musste ich wirklich erst auf Florence treffen, um allmählich wieder in ein normales Leben zurückzufinden. Ständig hatte ich ihre Stimme im Kopf, und vor allem hatte ich das Gefühl, ja, die fast schon körperliche Empfindung eines mit ihr geknüpften Bandes. Ich spürte ihre Gegenwart; selbst wenn wir nicht zusammen waren, blieb etwas von ihrem Auftreten zurück, sie übertrug etwas auf mich, steckte mich mit ihrer Art zu reden, mit ihrem Selbstbewusstsein an, sie beflügelte mich. Ich hatte den Eindruck, einen Zeitsprung zu machen, einen großen Schritt nach vorn. Ich kam mir anders vor als die übrigen Typen in meinem Alter. Ich hatte den Eindruck, dass der Altersunterschied schrumpfte.
Ich hatte den Eindruck, sie eingeholt zu haben. Nicht mehr sechsundzwanzig, sondern vielleicht dreißig oder fünfunddreißig oder vierzig zu sein, wie sie. Als hätte ich kein tatsächliches Alter und als hinge dieses von meinem Gegenüber ab. Mit ihr zusammen war ich vierzig. Mit Jenny war ich fünfzehn, achtzehn, zwanzig gewesen. Mit Jenny, wie auch mit Léa, war die Nachwirkung einer gesprächsreichen, durchzechten, durchfeierten Nacht schwächer. Mit Flo spürte ich das Gewicht der Vergangenheit und nahm einen Teil davon auf. Vielleicht entlastete ich sie davon. Und vielleicht war es für sie das Gegenteil: Vielleicht sah sie in mir nur eine Ablenkung, nur einen Fickfreund, um die Zeit bis zur Geburt ihres Sprösslings totzuschlagen. Einmal hat sie sogar von den Schwierigkeiten für eine alleinstehende schwangere Frau gesprochen, Männer kennenzulernen. Weil man nicht mehr wahrgenommen wird wie früher. Wenn sie zum Beispiel ins Schwimmbad ging, guckte kein Typ sie unter der Dusche mehr an. Wo man schon nicht mehr rauchen und trinken, weder Weichkäse noch Meeresfrüchte mampfen darf … Und dann stell dir mal vor, ey, du musst auch noch die Fickerei lassen. Ich war in dieser Geschichte also der Typ, der nicht vor ihr zurückgeschreckt war.
Genau wie Romu fragte auch sie mich, ob ich mich denn nicht gestört fühlte von diesem großen Ballon zwischen meinen Händen, und Florence versuchte ich die Wahrheit zu sagen: Wenn ich spürte, dass das Baby sich darin regte, empfand ich seine Bewegungen immer als etwas, das sich gegen mich richtete, als versuchte es, mich zu treten, mich wegzustoßen, als verlangte es, dass ich es in Ruhe ließ und mich um meinen eigenen Kram kümmerte. Florence brachte das zum Lachen, und sie beruhigte mich, aber ich blieb hartnäckig, ich schwör’s dir, ich bin Spezialist für sowas, Spezialist für seltsame, nicht ganz koschere Angelegenheiten, nein, echt jetzt, ich hab das Gefühl, sie förmlich anzuziehen, ich weiß nicht warum, aber ich lass mich immer in komplizierte Geschichten verwickeln. Und sie hatte ihre Erklärung dafür. Ist, weil du nett bist, sagte sie, den bösen Leuten passiert nie was, die Bösen bleiben allein. Ich fand diese Erklärung völlig bescheuert.
In den letzten Jahren hatte ich das oft über mich gehört, vor allem wegen der Geschichte mit Titi und Odile. Meine Freunde, meine Familie, meine Schwester, die Menschen, die mich lieben, sie wollten mich unterstützen, indem sie mich als den viel zu netten Typen darstellten, den Typen, der sich alles gefallen lässt, der einfach nicht Nein sagen kann. Bloß war ich da anderer Meinung. Ich teilte diese Ansicht nicht, der zufolge Nettigkeit die Ausnahme sein soll. Ich hatte eher den entgegengesetzten Eindruck, dass die meisten Leute sehr wohl nett sind. Man behauptet immerzu das Gegenteil: dass die Leute verrückt, boshaft seien, wo die meisten Leute doch brav sind, lammfromm, gehorsam und unterwürfig. Die Leute, die durchdrehen, sind wirklich selten. Die überwältigende Mehrheit weiß sich sehr gut zu benehmen. Und doch fantasieren wir alle vom Gegenteil. In diesem Punkt sind wir uns alle einig: Die Netten sind stinklangweilig, im Film lieben wir es, wenn die Figuren die Nerven verlieren, austicken, zu weit gehen, sich Verhaltensweisen erlauben, die wir uns im richtigen Leben verbieten, aber eigentlich alle gern ausprobieren würden. Und doch sind die wirklich Wahnsinnigen im Leben selten, so selten, dass man, sobald einer ausflippt, drei Wochen lang über nichts anderes spricht. Aber ich hatte kein Anrecht auf die gleiche Behandlung. Weil ich noch nicht genug Scheiße gebaut hatte? Weil ich sofort gestanden und kooperiert hatte? Warum wollte man mich unbedingt retten? Nicht ich, sondern sie waren die Netten. Warum war man so nett zu mir? Und warum wurde ich so schlecht damit fertig, dass man mich für den Netten hielt, warum ärgerte mich das so? Fühlte ich mich irgendwie missachtet, von oben herab behandelt? Warum mussten die Leute meine eigenen Ausfälle immer herunterspielen und sie einer angeblichen Nettigkeit zuschreiben? Ich verliebte mich gerade in eine Frau, die im sechsten Monat schwanger war, lag das etwa auch daran, dass ich zu nett war? Das war doch hirnrissig. Andererseits redete man nur so zu mir, in meiner Abwesenheit aber, das wusste ich genau, behauptete man das genaue Gegenteil, dass ich nicht ganz sauber sei, ein verschrobener Kerl, ein Gestörter. Was genauso übertrieben und idiotisch war, wie mich als den Netten hinzustellen. Zu nett, wenn ich dabei war; völlig bekloppt, wenn es hinter meinem Rücken geschah. Die Leute spinnen. Naja, man weiß schon, was ich meine.
Wenn ich schon unmöglich sagen konnte, woher meine Vorliebe für komplizierte Situationen, für merkwürdige Geschichten kam, konnte ich doch immerhin dazu stehen, mich vielleicht sogar offen dazu bekennen. Eben das hatte sich mit Florence geändert. Was wahrscheinlich ihrer Reife und Intelligenz geschuldet war, oder gar ihrem Rock’n’Roll. Mit ihr akzeptierte ich allmählich, dass diese seltsamen, diese nicht ganz koscheren Angelegenheiten meine eigene Entscheidung waren, dass ich mich empfänglich für sie zeigte. Für die Angelegenheiten, aber auch die Leute, die komplizierten, mit Macken behafteten Leute. Eine alleinstehende Vierzigjährige, im sechsten Monat schwanger, das war doch wie geschaffen für mich! Etwas daran erregte mich. Ihre Schwangerschaft erregte mich. Also sexuell, jetzt? Nicht sicher. Das war eine andere Art körperlicher Erregung, vielleicht die des Wettkämpfers, des Extremsportlers. Es durfte auf keinen Fall zu einfach sein, sonst konnte es schnell langweilig werden. Als hätte meine Geschichte mit Jenny mich derart traumatisiert, dass ich jetzt nur noch reagierte, wenn Aussicht auf Herausforderung bestand.
Aber glaubt ja nicht, dass ich mich für den Obermacker hielt, auch das wäre viel zu einfach, wenn ich nur ein auf Krawall gebürsteter, das Unglück herausfordernder Hitzkopf wäre, diese Art draufgängerischer, gedankenloser Typ. Auf mich traf das leider gar nicht zu. Ich hatte eine Heidenangst, ich sagte mir, dass ich hier nichts zu suchen hätte und völlig bescheuert sein musste, mich auf sowas einzulassen, und dass ich besser daran täte, an meinem Platz zu bleiben und mich für Mädels in meinem Alter zu interessieren. Fünfzehn Jahre älter als du? Und obendrein noch schwanger? Junge, haste dich mal angeguckt? Für wen hältst du dich eigentlich? Weißt du, wie du aussiehst? Glaubst wohl, du bist der tollste Hecht von allen, was? Moment, warte mal … Der nackte Rugbyspieler da auf dem Deckblatt des Dieux-du-Stade-Kalenders, bist du das etwa? Hahaha … Schon eigenartig, aber die Bilder, die in diesen Panikmomenten aufkamen, hoben jedes Mal meine körperlichen Schwächen hervor. Und doch bestand das Problem, sofern es überhaupt eins gab, nicht wirklich darin: Ich hatte keine Angst, zu schmächtig zu sein, sondern eher zu jung, zu grün hinter den Ohren; was, wenn es ihr nicht gehaltvoll genug, nicht komplex und tief genug war, wenn sie die Erfahrung vermisste, das Geheimnis in ihrem Gegenüber? Wenn sie mich anfangs nur für meine Frische ausgewählt hatte, meine Sorglosigkeit, es dann aber leid sein, sich langweilen würde, ziemlich schnell von mir angeödet wäre?
3
Auch ich bin mit siebzehn von meinen Eltern weg. Mit siebzehn, weil ich im September geboren bin, aber es war das Jahr meines achtzehnten Geburtstags. Das Jahr meiner Hochschulreife, die ich ohne jede Auszeichnung erworben hatte, aber auf der allgemeinen Oberstufe, mit Schwerpunkt Wirtschaft und Sozialkunde. Wie Florence mit Martial bin ich mit meiner damaligen Freundin weg, und das war’s dann auch schon mit den Gemeinsamkeiten in unseren beiden Geschichten. Meine Freundin war kein bisschen Rock’n’Roll. Wir waren seit der Neunten ein Paar. In der Mittelstufe und vor allem in der Oberstufe gehörten wir zur ziemlich mickrigen Kategorie der süßen Pärchen. Immer Händchen haltend und sich umarmend, eher locker und entspannt, als sei es ganz natürlich, in diesem Alter schon zusammen zu sein. Wir bildeten ein vernünftiges, putzig-ernstes Pärchen, so seelenverwandt, dass die anderen uns noch im Altenheim zusammenleben sahen. Wir hatten dieselben Schwerpunktfächer gewählt, um in dieselbe Klasse zu kommen. Im letzten Jahr hatten wir vier Stunden Philosophie pro Woche, wobei uns weniger die Entdeckung von Kant, Nietzsche oder Sartre geprägt hat als von Freud und Jung, die Einführung in die Psychoanalyse. Also haben wir uns an der psychologischen Fakultät in Besançon eingeschrieben. Jenny paukte im Grundstudium sogar für den Doppelabschluss, denn sie belegte auch Geschichte. Sie wollte Lehrerin werden und arbeitete gezielt darauf hin. Sie redete bereits von der Auswahlprüfung, die doch frühestens in vier Jahren anstand. Sie beeindruckte mich, ich war längst nicht so weitsichtig und diszipliniert, längst nicht so gut organisiert und vor allem nicht so auf Zack. Sie war es, die unsere Unterkunft auswählte – fürs erste Jahr eine Vier-Zimmer-Wohnung mit drei Schlafräumen, sodass wir zwei Mitbewohner brauchten, was sie ebenfalls in die Hand nahm. Sie war es auch, die die Putz- und Einkaufspläne schrieb, sie war es, die über die Abende bestimmte, an denen wir ausgingen, über die Filme, die wir uns im Kino ansahen. Solange ich Jenny an meiner Seite hatte, war mir der Rest egal. Ich schaffte es einfach nicht, mir meine Zukunft auszumalen, es schien mir zu früh dafür, und es interessierte mich auch nicht, nicht die Bohne, ich wusste bloß, dass ich weder Seelenklempner noch Lehrer werden wollte. Wenn man mich fragte, kam mir nichts anderes als Fotograf in den Sinn. Bevor ich nach Besançon gegangen war, hatte ich die Analogkamera meines Vaters an mich genommen, eine alte Canon mit drei Objektiven, 50 mm, 70-300 mm Zoom und ein Weitwinkel, und so schoss ich haufenweise Fotos von Jenny oder unseren Kumpels, auf Partys, auf der Straße, in der Uni, ja sogar in den Kursen. Die Entwicklung war so teuer, dass ich die Filme in einem Schuhkarton von La Halle aux Chaussures hortete, darauf wartend, im Lotto zu gewinnen oder mein eigenes Labor zu bekommen. Während des Studienjahrs jobbte ich fünfzehn Stunden die Woche bei Fastfood-Ketten, zuerst ein Jahr bei Mäckes in Planoise, der abseits der Stadt gelegenen Hochhaussiedlung, die beiden letzten Jahre dann in einer Filiale von Brioche-Dorée mitten im Zentrum. Für die großen Ferien ging ich nach Saint-Claude zurück und jobbte als Leiharbeiter, die ersten zwei, drei Wochen immer in der Fabrik oder auf dem Bau, ehe ich dann alles daransetzte, in die großen Geschäfte zu kommen. Supermärkte und Großsupermärkte gefielen mir mit Abstand am besten, nicht so eintönig wie die Fabrik und körperlich nicht so anstrengend wie die Baustellen. Ich räumte meine Paletten leer, füllte die Regale auf, hantierte während der Öffnungszeiten zwischen den Kunden; als Leiharbeiter war ich freier als die richtigen Angestellten, ich trug nicht das Firmen-Shirt, weshalb man mich schlechter erkannte und folglich auch weniger überwachte. Ich stürzte mich auf jede Gelegenheit, meinen Posten zu verlassen und ein Omalein bis zum Regal mit den Zahnstochern, den Batterien oder Plastiktellern zu eskortieren: Bitte schön, Madame, gern geschehen, schönen Tag noch! Freitags sympathisierte ich mit den Produkt-Promotern, die im Umkreis ihres Stehpults aus Pappe mal einen neuen Schrubber vorführten, mal ein revolutionäres Reinigungstuch; ich duzte jeden, ließ mich von den ältesten Angestellten verhätscheln, fuhr durch die Lagerräume, indem ich meinen Hubwagen wie einen Roller benutzte, mit erhobener Brust, durchgestrecktem Rücken, die Bewegungen stets fließend.





























