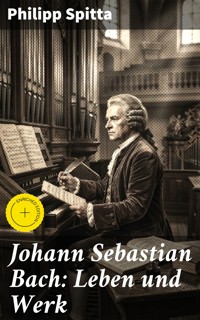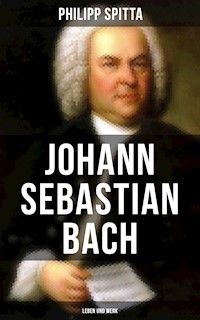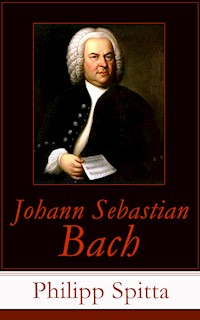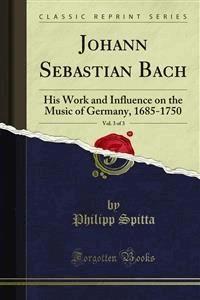1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Booksell-Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
In seinem umfassenden Werk "Johann Sebastian Bach" setzt sich Philipp Spitta mit dem Leben und Schaffen des großen Komponisten auseinander und bietet eine tiefgehende Analyse seiner Musik sowie der kulturellen und historischen Kontexte, in denen Bach lebte. Spitta nutzt einen sowohl biografischen als auch musikgeschichtlichen Ansatz, um die Entwicklung von Bachs Stil und seine bedeutende Rolle in der Musikgeschichte zu beleuchten. Die detailreiche Erzählweise und die fundierte Recherche machen das Werk zu einer entscheidenden Quelle für das Verständnis von Bachs Einfluss auf die westliche Musiktradition. Philipp Spitta, ein deutscher Musikwissenschaftler und Zeitgenosse des 19. Jahrhunderts, war zeitlebens von der Musik Bachs fasziniert. Sein analytisches Denken und seine Leidenschaft für die Musik führten ihn nicht nur zu einer tiefen Auseinandersetzung mit der Materie, sondern auch zu umfangreichen Schriften, die im damaligen Musik-Diskurs wegweisend waren. Spitta war bestrebt, eine Brücke zwischen historischer Analyse und emotionaler Interpretation zu schlagen, was sich in diesem Werk deutlich niederschlägt. Für alle, die sich für die Musikgeschichte und insbesondere für das Werk von Johann Sebastian Bach interessieren, ist dieses Buch ein unverzichtbares Fundament. Es bietet nicht nur wertvolle Einsichten in Bachs Lebensumstände und musikalische Innovationskraft, sondern ist auch ein hervorragendes Beispiel für die kunstvolle Verbindung von Wissenschaft und künstlerischem Ausdruck. Spittas Werk ist sowohl für Fachleute als auch für Laien gleichermaßen zugänglich und wird sicher zum Verständnis von Bachs Genialität maßgeblich beitragen. In dieser bereicherten Ausgabe haben wir mit großer Sorgfalt zusätzlichen Mehrwert für Ihr Leseerlebnis geschaffen: - Eine prägnante Einführung verortet die zeitlose Anziehungskraft und Themen des Werkes. - Die Synopsis skizziert die Haupthandlung und hebt wichtige Entwicklungen hervor, ohne entscheidende Wendungen zu verraten. - Ein ausführlicher historischer Kontext versetzt Sie in die Ereignisse und Einflüsse der Epoche, die das Schreiben geprägt haben. - Eine gründliche Analyse seziert Symbole, Motive und Charakterentwicklungen, um tiefere Bedeutungen offenzulegen. - Reflexionsfragen laden Sie dazu ein, sich persönlich mit den Botschaften des Werkes auseinanderzusetzen und sie mit dem modernen Leben in Verbindung zu bringen. - Sorgfältig ausgewählte unvergessliche Zitate heben Momente literarischer Brillanz hervor. - Interaktive Fußnoten erklären ungewöhnliche Referenzen, historische Anspielungen und veraltete Ausdrücke für eine mühelose, besser informierte Lektüre.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Johann Sebastian Bach
Inhaltsverzeichnis
Einführung
Zwischen dem historisch greifbaren Handwerk eines barocken Stadtmusikanten und der nachromantischen Idee des schöpferischen Genies spannt Philipp Spitta in Johann Sebastian Bach einen Erkenntnisbogen, der aus Dokumenten, Klangvorstellungen und kulturellem Kontext ein Bild formt, das die Aura des Unvergleichlichen nicht feiert, sondern begründet, und der die Wege eines Lebens in die Ordnungen von Kirche, Schule und Hof einzeichnet, ohne die innere Freiheit des Komponierens zu nivellieren, indem er die Spur von Ausbildungswegen, Amtsgeschäften und familiären Bindungen verfolgt und sie mit der Werkgestalt verschränkt, um Herkunft und Wirkung, Pflicht und Erfindung, Öffentlichkeit und persönliches Glaubensleben kontrolliert zusammenzuführen.
Spittas Studie ist eine musikwissenschaftliche Biografie in zwei Bänden, zuerst 1873 und 1880 erschienen, und zählt zu den Gründungstexten einer sich im späten 19. Jahrhundert institutionalisierenden Musikgeschichtsschreibung. Als Schauplatz entfaltet sie das Mitteldeutschland der Bach-Zeit: Residenzen und Stadtgemeinden wie Eisenach, Arnstadt, Mühlhausen, Weimar, Köthen und Leipzig erscheinen als klingende Institutionenräume, in denen Ausbildung, Amt und Aufführung ineinandergreifen. Die Publikationsgeschichte verortet das Unternehmen in einer Epoche, die Quellenkritik, Archivarbeit und systematische Werkerschließung programmatisch erhebt. Spittas Buch steht somit an der Schnittstelle von nationaler Kulturgeschichtsschreibung und international anschlussfähiger Forschungspraxis und prägt beides nachhaltig.
Ausgangspunkt ist Bachs Einbettung in eine thüringische Musikerfamilie und die frühen sozialen und pädagogischen Umgebungen, aus denen seine Laufbahn wächst; Spitta setzt bei überlieferten Namen, Ämtern, Lehrzusammenhängen und lokalen Musikkulturen an und entfaltet daraus eine behutsame Annäherung. Das Leseerlebnis wird von einer gelehrten, ruhigen Stimme getragen, die sich Präzision und Weitblick zugleich auferlegt. Der Ton bleibt sachlich, respektvoll, gelegentlich mit leiser Empathie, während der Stil lange, sorgfältig gebaute Perioden und dichte Begriffsklärungen bevorzugt. Man liest weniger eine Erzählung des Sensationellen als eine kontrollierte Vertiefung in Voraussetzungen, Praktiken und Wirklichkeiten des Komponierens.
Methodisch verbindet Spitta akribische Quellenarbeit mit Werkanalyse: Kirchenbücher, Amtsprotokolle, Briefzeugnisse und zeitgenössische Beschreibungen werden geprüft, kontextualisiert und mit musikalischen Befunden verschränkt. Die Kapitel schreiten von dokumentierten Lebensstationen zu Fragen der Gattung, Technik und Form, ohne den Anschluss an institutionelle Rahmenbedingungen zu lösen. So entsteht eine Chronologie, die keine bloße Abfolge von Daten bleibt, sondern als Matrix für stilgeschichtliche Beobachtungen dient. Analysen von Kantaten, Orgelwerken und Instrumentalmusik werden nicht als Selbstzweck geboten, sondern als Instrument, um Werkentstehung, Gebrauchssinn und ästhetischen Anspruch in den jeweiligen liturgischen und gesellschaftlichen Funktionen zu beleuchten. Dabei meidet Spitta effekthascherische Wertungen zugunsten überprüfbarer Argumente.
Im Zentrum stehen Themen, die Leben und Werk wechselseitig erklären: die protestantische Kirchenmusik als institutioneller Rahmen und geistige Ressource; das Verhältnis von Tradition und Erneuerung; Komponieren als Übung, Dienst und künstlerische Selbstbestimmung; Bildung, Genealogie und Mentorschaft; die sozialen Räume der Aufführung und ihre Regeln. Spitta zeichnet Bach weder als isolierte Ausnahme noch als bloßes Produkt seiner Umgebung, sondern als Persönlichkeit, deren Meisterschaft sich in konkreten Aufgaben bewährt. Diese thematische Verschränkung ermöglicht eine Lektüre, die die historische Fremdheit nicht verkleidet, sondern fruchtbar macht, und zugleich die anhaltende Modernität der musikalischen Problemlösungen sichtbar werden lässt.
Für heutige Leserinnen und Leser bleibt das Buch relevant, weil es verlässliche Grundlagen mit einer reflektierten Erzählform verbindet. Vieles in der Bach-Forschung ist seither verfeinert, korrigiert oder um neue Quellen erweitert worden; doch Spittas Maßstäbe der Dokumentation, sein Sinn für institutionelle Kontexte und seine beharrliche Quellenkritik sind weiterhin vorbildlich. Zudem macht die Studie sichtbar, wie Kanonbildung, nationale Erinnerung und wissenschaftliche Methode einander beeinflussen. Wer sich für historisch informierte Aufführungspraxis, Musikpädagogik oder Kulturgeschichte interessiert, findet hier Orientierungswissen und methodische Anregungen, ohne auf die anspruchsvolle, aber lohnende Langsamkeit des gelehrten 19. Jahrhunderts verzichten zu müssen.
Diese Einleitung lädt dazu ein, Spittas Bach nicht als abgeschlossenes Denkmal, sondern als Forschungs- und Leseerfahrung zu betreten. Man kann das Buch chronologisch verfolgen oder thematisch queren, etwa entlang der Institutionen, der Gattungen oder der Werkentstehungsprozesse. Wer den Text mit Hörbeispielen begleitet, gewinnt zusätzliche Anschauung, doch die Argumente tragen auch für sich. Der Gewinn liegt in der geduldigen Verknüpfung von Lebenssachverhalt und musikalischer Form. So öffnet die Lektüre einen historisch informierten Zugang zu einer Kunst, deren Strenge und Erfindungslust bis heute inspiriert, ohne das Geheimnis ihres Gelingens zu banalisieren vermag.
Synopsis
Philipp Spittas 'Johann Sebastian Bach' erschien in zwei Bänden zwischen 1873 und 1880 und gilt als grundlegende wissenschaftliche Biographie des Komponisten. Das Werk verfolgt das Ziel, Leben, Werk und Umfeld Bachs systematisch zu erschließen und in einen verlässlichen historischen Zusammenhang zu stellen. Spitta stützt sich auf Archivalien, zeitgenössische Berichte und eine umfassende Analyse der Musik, um eine chronologische Darstellung zu ermöglichen. Die Darstellung verbindet Lebenslauf, Gattungsübersichten und stilkritische Beobachtungen, ohne sich in Anekdoten zu verlieren. Leitend ist die Frage, wie sich Bachs künstlerische Entwicklung aus seinem beruflichen Auftrag, seiner Bildung und den kirchlich-städtischen Institutionen heraus formte.
Die frühen Kapitel widmen sich Bachs Herkunft aus einer weitverzweigten thüringisch‑sächsischen Musikerfamilie und dem lutherischen Milieu, das seine Ausbildung prägte. Spitta zeichnet nach, wie Handwerkstradition, Kirchenpraxis und Schulwesen die Grundlagen für Bachs Technik und Hörwelt legten. Er ordnet die ersten nachweisbaren Tätigkeiten des jungen Organisten und Violinisten in regionale Netzwerke von Hof- und Stadtkapellen ein und prüft die Überlieferung kritisch. Im Mittelpunkt steht, wie sich aus Unterricht, eigener Anschauung und dienstlichen Aufgaben ein persönliches Profil herausbildete. Der Autor betont dabei Kontinuitäten der Arbeitsweise ebenso wie erste Impulse, die Bachs Interesse an komplexer Polyphonie lenkten.
Im weiteren Verlauf verfolgt Spitta Bachs berufliche Stationen vor Leipzig, darunter Stadt- und Hofdienste in Mühlhausen, Weimar und Köthen. Er zeigt, wie sich Aufgabenprofil und künstlerische Ziele je nach Institution verschoben: von der Pflege der Orgel- und Tastenmusik über instrumentale Ensemblepraxis bis zur Ausarbeitung größerer geistlicher Formate. Zugleich treten Konfliktfelder hervor, etwa Erwartungen von Vorgesetzten, Ressourcenfragen und der Anspruch, musikalische Qualität über Routinen zu stellen. Spitta macht an Repertoire, Handschriften und zeitnahen Zeugnissen fest, wie Bach experimentiert, frühreife Techniken konsolidiert und ein eigenes Maß für kontrapunktische Strenge und expressive Vielfalt entwickelt.
Ein Schwerpunkt liegt auf der Leipziger Zeit als Thomaskantor, in der sich pädagogische, liturgische und organisatorische Pflichten bündelten. Spitta beschreibt den Arbeitsalltag zwischen Unterricht, Proben, Gottesdiensten und Festmusiken sowie den Rahmen, in dem mehrjährige Kantatenfolgen und großangelegte Kirchenwerke entstanden. Er beleuchtet die Zusammenarbeit mit Schülern, Kopisten und städtischen Gremien, die Verlagskontakte und die Bewältigung praktischer Hürden. Zentrale Spannungen ergeben sich aus der Bindung an liturgische Funktionen einerseits und einem hohen kompositorischen Anspruch andererseits. Die Darstellung betont, wie Bach seine Produktionsweisen systematisierte und dennoch Raum für Erfindung, Variation und gelehrte Kunst behielt.
Breiten Raum nehmen analytische Kapitel zu Gattungen und Techniken ein. Spitta erörtert Orgel- und Clavierwerke, Kammer- und Orchesterstücke sowie geistliche Vokalmusik, prüft Zuschreibungen und datiert Werkgruppen anhand stilistischer und materieller Kriterien. Er beschreibt die Rolle des Chorals, die Verfahren der Fuge, der Variation und der motivischen Arbeit und vergleicht Bach mit Vorgängern und Zeitgenossen, ohne ihn auf Einflüsse zu reduzieren. Leitfragen sind: Wie organisiert Bach komplexe Mehrstimmigkeit? Wie verbindet er Gelehrsamkeit und Affekt? Spittas Vorgehen verbindet Formanalyse mit Quellenkritik und zeichnet Entwicklungslinien, statt isolierte Meisterstücke als Ausnahmen herauszustellen. Dabei bleibt die Darstellung nah an konkreten Notentexten und vermeidet spekulative Deutungen.
Ein weiterer Strang gilt der Überlieferung und Wirkung. Spitta verfolgt, wie Werke im Familien- und Schülerkreis weitergegeben, teilweise gedruckt, vielfach aber als Handschriften bewahrt wurden, und welche Konsequenzen das für Rezeption und Aufführung hatte. Er schildert Veränderungen im Ansehen Bachs von der unmittelbaren Nachwirkung über das späte 18. bis ins 19. Jahrhundert, als sein Werk in gelehrten und praktischen Kreisen neu bewertet wurde. Dabei diskutiert er Aufführungsmodalitäten, Instrumentarium und Besetzungsfragen aus den Quellen heraus und zeigt, wie Editionsarbeit und Forschung die Wahrnehmung und Zugänglichkeit der Musik allmählich erweiterten. Kontextualisierung bleibt leitend.
Am Ende steht ein geschlossenes Bild eines Komponisten, dessen Werk nach Spitta die polyphone Kunst auf einen Gipfel führt und zugleich aus konkreten sozialen, liturgischen und pädagogischen Funktionen hervorgeht. Die Biographie formuliert Maßstäbe der musikgeschichtlichen Darstellung: quellennahe Argumentation, sorgfältige Chronologie und die Verknüpfung von Analyse und Kontext. Ohne endgültige Urteile zu erzwingen, macht das Buch nachvollziehbar, warum Bach als zentraler Bezugspunkt für das Verständnis europäischer Musik gilt. Seine nachhaltige Wirkung liegt darin, Forschung und Hörpraxis mit einer belastbaren Erzählung zu versehen, die differenziert, prüfbar und bis heute anregend bleibt und Orientierung bietet.
Historischer Kontext
Philipp Spittas monumentale Bach-Biographie entstand im Deutschen Kaiserreich der 1870er und 1880er Jahre, mit Berlin und Leipzig als entscheidenden Zentren. Spitta (1841–1894) wirkte ab 1875 an der Universität Berlin; sein Werk erschien 1873 und 1880 bei Breitkopf & Härtel in Leipzig. Prägende Institutionen waren die Bach-Gesellschaft, die seit 1850 Bachs Werke edierte, die Sing-Akademie zu Berlin mit bedeutenden Beständen, sowie staatliche und städtische Archive in Thüringen und Sachsen. Das Umfeld universitärer Geschichtswissenschaft, Archivwesen und Verlagswesen bot Spitta die Infrastruktur, seine Biographie als gelehrte Studie mit umfassender Quellenbasis und systematischer Methodik zu verfassen.
Vor Spitta hatte Johann Nikolaus Forkel 1802 die erste Biographie Bachs vorgelegt; den öffentlichen Bach-Renaissance-Impuls gab 1829 Felix Mendelssohns Aufführung der Matthäus-Passion in Berlin. Die 1850 gegründete Bach-Gesellschaft begann eine Gesamtausgabe, die bis 1900 lief und maßgebliche Notentexte bereitstellte. Choralvereine und Oratorienfeste verbreiteten Bachs Vokalwerke im 19. Jahrhundert weit. Spitta knüpfte an diese erneuerte Aufmerksamkeit an, erweiterte sie jedoch um eine historisch-kritische Durchdringung von Leben, Werk und Wirkung. Seine zweibändige Darstellung verband Lebenslauf, Quellenkritik und Werkbesprechung zu einem kohärenten Bild des Komponisten innerhalb der Musik- und Kulturgeschichte. Er bezog Kirchen- und Stadtakten ebenso ein wie frühere biographische Zeugnisse.
Nach der Reichsgründung 1871 förderten preußische und deutsche Einrichtungen Forschung und Editionen, was der Musikwissenschaft institutionelle Stabilität gab. Berlin mit Universität, Bibliotheken und der Hochschule für Musik sowie Leipzig mit seinen Verlagen wurden Knotenpunkte. Breitkopf & Härtel verfügte über Netzwerke zu Sammlern, Kirchen und Archivaren, die Quellen erschlossen. Die Staatsbibliothek und städtische Archive bewahrten Akten zu Thomaskirche, Thomanerchor und Leipziger Ratsverwaltung, die für Bachs Amtsführung relevant waren. In diesem Gefüge aus Staat, Stadt, Kirche und Verlag entstand ein verlässlicher Informationskreislauf, den Spitta für seine biographisch-analytische Rekonstruktion produktiv nutzte. Auch regionale Kirchenarchive trugen Material bei.
Spitta arbeitete methodisch im Geist des 19.-Jahrhundert-Historismus: Autographen, Amtsbücher, Kirchenregister, Ratsprotokolle und zeitgenössische Drucke wurden systematisch gesichtet, verglichen und datiert. Er reiste in die für Bach zentralen Orte in Thüringen und Sachsen, darunter Eisenach, Arnstadt, Mühlhausen, Weimar, Köthen und Leipzig, um lokale Überlieferungen zu prüfen. Seine Chronologie von Bachs Ämtern und Gattungsentwicklungen band kirchenmusikalische Praxis, Hofdienst und bürgerliche Musikkultur eng aneinander. Durch detaillierte Werk- und Quellenbeschreibungen legte Spitta eine Grundlage, auf der spätere Kataloge, Editionen und Archivarbeiten aufbauen konnten. Er diskutierte Kriterien der Autorschaft und Datierung im Lichte vorhandener Handschriften und Abschriften.
Zeitgleich entfalteten sich Debatten über Programmmusik und absolute Musik. In Berlin wirkten konservativ geprägte Musiker wie Joseph Joachim; zugleich prägten Wagnerianer andernorts den Diskurs. Spitta positionierte Bach als Maßstab kontrapunktischer Kunst und historischer Kontinuität, ohne in tagesästhetische Polemik zu verfallen. 1885 gründete er gemeinsam mit Friedrich Chrysander und Guido Adler die Vierteljahrsschrift für Musikwissenschaft, die methodische Standards und internationale Vernetzung der Disziplin förderte. Der biographische Zugriff auf Bach, flankiert von quellennahen Editionen, bot der Hochschul- und Konzertpraxis ein normatives Referenzsystem jenseits kurzfristiger Stilkämpfe. Er lehrte Musikgeschichte an der Universität Berlin und prägte dort Generationen von Studierenden.
Die Ausweitung des Konzert- und Vereinswesens im 19. Jahrhundert veränderte die Aufführung von Bach: Kantaten, Oratorien und Orgelwerke fanden außerhalb liturgischer Kontexte neue Orte. Editionen passten Notation und Besetzungen an zeitgenössische Gewohnheiten an, was Wiederaufführungen erheblich erleichterte. Spitta dokumentierte diese Entwicklung, indem er Werkgruppen historisch verortete und liturgische, höfische und bürgerliche Rahmenbedingungen beschrieb. So entstand ein Bezugssystem, das Kantatenzyklen, Passionen und Clavierwerke für Chorleiter, Organisten und Verleger systematisch erschloss. Seine Darstellung knüpfte musikhistorische Erkenntnis unmittelbar an die praktische Pflege des Bach-Repertoires. Gleichzeitig professionalisierten sich Chor- und Organistenausbildung, die Bachs Werke als Lehr- und Prüfungsstoff nutzten.
Spittas Johann Sebastian Bach wurde rasch zu einem Standardwerk. Eine englische Übersetzung von Clara Bell und J. A. Fuller-Maitland erschien 1884–1885 in drei Bänden und verbreitete seine Ergebnisse im englischsprachigen Raum. Im 20. Jahrhundert bauten unter anderem Albert Schweitzer (1905 französisch, 1908 deutsch) und Arnold Schering auf Spittas Forschung auf, auch wenn Einzelheiten später revidiert wurden. Die Biographie prägte Katalogisierung, Quellenkritik und das Bild Bachs in Enzyklopädien, Konzertprogrammen und Lehrplänen weit über Deutschland hinaus und blieb über Jahrzehnte der wichtigste Bezugspunkt. Sie beeinflusste zudem Editionen und Bibliographien und etablierte zahlreiche bis heute gebräuchliche Termini und Ordnungsschemata.
Als Kommentar zu seiner Epoche spiegelt Spittas Buch den historischen Positivismus, die protestantisch geprägte Bildungskultur und die Kanonbildung des nach 1871 geeinten Deutschland. Es verbindet nationale Erinnerung, Archivwissenschaft und philologische Strenge zu einem Modell musikalischer Biographie, das lange wirksam blieb. Zugleich macht es sichtbar, wie eng universitäre Forschung, Verlagswesen und Vereinsleben im 19. Jahrhundert kooperierten. Trotz späterer Erweiterungen der Quellenlage und veränderter Aufführungsästhetik bietet Spittas Darstellung eine belastbare Grundlage, auf der die Bach-Forschung weiterarbeitet, und ein prägnantes Zeugnis des Selbstverständnisses der frühen Musikwissenschaft. Damit wurde Bach zugleich als historische Figur und als moderner Klassiker verankert.
Johann Sebastian Bach
Erster Band
Inhalt
Vorwort.
Das Werk, dessen erste Hälfte ich hiermit der Oeffentlichkeit übergebe, trägt als Anzeichen seines Inhalts einen schlichten Personennamen. Die Kürze der Fassung entsprang nicht dem Verlangen, ein Verfahren nur nachzuahmen, das, bei umfassenden und gründlichen biographischen Arbeiten seither mit einer gewissen Berechtigung angewendet, allmählig zur gedankenlosen Mode zu werden droht. Allerdings bilden Leben und Werke Johann Sebastian Bachs des Buches hauptsächlichen und im weiteren Fortschreiten immer ausschließlicheren Gegenstand. Aber wenn es unbestritten ist, daß jede Individualität nur dann richtig und vollständig gewürdigt werden kann, wenn die Verhältnisse klar entfaltet vorliegen, aus und unter denen, und die Wirkungen, zu denen sie sich entwickelte, so muß dieser Grundsatz ausgedehnteste Gültigkeit erlangen für einen Mann, der in der deutschen Musik der letzten drei Jahrhunderte gleichsam den Knotenpunkt bildet, welchem alle früheren Richtungen einer neuen Periode convergirend zustreben, um aus ihm zu frischen Wirkungen sich zu vereinzeln. Dieses letztere ausführlich darzustellen, konnte nun freilich meine Aufgabe um so weniger sein, als überhaupt wohl die Zeit noch nicht gekommen ist, über den tiefgreifenden Einfluß der Bachschen Kunst namentlich auf die Musik des 19. Jahrhunderts das letzte Wort zu sprechen. Aber in dem vorausliegenden Zeitraume die Fäden auszusondern, welche jenen Knoten schürzen sollten, den Ursachen nachzuspüren, warum sie grade in einer Persönlichkeit wie Bach zusammenlaufen konnten, eine solche Forderung war unabweislich, wenn die Absicht dahin ging, von der Großartigkeit dieser Künstlererscheinung auch nur eine annähernde Vorstellung zu geben. Je mächtiger und verzweigter nun die Wurzeln sind, mit denen sie im Erdreich des deutschen Lebens und Wesens haftet, in desto weiterem Umkreise mußte ich das Gebiet aufgraben, um dieselben bloß zu legen. So wird der Leser mancherlei in diesem Buche finden, was er in einem »Leben« Sebastian Bachs nicht suchen würde, was aber trotzdem mit ihm im innigsten, unlösbaren Zusammenhange steht. Und dieser Beschaffenheit des Werkes, denke ich, wird seine Bezeichnung entsprechen.
Der Versuch einer solchen umfassenden Darstellung ist bis jetzt nicht gemacht worden. Doch fehlt es nicht an Schriften, welche die äußeren Lebensereignisse Bachs oder auch gewisse Seiten seiner künstlerischen Thätigkeit zum Gegenstande haben. Unter ihnen ist die bei weitem werthvollste der Nekrolog[1], welcher vier Jahre nach des Meisters Tode in L. Chr. Mizlers Musikalischer Bibliothek Bd. IV, Th. 1. Leipzig, 1754. S. 158–176 veröffentlicht wurde. Schon daß er zu einer Zeit ans Licht trat, als die Erinnerung an Bach noch ganz frisch war, zumal an der Stätte, wo er 27 Jahre lang gewirkt hatte, gewährt seinen Mittheilungen einen hohen Grad von Glaubwürdigkeit, viel mehr aber noch der Umstand, daß er von dem zweiten Sohne des Verstorbenen, Karl Philipp Emanuel Bach, und einem trefflichen einstmaligen Schüler, Johann Friedrich Agricola, verfaßt ist. Offenbar vereinigten sich beide zu diesem Zwecke deshalb, weil Agricola Sebastian Bachs Unterweisung genoß, als der Sohn schon nicht mehr im Elternhause weilte, und somit manches als unmittelbarer Zeuge erlebte, was jener nur auf indirectem Wege erfahren konnte; auch zu Jakob Adlungs Musica mechanica organoedi (Berlin, 1768) hat Agricola noch eine Reihe von schätzbaren auf seinen großen Lehrer bezüglichen Anmerkungen geliefert. Die schlichte Schilderung von Bachs Leben und künstlerischem Vermögen, welche der Nekrolog nebst einer summarischen Uebersicht seiner Compositionen enthält, haben nun fast alle späteren sogenannten Biographen ausgeschrieben. So zuerst Johann Adam Hiller, Lebensbeschreibungen berühmter Musikgelehrten und Tonkünstler neuerer Zeit. 1. Theil. Leipzig, 1784. S. 9–29. Diesem folgte dann wieder Ernst Ludwig Gerber, Historisch-Biogra phisches Lexicon der Tonkünstler. 1. Theil. Leipzig, 1790. Sp. 86 ff., ohne, wie es scheint, zu bemerken, woher Hiller seine Kenntnisse geschöpft hatte. Doch finden sich auch bei Gerber hier und an andren Stellen beachtenswerthe Originalbemerkungen, die auf die Erzählungen seines Vaters, eines Schülers von Seb. Bach, begründet sind. Ein seltsames biographisches Elaborat steht bei Hirsching, Historisch-literarisches Handbuch berühmter und denkwürdiger Personen, welche im 18. Jahrhundert gestorben sind. 1. Band. Leipzig, Schwickert. 1794. S. 77–80. Hier werden zuerst die Daten des Nekrologs ungefähr und mit manchen Fehlern reproducirt; dann folgt eine Charakteristik; diese wurde den »Proben aus Schubarts Aesthetik der Tonkunst« entnommen, welche dessen Sohn Ludwig Schubart in der Deutschen Monatsschrift. Berlin, Vieweg. 1793. St. 1. veröffentlicht hatte. Zu geben ist natürlich auf diese Phantasmen nichts, auch dort nicht, wo etwas thatsächliches hindurchschimmert, dessen Unrichtigkeit sich nicht sofort beweisen läßt. C.A. Siebigke, Museum berühmter Tonkünstler. Breslau, 1801. S. 3–30, wiederholt Gerber und Hiller, d.h. den Nekrolog, fügt jedoch einige gute Bemerkungen über Bachs Stil hinzu. Bei J.Ch.W. Kühnau, Die blinden Tonkünstler. Berlin, 1810, und J.E. Großer, Lebensbeschreibung des Kapellmeister u.s.w. Johann Sebastian Bach. Breslau, 1834. S. 7–64 ist nicht einmal Selbständigkeit des musikalischen Urtheils vorhanden, von eigner Forschung kann, Gerber zum Theil ausgenommen, bei keinem von allen diesen die Rede sein.
Den ersten Fortschritt, der seit dem Mizlerschen Nekrologe in in der Bach-Litteratur geschah, bezeichnet J.N. Forkel[2]s Schrift: Ueber Johann Sebastian Bachs Leben, Kunst und Kunstwerke. Für patriotische Verehrer echter musikalischer Kunst. Leipzig, bey Hoffmeister und Kühnel (Bureau de Musique[3]). 1802. 4. X und 69 S.S. mit Notenbeilagen, von der im Jahre 1855 eine neue Ausgabe erschien. Forkel, der gründlichste deutsche Musikgelehrte seiner Zeit und ein leidenschaftlicher Verehrer der Kunst Seb. Bachs, stand mit den ältesten beiden Söhnen desselben im persönlichen Verkehr. Hierdurch kam er in Besitz eines reichen Materials, das er in jene Schrift verarbeitete. Hinsichtlich der Lebensnachrichten geht selbst er kaum über den Inhalt des Nekrologs hinaus, wohl aber in der Schilderung, von Bachs Eigenschaften als Orgel- und Clavier-Spieler, als Tonsetzer, Lehrer, Familienvater. So werthvoll nun also Forkels Buch als Quelle ist, und so wenig man ihm wird vorwerfen dürfen, er habe irgend etwas darin ganz aus der Luft gegriffen, mit Vorsicht muß es dennoch benutzt werden. Da er nämlich die thatsächlichen Ueberlieferungen und Urtheile der Bachschen Söhne von seinen eignen Meinungen nicht getrennt, vielmehr in eine fortlaufende Darstellung verarbeitet hat, so weiß man oft nicht, wo dasjenige anfängt oder aufhört, was eben diese Quelle so außerordentlich schätzbar macht. Denn Forkels eignes Urtheil ist selbst über Bach oft auffällig befangen. Nicht selten führt die Forschung auf eignem Wege zu einem Resultate, welches mit einer Aeußerung Forkels derart übereinstimmt, daß über die reine Quelle, aus der er sie schöpfte, kein Zweifel bleibt. Dann aber befremden wieder offenbare Unrichtigkeiten oder die Entdeckung, daß er günstigsten Falls seine Gewährsmänner mißverstanden haben muß. Endlich ist immer zu bedenken, daß auch Bachs Söhne irren konnten. Daher muß man wohl dieses Buch bei jedem Schritte berücksichtigen, darf aber, um möglichst sicher zu gehen, keinen Satz desselben ungeprüft lassen.
Mit Bezug auf den hundertjährigen Todestag Bachs, der am 28. Juli 1850 eintrat, erschienen zwei Erinnerungsschriften über ihn. Die eine: Johann Sebastian Bachs Lebensbild. Eine Denkschrift u.s.w. aus Thüringen, seinem Vaterlande. Vom Pfarrer Dr. J.K. Schauer, Jena, Fr. Luden. 1850. 8. VII und 38 S.S., faßt ihrem Zwecke gemäß das bis dahin allgemeiner Bekannte kurz und meistens correct zusammen, ist gewissenhaft in der Quellenangabe und bietet ein fleißiges Verzeichniß der durch Stich und Druck veröffentlichten Compositionen; tieferes Kunstverständniß verräth sie nicht. Eingehender läßt sich auf seinen Gegenstand der zweite Saecularschriftsteller ein, C.L. Hilgenfeldt, Johann Sebastian Bachs Leben, Wirken und Werke. Ein Beitrag zur Kunstgeschichte des achtzehnten Jahrhunderts. Leipzig, Friedrich Hofmeister. 4. X und 182 S.S. mit Notenbeilagen. Das Buch ist mit ernstem Sinne geschrieben und macht insofern einen kleinen Fortschritt über Forkel hinaus, als der Verfasser aus der Litteratur des vorigen Jahrhunderts eine Anzahl von Daten und Urtheilen über Bach mit Sorgfalt gesammelt und in seine Darstellung verwoben hat. Auch über die Vorfahren Bachs hat er zum ersten Male Ausführlicheres bekannt gemacht und eine Uebersicht der Bachschen Compositionen gegeben, an der wenigstens der Fleiß Achtung verdient. Historische Auffassung freilich und wissenschaftliche Methode darf man nicht von ihm verlangen; seine Kunsturtheile, seine geschichtlichen Um- und Rückblicke sind, wie überhaupt das Ganze, schief und dilettantisch. Da aber der Verfasser selbst über seine Kräfte bescheiden denkt, wäre es unbillig, ihm weitere Vorwürfe zu machen. Ein sonderbares litterarisches Product hat seitdem noch geliefert C.H. Bitter, Johann Sebastian Bach. 2 Bände. Berlin, F. Schneider. 1865. Fortgerissen von der historischen Strömung unserer Zeit sucht dieser Schriftsteller mit dem wissenschaftlichen Apparate zu operiren, aber ohne in irgend einer Weise dazu fähig zu sein. Dankenswerth ist allenfalls die Mittheilung einiger bis damals unbekannter Archivalien, denn dergleichen Schriftstücke haben, wie die Bücher, ihre Schicksale. Leider sind sie sehr flüchtig wiedergegeben. Alle Versuche zu historischen Entwicklungen und sonstigen Reflexionen wären zum Vortheil des Buches und Verfassers besser unterblieben. Etwas mehr hat derselbe mit einer späteren Arbeit geleistet: Carl Philipp Emanuel Bach und Wilhelm Friedemann Bach und deren Brüder. 2 Bände. Berlin, W. Müller. 1868; hier war freilich die Aufgabe auch sehr viel leichter.
Es geht aus dieser Uebersicht hervor, daß als wirkliche Quellen von mir nur der Nekrolog, Forkel und hier und da Gerber benutzt werden konnten. Um zu neuem Materiale zu gelangen, war neben einer genauen Musterung der mit Bach gleichzeitigen musikalischen Schriftsteller vor allem eine sorgfältige Durchforschung aller derjenigen Archive hothwendig, in denen allenfalls Spuren von Bachs Existenz als Bürger und Angestellter zu erwarten waren. Dann galt es nicht nur im allgemeinen die Verhältnisse seiner Zeit zu durchdringen, sondern auch für die verschiedenen Orte seines Aufenthalts jedesmal eine möglichst deutliche Vorstellung seiner Umgebung und äußern Thätigkeit zu gewinnen, den Andeutungen weiterer Zusammenhänge nachzuspüren, die Lebensschicksale von Personen zu verfolgen, mit denen er in Verbindung gestanden zu haben schien. Briefe hat Bach sicherlich nicht häufig geschrieben, am seltensten an Privatpersonen; auf dieses wichtigste biographische Mittel durfte von Anfang her nur in bescheidenstem Maße gerechnet werden. Desto erfreulicher war es, dennoch ein paar werthvolle Funde der Art zu thun. Ein unschätzbares Schriftstück ist der am 28. October 1730 von Leipzig aus an den Jugendfreund Georg Erdmann in Danzig gerichtete ausführliche Privatbrief, den ich durch die Hülfe meines lieben Freundes O. von Riesemann in Eeval aus dem Haupt-Staatsarchive zu Moskau wieder ans Licht ziehen konnte. Erdmann starb am 4. October 1736 als kaiserlich russischer Hofrath und Resident zu Danzig. Er hinterließ eine unmündige Tochter, ihre Erziehung sowie die Ordnung der ziemlich derangirten Verhältnisse übernahm ein Fräulein von Jannewitz, seine Schwägerin. Diese berichtete am 9. November 1736: »ich habe auch noch gantz alte briffe und Papir, welches mein seliger Schwager schon vor der bombardirung auff Einer aparten stube hat liegen gehabet, gleich als ich mich darauff bedacht in Einem Kuffer geleget und mit seinen Pittschaft 2. mahl versigelt, welge auch werde mit zu der andern versigelung geben.« Sie selber wollte Danzig als Wohnort aufgeben und diese Hinterlassenschaft war ihr beschwerlich. Unter den »gantz alten briffen« aber befand sich auch der Sebastian Bachs, welcher somit nebst den amtlichen Papieren Erdmanns nach Moskau wanderte und dort fast anderthalb hundert Jahre hindurch seiner Auferweckung entgegenschlummerte.
Gehören solche Autographe, deren Auffinden oft nur ein glücklicher Zufall bedingt, zu den Seltenheiten, so ist es um die autographen Compositionen Bachs bei weitem besser bestellt. Man darf wohl behaupten, daß sie zum größeren Theile noch existiren, und in einer nicht unbeträchtlichen Anzahl sind sie auch allgemeiner zugänglich. Dieselben haben aber nicht nur wegen ihres Kunstinhaltes einen unersetzlichen Werth, sie bieten auch bei richtiger Behandlung eine Fülle von biographischen Anhaltepunkten, durch die man oftmals selber in Verwunderung gesetzt wird. Die Quelle würde noch reichlicher fließen, wenn nicht die Entstehungszeit der meisten Werke verschwiegen wäre. Hier öffnet sich nun zur Begründung einer einigermaßen sicheren Chronologie für die diplomatische Kritik ein Arbeitsfeld, auf dem sie alle ihre Instrumente zur Anwendung bringen kann. Da die Bachschen Handschriften sich durch einen Zeitraum von mehr als vierzig Jahren erstrecken, so ist es eine keineswegs unlösbare Aufgabe, nach bestimmten Merkmalen der Schrift verschiedene Perioden derselben abzugränzen, wenn sich auch die Hand in ihren Grundzügen wunderbar beständig zeigt. Hinzu tritt die verschiedenartige Beschaffenheit des Papieres. Ein drittes allgemeines Moment ist bei Vocalcompositionen die Untersuchung des Textes. Die Haltung der von Bach componirten Poesien ist freilich meistens zu unbestimmt, als daß etwas thatsächliches daraus zu entnehmen wäre, obgleich in einzelnen Fällen auch dieses möglich ist. Sehr ergiebig kann dagegen das Bemühen werden, den Dichtern und Drucken der Texte auf die Spur zu kommen. Die Sitte der Zeit, nach welcher die poetischen Unterlagen der Kirchenmusiken gedruckt und unter die Gemeinde zum Nachlesen vertheilt zu werden pflegten, kommt dem entgegen und steckt meistens wenigstens nach einer Seite hin die Entstehungszeit ab. Der besondern Handhaben verschiedenster Art, welche oftmals die einzelnen Handschriften der Forschung bieten, soll hier natürlich nicht weiter gedacht werden. Von erheblichem Vortheil für meine Arbeit waren die Publicationen der Bach-Gesellschaft, welche jetzt bis zum 20. Jahrgange fortgeschritten sind; sie stützen sich meistens auf die bestmöglichen Quellen und sind, zumal wo W. Rust seine erfahrene Hand angelegt hat, Zeugnisse von großer kritischer Sorgfalt. Mit nicht geringerer Gewissenhaftigkeit besorgten F.C. Griepenkerl und F.A. Roitzsch die bei C.F. Peters in Leipzig erschienene Gesammt-Ausgabe der Instrumentalwerke Bachs, und A. Dörffel vervollständigte dieselbe im Jahre 1867 durch ein genaues thematisches Verzeichniß. Dennoch mußte es aus den oben genannten Gründen mir zur Pflicht werden, alle nur irgend zu entdeckenden Autographe Bachscher Compositionen selbst zu untersuchen. Bei denen, welche öffentliche Bibliotheken aufbewahren, also vor allem in der königl. Bibliothek zu Berlin, war dieses Ziel wohl allmählig zu erreichen. Schwieriger ist es immer, zum Privatbesitz Zugang zu erhalten. Doch habe ich auch hier in den meisten Fällen ein sehr freundliches und liberales Entgegenkommen gefunden, und hoffe, daß die Thüren, an welche ich bis jetzt vergebens anklopfte, sich nicht für immer verschlossen zeigen werden. Ich kann das um so ruhiger aussprechen, als derartige Weigerungen für Gestalt und Inhalt dieses ersten Bandes höchstwahrscheinlich ohne Bedeutung geblieben sind. Viele Autographe freilich giebt es noch und mag es geben, die, bei unbekannten Besitzern an unbekannten Orten verborgen, vorläufig jeder Kenntnißnahme spotten. Ich denke hier hauptsächlich an England. Wann werden wir, wenn auch nur dem Inhalte nach, von dort das Unsrige zurückerhalten?
Die Erwähnung der Compositionen führt von der biographischen und culturhistorischen auf die künstlerische und kunsthistorische Seite hinüber. Aus den Schriften der Männer, welche von hier aus Bach bald mehr bald weniger umfassend zu behandeln versucht haben – Winterfelds im 3. Bande seines Evangelischen Kirchengesangs, Mosewius' in seinen Schriften über Bachs Matthäuspassion, Kirchencantaten und Choralgesänge, und anderer – konnte ich nur Einzelheiten hier und da gebrauchen, da es sich herausstellte, daß grade diejenige treibende Kraft, welche durch ein Jahrhundert hinströmend endlich in Sebastian Bach triumphirend emporschoß, von ihnen unterschätzt oder ganz unbeachtet gelassen war. Auch bleibt es immerhin besser, mit eignen Augen als durch ein fremdes Medium zu sehen. Uebrigens steht, was auch nur das 17. Jahrhundert an Kunstformen hervorbrachte, in so enger und unmittelbarer Verbindung mit der Kunst Seb. Bachs, daß es unerläßlich war, auf deren Geschichte sich etwas genauer einzulassen. Hierbei und nicht minder bei der Betrachtung von Bachs eigenen Kunstleistungen habe ich natürlich auf das formale Moment das größte Gewicht gelegt, entsprechend dem Verhältnisse, in welchem dieses der exacten Wissenschaft zugänglicher ist, als das ideale. Letzteres darum ganz unberührt zu lassen, hielt ich mich jedoch nicht für berechtigt, da ich so einen Theil meiner Aufgabe, eine umfassende Darstellung der Kunst Seb. Bachs zu geben, hätte unerfüllt lassen müssen. Der musikalische Schriftsteller wird sich hier immer in einer besonders schwierigen Lage befinden. Er kann die Grundstoffe einer Form vorlegen, die Modificationen aufweisen, welche sie im einzelnen Falle durch das künstlerische Subject erfährt, ein wesentlich Musikalisches, der Stimmungsgehalt, ist dadurch immer noch nicht dem Leser vermittelt. In der Vocalmusik bildet das gesungene Wort eine Nothbrücke; in der Instrumentalmusik hat man die Wahl, entweder den Leser einem anatomischen Praeparat gegenüber zu stellen, oder den Versuch zu machen, mittelst eines kurzen Wortes die Stimmung zu bannen, welche allein erst das Praeparat zu blühendem Leben erweckt. Ich habe das letztere vorgezogen und muß es darauf ankommen lassen, in wie weit das, was ich bei diesem und jenem Musikstücke empfinde, auch die Empfindung andrer ist. Daß ich dabei allzu subjectiv verfahren, wird man mir, hoffe ich, nicht vorwerfen. Eine einheitliche Grundstimmung durchzieht Bachs Compositionen mit einer solchen Stärke, daß sie niemandem verborgen bleiben kann, der sich jemals diesem Meister wirklich hingegeben. Ihre eigne Stimmung hat auch jede Zeitepoche, hat jede selbständige musikalische Form, ja, jedes Tonwerkzeug umschreibt sein besonderes Empfindungsgebiet. Bis auf diese Distanz kann man ungefährdet herankommen, dann beginnt der Boden zu schwanken, man sieht Farbenspiele, die der Augenblick gebiert und tödtet, das vollständig deckende Wort für sie könnte nur ein Dichter finden. Ausdrücklich aber verwahre ich mich hier gegen die Unterstellung, daß es zum Genusse des Kunstwerks nöthig sei, dessen Stimmungsgehalt irgendwie in Worte umzusetzen. Wie jedes andre echte Kunstwerk, so muß auch jedes Instrumentalstück rein aus seinem eignen Wesen heraus wirksam sein. Nur eine schriftstellerische Pflicht war es, der ich nachzukommen suchte.
Eine breite historische Grundlage der Darstellung von Bachs Künstlerthum und Kunstwerken zu geben, darauf mußte übrigens schon die biographische Betrachtung führen, der es nicht gleichgültig sein konnte, daß ihr Held einer bereits hundertjährigen Künstlerfamilie entsproßte. In den Bericht über diese flocht sich jene meistentheils ungezwungen hinein. Bach selbst und seine Söhne legten auf ihre altkünstlerische Herkunft ein großes Gewicht, und diesem Umstande verdanken wir die handschriftliche Genealogie der Bachschen Familie, welche sich jetzt auf der königlichen Bibliothek zu Berlin befindet. Dahin gelangte sie aus dem Nachlasse des hamburgischen Musiklehrers G. Pölchau, dieser hatte sie aus dem Nachlasse Forkels erhalten, an Forkel hatte sie seiner Zeit Philipp Emanuel Bach geschickt. Sie zählt 53 Nummern; in jeder werden Herkunft, Geburts- und Todesdatum und sonstige wichtige Lebensereignisse je einer männlichen Persönlichkeit des Bachschen Geschlechtes chronistisch aufgeführt. Die erste hatte, nach des Sohnes Zeugniß, Sebastian Bach selbst verfaßt. Von wem die Fortsetzung stammt wird uns nicht gesagt, doch läßt es sich mit ziemlicher Sicherheit schließen. Zunächst ist zu constatiren, daß sie in den letzten Monaten des Jahres 1735 gemacht wurde, denn Sebastians Sohn Johann Christian, der am 5. September 1735 geboren wurde, wird noch aufgeführt und unter Nr. 18 das Jahr gradezu genannt. Philipp Emanuel war damals Student zu Frankfurt an der Oder. Nun geht aus gewissen Einzelheiten klar hervor, daß die Genealogie, mit Ausschluß natürlich der ersten Nr., garnicht unter den Augen Sebastian Bachs entstanden sein kann. Denn es fehlen darin die Todesjahre von dessen älteren Brüdern, die er doch wissen mußte. Und was mehr ist, in den Notizen über Sebastians eignes Leben findet sich eine falsche chronologische Angabe (s. hierüber die Auseinandersetzung in Anhang A. Nr. 9), und zwar betrifft sie ein so wichtiges Ereigniß, daß Sebastian selbst schwerlich das Jahr verwechselt haben kann. Dieser Irrthum aber kehrt in dem Nekrologe wieder, und von dem Nekrologe wissen wir, daß ihn großen Theils Philipp Emanuel Bach verfaßte. Die Folgerung ergiebt sich von selbst. Als Philipp Emanuel später eine Abschrift der Genealogie an Forkel schickte, fügte er noch allerhand erweiternde, erklärende und verbessernde Notizen hinzu. Die Genealogie hatte sich aber schon vorher unter dem Bachschen Geschlechte verbreitet, namentlich in der Linie, welche sich in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts nach Franken hinein abzweigte. Abschrift davon besaß ein Vetter Philipp Emanuels, Johann Lorenz Bach, und dessen Urenkel, Johann Georg Wilhelm Ferrich, Pfarrer zu Seidmannsdorf bei Coburg, auf welchen dieselbe allmählig vererbt war, ließ sie in der allgemeinen musikalischen Zeitung, Band 45, Nr. 30 und 31 veröffentlichen. Er meinte irrthümlich, Lorenz Bach habe sie selbst verfaßt. Daß es in der That nur eine Abschrift ist, geht aus einer Vergleichung klar hervor. Die Kleinigkeiten, welche in der Ferrichschen Genealogie fehlen, sind theilweise unabsichtliche Versehen, theils betreffen sie ganz unwichtiges, theils können sie etwa aus der Undeutlichkeit der geschriebenen Vorlage leicht erklärt werden. Dagegen hat sie auch eine Reihe von Zusätzen, wie Seb. Bachs Ernennung zum königlich polnischen Hof-Compositeur (1736), seinen Tod, genauere Notizen über die Schweinfurter und Ohrdrufer Bachs. Auch das » Anno 1735« in Nr. 18 ist erst mit späterer Tinte hinzugefügt, wahrscheinlich als der Besitzer merkte, daß dies Datum zur Bestimmung verschiedener andrer darin nothwendig sei, während er es zuerst fortgelassen hatte, als für das Jahr seiner Abschriftnahme nicht mehr passend. Jedenfalls sind aber diese Zusätze vor 1773 gemacht, dem Todesjahre Lorenz Bachs, das noch nicht aufgeführt ist. Wir wissen noch mehr: die Vorlage, nach welcher Lorenz Bach copirte, war schon nicht mehr Philipp Emanuels Genealogie selber, sondern nur eine Abschrift derselben. Auch diese hat sich noch erhalten, wenngleich fragmentarisch, da sie erst mit Nr. 25 beginnt. Sie ist jetzt im Besitz von Fräulein Emmert in Schweinfurt, einer Seitenverwandten des Geschlechts der fränkischen Bachs, welche die Gefälligkeit hatte, sie mir zur Untersuchung zu überschicken. Aus Nr. 41 derselben geht hervor, daß sie vor 1743 angefertigt ist; sie konnte demnach schon einiges mehr bieten, als Philipp Emanuel. Späterhin erfuhr sie noch Zusätze und erst nachdem dieses geschehen war, diente sie für die Ferrichsche Genealogie als Vorlage. Eine Kleinigkeit, in Nr. 43, hat diese weniger, was aber nicht ins Gewicht fällt und eine absichtliche oder zufällige Auslassung sein kann. Neben den Genealogien wurden in dem Bachschen Geschlechte auch Stammbäume angelegt. Einen solchen, und vielleicht den ältesten, besaß Phil. Emanuel Bach und schickte ihn mit der Genealogie an Forkel. Er ist verschwunden; eine Spur seiner Existenz weist aber die »Beschreibung der königl. ungarischen Haupt-, Frey- und Krönungstadt Preßburg« auf, welche im Jahre 1784 daselbst bei Joh. Mathias Korabinsky erschien. Hier findet sich ein kleiner Stammbaum mit bezifferten Schildchen und dazu eine Liste, welche die Namen von 64 männlichen Bachs enthält; auf S. 110 bemerkt der Verfasser, daß es die Geschlechtstafel »des berühmten Herrn Kapellmeisters Bach in Hamburg« sei. Die Aufnahme derselben in dieses Buch geschah, weil man die Bachs für eine aus Ungarn gebürtige Familie hielt. Einen andern Stammbaum besaß Seb. Bachs Schüler, der Erfurter Organist Johann Christian Kittel: er wurde mit erläuternden Zusätzen von Christian Friedrich Michaelis in der Allgemeinen musik. Zeitung, Band 25, Nr. 12 veröffentlicht; wo er selbst geblieben ist, weiß man nicht. Dagegen besitzt Frl. Emmert in Schweinfurt ein wirkliches Original von einem Stammbaum; er ist sehr sorgfältig gezeichnet und geschrieben und splendid colorirt. Nach seiner Anlage zu schließen muß er etwa zwischen 1750 und 1760 gefertigt sein; dann finden sich darin von andrer Hand und mit andrer Tinte ausgeführt noch einige nachträgliche Zusätze. Um die Fortführung des Stammbaums bis auf unsere Zeit hat sich ein noch lebender Nachkomme des Geschlechts, der Herr Kämmereiverwalter Bach in Eisenach, bemüht. – Für die Geschichte der Vorfahren Seb. Bachs gewährte dieses Material eine schätzbare Hülfe. Es kam nun darauf an, überall die Quellen wieder aufzusuchen, aus denen es geflossen sein mußte, um die gebotenen Daten zu prüfen – wobei es sehr viel zu berichtigen gab – und um die Quellen gründlicher noch auszuschöpfen. Sodann galt es, neues Material herbeizuschaffen. Denn sollte diese Geschichte einen Nutzen haben, so mußten die hervorragendsten Persönlichkeiten zu möglichst greifbaren Individuen herausgearbeitet werden, so mußten sie endlich durch eine möglichst bestimmte Skizzirung ihrer Zeit- und Standesverhältnisse den belebenden Hintergrund erhalten. Ich habe hier versucht zu leisten, was das Material erlaubte. Zu vielem Danke bin ich besonders für diesen Theil meiner Arbeit meinem werthen Collegen Prof. Th. Irmisch verpflichtet, der mit seiner genauen Kenntniß der thüringischen Culturgeschichte jederzeit bereit war, mir hülfreich zu sein. Ich muß das hier um so mehr aussprechen, als grade eine solche Hülfe weniger an hervorspringenden Punkten, wo man ihrer zu gedenken Gelegenheit hätte, sichtbar wird, als sich in allerhand gelegentlichen Winken und Informationen zu äußern pflegt, deren Werth kaum jemand so, wie der, dem sie geleistet wird, zu ermessen vermag. Die Geschichte der Vorfahren weist an einigen Stellen eine ziemliche Fülle genealogischen Details auf. Wenn ich hier die Bitte ausspreche, darin keine unfruchtbare Notizenkrämerei sehen zu wollen, so geschieht es eigentlich in der Hoffnung, damit etwas überflüssiges zu thun. Es liegt auf der Hand, daß für eine »Darstellung« die nackte Behauptung von der seltenen Fülle und Breite des Bachschen Geschlechtes nicht genügt, der Leser muß sie sehen und auch in ihren tieferen und tiefsten Entwicklungsschichten mit erleben. Wem dies trocken und uninteressant erscheinen sollte, der möge bedenken, daß die Schönheit eines Baumes in seinem Stamme, seinen Aesten, Blättern und Früchten besteht, daß aber die Bedingung hierzu gesunde und starke Wurzeln sind. Das genealogische Material ist somit zum größeren Theile und zwar nach einem festen Plane in die Darstellung verarbeitet. Ein Stammbaum, den sich danach jeder leicht entwerfen kann, ist nicht beigegeben, sollte sich jedoch das Bedürfniß nach ihm herausstellen, so wird er nachträglich dem zweiten Bande angeschlossen werden.
Was die Anordnung des Buches im übrigen betrifft, so war es mein Bestreben, eine zusammenhängende, gleichmäßig durchgebildete Darstellung zu geben. Was sich diesem Zwecke nicht fügen wollte und durfte, mußte ausgeschieden werden. So entstanden zwei Anhänge, der eine für streng kritische Untersuchungen, der andere für quellenmäßige Mittheilungen ausgedehnterer Art und einzelne Ergänzungen, die, wenn planmäßig verfahren werden sollte, im Rahmen des Buches selbst ihre Stätte nicht hatten. Man wolle keine Inconsequenz darin sehen, daß dennoch hier und da einige kritische Entwicklungen dem Contexte einverleibt wurden. Es giebt Gegenstände, die in ein Gewebe biographischer, kunst- oder culturhistorischer Beziehungen so fest eingesponnen sind, daß ihre kritische Behandlung unmöglich ist, ohne eine Anzahl von Dingen gleichsam unabsichtlich zu streifen, deren Erwähnung für den allgemeinen Zweck höchst wünschenswerth, wenn nicht gar nothwendig sein kann. Und dann – ist es ein Zufall, daß wir bei so vielen Fragen in Bachs Leben auf Combination angewiesen sind? Mich dünkt, es fällt aus solchen Untersuchungen wohl ein Reflex auch auf die Persönlichkeit des Mannes, der so still, bescheiden und in sich gekehrt dahin lebte, nur den Idealen seiner Kunst nachtrachtend. Auch aus den Quellen unmittelbar ist manches in die Darstellung selbst aufgenommen worden. Es geschah jedoch fast nie, ohne dann dessen Form soweit zu biegen und zu glätten, daß sie dem Uebrigen gleichartig wurde. Der Forderung stilistischer Einheit mußte in diesem Falle die diplomatische Genauigkeit zum Opfer fallen. Dadurch braucht das Charakteristische einer älteren und originellen Fassung keineswegs ganz verwischt zu werden. Um das Gefühl davon zu erwecken genügt oft schon ein einziger ungebräuchlicherer Ausdruck, ja selbst nur eine hier und da abweichende Orthographie; dem Takte des Schriftstellers bleibt es anheim gegeben, hier die richtige Gränze zu finden. Einzig da wurde eine Ausnahme gemacht, wo es sich um die Mittheilung von Bachs eignen Schriftstücken handelte, oder von solchen, die (vrgl. S. 313 f. und 323 f.) seine Aeußerungen referiren. Außerhalb des Contextes aber habe ich mich natürlich der vollständigsten Treue in Beibehaltung der originalen Ausdrucksweise, Orthographie und Interpunction beflissen, auch, wenn ich seltene Druckwerke zu citiren hatte, den Titel mit allen bibliographischen Merkmalen aufgeführt. Der Platz hierfür waren die unter dem Text von Capitel zu Capitel fortlaufenden Anmerkungen. Diese enthalten durchweg nur Quellennachweise und ab und zu eine gelegentliche kürzere Bemerkung, die in einen Anhang zu bringen sich nicht verlohnte, und die, wenn sie überhaupt Bedeutung haben sollte, unter dem frischen Eindrucke des Textes gelesen werden mußte. B.-G. bedeutet die Ausgabe der Bach-Gesellschaft, P. diejenige von C.F. Peters.
In einem Vorworte ist es erlaubt, eine persönlichere Sprache zu führen. Und so will ich denn auch die Empfindungen nicht ganz zurückhalten, mit denen ich dieses Buch bei seinem Hinaustritte in die Welt begleite. Ich entlasse es wie einen Freund, der in einsamen Jahren treu zu mir gestanden, der mit seiner reichen Fülle von Anregungen so vieles ersetzt hat, dessen Entbehrung sonst vielleicht unerträglich geworden wäre, mit seinem unablässigen Hinweis auf das Höchste und Heiligste, was wir besitzen, eine stete Quelle der Erhebung und reinsten Freude war. Vielleicht war er es nur mir, und andre, an die er jetzt herantritt, finden in ihm einen ganz gewöhnlichen Menschen, dessen Umgang wenig lohne, noch weniger erfreue. Niemand weiß das, aber ich hoffe es nicht. Zu fest lebt in mir der Glaube an die stetig wachsende Bedeutung Bachs für die deutsche Nation, der er in all seinem Denken, Thun und Fühlen mit einer Entschiedenheit angehörte, wie kein andrer Künstler mehr. Als meine Vorarbeiten zu einem Werke über Deutschlands größten Kirchencomponisten begannen, dachte ich nicht, daß dessen Veröffentlichung schon in eine Zeit fallen würde, die durch heiße Geisteskämpfe beweist, wie tief, allem widersprechenden Scheine zum Trotz, das religiöse Bedürfniß dem deutschen Volke eingeboren ist. Mehr fast noch als jene glänzenden politischen Errungenschaften verkünden die mächtigen religiösen Regungen, welche das tiefste Wesen unseres Volkes aufwühlen, das Herannahen einer neuen großen Zeit. Und wie immer und überall den Mutterschooß der Kunst die Religion gebildet hat, so wird sie uns auch dieses Mal die Keime zeitigen, aus denen einst die Musik neuen Idealen entgegenwächst. Welche Stellung zu diesen dann Bach einnehmen wird, können wir nicht wissen. Aber weiter als je, scheint mir, findet grade jetzt seine Kunst die Thore zum Einzuge geöffnet. Denn Bachs, des Kirchencomponisten, so oft mißkannte Eigenthümlichkeit liegt darin, daß er die engen Gränzen eines kirchlichen Ideals durch ein allgemein religiöses Empfinden – nicht niederriß, aber in großartigster Weise erweiterte, und entgegenkommend einer solchen maßvollen Freiheit strebt unsere Zeit, unbefriedigt durch eine lange und viel gepriesene allgemeine Religiösität, von neuem festeren kirchlichen Formen zu. Die an Zahl und Inhalt fast unbegreiflich großen kirchlichen Kunstwerke des Mannes, den wir wohl den verkörperten Musikgenius des deutschen Volkes nennen dürfen, können nicht dazu in die Welt gesetzt sein, um nach einer oder wenigen mangelhaften Vorführungen spurlos zu verschwinden. Sie müssen, sie werden im Volke lebendig werden, werden mit ihrem tiefgeschöpften, lauteren Gehalte die Gemüther überall erfüllen, sie dem Göttlichen mit neuer und verstärkter Innigkeit entgegenwenden, Leben und Kunst unserer Zeit mit der Gewalt beeinflussen, die ihrem Werthe entspricht. Möchte ich zur Erreichung dieses großen Zieles einiges beitragen! Es wäre für alle Arbeit ein überreicher Lohn.
Sondershausen, im März 1873.
Philipp Spitta.
Erstes Buch: Die Vorfahren
I.
Das Geschlecht, dem Johann Sebastian Bach entstammte, ist ein grunddeutsches und läßt sich in seinem thüringischen Heimathsitze schon vor den Zeiten der Reformation nachweisen. Mit derselben Stetigkeit, welche im 17. und auch noch im 18. Jahrhundert seine Angehörigen in den Dienst der Musik trieb, blieb es durch drittehalb Jahrhunderte in einer Gegend wohnhaft, verzweigte sich bis ins Unübersehbare und erschien zuletzt als ein wesentliches Stück der dortigen Volkseigenthümlichkeit. Nicht weniger ausdauernd hielt es an gewissen Vornamen fest, und durch einen bezeichnenden Zufall trägt der erste des Stammes, von dem wir Kunde erlangen konnten, schon den Namen, der als häufigster unter allen vorkommenden auch unserm großen Meister eigen ist.
Dieser früheste Vertreter ist Hans Bach aus Gräfenrode, einem Dorfe etwa 2 Meilen südwestlich von Arnstadt gelegen. Gräfenrode war am Anfange des 16. Jahrhunderts dem Grafen von Schwarzburg untergeben, wahrscheinlich gehörte es jedoch zur gefürsteten Grafschaft Henneberg und der Schwarzburger besaß es nur als Pfand. Die thüringischen Herren jener Zeit befanden sich häufig in Geldnoth, und versetzten dann Ortschaften oder ganze Districte ihres Gebietes wie ein Stück vom Hausrath. Hans Bach, den wir uns als einfachen Bauer denken müssen, scheint mit andern Gräfenrodern, unter denen sich ein gewisser Abendroth befand, in den nahen Ilmenauer Bergwerken gearbeitet zu haben, deren Betrieb zu derselben Zeit von Erfurt aus in Angriff genommen war. Wohlhabende Erfurter Bürger hielten sich wohl zu diesem Zwecke zeitweilig in Ilmenau auf, und einer von ihnen kann Hans Schuler gewesen sein, mag derselbe nun mit Johannes Schüler, dem Ober-Vierherrn des Raths zu Erfurt vom Jahre 1502 und 1506, identisch sein oder nicht. Jedenfalls war dieser Schuler die Veranlassung, daß gegen Bach aus sonst unbekannten Gründen um das Jahr 1508 ein Process beim geistlichen Gericht des Erzstiftes Mainz[4] anhängig gemacht und er mit dem genannten Abendroth in Gewahrsam gehalten wurde. Erfurt gehörte nicht nur zur Mainzer Diöcese, sondern die Erzbischöfe hatten auch seit langem in der Stadt eigne Besitzungen und beabsichtigten unablässig ihren Einfluß daselbst zu vergrößern. Die Verhafteten suchten durch Vermittlung des damaligen Grafen von Schwarzburg, Günther des Bremers, los zu kommen; dieser verwendete sich jedoch, wie es scheint, ohne besondern Erfolg für seine Unterthanen. Ein Brief, den er nach manchen vergeblichen Versuchen im Februar 1509 an den Domherrn Sömmering in Erfurt schrieb, mit der Versicherung, er wolle in strengster Form Rechtens die Sache vor seinen eignen Gerichten entscheiden lassen, wenn man Bach und Abendroth nur frei gäbe, ist erhalten und für den eben erzählten Vorgang die Quelle. Was weiter aus der Sache geworden, kann nicht angegeben werden1. Der Name Bach findet sich aber unter den Bewohnern von Gräfenrode noch das 16. und 17. Jahrhundert hindurch. Auch in Ilmenau war im Jahre 1676 ein Johannes Bach Diaconus2.
Wenden wir uns über Arnstadt hinaus eine starke Meile nordöstlich zu dem Dorfe Rockhausen. Hier wohnte in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts Wolf Bach, ein reich begüterter Bauer. Als er starb, hinterließ er seiner Gattin Anna, welche ihm elf Kinder geboren hatte, sein sämmtliches Vermögen zum Nießbrauch. Im Jahre 1624 war diese »ein sehr alt verlebt Weib«, und wollte die Güter unter ihre noch lebenden Kinder theilen. Wir erfahren von einem Hofe, 4 guten und 32 geringen Ackern, zusammen geschätzt auf 925 Fl. – ein für damalige Verhältnisse sehr ansehnlicher Besitz und jedenfalls zur Zeit der bedeutendste des Ortes, was auf ein langes Ansässigsein daselbst hinweist. Die Kinder, deren uns drei Söhne: Nikol, Martin, Erhart, und eine verheirathete Tochter genannt werden, waren zum Theil schon ziemlich bejahrt; Erhart befand sich seit 18 Jahren in der Fremde, war schon über die fünfziger hinaus, Nikol schritt im Jahre 1625 zu seiner dritten Ehe. Dieser hatte schon vor der Theilung des väterlichen Nachlasses einen stattlichen Grundbesitz und war zuverlässig auch der einzige, welcher als Stammhalter in Rockhausen zurückblieb. Anläßlich seiner letzten Verheirathung erwuchsen ihm allerhand Vermögensstreitigkeiten; eine eigenhändige Eingabe in dieser Angelegenheit ist erhalten, die ihn auch mit der Feder nicht ungewandt erscheinen läßt3. In den ersten Jahrzehnten des 18. Jahrhunderts scheint sich kein Bach mehr in Rockhausen zu finden.
Unweit Rockhausen in westlicher Richtung liegt Molsdorf, wo das ganze 17. Jahrhundert hindurch ebenfalls eine reichverzweigte Bachsche Familie ihren Wohnsitz hatte. Der dreißigjährige Krieg hat die frühesten und wichtigsten Pfarr-Register vernichtet, die erhaltenen reichen nur bis zum Jahre 1644 zurück. Nach ihnen war der älteste der dort lebenden Bachs – er hieß wiederum Hans – 1606 geboren. Ein Andreas Bach, dessen Wittwe am 21. März 1650 starb, greift aber sicherlich noch in das vorhergehende Jahrhundert hinüber. Söhne desselben können Ernst und Georg Bach gewesen sein, letzterer war 1624 geboren. In einem Zeitraum von kaum 70 Jahren werden über zwanzig Glieder der molsdorfschen Familie erwähnt, die männlichen Individuen mit den Namen Johann, Andreas, Georg, Ernst, Heinrich, Christian, Jakob, Paul, die, von dem letzten abgesehen, auch in der Sebastian Bachschen Linie reichliche Anwendung fanden, während die weiblichen Namen abweichen. Andere Quellen berichten noch von einem Nikol Bach aus Molsdorf, welcher in das schwedische Heer eingetreten war und am 23. Juni 1646 in Arnstadt begraben wurde, da er »trunkener Weise aus selbstgegebener Ursache erstochen worden«4. Auch irren wir wohl kaum, wenn wir Johann Bach, »Herrn General Vrangels Musicanten«, gleichfalls aus dem Orte entstammt sein lassen, einen Mann, der als »kunstreich« gerühmt wird, von dem man aber sonst nur weiß, daß er 1655 schon todt war und eine Tochter hinterlassen hatte5. Dies wäre dann der erste Musiker der Molsdorfer Linie. Der zuvor erwähnte Georg Bach erhielt von seiner Gattin Maria am 23. Mai 1655 einen Sohn Jakob, welcher Corporal im kursächsischen Kürassier-Regimente und der fernere Stammhalter des Geschlechtes wurde. Dasselbe verließ Molsdorf im Anfange des 18. Jahrhunderts, um sich weiter nordwärts in Bindersleben bei Erfurt niederzulassen. Hier besteht es noch jetzt, nachdem mehre tüchtige Musiker daraus hervorgegangen waren, unter denen Johann Christoph (1782–1846) der bedeutendste gewesen zu sein scheint, der wenngleich einfacher Landwirth doch als Orgelspieler und Componist zu seiner Zeit in Thüringen einen guten Ruf besaß.
Wir wandern nun zum dritten Male weiter nach Süd-Westen, wo wir nahe bei Gotha die Heimath der directen Vorfahren Sebastian Bachs erreichen. In welchem Zusammenhange dieselben mit den vorher erwähnten Stämmen stehen, ist nicht zu sagen, aber es hieße das Unwahrscheinlichste annehmen, wenn man ihn zwischen Familien gleichen Namens und vielfach gleicher Vornamen, die auf einem kleinen Flächenraume neben einander wohnen, leugnen wollte. Wir müssen übrigens die gemeinsame Wurzel mindestens in die Mitte des 15. Jahrhunderts zurückverlegen, denn im 16. hatte der Stamm schon mächtige Aeste nach vielen Seiten hin getrieben. Auch in Wechmar – so heißt das letzte Ziel unseres Umganges – saßen die Bachs schon vor 1550 fest. Ihr ältester Repräsentant, der auch hier den Namen Hans führt, erscheint am Montage vor Bartholomaei des Jahres 1561 als Mitglied der Gemeindevormundschaft6. Ein solcher Posten verlangt einen gereiften Mann, sein Geburtsjahr mag also um 1520 zu setzen sein. Veit Bach, den Sebastian Bach selbst als Ahnherrn der Familie angiebt, kann als Hansens Sohn gelten, und dürfte zwischen 1550 und 1560 geboren sein; wahrscheinlich war er nicht der einzige, wie das Folgende ergeben wird. Seinen Vornamen trug er von St. Vitus, dem Schutzheiligen der wechmarischen Kirche7, und deutet dadurch auf ein inniges und dauerndes Verwachsensein mit den Ortsangelegenheiten. Er lernte das Bäckerhandwerk, zog, wie sein Stammverwandter Erhart Bach aus Rockhausen, in die Fremde, und ließ sich in irgend einem ungarischen Orte nieder8. Im Kurfürstenthum Sachsen, zu dem bei Beginn der Reformation auch Gotha und Umgegend gehörte, war bekanntlich am frühesten die lutherische Religion angenommen worden; ebenso hatte sich dieselbe unter den Kaisern Ferdinand I. und Maximilian II. in Ungarn rasch und blühend entwickelt. Unter Rudolph II. (1576–1612) begann der Rückschlag; die Jesuiten wurden wieder ins Land geführt und bedrängten die Lutheraner mit wachsendem Erfolg. Veit wird das Jahr 1597, wo durch Erwerbung der Probstei Thurócz jesuitischer Einfluß übermächtig wurde, nicht abgewartet haben. »Ist dannenhero«, wie Sebastian Bach erzählt, »nachdem er seine Güter, so viel es sich hat wollen thun laßen, zu Gelde gemacht, in Deutschland gezogen«, und, fahren wir fort, in sein thüringisches Heimathdorf zurückgekehrt, wo er Sicherheit für sich und seinen Glauben fand. Hier soll er die Bäcker-Profession weiter getrieben haben, sicherlich aber nicht mehr lange, denn am Ende des 16. und Anfange des 17. Jahrhunderts waren die Wechmaraner Backhäuser in andern Händen. Die Mittheilungen Sebastian Bachs schildern den Veit auch eigentlich nicht als Bäcker, sondern als Müller, doch waren beide Handwerke wohl oftmals mit einander verbunden9. Als echter Thüringer liebte und übte er die Instrumental-Musik. »Er hat«, sagt sein Ururenkel, »sein meistes Vergnügen an einem Cythringen[5]10 gehabt, welches er auch mit in die Mühle genommen, und unter währendem Mahlen darauf gespielet. Es muß doch hübsch zusammen geklungen haben! Wiewol er doch dabey den Tact sich hat inprimiren lernen. Und dieses ist gleichsam der Anfang zur Musik bey seinen Nachkommen gewesen.« Was jedoch Veit nur als Liebhaberei trieb, war bei einem andern mitlebenden Familiengliede, vielleicht seinem leiblichen Bruder, schon zur Profession geworden. Veit starb am 8. März 1619 und wurde noch an demselben Tage begraben11. Er besaß möglicher Weise eine ganze Anzahl von Kindern, denn die große Menge männlicher und weiblicher Individuen der wechmarschen Linie läßt sich kaum auf die Söhne allein zurückführen, von denen die Genealogie redet. Genannt werden uns durch dieselbe zwei, oder genauer einer, da bei dem zweiten nur die Existenz constatirt, der Name aber verschwiegen wird. Der Genannte hieß natürlich Hans, und ist Sebastian Bachs Urgroßvater. Am passendsten denken wir ihn uns in Wechmar etwa um 1580 geboren, wie denn auch Veit sich wohl erst nach seiner Rückkehr aus der Fremde vermählt haben wird. Er zeigte Lust zur Musik, so beschloß denn der Vater, ihn einen »Spielmann« werden zu lassen, und gab ihn nach Gotha zu dem dortigen Stadtpfeifer in die Lehre. Dieser war aber ebenfalls ein Bach, hieß Caspar, und dürfte ein jüngerer Bruder, jedenfalls ein naher Verwandter Veits gewesen sein. Den Hans nahm er zu sich auf den Thurm des alten Rathhauses, wo er seine Dienstwohnung hatte: in den Hallen um die Kaufläden, welche das ganze untere Stockwerk einnahmen, ertönte das Treiben des Marktes und oben von der Gallerie mußte er nach Herkommen zu bestimmten Stunden den Choral mit seinen Gesellen abblasen12. Seine Gattin hieß Katharina, von seinen Kindern war Melchior im Jahr 1624 schon ein erwachsener Mensch, eine Tochter Maria wurde am 20. Febr. 1617, ein anderer Sohn Nikolaus am 6. Dec. 1619 geboren13. Hiernach wandte er sich nach Arnstadt, wo er als frühester Vertreter des Geschlechtes daselbst gestorben ist; seine Frau folgte ihm am 15. Juli 1651 hochbejahrt14. Hans kehrte also »nach ausgestandenen Lehrjahren« zurück in das väterliche Dorf, und nahm Anna Schmied, die Tochter des dortigen Gastwirths, zum Weibe. Wie man es in jener Zeit ungemein häufig findet, daß die Musikanten noch etwas andres als Gewerbe nebenher treiben, so übte auch er als gewöhnliches Handwerk die Teppichflechterei15. Doch blieb das Musikmachen sein eigentlichster Beruf, wie die im Pfarr-Register ihm beigelegte Benennung »Spielmann« beweist. Der führte ihn weit durch Thüringen umher: oftmals wurde er »nach Gotha, Arnstadt, Erfurt, Eisenach, Schmalkalden und Suhl verschrieben, um denen dasigen Stadt-Musicis zu helfen«. Da ließ er lustig seine Fiedel ertönen, hatte den Kopf voller Späße und war bald eine volksthümliche Persönlichkeit. Ohne das wäre er wohl schwerlich zu der Ehre gekommen, zweimal portraitirt zu werden. Beide Bilder besaß Philipp Emanuel Bach unter seiner Sammlung von Familien-Bildnissen, eins davon war ein Kupferstich aus dem Jahre 1617, das andere ein Holzschnitt; hier sah man ihn Violine spielen mit einer großen Schelle auf der linken Schulter, linker Hand standen die Reime:
Hier siehst du geigen Hansen Bachen, Wenn du es hörst, so mustu lachen. Er geigt gleichwohl [d.i. nämlich] nach seiner Art Und trägt einen hübschen Hans Bachens Bart,
und unter den Versen war ein Schild mit einer Narren-Kappe. Wie der fröhliche Sinn auch auf eins seiner Kinder überging, werden wir später sehen.
Hans Bach ist nicht sehr alt geworden; er starb am 26. Dec. 1626 im Pestjahre, was auch andere Familienglieder dahin raffte. Als neun Jahre darauf die Seuche im Dorfe noch viel furchtbarer wüthete, so daß von damals ungefähr 800 Einwohnern 503 starben (im September allein 191), folgte ihm seine Wittwe nach (18. Sept. 1635). Von ihren Kindern werden uns in der Folge diejenigen drei beschäftigen, auf welche der musikalische Sinn des Vaters überging. Daß aber mehr noch vorhanden gewesen sind, deren die spätere Genealogie nur deshalb nicht gedachte, weil sie einfache Bauern blieben, ist sicher. Ohne uns bei den verschiedenen weiblichen Individuen aufzuhalten, von deren Existenz noch Spuren vorhanden sind, wollen wir nur ein kurzes Wort noch den übrigen Männern gönnen. Es ist freilich nicht leicht, zuweilen auch nicht möglich, sich durch die bunte Schaar, welche sich aus den Pfarr-Registern entwickelt, sichern Weges hindurch zu finden; so wird denn gegeben was zu erreichen war. Von den drei musikalischen Söhnen bietet die genannte Quelle nur etwas über Johann, den ältesten. Neben diesem aber treffen wir noch auf sechs andre Persönlichkeiten, die muthmaßlich von ziemlich gleichem Alter waren und für Söhne von Hans Bach oder seiner Brüder oder altersgleichen dortigen Verwandten gelten können. Zunächst ein Hans Bach, welcher als junior dem alten Hans Bach senior mehrfach gegenüber gesetzt wird, also doch wohl sein Sohn war. Identisch mit Johann Bach kann er nicht sein, da er schon 1621 mit seinem Weibe zum Abendmahle ging, Johann sich aber erst 1635 verheirathete: halten wir ihn also für einen älteren Bruder, und viel leicht erstes Kind des alten Hans Bach, der nach damaliger einfacher Lebensweise früh in die Ehe getreten sein wird. Der Sohn starb am 6. Nov. 1636, jung an Jahren, seine Wittwe Dorothea lebte noch bis zum 30. Mai 1678, wurde 78 Jahre alt. Von Söhnen aus dieser Ehe erfahren wir nichts. Dann noch ein Hans Bach, der um einiges jünger erscheint, und sich am 17. Juni 1634 verheirathete, das Mädchen hieß Martha. Söhne werden angeführt: Abraham (geb. 29. März 1645), Caspar (geb. 9. März 1648) – dieser war späterhin Schafhirt in Wechmar –, ein nicht benannter dritter Sohn (geb. 27. März 1656), »so bei der Geburt kaum eine Spanne lang«. Auch dieser dritte Hans war ein Sohn des Spielmanns16. Also drei Brüder desselben Namens. Es ist charakteristisch für den Alten mit der Schelle, daß er an diesem Triumvirat von Hansen seine Freude hatte. – Ferner Heinrich Bach, von dem wir nur hören, daß ihm 1633 und 1635 zwei Söhne geboren wurden, die beide am 28. Jan. 1638 starben. Denselben Namen führte der jüngste des musikalischen Kleeblatts; wäre der genannte dessen Bruder, so hätte der lustige Fiedler zwei Heinriche gehabt, wie er drei Hanse besaß. – Weiter Georg Bach, welcher 1617 geboren wurde. Seine erste Gattin, Magdalena, war 1619 geboren und starb am 23. Aug. 1669. Er verheirathete sich am 21. Oct. 1670 zum zweiten Male, die Braut hieß Anna, sie starb am 29. Febr. 1672 in Folge eines Wochenbettes. Unverehelicht konnten diese Leute nicht leben; er schloß die dritte Ehe am 19. Nov. 1672, starb am 22. März 1691; seine Gattin Barbara folgte am 18. April 1698. Söhne werden nicht erwähnt; ebenso wenig ist zu sagen, wessen Sohn er selbst war. Eines Bastian (Sebastian) Existenz endlich verräth uns nur sein Tod (3. Sept. 1631); er kann daher auch schon ein Greis gewesen sein und ist der einzige des Geschlechts, welcher vor dem großen Tonmeister diesen Namen führte.
Die Genealogie erwähnt, wie schon bemerkt, noch einen andern Sohn Veit Bachs, ohne dessen Namen zu kennen. Derselbe kann auch auf anderm Wege nicht mit Sicherheit bestimmt werden; doch läßt sich nach den Pfarr-Registern wenigstens ein Altersgenosse des Spielmanns Hans Bach beibringen, der sein Bruder gewesen sein könnte. Er hieß Lips, und starb am 10. Oct. 1620; ein Sohn gleichen Namens fiel am 21. Sept. 1626 der Pest zum Opfer. Die Söhne, welche das Geschlecht fortpflanzten, würden demnach in den Registern fehlen. Die Genealogie spricht von dreien, welche durch den regierenden Grafen von Schwarzburg-Arnstadt zu ihrer weitern musikalischen Ausbildung nach Italien geschickt werden und von denen Jonas, der jüngste, blind und Gegenstand vieler abenteuerlicher Erzählungen gewesen sein soll17. Dagegen läßt sich nachweisen, daß ein Sohn des ungenannten Bruders von Hans Bach den Namen Wendel führte, 1619 geboren ward und späterhin in Wolfsbehringen, einem Dorfe nordwestlich von Gotha, seßhaft war; er scheint Landwirth gewesen zu sein und starb am 18. Dec. 1682. Sein vermuthlich einziger Sohn Jakob (geb. 1655 in Wolfsbehringen) bekleidete das Cantorat in Steinbach, seit 1694 in Ruhla und starb dort 171818. Er war erster Lehrer des später merseburgischen Capellmeisters und nicht unbedeutenden Componisten Johann Theodorich Römhild19. Von ihm gehen, wenn man den vorhandenen Zeugnissen trauen darf, die meisten musikalischen Persönlichkeiten dieses Stammes aus, ganz sicher wenigstens der bedeutendste unter ihnen. Dieser, Johann Ludwig, wurde als Sohn des Cantors Jakob Bach im Jahre 1677 geboren. 1708 war er Hofcantor in Meiningen, drei Jahre darauf aber, als er sich verheirathete, schon Capell-Director, und starb 174120. Da Sebastian Bach mit ihm von Weimar aus in persönlichen Verkehr trat, so erscheint es passend, ihn auch dann erst in seiner künstlerischen Bedeutung zu charakterisiren. Das bedeutende musikalische Talent dieses Mannes lebte in seinen beiden Söhnen, Samuel Anton (1713–1781) und Gottlieb Friedrich (1714–1785), sowie in dem Sohne des letzteren, Johann Philipp, weiter. Alle drei waren zeitweilig herzogliche Hoforganisten, der letzte reicht bis in die neueste Zeit hinab, da er erst 1846 im 95. Lebensjahre starb, nachdem am 22. Dec. 1845 auch der letzte Enkel Sebastians geschieden war21