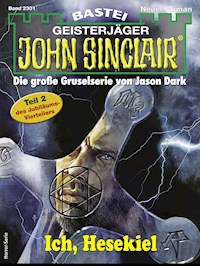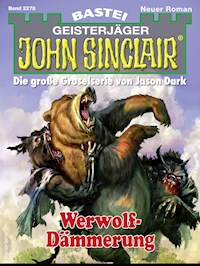1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Lübbe
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: John Sinclair
- Sprache: Deutsch
Der Werwolf zitterte vor Angst. Er, der in Vollmondnächten selbst Furcht und Schrecken verbreitete, winselte, denn er wusste, dass er sterben würde. Eigentlich hätte er sich gar nicht verwandeln dürfen, doch die Magie eines Mächtigen hatte die Transformation erzwungen.
Unruhig lief er im staubigen Sand der Arena herum, die sich in einer großen, hölzernen Scheune befand. Er spürte, dass ihm grausame Qualen bevorstanden ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 134
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Inhalt
Cover
Impressum
Arena der Werwölfe
Vorschau
BASTEI ENTERTAINMENT
Vollständige E-Book-Ausgabe der beim Bastei Verlag erschienenen Romanheftausgabe
Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG
© 2015 by Bastei Lübbe AG, Köln
Verlagsleiter Romanhefte: Dr. Florian Marzin
Verantwortlich für den Inhalt
Titelbild: Timo Wuerz
E-Book-Produktion: César Satz & Grafik GmbH, Köln
ISBN 978-3-7325-0991-1
www.bastei-entertainment.de
www.lesejury.de
www.bastei.de
Arena der Werwölfe
von Ian Rolf Hill
Das harte Hämmern gegen die Tür weckte Brian Merryweather aus einem unruhigen Schlaf. Fluchend schwang sich der kräftige Mittdreißiger aus dem Bett und griff nach seinem Morgenmantel. Ein Blick auf den Wecker schürte den aufkeimenden Ärger: Zwei Uhr dreiundzwanzig.
»Was ist denn los?«, fragte seine Frau Helen schläfrig.
»Keine Ahnung. Aber wer auch immer das ist, dem mache ich Beine«, antwortete Brian und stapfte zornig aus dem Schlafzimmer.
Wieder schlug es hart gegen die Haustür. Wütend riss Brian sie auf. Er sah noch den breitschultrigen Mann mit dem wallenden weißen Haar, ehe eine riesige Faust in sein Gesicht krachte …
Brian hatte das Gefühl, sein Schädel würde auseinanderplatzen. Durch den rasenden Schmerz in seiner Nase, aus der augenblicklich Blut schoss, spürte er den Aufprall auf den harten Dielen kaum. Sein Blick verschleierte sich, sodass er den weißhaarigen Hünen wie durch eine Nebelwand hindurch in sein Haus treten sah.
Zwei weitere Männer drängten hinter ihm herein und an dem Weißhaarigen vorbei. Er kannte alle drei. Es handelte sich um Kubrat Petrova und seine Söhne Bogoris und Petko.
Wenig später prasselten die Schläge der beiden Brüder auf den Wehrlosen ein. Brian krümmte sich vor Schmerz und versuchte seinen Kopf unter den angewinkelten Armen zu schützen. Über sich, am oberen Treppenabsatz vernahm er den panischen Schrei seiner Frau Helen. Wie auf Knopfdruck hörten die Schläge auf. Brian blickte entsetzt auf und sah, wie der Weißhaarige Helen anschaute.
»Holt sie euch!«
Die beiden Schläger reagierten ohne zu Zögern.
»Ja, Vater«, riefen sie zugleich und stürmten die Treppe hoch.
Helen wollte noch fliehen, doch sie kam gerade einmal drei Schritte weit, ehe die kräftigen jungen Männer sie eingeholt hatten und die tobende Frau roh an den Armen packten. Kreischend schlug und biss sie um sich, doch das schien Bogoris und Petko nur noch mehr anzustacheln. Dass sie im Handgemenge auch ihre Brust begrapschten war kein Zufall.
»Schluss damit!«, der barsche Befehl ihres Vaters Kubrat machte der Farce ein Ende, und Petko riss brutal an Helens schwarzen Haaren, ehe er sie wie ein Kaninchen im Nacken griff und sie die Treppe herunterschleifte.
Vor Schmerzen und Scham wie gelähmt kauerte Brian am Fußende der Stiege. Als die beiden Männer mit seiner Frau an ihm vorbeigingen, versuchte er, das Bein eines seiner Peiniger zu ergreifen, und kassierte prompt einen brutalen Tritt in den Magen. Der Weißhaarige hielt seinen beiden Söhnen die Tür auf, die mit ihrer wimmernden Beute das Haus verließen, ohne den zusammengeschlagenen Brian eines Blickes zu würdigen. Dafür schaute Kubrat dem gebrochenen Mann in die Augen.
»Danke deinem Herrgott, dass wir dich am Leben lassen.«
Ein bellendes Lachen folgte diesen Worten, ehe Kubrat die Eingangstür mit einem lauten Knall zuwarf. Brian Merryweather hatte das Gefühl, als ob sich der Deckel zu seinem Sarg schließen würde.
***
Das Lachen des weißhaarigen Kubrat gellte noch in Helens Ohren als auch sie das Zuschlagen ihrer Haustür vernahm. Augenblicklich erlosch ihr Widerstand, sodass sie in den Armen der beiden Brüder zusammensackte.
»He, nicht schlapp machen«, rief Bogoris und ließ ein meckerndes Lachen vernehmen. »Petko und ich werden viel Spaß mit dir haben, meine Schöne.«
Seine Worte waren Versprechen und Drohung zugleich, und in Helens Magen bildete sich ein bleischwerer Klumpen Angst, der sie schlagartig lähmte. Heiße Tränen liefen ihre Wangen herab, sodass sie die hellen Lichtbahnen der beiden Scheinwerfer des dunkelblauen Lieferwagens wie zwei zerfasernde Geisterfinger wahrnahm.
Bogoris und Petko schleiften sie zur Rückseite des Sprinters, dessen Doppeltür gerade von Kubrat geöffnet wurde. Mit einem anzüglichen Lachen stießen sie die vor Angst erstarrte Frau auf die Ladefläche und warfen die Türen ins Schloss. Helen prallte hart auf. Wenig später schlugen die Türen des Lieferwagens zu, und der Motor wurde gestartet. Ruckelnd setzte sich das Fahrzeug in Bewegung. Schluchzend stemmte sich Helen auf ihre Arme und spürte dabei, wie sich neben ihr etwas regte. Nein, nicht etwas. Jemand.
»Wer … wer ist da?« Ihre Stimme war dünn und zerbrechlich, sodass Helen gar nicht erst mit einer Antwort rechnete.
Umso mehr erstaunte es sie, als sie tatsächlich angesprochen wurde.
»Helen, bist du das?«
Wieder musste die Dreißigjährige schluchzen. Einerseits aus Verzweiflung und Angst, andererseits aber auch aus einem Gefühl der Erleichterung heraus, denn sie hatte die Stimme erkannt.
»Martha?«
»Ja«, die Stimme ihrer besten Freundin klang ebenfalls schwach und leise, hoffnungslos. »Hat man dich also auch geholt.« In den Worten schwangen keine Gefühle mit, nur dumpfe Resignation.
Helen nickte, obwohl ihre Freundin die Geste in der Dunkelheit überhaupt nicht sehen konnte. »Ja, und Brian haben sie zusammengeschlagen im Haus liegen lassen.«
»Genau wie Fred«, sagte Martha.
Helen erschrak abermals vor der Leere in der Stimme ihrer Freundin. Sie schniefte und wischte sich mit dem Handrücken die Tränen und den Rotz aus dem Gesicht.
»Weißt du, was die Schweine mit uns vorhaben?«, fragte sie schließlich, obwohl ihr die Antwort mehr Angst machte als die bisher erlittene Pein.
Martha sagte nichts, und die Stille lastete unheilvoll in der undurchdringlichen Finsternis. Nur das Geräusch des Motors und das Rumpeln des Fahrzeugs über einen unebenen Feldweg begleiteten die Leidensgenossinnen. Helen wollte ihre Frage schon wiederholen, als Martha schließlich doch antwortete.
»Glaub mir. Das willst du gar nicht wissen.«
***
Brian Merryweather lag immer noch auf dem harten Holzfußboden der Diele in seinem Haus. Tränen liefen ihm aus den Augen über die Wangen. Es gab keinen Zentimeter an seinem Körper, der nicht schmerzte. Kein Knochen, der sich nicht wie gebrochen anfühlte.
Doch es waren keine Tränen des Schmerzes, die Brian vergoss, sondern Tränen der Trauer und der Scham. Trauer um seine Frau, die ihm genommen worden war, und Scham über die eigene Ohnmacht. Was konnte er tun? Wie konnte er Helen befreien? Es war doch alles sinnlos. Seit Monaten terrorisierten die Petrovas die Bewohner des kleinen Ortes Todenham, und jeder kuschte.
Man munkelte von satanischen Ritualen, und manche behaupteten sogar gesehen zu haben, wie nachts Wölfe um das Dorf herumschlichen. Alles Gerüchte. Tatsache war jedoch, wer nicht spurte, der wurde brutal zusammengeschlagen.
Das harte Klopfen gegen die Tür riss Brian aus seiner Lethargie. Erschrocken zuckte er zusammen, aus Furcht, dass seine Peiniger zurückgekehrt sein könnten. Er begann, am ganzen Leib zu zittern, war aber nicht in der Lage, zu sprechen. Wieder hämmerte es von Außen gegen die Tür.
»Verdammt, Brian, bist du da? Helen? Macht auf, bitte. Ich bin es, Fred.«
Schlagartig entspannten sich Brians Muskeln, ein Stein fiel ihm vom Herzen, doch er war immer noch nicht in der Lage, zu antworten. Er schluchzte und zog die Nase hoch. Sein bester Freund Fred Cannon stand draußen vor der Tür und wollte mitten in der Nacht mit ihm sprechen. Trotz der Erleichterung, die Brian verspürte, breitete sich ein ungutes Gefühl in seiner Magengegend aus. Das konnte nicht Gutes verheißen.
Plötzlich bewegte sich die Klinke, und die Haustür wurde langsam geöffnet. Erst einen winzigen Spalt weit, dann wurde sie mit einem Ruck aufgerissen, und Fred Cannon stand im Türrahmen.
Seine Augen waren vor Angst und Verzweiflung weit geöffnet, sodass man das Weiße darin erkennen konnte. Der Schrecken stand ihm ins Gesicht geschrieben. Er schien sich in aller Eile angezogen zu haben, und Brian erkannte mit Entsetzen, dass sein Freund nicht besser aussah, als er sich selbst fühlte.
Freds rechtes Auge war beinahe vollständig zugeschwollen, die Lippe aufgeplatzt. Getrocknetes Blut auf Oberlippe und Kinn zeugte davon, dass auch die Nase in Mitleidenschaft gezogen worden war. Die braunen Haare waren schweißnass und an der linken Seite mit dickem, rotbraunem Blut verklebt.
»Bei euch waren sie also auch«, sagte Fred nur, als er Brian im Schein der Dielenbeleuchtung sah.
Er tat zwei Schritte in das Haus seines Freundes und schloss die Tür. Dann fiel er kraftlos neben Brian auf die Knie und stammelte resigniert: »Sie haben Martha mitgenommen.«
Brian Merryweather hörte die Worte, doch er war nicht imstande, darauf zu antworten. Apathisch blickte er an Fred vorbei ins Leere.
»Brian, hörst du? Sie haben Martha mitgenommen. Sie kamen mitten in der Nacht, brachen die Tür auf und schlugen mich zusammen. Dann zerrten sie Martha in ihren Sprinter. Was ist mit Helen? Haben sie sie auch entführt?«
Brian wollte nicken, doch stattdessen liefen nur neue Tränen aus seinen Augen. Schließlich war Fred es leid, und er packte seinen Freund mit beiden Händen seitlich am Kopf, zwang ihn so, ihm in die Augen zu sehen.
»Wo ist Helen?«, schrie er.
Endlich fand Brian die Kraft, zu antworten.
»Weg«, hauchte er. »Wie bei dir. Sie kamen, verprügelten mich und nahmen Helen mit. Ich weiß nicht, was wir tun sollen, Fred.«
»Aber ich«, plötzlich klang die Stimme seines Freundes hart und entschlossen.
Schlagartig verschwand Brians Lethargie, und neue Hoffnung keimte in ihm auf, als er den unbändigen Willen in Freds Augen sah.
»Kubrat und seine Brut haben lange genug auf unseren Nasen herumgetanzt. Die Schweine werden für das bezahlen, was sie uns angetan haben. Wir zwei brechen aus. Noch heute Nacht. Wir holen Hilfe, und dann werden die Petrovas bluten.«
Brians Blick verfinsterte sich, und er zog missmutig die Augenbrauen zusammen.
»Wie willst du das anstellen? Die Dreckskerle haben doch sämtliche Autos lahmgelegt, bis auf ihre eigenen natürlich. Auch die Telefone funktionieren nicht, und die Handys haben sie ebenfalls kassiert.«
Er schüttelte den Kopf und verzog augenblicklich das Gesicht, als neue Schmerzwellen durch seinen Schädel rasten.
»Vergiss es, Fred.«
»Kommt nicht infrage, Brian«, Freds Mine wurde hart.
»Wir laufen querfeldein, direkt zur A429. Dort fahren immer eine Menge Autos und Lastwagen, auch in der Nacht und in den frühen Morgenstunden. Einer wird uns mitnehmen oder zumindest die Polizei verständigen können.«
Jetzt lachte Brian bitter, und der Klang seiner Worte war zynisch.
»Die Polizei?«, das glaubst du doch selbst nicht. »Das hat schon einmal jemand ausprobiert. Erinnerst du dich? MacFarlane, der Lehrer. Doch es gab keine Beweise und so sind die Bullen tatenlos wieder abgezogen. MacFarlane ist seitdem verschwunden, und …«
»Vergiss die normale Polizei«, unterbrach Fred seinen Freund barsch.
»Wir holen Scotland Yard. Die haben dort Spezialisten für ungewöhnliche Fälle. Du weißt schon, ich hab dir davon erzählt.«
Brian nickte bedächtig. »Ja, vielleicht hast du recht.«
Fred Cannon stemmte die Hände auf seine Oberschenkel und stand auf, ein wenig wackelig zwar, aber es ging. Von oben blickte er Brian Merryweather ins Gesicht und streckte ihm die Hand entgegen.
»Natürlich habe ich recht. Also, bist du dabei?«
Brian zögerte, verweilte kurz in Gedanken bei seiner Frau Helen. Dann hob er entschlossen den Kopf, begegnete dem Blick seines Freundes Fred, schlug ein und ließ sich von diesem auf die Beine ziehen.
»Okay. Ich bin dabei!«
***
»Alles klar, Fred. Es ist niemand zu sehen und auch nichts zu hören.«
Brian Merryweather blickte um die Ecke seines Hauses, die Straße entlang gen Dorfmitte, und winkte seinem Freund mit der linken Hand, ihm zu folgen. Die Nacht war stockfinster, denn selbst der zunehmende Halbmond verbarg sich hinter einer dichten Wolkendecke.
Wenigstens regnet es nicht, dachte Fred Cannon, als er seinem Gefährten in den Schatten einer baufälligen Scheune hinterher huschte. Es war kühl geworden, und die Männer mussten mit scharfen Herbstwinden rechnen, sodass sie die dicken mit Lammfell gefütterten Jacken angezogen hatten. Hohe Arbeitsschuhe mit geriffelten Sohlen sollten ihnen das Vorankommen auf den Feldern und Wiesen erleichtern, deren Böden oftmals weich und nachgiebig waren.
In der Innentasche seiner Jacke spürte er das Gewicht des Beils, das er als behelfsmäßige Waffe eingesteckt hatte. Er hätte zwar ebenfalls gerne so eine Schrotflinte wie Brian gehabt, doch Schusswaffen besaß er leider keine.
Martha war strikt dagegen gewesen und hatte ihn sogar dazu überredet, die alte Bockdoppelflinte seines Vaters zu verkaufen, mit der er samstags immer zum Tontaubenschießen gegangen war.
Zwar hatten die Petrovas darauf bestanden, dass nicht nur alle Handys, sondern auch diverse Schusswaffen konfisziert wurden, doch Brians Flinte schien ihnen durch die Lappen gegangen zu sein.
Freds Gedankenkette brach ab, als sie den Rand des Dorfes erreichten. Vor ihnen und um sie herum war tiefschwarze Finsternis, die nur in weiter Ferne von winzig kleinen, hellen Punkten unterbrochen wurde. Das war die A429, das rettende Ziel. Doch dazwischen lagen mindestens zwei Kilometer Äcker, Felder und Wiesen, unterbrochen von kleinen Gräben. Kein optimales Gelände für einen schnellen Dauerlauf.
Es war vier Uhr Morgens, und die Sonne würde frühestens in zwei Stunden aufgehen. Da wollten Fred und Brian bereits an ihrem Ziel sein. Beide trugen lichtstarke Taschenlampen bei sich, die sie aber nur sporadisch und in Notfällen nutzen wollten, denn die armdicken Strahlen würden sie nur verraten.
Ihre Augen hatten sich bereits an die Dunkelheit gewöhnt, sodass die Männer sich gegenseitig als scharfe Schattenrisse vor der diffusen Schwärze der Nacht ausmachen konnten. Obwohl es nahezu unmöglich war, in der Mimik des jeweils anderen zu lesen, glaubte Fred Cannon ein entschlossenes Funkeln in den Augen seines Freundes Brian zu sehen.
Jetzt gab es kein Zurück mehr, und Fred freute sich über den Herbstwind, der sein geschwollenes Gesicht kühlte und die Schmerzen linderte.
»Bereit?«, fragte Brian und schob sich an der Scheune vorbei.
»Bereit«, antwortete Fred Cannon.
»Dann los«, zischte Brian und setzte sich in Bewegung.
Fred rannte seinem Freund hinterher, das Stechen in seiner Seite ignorierend. Vor ihm fluchte Brian leise in der Finsternis, als er auf dem weichen Ackerboden ins Straucheln geriet. »Verdammt, ich muss die Lampe einschalten.«
»Nichts da!«, zischte Fred. »Wenn das einer sieht, sind wir geliefert. Dann machen wir eben etwas langsamer. Bloß nichts überstürzen.«
»Ich will hier weg, Fred!«, Brians Stimme bebte vor Angst.
»Ich auch, aber es hilft weder uns, noch unseren Frauen, wenn wir uns hier verraten. Also reiß dich zusammen.«
Brian schniefte und packte die Flinte, die er mit beiden Händen schräg vor seinen Körper hielt, fester.
»Du hast recht.«
Gemeinsam liefen sie in einem leichten Dauerlauf weiter, ihre Aufmerksamkeit konzentriert auf den Boden gerichtet. Der Atem der beiden Männer ging stoßweise. Fred spürte ein leichtes Rasseln in den Lungen und das Stechen in seiner Seite wurde stärker. Die Mistkerle mussten ein paar Rippen erwischt haben. Das Laufen war anstrengend und zehrte an den Kräften der Fliehenden.
Auch Brian waren die Strapazen anzumerken. Er keuchte und spie ab und zu bitter schmeckenden Speichel aus. Dann hatten sie den Acker hinter sich gelassen und erreichten eine Kuhweide. Der Boden war ebener, und automatisch liefen die Männer schneller.
»Wir schaffen es, Fred. Verdammt, wir schaffen es.«
Fred Cannon ließ sich nur zu gern von der Euphorie seines Freundes anstecken. Ja, sie würden es schaffen. Jetzt glaubte er es auch. Zwei Drittel der Strecke hatten sie mittlerweile hinter sich.
Und dann hörten sie das Heulen …
***
Abrupt hielten die Männer inne und sahen sich gegenseitig verängstigt an.
»Wa … was war das?«, Brians Stimme zitterte. Die Angst war zurückgekehrt.
»Ich weiß nicht«, Freds Blick flackerte.
»Du lügst! Sie sind es, nicht wahr? Die Werwölfe.«
»Du spinnst, Brian. Das sind dumme Gerüchte. Los, weiter.«
»Ich kann nicht mehr.« Brians Atem war nicht mehr als ein Keuchen.
»Und ich spinne nicht. Hast du nicht die Augen der Petrovas gesehen, als sie uns zusammengeschlagen haben?«
Freds Antwort kam zögernd und verriet Brian, dass sein Freund genau wusste, worauf er hinauswollte.
»Schon … aber.«
»Welche Farbe hatten sie, Fred?«
»Dafür haben wir keine Zeit, Brian, wir …«
»Welche Farbe hatten sie?« Jetzt schrie er.
»Gelb. Sie waren gelb.« Die Antwort war nur noch ein Hauch.
»Ja, genau. Gelb. Gelb, wie die Augen von Raubtieren.«
Erneut erklang das langgezogene Heulen. Ein Laut der bei den beiden Männern eine Gänsehaut erzeugte, denn es klang geradewegs so, als ob das Wesen, das ihn ausgestoßen hatte, näher gekommen war.
»Komm weiter, Brian. Bitte!«
»Ja.« Die Angst drohte Brian zu überwältigen. »Ja, du hast recht.«
Fred drehte sich um und rannte weiter. Brian wollte ihm folgen, doch es war zu spät!