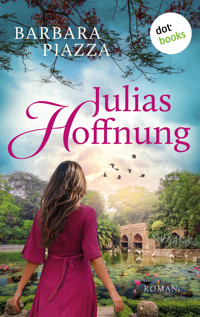
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Kann sie es wagen, ihrem Herzen zu folgen? Der mitreißende Liebesroman »Julias Hoffnung« von Barbara Piazza jetzt als eBook bei dotbooks. Zwei Jahre ist es her, seit der zurückhaltenden Bibliothekarin Julia das Herz gebrochen wurde. Nie wieder, so glaubt sie, kann sie wieder so eine Liebe empfinden … Doch als sie den charmanten Stefan kennenlernt, spürt sie, wie sein warmes Lächeln und leichtherziger Charme ihr wieder neuen Lebensmut schenken. Als er Julia nach kurzer Zeit um ihre Hand bittet, beschließt sie, zum ersten Mal in ihrem Leben unvernünftig zu sein … und sagt »Ja«, ohne zu wissen, ob er wirklich der Richtige ist. Schon auf der Hochzeitsreise nach Indien kommen ihr jedoch dunkle Zweifel: Was verbirgt Stefan vor ihr? Zur gleichen Zeit begegnet Julia in einem Tempel dem Amerikaner Andrew Miller, dem sie sich auf nie gekannte Art verbunden fühlt. Doch auch er scheint ein dunkles Geheimnis zu hüten … Kann Julia einem der beiden Männer vertrauen – oder schwebt sie in größerer Gefahr, als sie es je für möglich halten könnte? »Ein temporeiches Werk voller überraschender Wendungen.« Augsburger Allgemeine Jetzt als eBook kaufen und genießen: Das exotische Romantik-Highlight »Julias Hoffnung« von Barbara Piazza wird alle Fans der Bestseller von Nora Roberts und Lucinda Riley begeistern. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 514
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über dieses Buch:
Zwei Jahre ist es her, seit der zurückhaltenden Bibliothekarin Julia das Herz gebrochen wurde. Nie wieder, so glaubt sie, kann sie wieder so eine Liebe empfinden … Doch als sie den charmanten Stefan kennenlernt, spürt sie, wie sein warmes Lächeln und leichtherziger Charme ihr wieder neuen Lebensmut schenken. Als er Julia nach kurzer Zeit um ihre Hand bittet, beschließt sie, zum ersten Mal in ihrem Leben unvernünftig zu sein … und sagt »Ja«, ohne zu wissen, ob er wirklich der Richtige ist. Schon auf der Hochzeitsreise nach Indien kommen ihr jedoch dunkle Zweifel: Was verbirgt Stefan vor ihr? Zur gleichen Zeit begegnet Julia in einem Tempel dem Amerikaner Andrew Miller, dem sie sich auf nie gekannte Art verbunden fühlt. Doch auch er scheint ein dunkles Geheimnis zu hüten … Kann Julia einem der beiden Männer vertrauen – oder schwebt sie in größerer Gefahr, als sie es je für möglich halten könnte?
Über die Autorin:
Barbara Piazza, geboren 1945 in Eislingen/Fils, zählt zu den erfolgreichsten deutschen Drehbuchautorinnen – und noch dazu stammen von ihr die Ideen zu den TV-Erfolgsserien »Forsthaus Falkenau« und »Alle meine Töchter«. Gemeinsam mit Hans W. Geißendörfer entwickelte sie außerdem die legendäre »Lindenstraße«. Barbara Piazza ist verheiratet, hat zwei erwachsene Kinder und lebt in Oberschwaben.
***
eBook-Neuausgabe Juli 2020, August 2023
Dieses Buch erschien bereits 2014 unter dem Titel »Im Garten der Göttin« bei Blanvalet und 2020 unter dem Titel »Der Goldvogel« bei dotbooks.
Copyright © der Originalausgabe 2014 by Blanvalet Verlag, in der Verlagsgruppe Random House GmbH, München
Copyright © der Neuausgabe 2020, 2023 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Dieses Werk wurde vermittelt durch die Literarische Agentur Thomas Schlück GmbH, 30161 Hannover.
Titelbildgestaltung: Wildes Blut – Atelier für Gestaltung Stephanie Weischer unter Verwendung mehrerer Bildmotive von shutterstock/box of pic, Rawpixel.com, Scorpp, Alvaro Puig, Rpoop_Dey, anythings, TLaoPhotography und S_Photo
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (ah)
ISBN 978-3-98690-698-6
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter (Unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »Julias Hoffnung« an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Barbara Piazza
Julias Hoffnung
Roman
dotbooks.
Meiner Mutter Klara gewidmet.
Kapitel 1
Über Nacht waren die Knospen der Buchen aufgebrochen und zeigten ihre hellgrünen Spitzen. Der Himmel war hoch und von hellem, durchscheinendem Blau.
Ein Duft von Frühling und Erwartung zog durch den Wald. Er strömte in Julias Lunge, und irgendetwas brach dabei auch in ihrem Inneren aus der starren Kapsel, die es bisher umschlossen hatte.
Sie atmete tief ein und fühlte, wie sich zaghaft die Lebensfreude in ihr regte, die sie zwei Jahre lang vermisst hatte.
Sicher, sie hatte existiert und sich guter Gesundheit erfreut. Sie hatte ihre Arbeit so engagiert erledigt wie immer, aber ihre Tage waren abgelaufen wie ein Film: Sie hatte alles gesehen und auch mitbekommen, worum es ging, doch sie selbst war nicht daran beteiligt gewesen.
»Das hat echt was von Autismus«, hatte ihre Freundin Jenny diesen Zustand umschrieben.
Jenny war nichts vorzumachen.
»Es ist unglaublich, was dieser Typ angerichtet hat«, hatte Jenny noch bei ihrem letzten Besuch vor zwei Monaten festgestellt, und sie hatte damit natürlich Jürgen gemeint.
Julia hatte ihn kennengelernt, als sie beide noch Teenager gewesen waren. Seit zwei Tagen nun war sie achtunddreißig, und ihre Liebe zu Jürgen hatte, in verschiedenen Ausformungen, gut zwei Jahrzehnte gedauert.
Danach aber war die Zeit stehen geblieben.
Die letzten beiden Jahre hatte sie nicht wirklich erlebt, allenfalls überstanden. Jetzt aber, an diesem Aprilsonntag, fühlte Julia plötzlich, wie neue Kräfte in ihr erwachten, sie spürte die Wärme der Sonne, den Frühlingswind über ihre Wangen streifen und ihre Haare bewegen. Sie hörte den Ruf einer Amsel und das geheimnisvolle Rascheln im hellbraunen, ausgewaschenen Laub des Vorjahrs.
Überrascht verspürte sie Hunger, was schon sehr lange nicht mehr der Fall gewesen war.
Seit Tante Martas Gardinenpredigt im letzten Sommer und der danach folgenden Kontrolle auf der Waage, bei der sie bemerkt hatte, dass sie mehr als zehn Kilo weniger zeigte als früher, hatte sie sich gezwungen, täglich zumindest eine warme Mahlzeit zu sich zu nehmen. Sie hatte gegessen, weil sie wusste, dass es erforderlich war, aber im Grunde war es ihr egal gewesen, was auf dem Teller gelegen hatte.
Jetzt aber dachte sie an Cannelloni, dick mit Käse überbacken, und es überkam sie eine solche Gier, dass sie die Schritte beschleunigte.
Julia überlegte, ob sie ein Glas Pinot Grigio dazu trinken sollte, das passte zum Frühling, und gleich danach wurde ihr klar, dass ein Wunder geschehen war: Sie war ins Leben zurückgekehrt, die Welt war wieder farbig, und sie hatte Wünsche. Es gab Sonne, Wind, Geräusche, Vogelgesang, sie hatte Appetit auf ihr Lieblingsgericht und war bereit, dafür allein in ein Restaurant zu gehen. Die dicke Glaswand, hinter der sie ihr Leben geführt hatte, war nicht mehr vorhanden.
Zwei Menschen, ein Paar mittleren Alters, kamen ihr entgegen. »Ist es nicht schön, dass jetzt der Frühling kommt?«, fragte die unbekannte Frau.
»Ganz wunderbar«, bestätigte Julia und lächelte.
Dann ging sie eilig weiter. Kurz bevor sie das Ortsschild der kleinen Stadt erreichte, spürte sie die Träne, die in ihren Mundwinkel floss. Sie leckte sie mit der Zungenspitze auf. Das ist der letzte, bittere Bodensatz dieser verdammten Liebe, dachte sie und wich einem entgegenkommenden Fahrzeug aus.
Luigi, der neue Padrone der kleinen Taverne, warf der hübschen, blonden Frau mit den schulterlangen Haaren und den hellen, blauen Augen einen bewundernden Blick zu.
Eine von Julias Urgroßmüttern stammte aus Schweden, und die schwedischen Genprozente, wie ihr Vater dies immer bezeichnet hatte, dominierten ganz eindeutig ihr Aussehen. Und heute streute die unverhoffte, gute Laune noch Goldflitter drüber.
»Meinen besten Tisch für Sie, Signorina«, sagte Luigi, als ob er begriffen hätte, dass dies ein besonderer Tag war.
Julia sagte ihm das, und noch während sie es aussprach, war sie erstaunt über die wiedergewonnene Fähigkeit, anderen Menschen etwas von ihrer Befindlichkeit mitteilen zu können.
»Ich nix könne schaue in Ihre Herz, aber sehe ich eine schöne junge Frau, und – bin ich eine Italiener. Finde ich, so etwas gehört ... Tribut dargebracht ...«
Er verneigte sich charmant und unterstrich den Tribut mit einem Glas Prosecco auf Kosten des Hauses.
Julia nahm einen kleinen Schluck des angenehm prickelnden Getränks, behielt ihn im Mund und ließ ihn ihren Gaumen kitzeln. Es war ein wunderbares Gefühl.
Dann holte sie ihr Handy aus der Umhängetasche und schickte Jenny eine SMS: »Bin wieder da. Julia.«
Sie war ganz sicher, dass die Freundin ihre Botschaft richtig verstehen würde. Ein kurzes Piepen, und der prompt eingetroffene Antworttext auf dem Monitor ihres Smartphones zeigte ihr, dass sie richtig vermutet hatte: »Gott sei Dank. War auch Zeit. LG, Jenny«.
Nach dem Essen nahm Julia statt des geteerten Wegs den steilen Trampelpfad zur Burg hinauf. Er endete dort, wo sich ein für die Allgemeinheit zugänglicher Aussichtsbalkon befand.
Sie stellte sich ganz vorn an die Brüstung und schaute auf das Städtchen und den Fluss, die wie eine Spielzeuglandschaft unter ihr lagen. Sie dachte an die düsteren Gedanken, die ihr an dieser Stelle so oft gekommen waren, und daran, wie dicht sie an diesem schrecklichen Abend davor gewesen war, sie zu verwirklichen.
Dann kramte sie aus ihrer Handtasche noch einmal ihren Geldbeutel hervor. Hinter dem Personalausweis versteckt, bewahrte sie das allerletzte Bild von Jürgen auf, das sie behalten hatte. Es war eine Aufnahme, die sie zusammen zeigte, bei der ersten ihrer insgesamt drei Urlaubsreisen nach Griechenland.
Julia machte sich nicht einmal die Mühe, dieses Zeugnis ihres höchsten gemeinsamen Glücks zu zerreißen. Sie öffnete einfach Daumen und Zeigefinger und ließ das Foto im frischen Wind dieses Frühlingstags davonflattern. Es war ihr, als ob alle Schwere der Vergangenheit endgültig damit verschwinden würde.
Obwohl Julia befürchtete, dass sie niemanden jemals wieder so lieben könnte wie Jürgen, schmerzte diese Erkenntnis nicht, sie war eher befreiend: Nie mehr würde sie es dulden, dass so tiefe, so ausschließliche Gefühle entstanden. Und nie mehr würde sie so leiden müssen, wie sie es die letzten zwei Jahre getan hatte.
Sie drehte sich um und ging zum Eingang des Burgareals.
Benno, der Rhodesische Löwenhund des Verwalters, flitzte auf sie zu, sprang an ihr hoch und leckte mit seiner großen Zunge liebevoll ihre Wange.
Julia wehrte das Tier ab und lachte dabei.
»Heut sind Sie aber gut aufgelegt – und der Benno freut sich darüber«, rief Brigitte Hasler, die Frau des Verwalters, die sie vom Fenster aus beobachtete.
Julia wusste um das einfühlsame Wesen dieser Hunderasse, streichelte das glatte, cognacfarbene Fell des Hundes und schob ihn dann energisch durch die Tür des Verwalterhauses.
»Schönen Abend zusammen«, rief sie, als hinter der Frau jetzt auch Walter Hasler, der Burgverwalter, am Fenster erschien.
»Ich glaube, das wird wieder, mit unserer Frau Doktor«, konstatierte Brigitte Hasler mit einem Schmunzeln.
»Geb es Gott«, brummte Walter Hasler, denn er hatte den Novemberabend nicht vergessen, an dem Julia Bader auf der Felsplatte neben der Balustrade des Aussichtsbalkons gestanden und plötzliche Angst seinen Herzschlag zum Rasen gebracht hatte. Glücklicherweise aber hatte die Archivarin sich plötzlich umgedreht und war, ganz normalen Schritts, zur Burg zurückgekehrt. Manchmal schon hatte er sich gefragt, ob er sich damals geirrt hatte, doch selbst seine Frau, die sonst immer positiv dachte, hatte es nicht für ausgeschlossen gehalten.
»So ein Liebeskummer kann schon Selbstmordgedanken auslösen, und dies vorzugsweise bei den Guten, Feingestrickten, wie unsere Frau Doktor das ist!«, hatte sie gesagt.
Und Walter Hasler dachte, dass man froh sein könne, wenn Sturm und Drang überwunden waren, und dass es sich mit der Liebe wohl so verhalte wie mit dem Fluss unterhalb des Burgbergs: Nach starken Gewittern war er gefährlich und ungebärdig, vor allem dort, wo er sich zwischen Hindernissen verengte. Sonst aber floss er ruhig und gemächlich dahin, erfreute Anwohner, Wanderer, Fotografen und sogar gelegentlich seinetwegen herbeigereiste Kunstmaler.
Ihm schien, dass die junge Historikerin, die seit zwei Jahren oben im Burgturm hauste und an ihren Arbeitstagen das Archiv derer von Staufenfels in Ordnung brachte, die gefährliche Engstelle im Fluss ihres Lebens jetzt überwunden hatte
Kapitel 2
Es war Mitte Juni, und die hoch stehende Sonne brannte gnadenlos auf den Burgberg.
Julia, die im Städtchen unten auf der Post gewesen war, eilte über den gepflasterten Burghof, öffnete die schwere, eisenbeschlagene Tür des Turms und flüchtete sich in den kühlen Schatten ihres Arbeitsraums. Die dicken Mauern schützten vor zu heftiger Wärme ebenso wie vor Kälte. Was natürlich nicht bedeutete, dass auf die Heizung verzichtet werden konnte, die den großen, quadratischen Raum bei Bedarf angenehm temperierte. Allerdings war Letzteres eine Errungenschaft der Neuzeit, aber mit guter Kleidung ausgerüstet, hatte man es hier sicher auch in den Wintern des Mittelalters aushalten können.
Sie fuhr den Computer hoch und prüfte die angekommenen Mails. Die erste war von Graf Staufenfels, ihrem Arbeitgeber, und betraf die Genehmigung zum Druck der Broschüre, die sie über die Geschichte der Burg geschrieben hatte. Das Schöne daran war, dass Graf Franz Anton nicht mit Komplimenten sparte und sowohl den Text als auch ihre Auswahl der Archivbilder lobte.
Julia freute sich und beschloss, die Datei ohne weiteren Kommentar an den Freiburger Verleger weiterzuleiten. Es konnte nicht schaden, wenn dieser Mann, mit dem sie es in Zukunft noch öfter zu tun haben würde, gleich von Anfang an begriff, dass sie eine geschätzte Arbeitskraft der Staufenfels' war.
Die zweite Mail war von Jenny, die wieder einmal in der Welt umhergondelte. Jenny war Reiseleiterin und organisierte exklusive Abenteuerreisen in Kleingruppen. Diesmal aber war sie privat unterwegs. Sie traf sich mit ihrem Freund Richard, einem Mann aus Cairns, den sie vor zwei Jahren über eine Internetplattform kennengelernt hatte.
Richard Butcher war Entomologe und erkundete mit leidenschaftlicher Beharrlichkeit die Insektenwelt des nordaustralischen Regenwalds.
Julia hatte keine Ahnung, was die umtriebige, lebenslustige Jenny bewogen hatte, sich ausgerechnet in einen Insektenforscher zu verlieben, der sich weigerte, sein Arbeitsgebiet auch nur für ein paar Urlaubstage zu verlassen. Tatsache aber war, dass diese ungleichen Partner sich offenbar prächtig verstanden und die Beziehung intakt und stabil war.
»Du kannst doch nicht einfach zu einem Menschen reisen, den du nur über ein paar E-Mails kennst«, hatte sich Julia entsetzt, als Jenny zum ersten Mal nach Cairns geflogen war.
»Und weshalb nicht?«, hatte Jenny geantwortet. »Wir mailen seit gut einem halben Jahr miteinander, und inzwischen weiß ich mehr von Richard, als ich jemals über Mark wusste, mit dem ich zwei Jahre in derselben Firma gearbeitet habe, bevor wir damals zusammengezogen sind. Es kommt meiner Meinung nach nicht so sehr auf den Faktor Zeit an, sondern auf die Bereitschaft, sich dem anderen wirklich zu öffnen«, hatte Jenny befunden, und inzwischen wusste Julia, dass sie recht damit hatte. Immerhin hatten Jürgen und sie ... aber ... Jürgen war Vergangenheit, und es brachte nichts, wenn sie wieder begann, darin herumzuwühlen.
Sie widmete sich dem Brief, den die achtzehnjährige Constanze von Staufenfels im Sommer 1738, kurz vor ihrer Hochzeit, von ihrem Verlobten erhalten hatte. Es war eine der damals seltenen Liebesheiraten gewesen, und jeder Satz des Briefs war ein Zeugnis der verliebten Ungeduld dieses Bräutigams.
Julia spürte die raue Oberfläche des alten Papiers unter ihren Fingern, und es war, als ob die darauf beschriebene Sehnsucht einen Weg durch ihre Poren finden würde und ihr ganzes Gemüt infiltrierte.
Ich will nicht mehr allein sein, dachte sie, doch sofort widersprach ihr Verstand: Du bist wirklich dumm. Hast du vergessen, was Jürgen ...?
Zum Teufel mit Jürgen!
Ihr ganzes Leben hatte dieser Kerl dominiert, und sein Betrug hatte alle Hoffnungen begraben, die sie jemals entwickelt hatte. Sie war noch nie so unglücklich gewesen, nicht einmal nach dem Unfalltod ihrer Eltern.
Julia holte sich eine Flasche Wasser und goss ein Glas davon ein, wobei sie sich selbst wieder zur Ordnung rief: Okay, sie hatte schwer unter der Trennung gelitten, doch diese Phase war überwunden: Sie hatte sich entschlossen weiterzuleben, auch ohne Jürgen. Sie sah gut aus, war beruflich erfolgreich und erst achtunddreißig Jahre alt. Ihre biologische Uhr tickte zwar, aber sie war noch nicht abgelaufen. Alles war noch möglich, sogar die Kinder, die sie sich in Jürgen-Zeiten gewünscht hatte.
Die Frage war allerdings, ob sie es fertigbringen würde, noch einmal einem Partner Vertrauen zu schenken.
Natürlich wusste sie, dass es auch Männer gab, die treu waren und denen ihre Partnerin alles bedeutete. Papa war ein solcher gewesen, Onkel Erich ebenfalls, und Walter Hasler war ein lebender Beweis dafür.
Die Frage war, wie sie ein solches Exemplar finden sollte. Ihr Job auf diesem einsamen Burgberg, der ihr im Trennungsfrust vor zwei Jahren so ideal erschienen war, erwies sich inzwischen als ausgesprochener Nachteil, denn eine passende Freizeitwelt für eine Frau von achtunddreißig gab es in dem kleinen, verschlafenen Staufenfels nicht. Es gab sie ebenso wenig wie interessante kulturelle oder gesellschaftliche Angebote, bei denen sie Gleichgesinnte hätte kennenlernen können. Sie wusste dies aus verschiedenen Versuchen, zu denen Jenny sie bei ihren Besuchen genötigt hatte.
»Total tote Hose hier«, hatte die Freundin schließlich resigniert. »Jeder, der etwas kann und zu sagen hat, scheint hier weggezogen zu sein!«
Julia wusste, dass dies nicht übertrieben war. Sie konnte die Klagen des Bürgermeisters darüber in beinahe jeder Ausgabe des örtlichen Nachrichtenblatts lesen. Staufenfels war ein Paradebeispiel der Landflucht. In dem verschlafenen Städtchen blieben offenbar nur die Trägen und Alten.
Sie musste also andere Wege beschreiten, um aus ihrer Einsamkeit wieder herauszufinden.
Nachdenklich starrte Julia auf den Monitor ihres Computers. Erst neulich hatte sie in einem Nachrichtenmagazin einen großen Artikel über den »riesigen Marktplatz namens Internet«gelesen und davon, dass immer mehr Menschen auch bei der Partnersuche von dieser Möglichkeit Gebrauch machten. Allerdings war auch von den Gefahren dieser virtuellen Bekanntschaften die Rede gewesen.
»Ach was, bei Jenny hat es ja auch geklappt«, sagte Julia schließlich laut und ein wenig trotzig, obwohl niemand da war, der ihr hätte widersprechen können. Ein letztes Mal zögerte sie noch, dann legte sie die Finger auf die Tasten.
Versuchsweise tippte sie das Wort »Partnersuche«, worauf auf dem Monitor so zahlreiche, grellfarbene und blinkende Angebote erschienen, dass sie erschrocken zurückwich.
Bald aber war die Neugier stärker als ihre Skrupel.
Sie las und klickte, klickte und las, und als es, ohne dass sie es bemerkt hätte, tiefe Nacht geworden war, entschloss sie sich zur Aktion: »Einsame Burgfrau, 38, sucht edlen Ritter«, schrieb sie und konnte ein Grinsen dabei nicht unterdrücken. »Du brauchst kein weißes Pferd, aber wenn Du Grips und Humor hast, werde ich Dich von meinem Turm aus besichtigen. Und wenn Du mir gefällst, werde ich mein Rapunzelhaar durchs Fenster werfen und Dich hereinlassen.«
Dann schaltete sie den Computer so schnell aus, als ob jemand in den Raum gekommen wäre, um sie einer verbotenen Tat zu überführen – oder zumindest einer Albernheit, die einer Frau ihres Alters eigentlich nicht mehr zustand. Oder gerade jetzt?
Vielleicht meldete sich keiner, doch dann hätte sie es zumindest versucht. Und sie war es sich schuldig, es wenigstens zu versuchen, fand Julia, als sie eine Treppe höher in ihrem Bett lag.
Kapitel 3
Es waren zweiundzwanzig mutmaßliche Ritter, die sich gemeldet hatten.
Drei davon schieden wegen grober Geschmacklosigkeiten auf der Stelle aus, ebenso die fünf Edelmänner, die sich, gewollt oder unbeabsichtigt, als Sexisten outeten. Drei weitere waren klare Fälle von Legasthenikern, was bereits eine Verlustquote von fünfzig Prozent ausmachte.
Von der zweiten Hälfte waren vier Herren eindeutig zu alt, drei weitere bezeichneten sich als »m. g.«, was, wie Julia nach einigen Recherchen als »mehrfach gebraucht« übersetzen konnte. Dies erschien ihr nicht weiter bedenklich, immerhin handelte es sich um Enddreißiger bis Mittvierziger, aber, so mailte die besorgte Jenny, bedeute es in diesem Kontext nicht nur Partnerschaften, sondern Ehen, und die verschärfte Variante davon sei »m. g. m. A.«, was »mehrfach gebraucht mit Altlasten« heiße. Dies wiederum sei in aller Regel mit massiven finanziellen Unterhaltsverpflichtungen gleichzusetzen.
Na ja, immerhin sind die ehrlich, dachte Julia und las die verbliebenen vier Antworten.
Eine davon war superflapsig, und vor Julias geistigem Auge erschien auf der Stelle ein pickeliger Siebzehnjähriger, der sein wahres Alter verschleierte. Sie klickte auch diesen in den Orbit und nahm sich die drei nächsten Zuschriften vor.
Eine davon hatte den Charme einer Steuererklärung, also blieben noch zwei.
Die vorletzte, die sie las, war ausgesprochen witzig und ließ gute Bildung erahnen. Die letzte war dezent humorvoll und las sich freundlich und erfrischend. Außerdem hatte sie etwas vorzuweisen, was allen anderen Zuschriften fehlte: ein Foto im Anhang. Es war keine Porträtaufnahme, sondern ein ungezwungener Schnappschuss vor einer üppig blühenden Bougainvillea, und zeigte einen schlanken, dunkelhaarigen, braun gebrannten Mann in Bermudahosen und hellem Hemd, der verhalten in die Kamera lächelte.
Sein Name sei Stefan Windheim, er stamme aus Graz in Österreich, sei Bauingenieur und arbeite seit drei Jahren auf einer Großbaustelle in Indien, entnahm Julia seinem Text.
»In Indien«, stieß sie laut und erfreut aus, denn wenn es außer einem Leben mit Jürgen jemals einen Traum für sie gegeben hatte, dann war dies eine Reise nach Indien. Als Kind hatte sie ein Buch mit diesem Titel besessen, dem sie vermutlich die Affinität für alles Indische und ihre Begeisterung für dieses Riesenland verdankte.
»Warum, um Gottes willen, reist du dann nicht mal dorthin?«, hatte Jenny sie schon einige Male gefragt.
Julia hatte immer ausweichend geantwortet, aber die wahre Erklärung wäre gewesen, dass sie sich vor Enttäuschungen fürchtete. Denn was immer sie bisher fasziniert hatte, die reale Beschäftigung damit, oder gar ein Augenschein, hatte die Bilder der Fantasie aufgehoben und die Sache entzaubert. Indien aber hatte sie als Sehnsuchtsziel behalten wollen.
Vielleicht war es ein Fehler gewesen.
Vielleicht war dieses Land noch viel grandioser, als ihr Kinderbuch es ihr vermittelt hatte.
Jetzt jedenfalls würde sie bald mehr davon erfahren.
Julia löschte alle anderen Nachrichten und schickte sich an zu antworten.
»Lieber Stefan ...«, tippte sie, aber sie unterbrach sich noch einmal, um das Foto zu suchen, das Jenny bei ihrem letzten Besuch von ihr gemacht hatte. Es zeigte sie, wie sie sich weit über die Brüstung des Burgturms beugte, was zur Folge hatte, dass ihre langen blonden Haare ein Stück weit über das Sandsteinmauerwerk nach unten hingen. Sie war nicht sicher gewesen, ob sie – nach ihrer kessen Mail – dieses »Rapunzel-Foto« tatsächlich verwenden sollte, aber der Gedanke, dass es gleich nach Indien fliegen würde, gefiel ihr.
Julia scannte es ein und fügte es der Nachricht bei, die sie an Stefan Windheim schickte. Außerdem unterzeichnete sie die Botschaft mit ihrem vollen Namen, den sie bisher noch nicht genannt hatte.
Dann griff sie wieder nach dem Brief an Constanze von Staufenfels. Sie las ihn mit einem Lächeln – und dieses Mal ohne Neidgefühle.
Die Welt war schön und interessant, in jedem Jahrhundert, in dem man lebte, und es kam nur darauf an, wie man in den Wald hineinrief, wenn man darauf wartete, ein Echo zu hören.
Die erhoffte Antwort kam noch in derselben Nacht, und die Freude im Text Mang sympathisch und ungekünstelt. Noch bevor sie sich an ihre Arbeit machte, schrieb Julia ihm einen Morgengruß.
Kapitel 4
Sie hatten sechsundsechzig Mails gewechselt, und Stefan war mit der siebenundsechzigsten seit ungefähr sechs Stunden im Rückstand, als ein pinkfarbener Boxster im Burghof vorfuhr.
»Mein lieber Scholli!«, rief Julia anstelle einer Begrüßung. »Hast du im Lotto gewonnen?«
»So ähnlich. Ich hab von meiner Firma eine Gehaltserhöhung bekommen und beschlossen, das Ding hier zu leasen. Man muss sich seine Träume erfüllen, solange man welche hat!«, erwiderte Jenny fröhlich und kletterte heraus.
Julia schmunzelte und nickte. »Stimmt«, sagte sie, umarmte die Freundin und hörte dabei durch die gekippte, verglaste Schießscharte des Arbeitszimmers das akustische Signal, welches das Eintreffen neuer Mails ankündigte.
Sie schaffte es tatsächlich, erst eine Flasche Prosecco zu öffnen und zwei Gläser zu füllen, bevor sie Jenny an den Computer schleppte, um diese mit der Sensation bekannt zu machen, die sich inzwischen ereignet hatte.
»Das klingt nicht übel«, musste Jenny einräumen, als sie die Lektüre des Schriftwechsels beendet hatte.
»Ja, das finde ich auch«, erwiderte Julia und hörte selbst, wie hoffnungsvoll ihre Stimme dabei klang.
»Obwohl du trotzdem vorsichtig sein solltest«, dämpfte Jenny ihren Enthusiasmus. »Daraus, dass ich mit Richard einen Glücksgriff getan habe, lässt sich nicht ableiten, dass es immer so ist.«
»Das weiß ich auch. Ich bin ja kein Kindchen.«
»Manchmal schon.«
»Selten!«
»Okay, selten, aber ein bisschen mehr als ich neigst du schon zur Romantik – und vor allem zur Gutgläubigkeit.« Jenny schenkte sich noch einmal Prosecco nach, um dann gleich eine Begründung für die unterstellte Blauäugigkeit nachzuliefern: »Vermutlich deshalb, weil du es in der Regel mit toten Leuten zu tun hast – und ich mit lebendigen. Und der entscheidende Unterschied liegt darin, dass man die Fehler der Toten vergisst oder verklärt, wenn sie nicht gerade damit Geschichte gemacht haben. Was leicht zur Überzeugung führen kann, die Menschen seien mehrheitlich gut.«
Julia musste lächeln, fühlte sich aber doch verpflichtet, die Sache richtigzustellen: »Glaub ja nicht, dass meine ... Toten ... anders waren als wir! Je länger ich es mit den Vorvorderen zu tun habe, desto mehr komme ich zu der Erkenntnis, dass nur die Zeiten sich ändern. Die Menschen sind immer gleich. Gestern zum Beispiel hab ich mir den Grafen Franz August vorgenommen, das war der Urururgroßvater vom derzeitigen Chef der Familie Staufenfels, und der hat mich sehr lebhaft an meinen vergangenen Jürgen erinnert.«
Jenny musterte die Freundin mit einem aufmerksamen Blick. Dann hob sie das Glas mit dem Rest des Proseccos. »Bravo, Julia! Du bist tatsächlich darüber hinweg. Ich hatte es fast schon aufgegeben, darauf zu hoffen. Aber ich sehe, das Internet hat nicht nur in meinem Leben ein gutes Werk verrichtet, sondern auch in deinem. Darauf lass uns trinken, egal ob er dir bleibt oder nicht, dieser ... indische Prinz!«
Danach kicherten sie beide, beinahe so unbeschwert wie damals, als sie gemeinsam das Internat in Oberbayern besucht hatten.
Jenny blieb fünf ganze Tage, und alle verliefen so unbeschwert und fröhlich wie die erste Stunde im Turm.
Julia schob die Dokumente der männlichen Staufenfels', die allesamt Franz und dahinter noch irgendwas hießen, beiseite, holte ihre Wanderstiefel heraus und durchstreifte mit Jenny die schattigen Laubwälder der näheren Umgebung. Zusammen bestiegen sie nacheinander die beiden Vorzeigeberge der Region.
»Es ist wie immer, wenn wir zusammen sind«, fand die mollige, schwarz gelockte Jenny ein wenig nostalgisch und lehnte sich gegen die langbeinige, schlanke Freundin. »Schön und harmonisch. Wir haben uns von Anfang an fast ohne Worte verstanden.«
»Was erstaunlich ist. Schließlich sind wir ziemlich verschieden.«
»Du sagst es«, erwiderte Jenny und grinste.
Jenny war von sprudelnder Lebhaftigkeit, spontan bis leichtsinnig, und immer geneigt, sich kopfüber in alles Unbekannte zu stürzen.
Julia dagegen war eher reserviert, auf jeden Fall aber vorsichtig-beobachtend, wenn sie jemanden nicht sehr gut kannte. Ihr Pflichtbewusstsein und ihre Gewissenhaftigkeit waren sowohl angeboren als auch anerzogen und gingen ihr manchmal selbst auf die Nerven. Auf jeden Fall machten diese Eigenschaften ihr Leben nicht leichter. Manchmal wünschte sie sich, so sein zu können wie ihre Freundin.
»Du grübelst zu viel«, rief Jenny neckend. »Lass uns lieber nachsehen, ob dort oben ein knackiger Jägersmann sitzt!« Und trotz Julias Protest kletterte sie schon eine wacklige Leiter hinauf, um vom Hochsitz aus die Waldlichtung zu inspizieren.
»Lieber einmal zu viel nachgedacht, als beide Beine gebrochen«, konstatierte Julia, denn bei einer Kletterei in den Alpen war es genauso gewesen – und Jennys Doppelgips hatte ihnen damals den ganzen Sommer versaut.
Den bitteren Tropfen im Becher der Freundschaft servierte Jenny erst am allerletzten Abend. Sie hatten im Hof gegrillt und tranken danach auf dem Burgfried die gut gekühlte Flasche Wein aus dem Weingut der Staufenfels' in Chile, die Beigabe zu den letzten Weihnachtsgrüßen der gräflichen Familie gewesen war.
»Ich werde im Sommer heiraten und danach mit Richard in Cairns leben«, erklärte Jenny mit einer Stimme, aus der alles herauszuhören war, was sie derzeit bewegte: Freude, hoffnungsvolle Erwartung, ein klein wenig Angst und eine Andeutung des künftigen Heimwehs.
Die Hände der Freundinnen suchten und fanden sich. Sie verschlangen die Finger ineinander, wie sie es immer getan hatten, wenn etwas Großes oder etwas Schreckliches geschehen war: das gemeinsam bestandene Abitur, Jennys Diplom, der Unfalltod von Elise und Albert Bader, der Julia mit zwanzig Jahren zur Vollwaise gemacht hatte, ihr bestandenes Examen und ihre Promotion; Jennys großes Los mit ihrer neuen Stelle, ihre Verlobung mit Richard, schließlich Jürgens Verrat und die nachfolgende Trennung.
»Wir werden immer verbunden bleiben«, versicherte Jenny, und Julia sah die silberne Spur einer Träne auf der Wange der Freundin. »Egal, wo du oder ich uns grade befinden!«
»Klar«, murmelte Julia und versuchte, das blöde Zittern in ihrer Stimme zu überspielen. »In einer globalisierten Welt ...«
»Genau. Du musst nur einen Tag im Flieger verbringen, und schon sind wir wieder beisammen!«
Ja. Aber in der Zeit zwischen solchen Reisen sehen wir uns nicht. Und mehr als ein Mal im Jahr wird es nicht möglich sein, dass ich zu dir komme oder du zu mir, sagte sich Julia und hätte schwören können, dass die Freundin dasselbe dachte.
»Egal. Es gibt Telefone und Computer, man kann mailen, telefonieren, skypen, Simsen – und glücklicherweise ist das alles ja auch nicht mehr teuer«, zählte Jenny auf und wischte mit dem Handrücken ihre Tränen beiseite.
Julia fiel inzwischen ein, dass es bereits Ende Juni war: »Und wann genau ist bei dir Sommer?«, fragte sie und überlegte ein wenig panisch, dass sich eine baldige Reise nach Australien mit der geplanten Publikation über die Vorfahren der heutigen Staufenfels', die sie – ein wenig flapsig – nur ihre Fränze nannte, nicht gut vertragen würde. Sie musste das Manuskript im Spätherbst fertiggestellt haben – und wenn sie schon nach Australien flöge, dann wäre es ungeschickt, nur eine einzige Woche zu bleiben.
»Ich meine im australischen Sommer, also, wenn bei uns Winter ist«, erklärte Jenny jedoch.
»Das lässt sich einrichten«, überlegte Julia laut. Bis dahin hätte sie schon die Druckfahnen gelesen – und im Frühling, wenn die Präsentation des Buchs geplant war, würde sie längst wieder zurück sein.
Sie schwiegen, tranken in kleinen Schlucken den Wein und schauten hinauf zum Himmel, wo der Mond als blasse Sichel über den nachtdunklen, bewaldeten Hügeln des Staufenfelser Lands hing.
»Der Sternenhimmel ist wunderbar«, sagte Jenny nach einer Weile, und Julia verkniff sich zu fragen, ob er in Cairns wohl ebenso schön sei. Doch Jenny beantwortete die unausgesprochene Frage: »Es sind andere Sterne dort, aber an die werd ich mich hoffentlich auch gewöhnen.«
Wieder schwiegen sie, dann stellte Jenny fest: »Von Indien aus wär's übrigens näher nach Cairns als von hier.«
Danach mussten sie so sehr lachen, dass Jenny einen Schluckauf bekam, was die Rührung und den Vor-Trennungsschmerz ganz schnell killte.
Kapitel 5
Es war Oktober geworden, und die Umgebung der Burg glühte in Gelb- und in Rottönen.
Alle Lebensläufe der Fränze von Staufenfels waren recherchiert, verifiziert und in eine historische Abfolge gebracht. Es war leichter gegangen, als Julia sich dies vorgestellt hatte, denn die Unterlagen der Familie waren nahezu lückenlos. Allein die Abbildungen der Herren hatten ihr Mühe bereitet und langwierige Korrespondenzen mit Museen und anderen Adelshäusern verlangt. Jetzt aber war alles komplett und wartete auf Graf Franz Anton, der versprochen hatte, bald vom spanischen Hauptsitz der Familie bei Benidorm anzureisen und Korrektur zu lesen, bevor das Werk an den Verlag weitergeschickt werden sollte.
Julia, die sich nun ein paar Urlaubstage gönnen konnte, beschloss, ihre einzige noch lebende Verwandte, Tante Marta, eine Schwester ihrer verstorbenen Mutter, zu besuchen.
Marta Albers lebte von November bis Februar in ihrer Stadtwohnung in München, das restliche Jahr verbrachte sie vorzugsweise in ihrem Haus im Tessin.
Julia fuhr mit dem Zug bis Lugano, wo Tante Marta sie abholte.
»Du siehst fabelhaft aus, Julia. Mir scheint, du hast die Sache mit Jürgen endgültig überwunden«, stellte Tante Marta fest, nachdem sie ihre Nichte umarmt und danach gründlich gemustert hatte.
»Was einen nicht umbringt ...«
»Mach keine Späße darüber. Sehr weit weg davon warst du nicht«, fiel ihr Tante Marta ins Wort.
»Nein. Wirklich nicht«, gab Julia zu und rückte dann ihre neue Handtasche ins Blickfeld der Tante, die auf den Trick hereinfiel und sofort ausrief: »Du musst ja Unsummen verdienen bei diesem Grafen, wenn du dir dieses Label leisten kannst!«
Julia verschwieg, dass der Hersteller der Edeltasche ganz in der Nähe von Staufenfels einen Fabrikverkauf betrieb, in dem man Produkte, die kleine Fehler aufwiesen, für einen Bruchteil des üblichen Preises erhielt. Sie schob das edle Stück über die Schulter und behauptete lässig: »Manchmal gönn ich mir eben was!«
»So gefällst du mir wieder. Und den Männern auch, wie ich sehe«, erwiderte ihre Tante, denn sie hatte den Blick eines entgegenkommenden Herren bemerkt, als sie auf ihr Auto zusteuerte.
Auch Julia hatte ihn registriert – und sie stellte erstmals seit langer Zeit wieder fest, wie euphorisierend männliche Bewunderung wirkte. Es war unbestreitbar der Nachteil einer Mailbeziehung, dass dieses Moment nicht herzustellen war. Was sich bald ändern würde, wie sie seit vorgestern wusste.
Julia lehnte sich zurück und beobachtete ihre Tante, die den schweren Wagen versiert durch Lugano lenkte.
Marta Albers war siebenundsechzig. Sie war mittelgroß und hatte gepflegte, kinnlange graue Haare. Sie war elegant, selbstbewusst und modisch gekleidet, und dennoch war sie eine Frau der Spezies, die am Aussterben war: Sie hatte weder einen Beruf erlernt noch hatte sie jemals gearbeitet; sie hatte geheiratet, bevor so etwas eintreten konnte. Ihr Mann Erich war ein höherer Ministerialbeamter in der bayerischen Kultusverwaltung gewesen und vor wenigen Jahren, kurz nach seiner Pensionierung, verstorben. Er stammte aus einer alten Münchner Akademikerfamilie, war der einzige Sohn eines wohlhabenden Apothekers gewesen und hatte seiner Witwe neben seiner Pension auch ein stattliches Vermögen hinterlassen, was dieser ein unbeschwertes, großzügiges Leben ermöglichte. Ihr Sohn Alwin war nach einem Jurastudium in den diplomatischen Dienst eingetreten und derzeit deutscher Botschafter in Botswana.
»Hin und wieder flieg ich dorthin, so alle drei Monate ein paar Tage. Alwin schlägt mir zwar immer wieder vor, dass ich ganz zu ihm kommen soll, aber ich will meine Selbstständigkeit nicht aufgeben – und auf die Dauer mag ich an diesem abgelegenen Platz und dem ungesunden Klima nicht leben.«
Julia hatte keine genaue Vorstellung davon, wie das Klima in Botswana beschaffen war, aber sie kannte Bilder des stolzen Anwesens, in dem ihr Cousin residierte, und war der Auffassung, dass es so schrecklich dort nicht sein könne. Allerdings verstand sie den Wunsch der Tante, selbstständig zu bleiben.
Der Kaffeetisch war bereits gedeckt, als sie ankamen.
Julia wusch sich die Hände und nahm dann dankbar einen Schluck des heißen, wunderbar aromatischen Kaffees.
»Ich lasse ihn immer noch aus Bolivien kommen, direkt von der Farm, die ich damals besucht habe, als Alwin noch in Südamerika war.«
Die weißen, handbemalten Tassen waren aus der Nymphenburger Porzellanmanufaktur und ein Erbstück der Albers-Familie, die weiße Damasttischdecke war mit demselben Muster bestickt, und die Farben der gezüchteten Vergissmeinnicht waren vom gleichen Blau wie das Motiv auf Tassen und Decke.
»Die absolute Perfektion«, sagte Julia bewundernd. »Und der Kuchen ist erstklassig. Du bist einfach eine Frau mit Stil, Tante Marta!«
»Das will ich doch hoffen«, erwiderte Marta Albers mit der ihr eigenen Ironie. »Vorzeigbar auszusehen und ein gutes Haus zu führen ist das Einzige, was ich wirklich beherrsche, und das hab ich mühsam – und unter Zorntränen – von meiner Schwiegermutter gelernt.« Sie schmunzelte ein wenig, als sie gestand, was Julia ohnehin wusste: »Dein verstorbener Onkel hat mich verführt, als ich knapp siebzehn Jahre alt war. Ich konnte gerade noch das Abitur machen, bevor Alwin geboren wurde. Wir waren damals ein großer Skandal in München, aber wir hatten eine ausgesprochen glückliche Ehe. Ich möchte keinen Tag davon missen, und dein Onkel hatte noch Gelegenheit, mir dasselbe zu sagen, bevor er starb. Glaube mir, Julia, so etwas ist so selten wie ein Hauptgewinn in der Lotterie!«
»Ich glaub es dir auf der Stelle«, erwiderte Julia und dachte prompt wieder einmal an Jürgen.
»Was meinen Sohn betrifft, so wird er das leider nie von sich sagen können, so viel ist heute schon klar«, resümierte Tante Marta inzwischen bekümmert. »Neulich hatte ich Gelegenheit, seine zukünftige Frau kennenzulernen, die vierte, mit der er's versuchen möchte, und nachdem ich sie besichtigt habe, bin ich fast sicher, dass auch diese Ehe ein Flop werden wird.«
»Oje«, murmelte Julia und versuchte, ihre Erheiterung zu verbergen. Sie hatte keine Ahnung, wie ihr dicklicher Cousin es anstellte, immer wieder zu einer beiratswilligen Frau zu kommen. Sein Charme konnte es nicht sein, wohl eher sein Stand und sein finanzieller Hintergrund.
»Und was ist mit dir, diesbezüglich?«, fragte Tante Marta in logischer Fortsetzung ihrer Überlegungen. »Du wirst doch nicht allein bleiben wollen, so hübsch wie du bist?!«
»Für hübsch gibt's in Staufenfels keinen Markt«, wandte Julia ein.
»Nun denn, dorthin hast du dich selbst manövriert. Ich hab dir gleich davon abgeraten, dich in deiner liebeskummerverursachten ... Weltflucht ... auf dieser Burg zu verkriechen, wo Fuchs und Hase sich Gute Nacht sagen.«
Das allerdings war übertrieben und wurde der Bedeutung von Staufenfels nicht gerecht. Immerhin hatte Karl der Große dort schon gewohnt, zwei volle Tage und eine historisch bedeutsame Nacht.
Tante Marta betrachtete ihre Nichte aufmerksam und seufzte dann, bevor sie aussprach, was sie schon lange beschäftigte: »Ich mache mir wirklich Sorgen um dich, Julia. Diese Geschichte mit Jürgen hat nicht nur dein Urvertrauen zerstört, sondern auch dein Selbstbewusstsein niedergedrückt, und Letzteres schon, lange bevor ihr euch getrennt habt.«
»Wie meinst du das?«, versuchte Julia, sich dumm zu stellen.
Doch Tante Marta war nicht zu täuschen. »Das weißt du doch selbst! Dieser narzisstische Kerl hat sich derart breitgemacht, dass man dich jahrelang nur noch in seinem Schatten wahrnehmen konnte. Dabei hast du ganz eindeutig beruflich mehr geleistet als er. Aber du, du hast dich völlig von ihm vereinnahmen lassen und nahezu anbetend zu ihm aufgeschaut!«
»Also bitte, Tante Marta, so war es dann auch wieder nicht!«
»Doch. Genau so!« Tante Marta schnaubte aufgebracht. Sie hatte Jürgen mit Skepsis betrachtet und ihn als aufgeblasenen Ego bezeichnet. Und sie hatte auch gleich eine Erklärung für Julias angebliche Anbetung: »Das scheint ja leider das Handicap von Töchtern zu sein, die besonders gute Eltern hatten. Sie verlieren offenbar den Sinn für kritische Betrachtungen, weil sie ihr positives Vaterbild auf alle Männer übertragen. So lange jedenfalls, bis die Wirklichkeit sie eines Besseren belehrt.«
Tatsächlich war Albert, Bader ein großartiger Vater gewesen, nur weigerte sich Julia, einen Zusammenhang zwischen dem Scheitern ihrer Beziehung mit Jürgen und den guten Eigenschaften ihres Vaters zu sehen. Allerdings hatte es keinen Sinn, Tante Marta widersprechen zu wollen, wenn sie derart in Fahrt geraten war wie im Moment. Die einzige Möglichkeit, das Thema zu wechseln, war es wohl, Tante Martas Aufmerksamkeit auf die Zukunft zu lenken.
Julia hatte zwar nicht vorgehabt, darüber zu sprechen, aber weshalb eigentlich nicht? Ihre Tante mochte nachtragend, ironisch und überaus direkt sein, aber sie war auch intelligent und weltläufig, und mit irgendwem sollte sie vielleicht ja doch darüber reden, denn Jenny war derzeit mit einer Gruppe am Südpol und in einem Funkloch verschwunden.
»Ich hab vor ein paar Monaten eine nette ... Brieffreundschaft ... mit einem österreichischen Ingenieur begonnen, der auf einer Großbaustelle in Indien arbeitet.« Julia schaute über den Rand ihrer Kaffeetasse und beobachtete die Reaktion ihrer Tante. »Letzte Woche hat er geschrieben, dass er zu einem Heimatbesuch nach Graz kommen wird und mich anschließend gerne besuchen möchte. Was sagst du dazu?«
»Überhaupt nichts, solange ich den Mann nicht gesehen habe!«
Julia musste lachen. Das war typisch Tante Marta. Und eigentlich war es auch die einzig richtige Antwort. Es ging ihr ja selbst so: Sie wusste inzwischen zwar viele Details aus dem Leben von Stefan Windheim, aber ein leiblich anwesender Mensch war eben doch etwas anderes als eine Fülle von schriftlichen Informationen, selbst wenn diese ein überaus sympathisches Bild vermittelten. Man würde sehen, im Sinne des Wortes.
»Jedenfalls bin ich sehr gespannt auf das Treffen!«
»Ich würde ihn auch gerne kennenlernen, wenn sich das machen lässt«, erklärte Tante Marta, und dass sie dafür den Weg nach Staufenfels nicht scheuen würde, auch wenn es nur eine kurze Begegnung sein könne.
»Du überraschst mich«, sagte Julia erstaunt, denn Tante Marta war überaus konsequent in ihren Ablehnungen und hatte sie deswegen noch nie auf der weltabgelegenen Burg besucht.
»Was überrascht dich daran? Du bist das einzige Kind meiner verstorbenen Schwester, und ich bin deine Patin. Es kann mir nicht gleichgültig sein, mit wem du dich befreundest, und wenn ich an die Katastrophe mit Jürgen denke ...«
Womit wir wieder beim Thema wären, dachte Julia genervt. Es verfolgt mich sogar noch hier, in Lugano. Irgendwann muss es doch einmal aufhören! Dann aber fiel ihr ein, dass diese Sache mit Jürgen immerhin zwei Jahrzehnte ihres Lebens angedauert hatte. Es war demnach eine Überforderung zu erwarten, dass ihre Tante sie nach gerade einmal zweieinhalb weiteren Jahren nicht mehr erwähnen sollte.
Julia stand auf und trat an den Rand der Terrasse, von wo aus der unverstellte Blick auf den Luganer See möglich war. Mächtig und spitz ragte der San Salvatore über dem azurblauen Wasser auf. »Was hältst du davon: Wir fahren zum Sonnenuntergang mit der Seilbahn auf den Erlöserberg?«, fragte sie, wohl wissend, dass dieser Gipfel der Lieblingsplatz ihrer Tante war.
»Du hättest dich auch für den diplomatischen Dienst melden sollen, so geschickt wie du bist, wenn du ablenken möchtest«, spöttelte Marta Albers, aber sie stellte rasch das Kaffeegeschirr auf ein Tablett und holte sich eine warme Jacke, denn der Abendwind auf dem San Salvatore war selbst im Sommer oft frisch, und immerhin war es bereits Anfang Oktober.
Kapitel 6
Der erste November war im katholisch geprägten Umland der Burg ein Tag des Totengedenkens und der Friedhofbesuche; kein idealer Zeitpunkt für ein erstes Rendezvous, dachte Julia, als sie auf dem zugigen Bahnhofsvorplatz des kleinen Städtchens stand und auf den Regionalzug wartete, der Stefan Windheim nach Staufenfels bringen sollte.
Aber sicher war es zu viel verlangt, sich für diese Begegnung strahlenden Sonnenschein, wolkenlosen Himmel und blühende Bäume zu wünschen. Vermutlich war das nieselige Novemberwetter sogar die ideale Kulisse, wenn man vorhatte, die Realitätstauglichkeit einer virtuellen Beziehung zu prüfen.
Der Zug war, für eine Bummelbahn, erstaunlich elegant. Er tauchte nahezu lautlos aus dem Bodennebel auf und hielt ohne jedes Quietschen. Die Türen öffneten sich elektrisch, und heraus quollen dunkel gekleidete Menschen, die Kränze aus Tannengrün, Buketts aus irischem Moos oder Sträuße aus Winterastern und Chrysanthemen trugen. Sie verschwanden in Richtung Friedhof, und die Bahn setzte sich wieder in Bewegung.
Er hat den Zug versäumt, dachte Julia, und war nicht sicher, ob sie darüber traurig oder erleichtert sein sollte, als sie hinter sich eine angenehm weiche, dunkle Stimme vernahm.
»Entschuldige, aber ich war allein im Abteil und bin auf der falschen Seite ausgestiegen!«
»Das macht doch nichts«, erwiderte Julia reflexartig, während sie sich umdrehte, und setzte dann schnell hinzu: »Hauptsache, du bist da!«
Das war er also.
Mit Sicherheit war es nicht höflich, aber Julia musterte ihn so ausgiebig, als ob sie ihn hinterher malen müsste.
Er war braun gebrannt wie auf dem ersten Foto, hatte kurze, dunkle Locken und sah aus wie der jüngere Bruder von George Clooney. Ganz ohne Zweifel: Er war ein beeindruckender Mann.
Stefan Windheim lächelte. Es war ein ungemein charmantes, nahezu charismatisches Lächeln. Er stellte seinen kleinen schwarzen Koffer ab und betrachtete sie ebenfalls. »Du bist noch hübscher als auf den Bildern«, stellte er fest.
»Und du größer ... und irgendwie ... seriöser ... als auf den Fotos!«
»Das liegt vermutlich daran, dass ich hier lange Hosen trage, und nicht kurze, wie in Indien«, mutmaßte er – und dann lachten sie beide.
»Ich hab dir kein Hotelzimmer gebucht. Du kannst in einem der Gästezimmer auf der Burg wohnen. Franz Anton hat es ausdrücklich erlaubt.«
»Und wer ist Franz Anton?«
»Mein Chef. Graf Staufenfels. Nach seiner Familie heißt die Stadt, die Burg und die ganze Umgebung: das Staufenfelser Land. Du wirst gleich mehr davon sehen.«
Sie luden den Koffer in Julias Golf und stiegen dann ein.
Julia fuhr eigens die Straße am Fluss entlang, und wie jeder, der den mäandernden Wasserlauf mit den riesigen Trauerweiden an den Ufern zum ersten Mal sah, war Stefan entzückt.
Zu Recht, fand Julia. Diese Kulisse war sogar im November noch schön.
»In amtlichen Karten heißt das Gewässer ›die Staufe‹, aber hier spricht jeder nur vom ›Fluss‹. So, als ob es keinen anderen gäbe.«
»Na ja, der Ganges ist imposanter, und die Mur darf mir als Grazer auch niemand madig machen, aber ... dieser ... Fluss, der hat schon was sehr Außergewöhnliches. Wie alles übrigens, das ich bisher gesehen habe.«
Es war ganz klar ein Kompliment, und Julia ärgerte sich, dass sie deswegen errötete, was die Röte noch steigerte. Es war wirklich sehr unpassend, immerhin war sie eine Frau von achtunddreißig.
Sie sah die Haslers, die beinahe aus dem Fenster ihrer Erdgeschosswohnung fielen, als sie anhielt, um das geschlossene Burgtor zu öffnen.
Benno machte einen Riesensatz über das Verwalterehepaar hinweg, schoss auf Julia zu und leckte ihre Hand. Dann begann er zu kläffen und sprang an der Beifahrerseite des Autos hoch, als ob er wahnsinnig geworden wäre.
»Das macht er doch sonst nie«, wunderte sich Brigitte Hasler, als sie aus dem Haus kam, um Benno zu beruhigen.
Walter Hasler überholte seine Frau und packte den erregten Hund am Halsriemen. »Das ist ein klarer Fall von Eifersucht«, stellte er fest und grinste dabei ein wenig. »Er hat eben Instinkt, unser Benno!«
Julia führte Stefan zum Gästeapartment, das im aufwendig renovierten Hauptgebäude der Burg lag.
»Das ist ja wie im Luxushotel«, staunte ihr Gast.
»Es gibt noch zwei andere Apartments. Die Staufenfels' haben Besitzungen auf der ganzen Welt, und wenn sie hin und wieder herkommen, dann tun sie es meistens im Pulk: Die erwachsenen Kinder schleppen ihre Freunde an, und der Graf und seine Frau bringen manchmal Geschäftspartner oder befreundete Ehepaare mit. Mit der Ruhe ist es da vorbei. Dann gibt es große Einladungen und Bälle, Poolpartys, Grillfeste, Golf- und Tennisturniere; es ist ja alles vorhanden. Sogar einen eigenen Flugplatz haben wir unten, gleich neben den Tennisfeldern!«
»Nobler Chef, den du da hast!«
»Ich kann nicht klagen. Und wie gesagt, den größten Teil des Jahres hab ich hier wunderbar Ruhe. Es ist genau so, wie ich ganz am Anfang geschrieben habe: Ich bin eine einsame Burgfrau!«
»Im Moment nicht«, sagte er und legte seine Hände auf ihre Schultern.
Julias Herz begann rascher zu klopfen. Sie fühlte, wie sie sich versteifte, als er sie an sich zog.
Er legte seine Wange an ihre, und sie spürte seine ein wenig stechenden Barthaare. Angespannt erwartete sie einen Kuss, doch er drehte nur ein wenig den Kopf und fragte mit ruhiger Stimme: »Warum hast du so Angst, Julia?«
»Weil ...«, begann sie, aber ihre Stimme wollte ihr nicht gehorchen. Sie blinzelte, um zu verhindern, dass sie auch noch zu weinen begann. Es war wirklich zu dumm!
Stefan Windheim lehnte sich an die Wand und betrachtete sie, ohne sie dabei loszulassen. »Du hattest eine Beziehung ... vermutlich sogar eine langjährige, und er hat dich enttäuscht. War es so, Julia?«
Sie fragte nicht, warum er das wusste, denn sie hatte ihm zwar viele Begebenheiten aus ihrem Leben mitgeteilt, von Jürgen aber kein Wort. Sie nickte nur stumm und wartete ab.
»Wenn eine Frau so reagiert wie du eben, dann ist das die naheliegende Erklärung.«
Julia nickte erneut. Irgendwie war sie erleichtert, dass es heraus war. Es war ihr klar gewesen, dass es irgendwann einmal besprochen werden musste, allerdings hatte sie nicht erwartet, dass es gleich in der ersten Stunde passieren würde.
»Ich bin zweiundvierzig, und natürlich hat es auch in meinem Leben Frauen gegeben. Meine letzte Beziehung hat fast zehn Jahre gedauert. Ich wollte heiraten und eine Familie gründen. Ich bin beinahe verrückt geworden, als ich begriffen habe, dass sie mich betrügt.« Er ließ Julia los, drehte sich um und sprach zum Fenster gewandt weiter: »Ich hab Wochen gebraucht, um mich wieder für mein Leben zu interessieren, und zu der Zeit war es nur die Gegenwart, die irgendwie bewältigt werden musste. Eine Zukunft konnte ich mir gar nicht mehr vorstellen. Nach ein paar Monaten hab ich dann die Ausschreibung für den Brückenbau gelesen. Ich hab mich beworben, sie haben mich genommen, und ich bin nach Indien gegangen. Dort bin ich jetzt seit fast drei Jahren, nur langsam hab ich mich doch besonnen, dass ich nicht ewig allein sein möchte. Dass ich irgendwann zurückkommen werde, und dass es dann schön wäre, wenn jemand da wäre, der mich erwartet.«
Julia hatte aufgehört zu blinzeln, während er sprach.
Er wandte sich wieder um, und sie schauten sich erneut an. Diesmal waren es andere Blicke als zuvor auf dem Bahnsteig.
Ein Lächeln stahl sich in Julias Augen und wanderte weiter zu ihren Mundwinkeln. »Was man sich alles nicht berichtet, wenn man eine elektronische Fernbeziehung hat«, sagte sie und machte einen Schritt auf ihn zu. Jetzt war sie es, die ihre Hände auf seine Oberarme legte. »Danke. Und herzlich willkommen, Stefan!«
Und danach küsste sie ihn. Ganz behutsam.
Er fasste sie um die Taille und erwiderte den Kuss. Er war sanft und vorsichtig, und eine angenehme Wärme hüllte Julia ein. Gerade als sie erwog, ob sie nicht ein wenig den Mund öffnen sollte, löste er sich von ihr und sagte, mit einem netten ironischen Beiklang in der Stimme: »Wir sollten es nicht gleich übertreiben, denke ich!«
Julia war ein winziges bisschen enttäuscht, aber sie lachte und stimmte ihm zu: »So seh ich das auch.«
Und dabei blieb es an diesem Tag.
Auf jeden Fall war es spannend.
Der Mann sah fabelhaft aus, und er hatte Charme und Manieren.
Tante Marta wäre zufrieden. Die aber konnte nun doch nicht kommen. Sie war in Botswana, um Alwin zu trösten, dessen vierte Ehe diesmal schon vor der Hochzeit gescheitert war.
Kapitel 7
Das Wetter meinte es gut mit ihnen. Am nächsten Tag schien die Sonne, und die Temperaturen stiegen auf im November ungewöhnliche achtzehn Grad.
Sie frühstückten in Julias gemütlicher Turmwohnung und aßen die knackigen Brötchen, die Brigitte Hasler ihnen vom morgendlichen Einkauf im Städtchen mitgebracht hatte.
»Und was machen wir jetzt?«, fragte Stefan schließlich unternehmungslustig.
»Ich dachte, ich zeig dir erst mal die nähere Umgebung, und danach weiten wir die Erkundungen jeden Tag ein bisschen aus. Oder hast du einen besonderen Wunsch?«
»Nur den, dass wir so viel Zeit wie möglich zusammen verbringen«, bekannte er, griff nach ihrer Hand und drückte einen kleinen Kuss auf die Knöchel.
»Bist du immer so charmant?«, erkundigte sich Julia und errötete wieder; eine Reaktion, die sie zu ärgern begann. Ich bin doch keine siebzehn mehr, verdammt noch mal!
Stefan sah es und grinste. »Klar«, sagte er und machte eine Unschuldsmiene. »Ich bin Österreicher, und Charme ist uns praktisch angeboren!«
Er scheint tatsächlich Humor zu haben, dachte Julia.
Sie klopfte ihr Frühstücksei auf, wobei ihr einfiel, dass sie nicht ohne Weiteres davon ausgehen konnte, dass er Bewegung per pedes ebenso mochte wie sie. Am besten, sie klärte das rasch. »Macht es dir etwas aus, wenn wir die Stadt zu Fuß besichtigen?«
»Natürlich nicht. Ich sagte doch schon, ich bin Österreicher, und in meiner Heimat wandert jeder, der über zwei gesunde Beine verfügt.«
»Wie beruhigend zu hören. Ich bin nämlich ein ausgesprochener Lauffreak.«
»Ich auch. Das ist übrigens etwas, das mir in Indien wahnsinnig fehlt: Spazierwege oder Wanderpfade wie bei uns, die gibt es dort nicht. Okay, in den Großstädten gibt es natürlich Parks, aber dort, wo ich bin, gehen die Leute höchstens mal ein paar Schritte, um irgendwelche Besorgungen zu machen. Wenn man sich in der Landschaft bewegen möchte, dann muss man zum nächsten Golfplatz fahren, was für mich ein Halbtagstrip ist, und das kann ich mir nur am Sonntag erlauben. An den Arbeitstagen, auf der Baustelle, komm ich allerdings schon auf ein Laufpensum, aber eben zu keinen besonders angenehmen Bedingungen. Es gibt dort jede Menge Krach und Staub – und bei all dem ist es meistens schwülheiß und nirgendwo auch nur ein winziges Fleckchen Schatten.«
»An solche Dinge denkt man natürlich nicht, wenn man sich von hier aus ein exotisches Land wie Indien vorstellt«, erwiderte Julia und begann zu begreifen, dass ihre Fantasie und die indische Realität sich wohl sehr voneinander unterschieden.
Sie besichtigten die historische Altstadt von Staufenfels, das Heimatmuseum und die Kirche, deren Apsis und Turm in jedem Reiseführer als sehenswert aufgeführt waren.
Zur Mittagszeit aßen sie bei Luigi eine Kleinigkeit und stiegen dann wieder zum Burgberg hinauf.
Julia sah dabei zu, wie Stefan in ihrem Wohnzimmer den elektrischen Kamin »American Style« in Betrieb setzte, was vorher noch niemand versucht hatte.
Als die täuschend echt imitierten Holzscheite zu glimmen begannen, was nichts anderes war als eine Wärme spendende, elektrische Illumination, die kaum von einem echten Kaminfeuer zu unterscheiden war, ging sie in die kleine Küchennische und setzte Tee auf.
Ein köstlicher Duft zog kurz darauf durch den Raum. Er stammte nicht nur von den aromatischen Teeblättern, die Tante Marta von derselben Farm bezog wie ihren Kaffee – und Julia großzügig daran teilhaben ließ – , sondern er entströmte auch den unsichtbaren Düsen über dem Kamin und erweckte dadurch die Illusion vom Verbrennen harziger Hölzer.
»Unglaublich«, fand Stefan und betrachtete beeindruckt das amerikanische Feuer. Dann ging er zu dem Regal, auf dem Julia in geflochtenen Körbchen ihre musikalischen Schätze aufbewahrte. »Darf ich?«, fragte er, während er schon den ersten Deckel abhob und die CDs inspizierte. Beim dritten Korb wurde er fündig. Er ging zur Stereoanlage und schob die Kunststoffscheibe in die dafür vorgesehene Öffnung. Wenige Sekunden später hörte Julia die Anfangstöne des ersten Klavierkonzerts von Chopin. Sie richtete sich aus ihrer Couchecke auf und sagte, erstaunt über so viel gemeinsame Vorlieben: »Meine Lieblingsmusik!«
»Ich weiß«, erwiderte Stefan und grinste verschmitzt. »Du hast es mir irgendwann mal geschrieben!«
Immerhin hast du es dir gemerkt, dachte Julia, während Stefan näher kam, sich ans Fußende des Sofas setzte und sympathisch unkompliziert ihre Beine über seine Knie legte. Dann griff er nach der Tasse mit dem Tante-Marta-Tee, trank einen Schluck davon und rief begeistert: »Das ist ein echtes Spitzenprodukt, und von Tee versteh ich nun wirklich etwas!«
»Geschenk von meiner Patentante. Die dich übrigens gerne mal kennenlernen würde«, berichtete Julia und war neugierig, wie er darauf reagieren würde.
Er zog ein Clownsgesicht: »Wenn sie das möchte ... irgendwann wird es sich bestimmt einrichten lassen.« Dann nahm er noch einen Schluck aus der Tasse und hob flapsig die Schultern: »Abwarten und Tee trinken!«
Julia erwiderte nichts, aber sie dachte, dass Tante Marta seine Antwort gefallen hätte.
Die sanfte Klaviermusik lullte sie angenehm ein, das falsche Kaminfeuer knisterte, und es wurde ihr bewusst, dass sie sich schon sehr lange nicht mehr so wohlgefühlt hatte.
Kapitel 8
Sie nutzten die immer noch schönen Tage, um kleine Fahrten und ausgedehnte Spaziergänge zu machen.
Am Abend saßen sie beim amerikanischen Kaminfeuer. Sie redeten, was ihnen gerade in den Sinn kam, und Stefan erzählte viel von seinem Leben in Indien.
Julia saugte jedes Detail in sich auf und wurde nicht müde, Fragen zu stellen. »Ich liebe dieses Land schon seit meiner Kindheit. Ich glaube, es war der entscheidende Punkt für mich, wirklich in so eine Mailbeziehung einzusteigen, als du mir damals geschrieben hast, dass du dich in Indien befindest. Bitte, erzähl mir so viel wie möglich davon.«
Am vierten Tag hatten sie es aufgegeben, sich gegenseitig zu belauern, um verborgenen Eigenschaften auf die Schliche zu kommen.
Außerdem traten diese ohnehin offen zutage.
Julia sah sich gezwungen einzuräumen, dass Hausarbeit nicht ihre Stärke war. Brigitte Hasler kam an den Vormittagen herüber und putzte nicht nur das Büro, sondern auch die Privatwohnung. Außerdem wusch sie alles ab, was abzuwaschen war, und nahm Julias Schmutzwäsche mit hinüber in ihre Waschküche, um sie Tage später – gebügelt und zusammengelegt – wiederzubringen. »Es ist mir lieber, Frau Hasler zu bezahlen, als all das selbst zu erledigen«, gab Julia zu und war gespannt auf seinen Kommentar.
»Das ist doch vernünftig«, fand Stefan. »Und was mich betrifft: Ich war und bin nicht daran interessiert, mir ein Hausmütterchen anzulachen.«
»Wie beruhigend, das zu erfahren«, erwiderte Julia und schrieb ihm innerlich fünf Pluspunkte gut. Denn Jürgen hatte nicht nur ganz selbstverständlich erwartet, dass sie einkaufte und fürs Essen sorgte, er hatte sich sogar seine Klamotten von ihr mitwaschen lassen, wenn er mal wieder in einer Lieferklemme gewesen war. Jürgen war selbstständiger Grafiker und Designer, und die Art und Weise, wie er seine Tage und Nächte gestaltete, hatte ihr bei ihrem letzten Job beinahe eine Abmahnung wegen mehrmaligen verspäteten Eintreffens am Arbeitsplatz eingetragen.
Im Gegenzug zur Offenbarung ihrer Mängel bemühte Stefan sich nicht mehr, in einen höflichen Konversationston zu wechseln, wenn er mit seinem indischen Vorarbeiter telefonierte. Er schrie dabei derart in den Hörer seines Handys, dass einem unweigerlich das Bild eines größenwahnsinnigen Tyrannen vor die Augen trat.
»Dieser Mann reagiert nicht auf normale Anweisungen«, klärte Stefan sie auf. »Und ein ausgeprägtes Phlegma wie seines ist leider eine sehr verbreitete Untugend in Indien. Ich weiß, das klingt rassistisch und selbstgerecht, aber es ist nun mal so, und ich möchte die Baustelle ungern im selben Zustand antreffen, wie ich sie vor der Abreise verlassen habe!«
Julia nahm diese Auskunft widerspruchslos entgegen. Sie fürchtete sich zu sehr vor weiteren Entzauberungen ihres Sehnsuchtslands, um eine Diskussion über die schlechten Nationaleigenschaften der Inder loszutreten.
Außerdem hatte sie andere Probleme.
Es waren inzwischen sechs Tage vergangen, und nur noch morgen würde er bleiben.
Und die Nacht, die dazwischen lag.
Sie hatten sich häufig geküsst und vorsichtig befummelt; jetzt drängte Stefan auf mehr, das war nicht mehr zu ignorieren – und auch zu verstehen. Sie waren keine Teenager mehr, Erotik gehörte zum Leben von erwachsenen Menschen, und ihre Situation war eine außergewöhnliche: Sie hatten einfach nicht die Möglichkeit wie andere Paare, sich langsam anzunähern.
Stefan hatte sich für diesen Nachmittag entschuldigt. »Ich muss noch verschiedene Dinge einkaufen, die ich nach Indien mitnehmen möchte, Toilettenartikel und solchen Kram, und ich möchte dir nicht zumuten, mich dabei zu begleiten. Danach feiern wir dann unseren letzten Abend, okay?«
Julia bestellte also das Abschiedsfestmahl beim angesagten Staufenfelser Chinesen und überzeugte sich, dass die Flasche Champagner, die sie gekauft hatte, gut durchgekühlt war. Dann stellte sie sich unter die Dusche und wusch sich die Haare.
Um sechs abends fuhr Walter Haslers Opel in den Burghof, und Stefan stieg aus. Er kam aber nicht in den Turm, sondern verschwand mit einer dick gefüllten Plastiktüte in der Hand im Hauptgebäude.
Viertel vor sieben klingelte er. »Na, wie war dein freier Nachmittag?«, flachste er und umarmte sie liebevoll.
»Gut«, murmelte Julia an seiner Brust. Sie roch ein angenehm männlich duftendes, neues Aftershave und spürte an seiner Haut, dass auch er unter der Dusche gewesen war.
Sie führte ihn ins Wohnzimmer, wo es ihnen grade noch gelang, ein Gläschen Schampus zu trinken, bevor der chinesische Wirtssohn klingelte und das bestellte Essen lieferte.
Julia bezahlte und trug die Pappkartons in die Küchennische, um die Inhalte auf Porzellantellern anzurichten.
Sie aßen mit Appetit, und der restliche Champagner versetzte sie beide in eine fröhliche, beschwingte Laune.
»Das war köstlich«, sagte Stefan, als auch das Dessert verspeist war, das aus Litschis und Limoneneis bestanden hatte.
»Wunderbar«, stimmte ihm Julia zu. Sie wischte sich den Mund ab und stellte dann die Teller aufeinander, um sie zur Spüle zu tragen.
Stefan fing ihre geschäftigen Hände ein und hielt sie fest. »Lass das doch morgen Frau Hasler machen«, bat er und drückte seine Lippen auf ihren Puls. »Die Zeit läuft uns weg, und ich denke, wir sollten uns deshalb miteinander beschäftigen.«
Was er damit meinte, war unmissverständlich. Hätte er stattdessen gesagt: »Lass es uns endlich tun, Julia«, es wäre nicht deutlicher gewesen. Er stand auf, trat hinter sie und legte eine warme Hand auf ihren Nacken. Mit dem anderen Arm zog er sie hoch und drehte sie zu sich.
Julia sah die Glut in seinen dunklen Augen und spürte die Hitze seiner Erregung. Er drückte sie an sich und küsste sie, und dieses Mal tat er es nicht sanft, sondern fordernd, und Julia erwiderte seine leidenschaftlichen Zärtlichkeiten.
Doch genau in dem Moment, in dem sie ihren letzten, inneren Widerstand aufgeben wollte, schob sich wie ein übergroßes Dia das Bild Jürgens vor ihr geistiges Auge. Jürgen, wie er auf dieser nackten, rothaarigen Frau gelegen hatte, ebenfalls nackt, in ihrem, Julias Bett.
Es war wie ein kalter, ernüchternder Luftzug. All die Leichtigkeit und Unbeschwertheit des Abends war wie weggeblasen und Julia so steif und vorsichtig wie am ersten Tag seines Besuchs.
»Was ist denn, hab ich etwas falsch gemacht, Julia?«, wollte er wissen und machte Anstalten, sie erneut an sich zu ziehen, doch Julia schob ihn von sich.
»Ich ... kann das noch nicht, Stefan. Tut mir leid«, sagte sie hilflos. Sie wusste genau, dass sie sich wie eine Zicke benahm.
Natürlich war er enttäuscht.
Eine ganze Weile lang schwieg er und sah mit ausdruckslosem Gesicht in das amerikanische Feuer, dessen Knistern Julia lauter vorkam als jemals zuvor.
»Das liegt ganz bei dir«, sagte er schließlich. Dann stand er auf und verließ ohne ein weiteres Wort die Wohnung.
Julia sah ihm vom Fenster aus nach, wie er über den Hof ging und im Eingang des Burggebäudes verschwand.
Sie schlief keine Sekunde in dieser Nacht, weshalb sie auch das Taxi hörte, das gegen sechs Uhr am Morgen am Burgtor vorfuhr. Dabei hatte Stefan vorgehabt, noch bis zum Spätnachmittag des Tages zu bleiben.





























