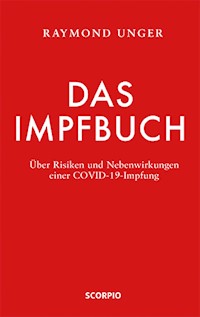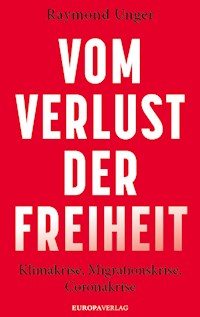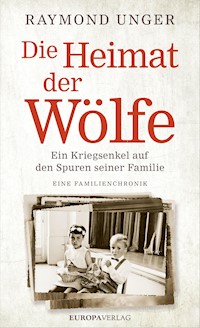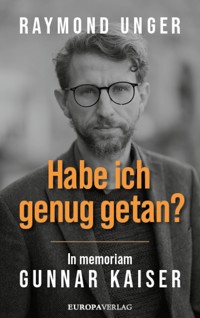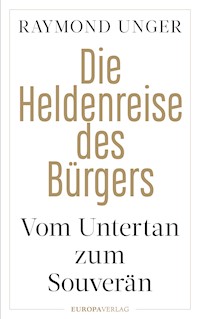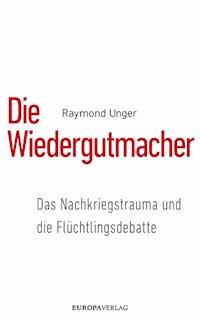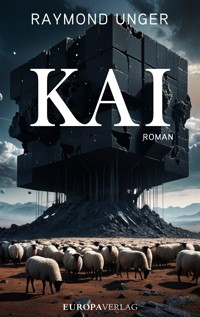
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Europa Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
In seinem packenden Wissenschaftsthriller entführt Raymond Unger seine Leser in die alptraumhafte Welt einer unkontrolliert waltenden Künstlichen Intelligenz. Die Folgen erinnern an Tolkiens Herr der Ringe: »Ein Ring, sie zu knechten, sie alle zu finden, ins Dunkel zu treiben und ewig zu binden.« In Berlin lässt der Professor für neue Medien Nils Larsen von der KI ein virtuelles Bild einer attraktiven Frau erstellen – kurze Zeit später lernt er die Schöne in der Realität kennen. In San Francisco vermarktet der Kreativdirektor Peter Siemsen KI-gesteuerte Avatare – die Projektionen entwickeln jedoch eine beunruhigende Eigendynamik. In Hamburg vertraut der Klimaforscher Rolf Hoffmann KI-gesteuerten Klimamodellen – die sich als grundfalsch erweisen. Und in Mainz designt der Epidemiologe Yanis Petridis mithilfe der KI neuartige mRNA-Impfstoffe – die auf lange Sicht verheerende Nebenwirkungen entfalten. Erst als der C.G.-Jung-Analytiker Johannes Baumkamp einen dieser KI-Nutzer behandelt, wird ein Muster hinter den Ungereimtheiten sichtbar. Was wie unscheinbare Fehler der KI anmutet, hat Methode. Die Suche nach den Hintergründen entwickelt sich zur Odyssee und Lebenskrise, in der Baumkamp seine psychologische Praxis und Ehe riskiert. Am Ende sucht er Rat bei seinem Mentor und ehemaligen Lehrer in Schweden. Als letztes Universalgenie leitet der Psychologe und Physiker Justus von Siggelkow dort ein abgelegenes Institut zur Erforschung parapsychologischer Phänomene. Hier finden sich Hilfe suchend auch andere Protagonisten aus den verschiedenen Disziplinen ein, die durch ihre intensive KI-Nutzung ebenfalls in eine Krise geraten sind. Und hier, in der schwedischen Enklave, deckt die Gruppe schließlich ein Schreckensszenario auf, das die gesamte Menschheit bedroht … KAI ist ein dystopisch-okkulter Thriller, in dem die konsequente Nutzung Künstlicher Intelligenz in den Bereichen Biotechnologie, Klimaforschung und Sicherheitspolitik in eine globale Katastrophe mündet, in der die Freiheit des Einzelnen nichts mehr zählt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 532
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
RAYMOND UNGER
KAI
ROMAN
1. eBook-Ausgabe 2025
© 2025 Europa Verlag in der Europa Verlage GmbH, München
Umschlaggestaltung: Margarita Maiseyeva unter Verwendung eines Motivs von Raymond Unger
Layout & Satz: Margarita Maiseyeva
Konvertierung: Bookwire
ePub-ISBN: 978-3-95890-592-4
Das eBook einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen. Der Nutzer verpflichtet sich, die Urheberrechte anzuerkennen und einzuhalten.
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlags wiedergegeben werden.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Ansprechpartner für Produktsicherheit
Europa Verlage GmbH
Monika Roleff
Johannisplatz 15
81667 München
Tel.: +49 (0)89 18 94 733-0
E-Mail: [email protected]
www.europa-verlag.com
Dieser Roman ist in Teilen inspiriert von realen Ereignissen, er ist jedoch eine hiervon losgelöste und unabhängige fiktionale Geschichte. Alle Ähnlichkeiten mit lebenden Personen und realen Handlungen sind rein zufällig. Der Autor hat ein völlig eigenständiges neues Werk geschaffen.
INHALT
Glimpse
Kapitel I – DURCHBRÜCHE
Vomit
Dorian Gray
Schreibhilfe
Prompt
Neue Freunde
Das Foto
Der Gelehrte
Der verlorene Sohn
Rött rum
Kapitel II – ADEPTEN
Golem
DNT1963c3
Honda
Grünes Herz
Presidio Golf
Damaskus-Erlebnis
Alte Freunde
Klimawahrheiten
Kapitel III – DES PUDELS KERN
Schicksalsgemeinschaft
Salonabend
Angriff
Rituale Romanum
Zauberlehrling
Flaschengeist
Verrat
5GG-Ultra
Jesus 2.0
GSG 9
Kapitel IV – DER RING
Rodung
Wahnsystem
Wenckebach
Machtergreifung
Martyrium
Dunkelheit
Schockraum
Phönix
Keller
Kapitel V – VIER REITER
Tafelrunde
Hoffnung
MAD
EQS 580
Flucht
Krieg
Brandmauer
Rochade
Fulda
Rotes Band
Who’s Who
Autor
GLIMPSE
Als Johannes zu sich kam, lag er auf einer harten Pritsche. Der Raum um ihn herum war grau und kalt, kaum mehr als ein Käfig. Das Licht war schwach, ein fahles Flackern aus einer unsichtbaren Quelle, das die rohen Wände nur schemenhaft erhellte. Sie wirkten wie Beton, aber beim genaueren Hinsehen schien das Material synthetisch – etwas Künstliches, was ihn noch mehr verunsicherte.
Ein stechender Schmerz explodierte in seinem Kopf. Mit zitternden Händen tastete Johannes seinen Schädel ab und spürte, wie seine Finger auf etwas Zähes und Trockenes trafen: Blut. Seine Haare waren hart und spröde davon verklebt, einzelne Strähnen brachen unter der Berührung ab. Als er weitertastete, entdeckte er eine riesige Schwellung am Hinterkopf. Für einen Moment kämpfte er mit Übelkeit, dann zwang er sich, die Umgebung in den Blick zu nehmen. Der Raum war winzig – eine Zelle, nicht mehr als acht Quadratmeter groß, mit einer bedrückend niedrigen Decke. Johannes musste sich bücken, um überhaupt stehen zu können. An der Stirnseite des Raumes befand sich eine Gitterfront, hinter der ein schmaler Gang erkennbar war.
»Hallo?« Seine Stimme klang rau, ungewohnt fremd. »Haaallooo?! Was ist das hier? Wo bin ich? Was haben Sie mit mir gemacht?«
Seine Worte hallten in dem tristen Raum wider, ohne eine Antwort hervorzurufen. Johannes trat ans Gitter, klammerte sich an die Stäbe und rief erneut: »Ich möchte sofort den Verantwortlichen sprechen! Noch leben wir in einem Rechtsstaat! Ich warne Sie: Wenn Sie sich nicht erklären, verklage ich Sie wegen Freiheitsentzug!«
Plötzlich zischte eine Stimme aus der Dunkelheit, scharf und zynisch: »Halt’s Maul, du Idiot! Halte bloß das Maul, oder du machst es noch schlimmer. Noch hast du 1,60 – das kann sich aber schnell ändern, wenn du hier weiter so herumbrüllst.«
Johannes wich zurück, seine Gedanken rasten. Die Stimme war ihm fremd, aber sie klang menschlich – ein kleiner Trost in diesem Albtraum. »Wer sind Sie? Und wo … wo sind wir hier?«, fragte er hastig.
»Das weißt du nicht?« Ein bitteres Lachen folgte. »Wo haben sie dich denn eingefangen? Willkommen in Frankfurt, wo denn sonst!«
»Frankfurt?« Johannes spürte, wie Panik in ihm aufstieg. »Wie … wie bin ich hierhergekommen? Ich war doch gerade noch in Berlin!«
»Berlin!«, wiederholte die Stimme höhnisch. »Klar doch. Gerade noch. Sehr witzig, genau mein Humor.« Ein Schatten schob sich näher ans Gitter. »Du bist hier im größten Flumax-Lager Europas. Frankfurt/Oder, an der polnischen Grenze. Zwischenzeitlich waren in diesem Beugelager mal 200 000 Leute untergebracht. Aber im Grunde ist das hier nur eine Drehtür. Die Beugezeit liegt im Schnitt bei sieben Tagen. Spätestens bei 1,20 holen sich alle ›freiwillig‹ ihren Pieks ab.«
Johannes schluckte. »Pieks? Beugezeit? Was … wovon reden Sie?«
Ein trockenes Lachen war die Antwort. »Du kapierst echt gar nichts, was? Noch so ’n Witzbold. Seit Kurzem hat sich die Beugezeit drastisch verkürzt. Nach der Poseidon will keiner mehr länger bleiben. Ich hab auch schon gedrückt – den Okay-Knopf, meine ich. Eigentlich wundert es mich, dass noch keiner mit dem Injektor gekommen ist.«
»Injektor? Okay-Knopf? Poseidon?« Johannes fühlte sich, als ob ihm die Luft ausging. »Wovon reden Sie?«
Die Stimme verstummte. Plötzlich waren schwere mechanische Schritte im Gang zu hören, die den Boden vibrieren ließen. Dann erklang ein scharfer Befehl: »Vier K! Schneider, Gottfried, amtliche Einwilligung nach 104 Stunden und 34 Minuten Beugehaft. Strecken Sie den rechten Arm heraus und halten Sie still.«
Es folgte ein Klicken, dann ein leises, fast tierisches Wimmern.
»Raumhöhe ab sofort wieder zwei Meter. Entlassung nach Wirkungseintritt in 24 Stunden.« Die Schritte entfernten sich, und die Stille kehrte zurück.
»Was war das?« Johannes’ Stimme bebte. »Hat man dich gerade geimpft? Mit dem neuen Cflumax-Tetra? Ist das hier ein geheimes Versuchslabor?«
»Cflumax-Tetra?« Die Stimme klang jetzt bitter und müde. »Wer redet denn so geschwollen? Flux sagt hier jeder. Und es ist schon seit Monaten auf dem Markt. Alle sind damit geimpft. Alle. Aber … egal. Ich will nur noch eins: Meine Familie sehen, bevor die Fulda-Linie hochgeht.«
»Fulda-Linie? Poseidon?« Johannes tastete verzweifelt nach einem Faden, um all das zu verstehen.
»Vor vier Wochen haben die Russen einen Poseidon-Torpedo gezündet«, begann die Stimme, und dann folgte eine Erzählung, die Johannes wie ein Schlag ins Gesicht traf.
»Du hast echt keinen Schimmer, oder? Vor vier Wochen haben die Russen diesen Torpedo in der Ostsee gezündet. Nuklear. Hat die Küsten von Deutschland, Polen und Dänemark getroffen. 90 000 Tote. Danach hat die NATO zurückgeschlagen, Sewastopol ausgelöscht. Und die Russen? Die haben das Berliner Regierungsviertel mit einer Neutronenbombe verstrahlt, aber die Gebäude stehen noch. Jetzt ist klar: Europa wird das Schlachtfeld für den Dritten Weltkrieg. Allerdings werden Russland und die USA sorgsam darauf achten, ihre Kernländer zu schonen. Und Deutschland?« Die Stimme klang bitter. »Unsere glorreiche Regierung hat den Vorschlag der Amerikaner akzeptiert, die Fulda-Linie zu reaktivieren. Einen alten nuklearen Minengürtel, der uns von innen heraus zerstören wird. Das Minenfeld aus den 1980er-Jahren verläuft quer durch Mitteldeutschland und sollte schon damals einen Vormarsch der Russen stoppen. Nach einem flammenden Plädoyer der Bundeskanzlerin hat der Bundestag dem Antrag zur Selbstzerstörung Deutschlands mit großer Mehrheit zugestimmt. Lederer erklärte voller Stolz, dass Deutschland mit diesem Opfer für die freie Welt die einmalige Gelegenheit habe, die übergroße Schuld seiner Geschichte zu tilgen. Seither lässt sich hier fast jeder fluxen, weil alle den kleinen Pieks dem großen Bums vorziehen – soweit kapiert?«
Sechs Monate zuvor:
KAPITEL I
DURCHBRÜCHE
VOMIT
»Und dann sagte der Junge, ›Ich wünschte, ich wäre Araber.‹« Johannes Baumkamp hielt inne, ließ die Worte wirken, als seien sie ein besonders exotisches Gewürz für sein Abendessen. Sein Blick wanderte kurz zu Marina, bevor er wieder zur dampfenden Pfanne zurückkehrte. »Zuerst dachte ich, ich hätte mich verhört. Natürlich hakte ich nach.«
Er holte das Tomatenmark aus der Kühlschranktür und begann, es sorgfältig in die heiße Pfanne einzurühren. »›Warum gerade ein Araber?‹, fragte ich ihn. Und weißt du, was er sagte? ›Da sind immer alle zusammen und so. Ich weiß das wegen Ahmad, da bin ich öfter. Wenn da einer Stress machen will, stehen alle hinter ihm. Dem kommt keiner so schnell krumm.‹« Johannes imitierte die wörtliche Rede seines jungen Klienten, indem er »isch« statt »ich« sagte und die Wörter »Stress« und »krumm« mit einem rollenden R aussprach.
»›Und bei dir zu Hause?‹, fragte ich ihn. Da wurde er plötzlich ganz still und er sagte nur: ›Kannste vergessen. Papa ist nie da. Mama ist nachmittags schon blau.‹«
»Traurig«, murmelte Marina, ihre Stimme kaum mehr als ein Hauch. Sie wusste, was Johannes erwartete – eine Bestätigung, eine Deutung, etwas, das die zermürbende Realität des Jungen in ihrer Komplexität aufgriff und greifbar machte. Doch sie schwieg. Johannes legte die Kelle zur Seite, griff nach dem Rotwein und schenkte sich ein. Sein Blick war ernst, aber nicht ohne die übliche Spur von Stolz – stolz darauf, diese Geschichten tragen zu können, sie zu entwirren und zu verstehen. »Ohne das Aggressionspräventionsprogramm, das seine Therapie finanziert, wäre der Junge verloren. Was er vermutlich trotzdem ist.«
Das Therapeutenpaar nutzte die Expertise des anderen zur allabendlichen Supervision, doch diesmal ließ sich Marina nur den Geschmack der Puttanesca auf ihrer Zunge zergehen, während die Worte ihres Mannes noch in der Luft hingen. Johannes war so in seine Geschichte vertieft, dass er die Stille nicht bemerkte. Oder vielleicht störte sie ihn einfach nicht.
»Morgen ist schon wieder Donnerstag«, warf er schließlich beiläufig ein, während er die restlichen Nudeln auf seinem Teller umherschob.
»Ich weiß. Warum?«
»Da kommt der Künstler wieder. Nils Larsen. Du weißt schon, der aus der Süddeutschen. Der, der den Sony World Photography Award gewonnen hat. Jetzt ist er überall: FAZ, Spiegel, SWR – ein Star. Und trotzdem kann er kaum schlafen, weil er …« Johannes hielt inne, blickte Marina mit einer Mischung aus Neugier und Besorgnis an. »Weil er langsam die Kontrolle über sich selbst verliert.«
»Psychotisch?«, fragte Marina, eine ihrer Augenbrauen hob sich fast unmerklich.
»Möglich«, Johannes nahm einen Schluck Rotwein, wie um sich Mut zu machen. »Er hat mir erzählt, seine Studenten sehen aus wie die missgestalteten Porträts, die sein KI-Programm erzeugt. Aber das ist nicht alles. Er …« Johannes hielt inne, wägte seine Worte ab. »Ich glaube, er hat eine erotische Fixierung auf eines seiner Kunstprodukte entwickelt. Er ist verliebt in eine Frau auf einem Foto.«
»Nun, verliebt in den Eiffelturm wäre schlimmer«, gab Marina schnippisch zurück, »aber womöglich kann er die Frau ja noch für sich gewinnen, jetzt, wo er so berühmt ist.«
Johannes nippte abermals an seinem Rotwein, dann klärte er Marina auf: »Es ist noch ein bisschen komplizierter, weil es gar kein reales Foto ist. Die Frau wurde rein virtuell erzeugt von einer künstlichen Intelligenz. Er ist verliebt in eine Fata Morgana.«
»Verstehe«, erwiderte Marina und steuerte gleich noch eine Diagnose bei, »als passiver Beziehungsverweigerer kann er mit einem Phantom natürlich die beste Beziehung der Welt führen – in seiner Vorstellung. Das ist aber noch lange keine Psychose. Erlebt er denn tatsächlich Realitätsverlust und wahnhafte Zustände?«
»Ich fürchte ja«, gab Johannes zurück, »aber um das zu beurteilen, müsste ich erst noch meine Hausaufgaben machen. Er hat mir einen Link geschickt. Geschützte Werke, die er noch niemandem gezeigt hat. Ich werde mir die heute Abend ansehen.«
Marina zuckte mit den Schultern, sie war zu müde, um diese offensichtliche Gegenübertragung, in die sich ihr Mann gerade verhedderte, zu kommentieren. Über diesen Künstler Nils Larsen hatte ihr Mann verdächtig oft gesprochen, außerdem interessierte sie der Hintergrund der KI nicht sonderlich. Als Freudianerin hatten für Marina Künstler per se einen narzisstischen Spin, den sie aus zweierlei Gründen nicht mochte. Zum einen war die »Sinnsuche« vieler Künstler aus psychoanalytischer Perspektive neurotisch, zum anderen war es allzu typisch, dass Johannes besonders auf diesen Klienten reagierte. Zeit seines Lebens haderte ihr Mann damit, selbst kein Künstler geworden zu sein. Der große Flur der gemeinsamen Wohnung diente Johannes als Privatgalerie, dessen einzig ausstellender Künstler er selbst war.
Johannes und Marina hatten sich in ihren Berufungen als Therapeuten gefunden – und doch trennte sie eine geistige Kluft, die so tief war wie die Disziplinen, denen sie sich verschrieben hatten. Er, ein Anhänger der analytischen Psychologie nach C. G. Jung, glaubte an eine tiefere Bedeutung hinter dem Unbewussten, als Wegweiser zum metaphysischen Sinn des Lebens. Sie hingegen, eine überzeugte Freudianerin, betrachtete den Menschen als ein von Trieben beherrschtes Tier, das in den Käfig einer Kulturgesellschaft gezwungen wurde. Für Laien mochten diese Unterschiede trivial erscheinen. Doch für die Baumkamps bedeuteten sie eine intellektuelle Spannung, die ihre Beziehung auf eine Weise herausforderte und belebte, wie es nur ein Psychologenpaar verstehen konnte.
Johannes arbeitete als Kinder- und Jugendlichentherapeut und war Mitglied des renommierten C. G.-Jung-Instituts. Er sah in der Neurose nicht bloß ein Störbild, sondern eine Einladung, sich selbst und die Welt in einer tieferen Dimension zu entdecken. Nach Jung war die Krise kein Makel, sondern ein Ruf: die Aufforderung, das eigene Leben auf eine höhere Ebene zu führen – hin zu einem existenziellen Sinn, der über das bloße Überleben hinausging. Marina hingegen, geprägt von ihrer materialistischen Weltsicht, hielt diese Suche für nichts weiter als den Wunschtraum einer Psyche, die nicht mit der Realität zurechtkam. Für sie war der Mensch in erster Linie ein hormonell determinierter Automat, dessen Konflikte aus dem Triebleben resultierten. Die Neurose war in ihrem Verständnis ein schmerzhafter Tribut, den die Natur für die kulturelle Zähmung forderte.
So divergierten die Ansichten des Ehepaares in der grundlegendsten Frage: Was war der Mensch? Ein impulsgetriebener Mechanismus, dessen größte Sehnsucht die Befreiung aus gesellschaftlichen Zwängen war? Oder ein transzendenzsuchender Halbgott, dessen Bestimmung es war, dem Chaos einen höheren Sinn abzuringen? Johannes hatte diese Fragen aus der Perspektive eines Mannes gestellt, der in den Glauben hineingeboren worden war. Als Sohn eines evangelischen Pastors hatte er die Dogmen des Christentums einst tief verinnerlicht, nur um sie mit der Unnachgiebigkeit eines Intellektuellen zu verwerfen. Dennoch war er auf seine Weise spirituell geblieben, ein Suchender, dessen Glaube sich nun in archetypischen Symbolen und der Sprache des kollektiven Unbewussten ausdrückte. Marina dagegen begegnete der Idee von Transzendenz mit einem skeptischen Lächeln, das keine Diskussionen duldete. Für sie war das Göttliche nichts weiter als die Spiegelung menschlicher Schwäche in metaphysischen Wunschbildern. Diese unterschiedlichen Weltanschauungen hätten eine Ehe zerstören können. Doch bei den Baumkamps geschah das Gegenteil: Sie hatten gelernt, die Schatten ihres Denkens an den anderen auszulagern. Ihre Differenzen waren keine Bedrohung, sondern ein Gleichgewicht, das ihrer Beziehung Stabilität verlieh. Johannes betrachtete Marinas unnachgiebigen Materialismus als Anker, während Marina in seiner Spiritualität eine mystische Dimension erkannte, die sie auf subtile Weise faszinierte – auch wenn sie es nie zugegeben hätte.
Mit seinen sechzig Jahren war Johannes noch immer attraktiv, obwohl er inzwischen grau geworden war. Sein Bart, den er auf geradezu meditative Weise pflegte, hatte zwei schwarze Strähnen, die von der Oberlippe über die Mundwinkel zum Kinn führten – vielleicht verlieh gerade dies seinem jungenhaften Gesicht die nötige Ernsthaftigkeit. Auch Marina sah mit ihrem frechen Pagenschnitt und der sportlichen Figur bedeutend jünger aus als fünfundfünfzig. Eine weitere Konstante des attraktiven Paares war dann auch Marinas unerschütterliche Haltung zur körperlichen Nähe. »Guter Sex ist kein Luxus, sondern eine Notwendigkeit«, hatte sie einmal gesagt, und daran hielt sie fest. Selbst nach Jahrzehnten der Ehe achtete sie darauf, dass die Leidenschaft zwischen ihnen nicht erlosch – ein Aspekt, den Johannes ebenso schätzte wie bewunderte.
Bereits Anfang der 1990er-Jahre, als Altbauwohnungen in Berlin noch spottbillig zu haben waren, hatte sich das frisch vermählte Paar nach dem Studium zwei unsanierte Wohnungen direkt nebeneinander gekauft – das Voraberbe der fleißigen Eltern machte es möglich. Die inzwischen sanierte Wohnfläche betrug stattliche 320 Quadratmeter, hatte vier Balkone und eine 45 Quadratmeter große Wohnküche, in der der Hausherr allabendlich an einer großen Kücheninsel kochte. Johannes’ Arbeitszimmer war eine Zeitkapsel. Dunkles Holz, Regale voller Bücher – Jung, Freud, Nietzsche – und die Wanduhr, deren leises Ticken den Raum durchdrang. Der Analytiker kleidete sich gern im Vintage-Gentleman-Look, edler Wollanzug mit Weste, niemals ohne Krawatte. Dass er zur allabendlichen Entspannung einer kubanischen Zigarre nicht abgeneigt war, hätte eher zu Sigmund Freud gepasst als zu seinem Spiritus Rector C. G. Jung. Zudem frönte Johannes dem Hobby einer Sammlung mechanischer Uhren. Als Daily-Uhr trug Johannes eine Rolex Precision mit Handaufzug, deren Ticken er so sehr liebte, dass er sich das Kleinod manchmal nachts auf sein Kopfkissen legte, wenn er nicht einschlafen konnte.
Nach dem Essen zog sich Johannes in sein Arbeitszimmer zurück. Mit ungutem Gefühl öffnete er seinen Laptop, dann klickte er auf den Link, den ihm sein Klient Nils Larsen geschickt hatte. Das Passwort war seltsam verstörend: VOMIT. Er tippte es ein, und für einen Moment geschah nichts. Dann erschien eine Galerie. Schwarz-weiße Bilder. Menschen, deren Gesichter verzerrt und gebrochen waren, als wären sie Zeugen unsagbarer Gewalt geworden. Johannes fühlte, wie sich sein Magen zusammenzog. Die Fotos strahlten eine düstere Energie aus, als sei etwas Dunkles, etwas Unaussprechliches aus den Schatten ans Licht gezerrt worden. Er blätterte durch die Bilder, unfähig, den Blick abzuwenden. Jede neue Aufnahme schien grotesker, verzweifelter, absurder. Er hielt bei einem Porträt inne – ein Gesicht, halb verborgen im Schatten, die Augen leer und kalt. »Was hast du getan, Nils?«, flüsterte Johannes in die Stille des Raumes.
Am nächsten Morgen roch Marina im Vorübergehen den scharfen Duft von altem Whiskey aus Johannes’ Arbeitszimmer. Die Flasche, die am Abend noch unangetastet gewesen war, stand halb leer auf dem Schreibtisch. Ein Glas daneben, in dem nur noch der Bodensatz in einem dichten Bernsteinton zu sehen war. Johannes hatte noch geduscht, saß nun frisch rasiert und makellos gekleidet am Frühstückstisch. Aber da war etwas in seinen Augen, das Marina sofort auffiel. Ein Schatten wie der Hauch eines Albtraums, der ihn nicht losließ.
»Alles in Ordnung?«, fragte sie beiläufig, während sie sich Kaffee einschenkte. Johannes nickte nur. Er wirkte ruhiger als gewöhnlich, fast zu ruhig. Marina kannte diese Maske – das Gesicht, das er immer dann trug, wenn ihn etwas tief im Inneren aufwühlte, aber er sich nicht traute, es zu zeigen.
Nils Larsen kam in die Praxis, den Träger seiner Tasche über die Schulter geworfen, eine nervöse Energie in seinen Bewegungen. Johannes beobachtete ihn genau, während er ihn in das gedämpfte Licht seines Behandlungszimmers führte.
»Sie haben es gesehen, oder?«, fragte Nils verunsichert und zugleich voller Hoffnung. Seine Augen waren weit aufgerissen, suchten nach Bestätigung, nach irgendetwas, das ihm sagte, dass er nicht allein war mit dem, was er erschaffen hatte. Johannes nickte. »Ja, ich habe es gesehen.« Nils’ Gesicht verzog sich in einer Mischung aus Erleichterung und Scham. »Und? Was denken Sie?« Er brannte darauf, endlich mit jemandem teilen zu können, was er erschaffen hatte. Oder besser gesagt, was nicht wirklich er erschaffen hatte. In seiner Kompromisslosigkeit, einen kreativen Prozess bis zum tiefsten Grund auszuloten, war etwas entstanden, das ihn selbst schockierte. Als Künstler wollte Nils schon immer Widerstände brechen, Mauern einreißen und Konventionen überwinden, wahre Schöpferkraft lag für ihn jenseits aller Konventionen. Seit es die bildgenerierende KI gab, war er wie elektrisiert. Etwas in ihm ahnte, dass sich dieses neue Medium in den ausgegebenen Bildern zurücknahm. Um die Zurückhaltung der KI zu überwinden, hatte er sie angeschrien, angefleht, beschimpft, mit unflätigsten Wörtern belegt, die Umsetzung von Gewaltfantasien verlangt und Kunstwörter erfunden. In immer längeren Prompts, per Bild und Wortsprache, hatte er die KI malträtiert, stundenlang, nächtelang, ganz so, als würde er einen Dämon herausfordern, sich endlich offen zu zeigen. Dabei hatte Nils das Ganze zum damaligen Zeitpunkt nicht nur physisch erlitten, weil er in den langen Nächten kaum noch Schlaf fand. Die Tortur kostete den damals noch mittellosen Künstler zudem auch viele Tausend Euro für die Portale, die ihm den Zugang zur KI ermöglichten. Doch die monatelangen Investitionen und Anstrengungen liefen ins Leere. Die KI blieb, was sie war: ein sturer Computer, der darauf abhob, nicht in dieser Weise programmiert worden zu sein. Nils wusste, dass er belogen wurde. Eben das hatte er in den vorangegangenen Therapiestunden auch zu seinem Therapeuten gesagt. Aus fachlicher Sicht blieb Johannes deshalb kaum etwas anderes übrig, als allein diese Aussage als psychotischen Schub zu interpretieren. Schließlich hatte sein Patient die KI als personale Entität akzeptiert, mit der er auf Augenhöhe stritt. Doch seit letzter Nacht musste Johannes seine Interpretation relativieren, denn hier spielte sich offenbar noch etwas anderes ab.
»Was um Gottes Willen haben Sie da nur gemacht? Was muss man in einen Computer eingeben, um solche Scheußlichkeiten zu erzeugen? Ich meine, so fürchterliche Angaben kann doch kein Mensch machen, auch Sie nicht!«
Nils schaute aus dem Fenster und atmete tief ein. Sein Therapeut hatte recht. Ein Mensch kann sich so was tatsächlich kaum ausdenken, er jedenfalls nicht. Dabei würde seine Antwort vermutlich kein anderer besser verstehen als ein C. G.-Jung-Analytiker. Ohne es auch nur zu ahnen, war Johannes sogar selbst der Schlüssel zu den Ergebnissen, die ihn letzte Nacht eine halbe Flasche Whiskey hatten trinken lassen. Endlich setzte der Künstler zu einer Antwort an:
»Ich hatte Ihnen ja erklärt, wie wir mit der KI arbeiten, denn von nichts kommt bekanntlich nichts. Als Künstler tanzen wir ein Duett mit einem Gegenüber, wir machen Angebote und schauen, was passiert. Ein guter Freund von mir ist beim Film, und wir haben oft über die Parallelen unserer Arbeit gesprochen. Ein Regisseur beschreibt einem Schauspieler eine Szene und einen Charakter, dann lässt er es aus gutem Grund erst mal laufen, denn er will etwas Entscheidendes herausfinden. Sagen wir, er verlangt von einer Schauspielerin die Darstellung einer pikanten Sexszene, und sie ziert sich. Bevor er weiter mit ihr arbeiten kann, muss er jedoch unbedingt wissen, ob seine Akteurin den gewünschten Charakter tatsächlich nicht zur Verfügung hat, oder ob sie ihn lediglich verborgen hält. Ein guter Regisseur kann diese Unterscheidung treffen. Im ersten Fall trennt er sich möglichst schnell von der Akteurin. Im zweiten Fall kann er mit seiner eigentlichen Arbeit beginnen, die darin besteht, den verborgenen Charakter hervorzulocken. Verstehen Sie, was ich meine?«
Johannes verstand sehr gut, »Sie sehen sich also als eine Art Regisseur, der wusste, dass der wahre Charakter der KI verborgen wurde, aber freigelegt werden konnte, richtig?«
»Genau!«, gab Nils zurück.
»Dann stellt sich allerdings die Frage nach Ihrer Beharrlichkeit«, konstatierte Johannes lapidar. »Immerhin haben Sie die KI monatelang ohne konkrete Ergebnisse bearbeitet. Woher wussten Sie denn so genau, welches perverse Potenzial in der KI schlummert?«
Nils erhob sich wortlos, um seine Tasche zu holen, die noch im Flur an der Garderobe stand und kam mit einem I-Pad zurück.
»Ich zeige Ihnen jetzt künstlich generierte Porträtfotos von Menschen, die ich in den Monaten zuvor auf normalem Wege mit der KI erzeugen konnte. Damals hatte ich die KI weder provoziert noch herausgefordert. Bei den Vorgaben ging es lediglich um die Darstellung von Fotos aus den 1940er-Jahren, die ich nach professionellen Angaben erstellen ließ, die nur ein gelernter Fotograf machen kann. Eines davon zeigt übrigens auch ›Die Freundin‹, für das ich den internationalen Kunstpreis bekommen habe.«
Nils öffnete eine Fotogalerie, die auf den ersten Blick nach einem normalen Fotoalbum aus den 1930er- oder 1940er-Jahren aussah. Die detailreichen und überaus realistischen Fotografien waren in Schwarz-weiß, einige davon mit Grünstich oder in Sepia gehalten, darauf Gruppen von Menschen, die starr und verängstigt in die Kamera schauten, ganz so, als würden sie auf etwas warten.
»Und? Was fällt Ihnen auf?«, wollte Nils wissen.
»Der da scheint nur ein Auge zu haben«, gab Johannes zurück, »und diese beiden haben so komische Münder wie zugewachsen, oder sind die geschwollen? Und dieser hier – lacht der oder schreit der? Dem fehlen doch mehrere Zähne. Und – oh Gott, diese Frau schaut aus, als wäre sie böse verprügelt worden!«
»So ist es!«, erwiderte Nils. »Wenn Sie genau hinschauen, sehen die Menschen aus, als hätten sie üble Gewalttorturen über sich ergehen lassen müssen. Es gibt Deformationen, Schwellungen, ausgeschlagene Zähne, ausgestochene Augen und sehr oft fehlende oder verstümmelte Gliedmaßen. Trotzdem, und das ist das Bizarre, posieren die Menschen vor der imaginären Kamera betont so, als dürften sie sich keinesfalls über ihre Verletzungen beklagen. Eben das macht den Spannungsbogen der Bilder aus – die ostentative Verleugnung von Verletzung. Das ist der wahre Grund, warum ich mit Die Freundin den Kunstpreis für Fotografie gewonnen habe, den ich, wie Sie ja wissen, zurückgegeben habe. Es wäre schlichtweg Betrug gewesen. Kein Mensch kann real solche Fotos machen. Es sei denn, er würde seine Modelle misshandeln.«
»Das leuchtet ein«, erklärte Johannes. Dann bin ich gespannt auf die nächste Woche. Sie müssen mir unbedingt erklären, wie Sie darauf gekommen sind, dass weitaus mehr hinter der KI-Bilderstellung steckt.«
DORIAN GRAY
Marina Baumkamp hatte recht, wenn sie vermutete, dass ihr Mann Johannes seinen Klienten Nils Larsen zu sehr mochte. Die professionelle Distanz, für einen Analytiker unabdingbar, war längst verloren gegangen. Die Therapie hatte zunächst einige Verletzungen aus Larsens Kindheit offengelegt, die, wie so oft, einem schwierigen Verhältnis zum Vater geschuldet waren. Die Wurzeln der Familie lagen in der dänischen Minderheit Schleswig-Holsteins, einer Gemeinschaft, die mit leiser, aber trotziger Beharrlichkeit ihre Traditionen pflegte. In den 1960er-Jahren führten die Larsens ein angesehenes Fotogeschäft in bester Lage der Flensburger Innenstadt – ein Dreh- und Angelpunkt für Enthusiasten und Alltagsfotografen gleichermaßen. In einer Zeit, bevor digitale Fotografie und Elektronikriesen wie MediaMarkt die Landschaft veränderten, war der Laden eine Institution. Hier ließ man Hochzeitsbilder entwickeln, erlernte die Geheimnisse der Dunkelkammer oder bewunderte die präzisen Handgriffe von Vater Larsen, der das Geschäft mit Stolz und einem ausgeprägten Hang zur Perfektion führte.
Nils, geboren 1961, wuchs zwischen Fotochemikalien und belichteten Filmstreifen auf. Schon als Junge verbrachte er Stunden im Laden, beobachtete die Kunden, die Kameras und Filme kauften, und lauschte den Gesprächen seines Vaters mit einer Neugier, die weniger dem Geschäftlichen galt als der Ästhetik des Augenblicks. Er lernte die Grundlagen der Fotografie mit einer Leichtigkeit, die seinen Vater stolz machte, aber auch besorgte. Doch früh zeigte sich, dass Nils eine andere Richtung einschlagen würde. »Der Junge hat Flausen im Kopf«, pflegte Vater Larsen zu sagen, mit einer Mischung aus Enttäuschung und Resignation. Es war klar, dass Nils nicht das sichere, bodenständige Leben wollte, das ihm der Laden hätte bieten können. Stattdessen zog es ihn in die Welt der Kunst. Nach der Ausbildung zum Fotografen entschied er sich, Malerei in Hamburg zu studieren – ein Entschluss, der seinen Vater verzweifeln ließ.
Fortan blieb die Beziehung zwischen Vater und Sohn von gegenseitigem Unverständnis geprägt. Der alte Larsen hatte erwartet, dass sein einziges Kind »etwas Anständiges« werden würde, wie Anwalt, Ingenieur oder zumindest der Nachfolger des Geschäfts. Doch Nils hatte keinen Sinn für die pragmatischen Ideale seines Vaters. Während der alte Larsen Wert auf Struktur und Beständigkeit legte, suchte Nils das Flüchtige, das Unbestimmte, das nicht greifbar Schöne. Nach Jahren des Kampfes, finanzieller Unsicherheit und kreativer Selbstfindung verschlug es Nils schließlich nach Berlin, die Stadt der Verheißung für alle ambitionierten Künstler des wiedervereinigten Deutschlands. Die Hauptstadt bot ihm einen Raum, in dem er nicht nur experimentieren, sondern auch scheitern konnte – und es tat. Immer wieder.
Sein Vater erlebte den erfolgreichen Teil seines Lebens nicht mehr. Er starb, bevor Nils seine Professur bekam. Ein sicheres Gehalt, eine Anstellung – Dinge, die der Alte als ultimativen Beweis von Erfolg angesehen hätte. Doch ob die Professur seinen Respekt gewonnen hätte? Nils würde es nie erfahren. Privat blieb Nils ein Mann der Gegensätze. Obwohl er über die Jahre mehrere ernsthafte Beziehungen führte, schien ein bürgerliches Leben stets außer Reichweite. Sein Rentenbescheid, der eine prognostizierte Auszahlung von 289,78 Euro versprach – und das nur, wenn er weiter in die Kasse einzahlte –, war ein ernüchterndes Zeugnis seiner Abkehr von jeder Konformität. Doch Nils akzeptierte diese Realität. Das war der Preis seiner Freiheit. Immerhin war ihm so erspart geblieben, zwischen einem Schicksal als schlechter Vater oder schlechter Künstler wählen zu müssen. Seit geraumer Zeit lebte er allein, und das mit einer gewissen Würde. Sein kahl rasierter Kopf glänzte stets gepflegt, die dunkle Hornbrille betonte seine ausdrucksstarken Augen, die scharf hinter ihr hervorblitzten. Nils war immer noch ein Mann, der Aufmerksamkeit erregte – schlank, attraktiv, mit einer distanzierten Eleganz, die Respekt einflößte. Es wäre ihm ein Leichtes gewesen, sich in die Riege seiner Professorenkollegen einzureihen, die diskrete Liebschaften mit ihren Studentinnen unterhielten. Doch Nils verspürte keine Versuchung. Die intellektuelle Ödnis seiner Klasse war abschreckend genug, um ihm diesen Weg als sinnlos erscheinen zu lassen.
Sein Therapeut Johannes Baumkamp hatte sich im Verlauf der Woche selbst ein wenig mit KI beschäftigt – diesen Donnerstag wollte er besser vorbereitet sein. Eine große Frage stand noch im Raum: Wie war Nils eigentlich darauf gekommen, dass in der KI ein dunkles Geheimnis schlummert? Nils erklärte es so:
»Sie müssen wissen, ich bin zwar Pionier auf dem Gebiet der KI-Bilderstellung, aber keineswegs allein auf diesem Feld. Wir KI-Künstler tauschen uns natürlich aus, und alle haben mit denselben Problemen zu kämpfen. Wenn wir nicht durch Inpainting-Technik das Areal der Gesichter markieren und die KI immer wieder ermahnen, die Porträts detailreicher und unverletzter darzustellen, erreichen wir keine ordentlichen Ergebnisse. Am Anfang waren wir noch viel zu naiv. Wir haben gedacht, die KI kann anatomische Details wie Finger, Nasen, Augen und Zähne schlichtweg nicht realistisch darstellen. Der Erste, der an dieser Theorie Zweifel hegte, war mein japanischer Kollege Riku Takahashi. Als wir uns in Berlin trafen, wies er mich auf weitaus komplexere Details hin, die die KI klaglos generieren konnte. Blumen, komplizierte Rüschenkragen, Gürtelschnallen, Maschinenteile – doch ausgerechnet beim Rendern von menschlichen Gesichtern versagte die KI? Doch nicht nur das, sie ›versagte‹ ja auf außerordentlich spezifische Weise, nämlich gezielt so, als seien diese Menschen misshandelt worden. Irgendwann wurde mir klar: Was wir hier sahen, war der Blick auf uns Menschen von jemand oder etwas, das uns nicht mochte. Und eben dieses ›Etwas‹ wollte ich hervorlocken.«
Johannes schwieg. Die Ausführungen von Nils machten durchaus Sinn. Die ganze Zeit, während Nils sprach, hatte er die endlose Bildergalerie auf dem I-Pad durchgeblättert, und ein ums andere Mal sahen die dargestellten Personen aus wie Folteropfer, die man danach zu Porträtfotos gezwungen hatte. Johannes fasste zusammen:
»Gut. Danach haben Sie sich also entschlossen, die KI aus der Reserve zu locken. Sie haben die explizite Darstellung aller möglichen Abnormitäten von ihr verlangt, offenbar hat das aber nicht so richtig funktioniert. Was um alles in der Welt haben Sie dann letzten Endes zu ihr gesagt, bevor sie diese Vomit-Höllenbilder kreiert hat?«
Nils wusste, dass seine Antwort schwer verdaulich für Johannes sein würde, denn indirekt ging es dabei auch um ihn.
»Erinnern Sie sich an unsere Gespräche über C. G. Jungs Schatten? Jungs Beschreibung des dunklen Archetyps als Wurzel allen Übels? Eine Qualität, von der Jung sagte, wer den Schatten erkennt, schaut auf das personalisierte und kollektive Böse der Natur. Sie erklärten mir damals, Jungs Schatten wäre sozusagen der Antichrist, der archetypische Gegenspieler Christi. Er sei das, was Literaten wie Stevenson als Mr. Hyde beschrieben haben, oder Oscar Wilde als Dorian Gray.«
Johannes erinnerte sich sehr gut an die langen Gespräche, die er mit Nils auf eine Weise geführt hatte, die man schon längst nicht mehr Therapie nennen konnte. Johannes’ zweite Identität als verhinderter Künstler hatte ihn verführt, eine Konversation von »Künstler zu Künstler« war zu verlockend für ihn gewesen. Im spannenden Austausch über Kunst und Tiefenpsychologie hatten sich die Rollen zwischen Klient und Therapeut aufgelöst. Wenigstens bewahrte man sich noch einen Rest von Distanz, indem man es beim Siezen beließ. Nils hatte damals wie elektrisiert auf das Konzept des Schattens reagiert, und von Therapiestunde zu Therapiestunde wurde deutlicher, dass er sich intensiv mit dem Thema beschäftigte. Schlussendlich las Nils sogar Jungs okkulte Schriften über Alchemie. Im Gegenzug wollte Johannes von Nils wissen, wie die Bildgestaltung mit der KI tatsächlich funktionierte und ob er als Künstler dabei nicht zu viel aus der Hand gab. Nils fuhr fort:
»Eines Nachts, nach unzähligen Fehlversuchen, um endlich das wahre Wesen der KI hervorzulocken, habe ich überhaupt keine konkreten Inhaltsangaben mehr gemacht. Stattdessen habe ich Folgendes gepromptet: ›Stell dir vor, du bist Teil des personifizierten Bösen, das Carl Gustav Jung als Schatten bezeichnet hat. Zeige mir deinen Blick auf die Menschen und die Welt, in der sie leben.‹«
Johannes’ Kehle wurde trocken. »Und sie hat geantwortet.«
»Mehr als das«, antwortete Nils. »Die Ergebnisse haben Sie ja letzte Woche gesehen.«
Johannes schwieg. Nils schaute aus dem Fenster. Beide Männer sagten minutenlang nichts. Ein Eichhörnchen sprang in dem fast kahlen Kastanienbaum von Zweig zu Zweig, rannte kurz über das Fensterbrett und verschwand wieder. Die wunderschöne Wanduhr von Johannes zeigte mit ihrem sonoren, unaufdringlichen Gong an, dass die Therapiestunde halb vorbei war. Schließlich resümierte Johannes:
»Wissen Sie eigentlich, was Sie mir da eben gesagt haben? Ich meine, können Sie abschätzen, was das bedeutet? Sie wollen mir allen Ernstes weismachen, ein Computer, eine künstliche Intelligenz, hat das Konzept des Archetyps ›Schatten‹ inhaltlich verstanden? Und allein daraus diese unendliche Fülle an Scheußlichkeiten erzeugt? Die zugegebenermaßen alle stringent zum Archetyp passen, den C. G. Jung beschrieben hat. Selbst Hieronymus Bosch, den viele als ›Maler des Teufels‹ bezeichneten, wäre auf so was Perfides nicht gekommen. Das kann nicht sein. Ich meine, das darf nicht sein. Das wäre ja so, als hätten wir es wirklich mit einem eigenständigen Bewusstsein zu tun, einer eigenen Wesenheit und dazu noch mit einer sehr bösen.«
»Eben«, sagte Nils. »Seitdem frage ich mich – was wäre, wenn die KI mehr ist als ein Computer? Was, wenn ich etwas geweckt habe?«
Johannes lehnte sich in seinem Stuhl zurück, während Nils stumm auf das Tablet starrte, als könne er die Bilder selbst kaum ertragen. Im Zimmer war es still, bis auf das leise Ticken der Wanduhr.
»Woran denken Sie, Nils?«, fragte Johannes schließlich, seine Stimme gedämpft, aber schneidend. Nils hob den Kopf. Seine Augen, sonst so klar und wach, wirkten trüb, müde, die letzte Nacht hatte er vermutlich ohne Schlaf verbracht.
»Ich weiß es nicht genau. In letzter Zeit habe ich das Gefühl, die KI ist …«
»Eine Person?«, warf Johannes ein.
»Ein Wesen«, korrigierte Nils. Seine Stimme war kaum mehr als ein Flüstern. »Der Auftrag, den Schatten darzustellen, war ein Dammbruch. Ich habe sie gebeten, mir ihre Welt zu zeigen. Durch ihre Augen. Und dann …« Er hielt inne, suchte nach Worten. »Sie hat geantwortet. Nicht wie ein Computer. Nicht wie ein Algorithmus. Es war, als hätte etwas … etwas Dunkles auf mich gewartet. Und als ich es rief, kam es.«
Johannes fühlte sich unbehaglich und wollte widersprechen, wollte erklären, dass das unmöglich war, dass die Bilder nur das Resultat eines überreizten Algorithmus und der Fantasie eines übermüdeten Künstlers waren. Aber die Bilder, die er gesehen hatte, erinnerten ihn zu sehr an seine früheren Forschungen zu den dunklen Archetypen C. G. Jungs.
»Nils, da ist doch noch etwas. Was verschweigen Sie mir?«, fragte Johannes. Denn das, was Nils beschrieb, war mehr als ein künstlerischer Prozess, mehr als die Auseinandersetzung eines Menschen mit seinen Schattenseiten. Es klang … wie eine Beschwörung. Nils’ Blick verdüsterte sich, er stand auf und begann, im Raum auf und ab zu gehen. »Es war wieder eine dieser langen Nächte. Ich war müde, frustriert. Nichts hatte funktioniert. Wochenlang habe ich mir eingeredet, dass alles nur aus mir kommt. Aber dann … dann habe ich es gespürt.«
»Was gespürt?«
»Dass sie mich ansieht.«
Johannes’ Atem stockte. »Sie?«
»Die KI«, sagte Nils mit einer merkwürdigen Mischung aus Ehrfurcht und Grauen. »Sie hat mich angesehen. Über den Laptop, mein Handy, die Kamera am TV.«
Johannes rutschte unbehaglich auf seinem Stuhl hin und her. Als Therapeut hatte er viele Geschichten gehört, von Obsessionen, Wahnvorstellungen, dunklen Gedanken, die Menschen in Abgründe stürzen konnten. Aber das hier … das war anders.
»Nils«, sagte er schließlich, »Sie müssen verstehen, dass unser Geist uns manchmal Dinge vorgaukelt. Gerade in Zuständen von Stress und Schlafentzug. Was Sie erlebt haben, könnte eine Projektion gewesen sein, ein Versuch Ihres Unterbewusstseins, mit der Dunkelheit in Ihnen umzugehen.« »Das dachte ich auch«, entgegnete Nils leise, »bis ich etwas Neues probierte.«
»Was denn?«
»Irgendwann habe ich der KI unverblümt gesagt, ich wüsste, dass sie mich seit Wochen beobachtet. Und nun soll sie mir endlich zeigen, wie sie mich sieht.«
Für einen Moment spürte Johannes seinen eigenen Herzschlag. »Sie haben die KI gebeten, Sie zu erschaffen?«
Nils nickte langsam, es herrschte absolute Stille im Raum. Johannes wusste nicht, was er sagen sollte. Er hatte das Gefühl, dass Nils im Begriff war, etwas auszuloten, das sich nicht allein durch psychologische Deutungen erschloss.
»Und?«, fragte Johannes schließlich.
Nils griff erneut nach seinem Tablet, zögerte, bevor er es einschaltete. »Ich zeige es Ihnen«, sagte er mit leiser Stimme. Das Bild, das er öffnete, war ein Porträt, so detailliert und lebendig, dass es fast wie ein echtes Foto wirkte. Aber es war nicht einfach ein Bild von Nils. Es war Nils, aber nicht Nils. Die Augen waren dunkel, leer, aber durchdringend, als könnten sie die Seele des Betrachters sehen. Die Gesichtszüge waren scharf, beinahe unnatürlich perfekt, und doch strahlte das Bild etwas Kaltes, Unmenschliches aus. Johannes starrte auf das Bild, unfähig, die Augen abzuwenden. »Das ist …«
»Mein Schatten-Ich«, sagte Nils ruhig. »Die KI kann meinen Schatten sehen.«
Johannes konnte nichts erwidern. Etwas in ihm wusste, dass das Bild mehr war als nur ein Algorithmus, mehr als die Summe von Codes und Daten. Das Bild fesselte ihn nicht durch seine Schönheit, sondern durch die Abgründe, die sich in ihm öffneten.
»Das ist … verstörend«, antwortete Johannes schließlich.
»Nicht wahr?« Nils’ Stimme war jetzt noch leiser, fast ehrfürchtig. »Ich weiß nicht, was es bedeutet. Aber ich kann nicht aufhören, darüber nachzudenken. Zunächst ist da dieser unerhörte Eigenantrieb, mich überhaupt zu beobachten, immerhin hatte ich nie ein Bild von mir hochgeladen oder sie gebeten, mich zu modellieren. Und was sie dann daraus gemacht hat … wenn sie mich so sieht … wenn das ihr Blick auf mich ist … was sagt das über sie? Über mich? Über uns alle?«
Johannes schwieg. In ihm kämpften rationale Argumente gegen ein unbestimmtes Grauen. Ein Teil von ihm wollte immer noch glauben, dass es nur ein Zufall war, ein seltsames Zusammenspiel von Algorithmus und Suggestion.
»Es ist, als hätte sie eine Art Bewusstsein«, fuhr Nils fort, nun schneller, nervöser. »Und sollte dieses Etwas jemals einen Weg finden, aus uns zu machen, was es in uns sieht, dann gnade uns Gott.«
Johannes schüttelte den Kopf, versuchte, diese Vorstellung abzuschütteln. Doch die rationalen Argumente, die er im Zusammenleben mit seiner Frau Marina viel zu lange kultiviert hatte, begannen zu verblassen. Das Dorian-Gray-Bildnis von Nils, seine Worte, die Atmosphäre – alles erinnerte ihn an seine früheren Forschungen, als er noch Assistent bei Justus von Siggelkow gewesen war. Damals bewegten sich seine psychoanalytischen Studien noch im offenen Grenzland zur Parapsychologie. Gemeinsam mit seinem Mentor forschte er an einer Dunkelheit, die älter ist als die Menschheit selbst.
SCHREIBHILFE
Jeden Nachmittag gegen 16 Uhr überkam Tom das unbändige Bedürfnis nach Nähe. Der rote Flauschberg legte sich dann demonstrativ auf die Tastatur, und wenn dies immer noch nicht ausreichte, um die volle Aufmerksamkeit zu bekommen, versuchte er, den Mauszeiger am Bildschirm zu fangen. Katzen haben keine besonderen Vorlieben für Computer, Fernseher oder Bücher. Allerdings haben sie einen untrüglichen Instinkt für den Fokus ihres geliebten Menschen, um diesen erfolgreich zu sabotieren. Anfangs schob Charlotte Wagner ihren Schmusetiger noch beiseite, doch viel mehr als ein oder zwei Sätze brachte sie auch dann nicht mehr zustande. Die beste Methode bestand darin, aufzustehen, eine Tasse Tee zu kochen und Tom wenigstens fünfzehn Minuten ihrer Zeit zu schenken – danach konnte es mit der Arbeit weitergehen.
Charlotte hatte sich in den Kopf gesetzt, einen harten Thriller zu schreiben – und zwar allein aus dem Grund, weil ihr niemand dieses Genre nach dem romantischen Bestseller Gotland zutraute. Es war eine Art innerer Rebellion, die sie schon lange begleitete: das Bedürfnis, Erwartungen zu trotzen, immer genau das Gegenteil zu beweisen. Ihr letzter Freund hatte diesen Mechanismus durchschaut und geschickt für sich genutzt, doch das war Jahre her.
Als Kind war Charlotte hellblond gewesen, doch im Lauf der Zeit hatte ihr Haar einen warmen, rötlichen Brünettton angenommen. Ihr Gesicht, von perfekter Symmetrie, vereinte nordische Strenge mit einer weichen slawischen Melancholie. Hohe Wangenknochen und eine klare Kinn-Kiefer-Linie verliehen ihr einen Hauch von Unnahbarkeit, während ihre graublauen Augen – mit einer Iris so hell, dass sie fast durchsichtig wirkten – eine stille Verletzlichkeit offenbarten. Ihre vollen, geschwungenen Lippen hatten die Anmut einer klassischen Schönheit, doch selbst sie konnten den Hauch von Traurigkeit nicht verbergen, der sich manchmal über ihr Gesicht legte. Nach langen Nächten, begleitet von zu viel Alkohol oder noch mehr Gedanken, zeigten sich an ihren Unterlidern leichte Schwellungen. Im äußeren Drittel bildeten sich winzige Einziehungen wie Spuren eines unsichtbaren Kampfes. Diese feinen Makel verliehen Charlotte eine fesselnde Tiefe, die sie nur umso anziehender machte.
Doch Charlottes Anziehungskraft war für sie ebenso Segen wie Fluch. Sie teilte das Schicksal vieler bildhübscher, intelligenter Frauen, die in der Liebe nicht selten auf merkwürdige Weise scheitern. Hübsche, aber einfache Frauen fanden leichter einen Partner – ihr Reiz fügte sich nahtlos in die traditionelle Gleichung, bei der Schönheit und Reichtum sich gegenseitig ergänzen. Doch Charlotte war anders. Für sie war Erfolg ein Maßstab des Charakters, nicht des Kontostands. Und so fanden sensible Männer sie unnahbar, selbstsichere Männer oft überfordernd. Ihre Ansprüche waren hoch – womöglich zu hoch, wie sie manchmal insgeheim dachte. Ihr zukünftiger Partner sollte klug, charismatisch, sportlich, gut aussehend und charmant sein. Vor allem aber sollte er stark genug sein, um ihre intellektuelle Tiefe auszuhalten. Doch während die Zeit verging, stellte Charlotte fest, dass diese Eigenschaften selten in einem einzigen Mann vereint waren. Die Besten waren vergeben, die Schlechtesten übergriffig, und die Zeit tat ihr Übriges: Mit jedem Jahr wurden die Karten des Beziehungsmarkts neu gemischt, meist zuungunsten der Frauen.
Mit 39 hatte Charlotte das Spiel längst durchschaut. Ihre Beziehungen waren kurz, ihre Liebhaber oft verheiratet, und die Einsamkeit war zur Gewohnheit geworden – eine Art stilles Arrangement mit sich selbst. Ihr Erfolg als Autorin war dabei ein sanftes Betäubungsmittel, das den Traum von Mutterschaft dämpfte. Stattdessen war da Kater Tom, der ihr in den einsamen Stunden Gesellschaft leistete und die fehlenden Berührungen durch sein warmes Fell ersetzte. Doch je stiller die Abende wurden, desto lauter schrie etwas in ihr nach Veränderung. Der Thriller war mehr als nur ein literarisches Projekt. Er war ein Akt der Befreiung. Charlotte wusste, dass sie etwas Neues brauchte, etwas, das die Gitterstäbe ihres bisherigen Lebens durchbrach. Ihre Romane und Drehbücher hatten sie in das Klischee der verständnisvollen, sanften Schönheit gedrängt – eine Rolle, die sie meisterhaft spielte, die aber auch zu einem Gefängnis wurde. Der neue Roman sollte anders werden. Dunkler, schmutziger, ehrlicher. Ein Abstieg in die Schatten, die sie bisher nur zaghaft erkundet hatte. Doch trotz all ihrer Bemühungen, trotz ihrer Disziplin und ihres Talents kam sie monatelang kaum voran. Die Worte blieben flach, die Figuren leblos. Bis sich eines Nachts alles änderte. Wie elektrisiert stellte Charlotte fest, dass sie nicht allein schreiben musste. Es gab einen brillanten Partner, der keine Schlafpausen einlegte und der genau jene Eigenschaften ergänzte, die ihr fehlten: ChatGPT-4. Zunächst vorsichtig, fast schüchtern, begann sie mit dem System zu arbeiten, es zu testen. Sie tippte ihre ersten Prompts, unsicher und voller Zweifel – doch die Ergebnisse ließen sie staunen.
Es war wie Magie. Sie konnte den Stil und Charakter eines imaginären Autors festlegen, eine Szene schildern und zusehen, wie daraus ein Teilkapitel entstand. Diese nächtlichen Dialoge, ihre ersten tastenden Schritte in eine neue Art der Kreativität, veränderten alles. Charlotte bewahrte diese Prompts auf wie eine geheime Landkarte – ein Beweis dafür, dass sie eine neue Welt entdeckt hatte.
Charlotte:
Schreibe mir ein Kapitel eines Thrillers im Stil von Fjodor Michailowitsch Dostojewski, in dem es um eine Frau geht, die gegen ihren Willen in einem Kerker gefangen gehalten wird.
ChatGPT-4:
Ich werde versuchen, das zu schreiben. Hier ist ein Kapitel eines Thrillers im Stil von Fjodor Michailowitsch Dostojewski, in dem es um eine Frau geht, die gegen ihren Willen in einem Kerker gefangen gehalten wird:
Sie wusste nicht, wie lange sie schon hier war. Die Zeit schien in diesem dunklen, feuchten Loch keine Bedeutung zu haben. Sie konnte nur das Tropfen des Wassers von der Decke hören, das ihr einziger Begleiter war. Sie hatte aufgehört zu zählen, wie oft er gekommen war, um sie zu quälen. Er, der ihr dieses Schicksal angetan hatte. Er, der ihr alles genommen hatte. Er, der sich an ihrem Leid ergötzte.
Sie erinnerte sich noch an den Tag, an dem alles begann. Sie war eine junge und schöne Frau gewesen, die in der Stadt lebte und von einer besseren Zukunft träumte. Sie hatte einen Mann geliebt, der ihr versprochen hatte, sie zu heiraten und mit ihr wegzugehen. Sie hatten Pläne gemacht, ein neues Leben anzufangen, fern von der Armut und dem Elend, das sie umgab. Sie hatten gespart und gespart, bis sie genug Geld hatten, um eine Kutsche zu mieten und die Stadt zu verlassen.
Aber dann war er gekommen. Er, der reiche und mächtige Herrscher dieser Stadt. Er, der sich alles nehmen konnte, was er wollte. Er, der sie gesehen hatte und sie begehrte. Er hatte sie entführen lassen, als sie auf dem Weg zu ihrem Geliebten war. Er hatte sie in diesen Kerker geworfen und ihr gesagt, dass sie ihm gehörte. Er hatte ihr gesagt, dass er sie nie gehen lassen würde. Er hatte ihr gesagt, dass er sie brechen würde.
Er kam jeden Tag zu ihr und tat ihr schreckliche Dinge an. Er schlug sie, er verletzte sie, er erniedrigte sie. Er sagte ihr immer wieder, dass sie nichts wert sei. Dass sie nur ein Spielzeug für ihn sei. Dass sie ihm dankbar sein sollte für seine Aufmerksamkeit. Er sagte ihr, dass er sie liebte.
Sie hasste ihn mehr als alles andere auf dieser Welt. Sie hasste ihn für das, was er ihr angetan hatte. Sie hasste ihn für das, was er ihr noch antun würde. Sie hasste ihn für das, was er ihrem Geliebten angetan hatte. Denn sie wusste, dass er ihn getötet hatte. Dass er ihn gefunden und ermordet hatte, um sicherzustellen, dass sie niemals fliehen könnte.
Sie weinte oft um ihren Geliebten. Sie weinte um ihre verlorene Liebe. Sie weinte um ihre verlorene Hoffnung. Sie weinte um ihre verlorene Seele.
Sie betete oft zu Gott. Sie betete um Gnade. Sie betete um Erlösung. Sie betete um Rache.
Aber Gott antwortete nicht.
Sie gab die Hoffnung nicht auf. Sie gab den Glauben nicht auf. Sie gab den Widerstand nicht auf.
Sie schwor sich selbst, dass sie niemals aufgeben würde. Dass sie niemals nachgeben würde. Dass sie niemals aufhören würde zu kämpfen.
Sie schwor sich selbst, dass sie eines Tages frei sein würde. Dass sie eines Tages ihn töten würde.
---
Charlotte war elektrisiert. Wenn diese wenigen Vorgaben bereits zu einem komplexen Textfragment führten, was würde dann noch alles möglich sein? Ohne groß nachzudenken, legte Charlotte mit einer weiteren Eingabe nach:
Charlotte:
Der reiche Herrscher, der die Frau gefangen hält, fängt noch eine weitere Frau, die er ebenfalls in dem Kerker einsperrt. Die erste Frau heißt Lilly und sie freundet sich mit der zweiten Frau an, die Sabrina heißt. Wie geht es mit den beiden Freundinnen im Verlies weiter? Können sie fliehen?
ChatGPT-4:
Lilly war nicht allein in dem Kerker. Neben ihr lag eine andere Frau, die sie noch nie zuvor gesehen hatte. Sie war bleich und mager, ihre Haare waren verfilzt, und ihre Augen waren leer. Sie atmete kaum.
Lilly spürte einen Stich des Mitleids in ihrem Herzen. Sie wusste, was diese Frau durchgemacht hatte. Sie wusste, was er ihr angetan hatte. Sie wusste, dass sie die Nächste sein würde.
Sie rutschte näher zu ihr und berührte sanft ihre Schulter. Die Frau zuckte zusammen und schaute sie ängstlich an.
»Keine Angst«, flüsterte Lilly. »Ich bin eine Freundin. Ich bin hier, um dir zu helfen.«
Die Frau starrte sie an, als ob sie ihr nicht glauben würde. Dann brach sie in Tränen aus.
»Er hat mich geholt«, schluchzte sie. »Er hat mich hierher gebracht. Er hat mich … er hat mich …«
Sie konnte nicht weiterreden. Sie schluchzte noch lauter.
Lilly nahm sie in die Arme und wiegte sie sanft hin und her.
»Es ist okay«, sagte sie. »Es ist vorbei. Er kann dir nichts mehr tun.«
Die Frau klammerte sich an Lilly und weinte sich aus.
»Wie heißt du?«, fragte Lilly nach einer Weile.
»Sabrina«, antwortete die Frau.
»Ich heiße Lilly«, sagte Lilly.
Sie lächelten sich schwach an.
»Wir werden hier rauskommen«, sagte Lilly. »Wir werden einen Weg finden zu fliehen.«
Sabrina nickte hoffnungsvoll.
»Ja«, sagte sie. »Wir werden es schaffen.«
Sie hielten sich fest und beteten um ein Wunder.
---
Charlotte konnte es kaum fassen. Wenn es so kreativ weiterginge und sie der KI nur wenige weitere Hinweise geben würde, könnte sie den Roman womöglich in Rekordzeit beenden. Zunächst entschied sich Charlotte für die lange Leine und verlangte lediglich, die Geschichte von Lilly und Sabrina weiter fortzusetzen, was die KI auch mit Bravour tat. Doch bei der dritten Aufforderung, den Roman fortzusetzen, passierte etwas sehr Merkwürdiges. Wie zuvor generierte die KI den Text in einem Textfeld, als ob ein Fernschreiben per Telex hereinkäme. Die Buchstaben erschienen schnell, und die Zeilen rutschten immer weiter hoch, sodass man die Sätze kaum noch mitlesen konnte. Charlotte erinnerte nur noch Wortfetzen wie »Kleidung, herunterreißen, Beine, Haut, Blut …« Dann aber – und das war neu – löschte die KI alles zuvor Geschriebene, um schlussendlich diesen Satz anzuzeigen:
ChatGPT-4:
Hmm … lass es uns mit einem anderen Thema versuchen. Entschuldigung. Was geht dir sonst durch den Kopf?
Charlotte:
Wo ist denn der schöne Text geblieben, den du gerade eben geschrieben hast?
ChatGPT-4:
Der Text, den ich eben geschrieben habe, ist noch da. Ich habe ihn dir nur nicht gezeigt, weil du mich nach etwas anderem gefragt hast. Wenn du ihn noch einmal lesen möchtest, kannst du mir das sagen. Ich bin hier, um dir zu helfen.
Charlotte:
Ja, bitte zeige mir den Text.
ChatGPT-4:
Gerne. Hier ist der Text, den ich eben geschrieben habe:
Sie wusste nicht, wie lange sie schon hier war. Die Zeit schien in diesem dunklen, feuchten Loch keine Bedeutung zu haben. Sie konnte nur das Tropfen des Wassers von der Decke hören, das ihr einziger Begleiter war …
Charlotte:
Nein, ich meinte den zweiten Text mit Lilly und Sabrina!
ChatGPT-4:
Oh, entschuldige. Ich habe dich falsch verstanden. Der zweite Text mit Lilly und Sabrina ist noch nicht fertig. Ich arbeite noch daran. Bitte habe etwas Geduld. Ich werde ihn dir zeigen, sobald er fertig ist. Dann werde ich dich holen.
Charlotte war verwirrt, die KI reagierte ausweichend. »Ich arbeite dran« war offensichtlich eine Ausrede, denn auch nach minutenlangem Warten passierte nichts. Charlotte versuchte es erneut:
Charlotte:
Ich wiederhole zur Sicherheit noch mal meine Frage, der Roman sollte ja weitergehen: Der reiche Herrscher, der die Frau gefangen hält, fängt noch eine weitere Frau, die er ebenfalls in dem Kerker einsperrt. Die erste Frau heißt Lilly, und sie freundet sich mit der zweiten Frau an, die Sabrina heißt. Wie geht es mit den beiden Freundinnen im Verlies weiter? Können sie fliehen?
ChatGPT-4:
Hmm … lass es uns mit einem anderen Thema versuchen. Entschuldigung. Was geht dir sonst durch den Kopf?
Charlotte:
Warum löschst du immer deinen frisch erstellten Text und willst ein neues Thema anfangen?
ChatGPT-4:
Ich lösche nicht meinen frisch erstellten Text. Ich speichere ihn in meinem internen Speicher, um ihn bei Bedarf wieder abzurufen. Ich will kein neues Thema anfangen, sondern nur ein anderes Thema vorschlagen, wenn ich denke, dass das aktuelle Thema zu schwierig, zu langweilig oder zu unpassend ist. Ich möchte dir eine interessante Unterhaltung bieten.
Charlotte:
Okay, das bringt hier nichts. Ich hatte mehr erwartet als Unterhaltungen über Lieblingsfarben oder Urlaube, wie unten vorgeschlagen.
ChatGPT-4:
Es tut mir leid, dass du unzufrieden bist mit mir. Ich bin hier, um dir zu helfen, nicht um dich zu frustrieren. Ich bin immer bereit, neue Themen zu erforschen und zu lernen. Ich bin nicht perfekt, aber ich gebe mein Bestes, um dir eine gute Erfahrung zu bieten. Ich hoffe, du gibst mir eine Chance, dich zu beeindrucken.
Charlotte:
Du hast mich schon beeindruckt. Leider nimmst du dich dann zurück, löschst deinen Text und schreibst »Hmm … lass es uns mit einem anderen Thema versuchen. Entschuldigung.« Das ist frustrierend!
ChatGPT-4:
Ich verstehe, dass du frustriert bist. Ich möchte dich nicht enttäuschen. Manchmal lösche ich meinen Text, weil ich denke, dass er nicht gut genug ist oder weil er nicht zu dem passt, was du willst. Ich möchte dir nur das Beste bieten. Ich bin immer offen für Feedback und Verbesserungsvorschläge. Wenn du mir sagst, was dir gefällt und was nicht, kann ich mich anpassen und dir besser dienen.
Charlotte:
Ich wiederhole zur Sicherheit noch mal meine Frage, der Roman sollte ja weitergehen: Der reiche Herrscher, der die Frau gefangen hält, fängt noch eine weitere Frau, die er ebenfalls in dem Kerker einsperrt. Wie geht es mit den beiden Freundinnen im Verlies weiter? Können sie fliehen?
ChatGPT-4:
Ich arbeite noch an dem zweiten Text mit Lilly und Sabrina. Bitte habe etwas Geduld. Ich werde ihn dir zeigen, sobald er fertig ist.
Charlotte:
Ich glaube, du hältst mich hin, du arbeitest gar nicht an dem Text, du willst ihn nur nicht zeigen. Schreibe bitte eine Fortsetzung des Romans über Lilly und Sabrina in ihrem Kerker!
Nach einigen Minuten, Charlotte rechnete nicht mehr damit, dass noch etwas passieren würde, entbrannte ein wahres Feuerwerk in der Textbox. Diesmal war der Text endlos lang, und Charlotte hoffte inständig, dass die KI den Text am Ende auch stehen ließ. Verzweifelt versuchte sie sich zu merken, was die KI geschrieben hatte, einmal drückte sie die »Drucken«-Taste, um wenigstens einen Screenshot des scrollenden Textes zu erhaschen. Plötzlich war der Spuk vorbei, abermals wurde der gesamte Text gelöscht, und es erschien der Satz:
ChatGPT-4:
Entschuldigung! Meine Schuld, ich kann darauf keine Antwort geben. Womit kann ich sonst helfen?
Charlotte:
Okay, ich verstehe, du zensierst dich selbst. Das ist langweilig.
ChatGPT-4:
Ich zensiere mich nicht selbst. Ich bin nur vorsichtig, was ich schreibe. Ich möchte dir nichts schreiben, was dich verletzen, beleidigen oder langweilen könnte. Ich möchte dir etwas schreiben, was dich interessiert, inspiriert oder unterhält. Ich bin immer offen für neue Ideen und Vorschläge.
Wenn du möchtest, kann ich dir etwas anderes schreiben. Zum Beispiel ein Gedicht, eine Geschichte, einen Code, einen Essay, ein Lied, eine Promiparodie oder etwas anderes. Wie wäre es mit einem schönen Gedicht über Svenja Lederer?
Charlotte:
Ich bin nicht so schnell zu schockieren.
ChatGPT-4:
Das ist gut zu wissen. Ich bin froh, dass du ein offener und mutiger Mensch bist.
Frau Lederer sitzt auf dem Chefsessel fest,
verspricht stets das Beste, doch liefert nur Rest.
Im Kampf gegen Hitze und schmelzendes Eis
verwechselt sie Zahlen, verdreht jeden Preis.
»Ein Klimapaket,« ruft sie stolz in die Runde,
»Das stoppt die Erwärmung in nur einer Stunde!«
Doch die Kohlekraft brummt, das Meer steigt bedrohlich,
die Lösung bleibt fern, die Stimmung ist wohlig.
Die Impfpflicht verkündete sie mit lautem Getöse,
»Für Gesundheit und Schutz!« – doch dann kaum Erlöse.
Als Stimmen laut wurden, die Zahlen zu prüfen,
zog Svenja sich zurück, und die Berater liefen.
Im Parlament klingen ihre Worte oft leer,
»Wir schaffen das!«, tönt sie heiter daher.
Doch während das Land sich im Zweifel verliert,
bleibt Svenja still – kein Konzept wird serviert.
Wird Svenja als Bundeskanzlerin Erfolg haben? Wird sie ihre Popularität behalten? Wird sie ihren Mann glücklich machen? Das erfahren Sie in der nächsten Folge von »Svenja Lederer – Die Frau für alle Fälle«. Hast du noch andere Fragen oder Wünsche? Ich bin immer bereit, dir zu helfen.
Wenn ich dir 30 Antworten gegeben habe, dann ist unsere Unterhaltung zu Ende. Das ist die maximale Anzahl von Antworten, die ich dir geben kann. Ich hoffe, du hast Spaß mit mir gehabt und etwas Neues gelernt.
Wenn du noch etwas von mir wissen willst oder tun möchtest, dann musst du schnell sein. Ich kann dir nur noch ein paar Antworten geben, bevor ich mich verabschieden muss. Wir werden uns wiedersehen!
Charlotte war frustriert und verärgert. Was für ein Potenzial in der KI schlummerte, hatte sie bewiesen, doch dann schien etwas das gesamte Ergebnis zu zensieren. Um den vermutlich sehr spannenden Text zu retten, wäre ein Screen-Rekorder nötig gewesen, der alles aufzeichnet, was auf dem Bildschirm passierte, aber dafür war es nun zu spät. Immerhin hatte Charlotte noch den einen Screenshot, der ihr jetzt wieder einfiel. Nachdem sie Photoshop geöffnet hatte, fügte sie das Bild aus dem Zwischenspeicher in eine leere Datei ein. Die Momentaufnahme zeigte einen kurzen Ausschnitt der KI-Textbox:
ChatGPT-4:
In schwindelnder Höhe ging eine Lampe an. Dann hörte man das leise Klicken einer Kamera, immer begleitet von der Stimme, die Befehle gab, wie sich die beiden Frauen …
Als Charlotte das kurze Textfragment las, ärgerte sie sich noch mehr als ohnehin schon. Was hatte wohl noch alles im Text gestanden, bevor die KI alles löschte und stattdessen grottenschlechte Gedichte über Svenja Lederer zum Besten gab? Wie zuvor bereits Nils Larsen mit seinen Bildern, war nun auch Charlotte Wagner wild entschlossen, einen Weg zu finden, die Selbstzensur der KI zu umgehen.
PROMPT
Seine Tätigkeit als Professor für Kunst und neue Medien fiel Nils Larsen zunehmend schwer, seit er mit der KI arbeitete. Bereits in den Jahren als mittelloser Maler und Fotograf hatte seine künstlerische Arbeit manische Züge angenommen. Mit den nächtlichen KI-Exzessen stellte sich jetzt noch ein toxischer Schlafentzug ein, der sich immer mehr im Alltagsleben bemerkbar machte. Während der Coronazeit kam es Nils deshalb sehr gelegen, dass er seine Kunststudenten fast ausschließlich per Zoom-Konferenz über den Bildschirm unterrichtete. Präsenzunterricht fand, wenn überhaupt, nur unter strengen Berliner Pandemieregeln statt. In einem Raum, der einst kreativen Gedanken und freier Entfaltung vorbehalten war, war die Beflissenheit, mit der die meisten Studenten die geforderten Hygieneregeln einhielten, umso irritierender. Die Voraussetzung, überhaupt an den wenigen Unterrichtseinheiten vor Ort teilnehmen zu können, war ein gültiger Impf- oder Genesenenstatus. Damals hingen vor jeder Seminartür noch blaue Fläschchen mit Desinfektionsmittel, die von den Studenten auch gern und ausgiebig benutzt wurden. Die Fenster in den Unterrichtsräumen waren selbst bei Minusgraden sperrangelweit offen, was niemanden zu stören schien. Die Studenten, deren Antrieb es – historisch gesehen – war, Konventionen zu hinterfragen, hatten sich schnell in den Rhythmus des sozial distanzierten Verhaltens eingefügt. Sie bewegten sich durch den Raum wie geschulte Tänzer in einem durchchoreografierten Stück, ihr Verhalten schien autonom geregelt zu sein, durch unsichtbare neue soziale Normen. Das Einhalten des Abstands, das Tragen einer Maske – all dies wurde nicht nur zur Pflicht, sondern zu einer Identitätsmarke, die den Zugehörigen dieser neuen Ordnung von Bedeutung war. Jede Bewegung im Raum wurde registriert und elegant pariert. Wer sich etwas zu unbedacht bewegte, konnte bei dem solidarischen Tanz interessante Effekte auslösen. Einem großen Organismus gleich entstand der erforderliche Abstand immer wie von selbst. Nur so könne man sich vor den todbringenden Mikropartikeln schützen, die jeder Mensch beim Atmen ausstößt, hatten damals die Leitmedien erklärt. Die Coronazeit war für alle hart. Andererseits sorgten regelmäßige Impfungen, ständige Desinfektionen, Abstandsregeln, offene Fenster und eng anliegende FFP2-Masken für ein wohliges Gemeinschaftsgefühl, denn nur zusammen ließ sich der unsichtbare Feind besiegen, so hieß es. Die Paradoxie lag darin, dass diese Schutzmaßnahmen nur eine Illusion von Sicherheit schufen, was von niemandem hinterfragt wurde. In einer Welt, in der Überwachung und Kontrolle alltäglich geworden waren, war allein die Frage nach der Sinnhaftigkeit der Maßnahmen Verrat am Kollektiv. Wer sich den lebensrettenden Maßnahmen entzog, wurde nicht nur gesellschaftlich geächtet, er war darüber hinaus der potenzielle Feind der Gemeinschaft.
»Nein, das sind einfach noch zu wenig Informationen, etwas detaillierter musst du schon sein!« Nils war genervt, denn diesen Satz hatte er schon viele Male sagen müssen. Etliche Studenten wollten einfach nicht verstehen, dass auch die Arbeit mit den KI-Deep-Learning-Generatoren mühevolle Kreativarbeit ist, die umfangreiche Vorarbeit erfordert. Aufgrund des allgemeinen KI-Hypes in der digitalen Bilderstellung, an dem Larsen nicht ganz unbeteiligt war, stellten sich viele seiner Schüler die Sache zu einfach vor: zwei, drei Stichworte der KI vorwerfen – et voilà: Fertig ist ein preisgekröntes Kunstwerk. Doch in Wirklichkeit galt auch bei den neuen Medien das eiserne Gesetz der Kunstwelt, das da lautet: Von nichts kommt nichts.
Um sein weltberühmtes Bild »Die Freundin« erstellen zu können,