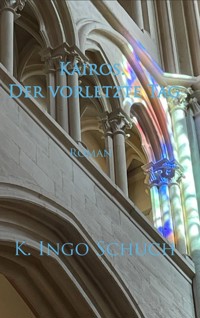
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
Kairos (altgriechisch Καιρός Kairós, deutsch 'das rechte Maß, die gute Gelegenheit') ist ein Begriff für den günstigen Zeitpunkt einer Entscheidung, dessen ungenutztes Verstreichen nachteilig sein könnte. Im Neuen Testament bedeutet Kairos "die festgesetzte Zeit im Plan Gottes", die Zeit, in der Gott handelt. Der uralte Konflikt zwischen Abendland und Morgenland eskaliert. Im Nahen Osten tobt seit Jahren ein erbitterter Krieg, der seine Fortsetzung auch in europäischen Großstädten findet. Auf den jungen Ermittler Julien von der Pariser Polizei wird ein Anschlag verübt. Jemand will offenbar verhindern, dass er einem Komplott auf die Spur kommt. Sein Vorgesetzter Commandant Clement begibt sich auf die Suche nach den Drahtziehern. In einem Wildpark bei Wiesbaden wird eine junge Frau tot aufgefunden. Verena Leipoldt vom LKA Hessen und ihre Kollegen ahnen zunächst nicht, dass es Verbindungen zu Clements Fall gibt. Die Polizisten geraten zwischen die Fronten religiöser Fanatiker und einer Verschwörung rechtsradikaler Kräfte. Selbst Leipoldts alter Bekannter Delegado Teixeira aus São Paulo wird in die Ermittlungen hineingezogen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 516
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
K. Ingo Schuch
Kairos. Der vorletzte Tag
Leipoldt- und Teixeira-Reihe Band III
Von K. Ingo Schuch bisher erschienen:
Tod im Regenwald
Leipoldt-und Teixeira-Reihe Band I
ISBN: 9783818777012
Mortos Vivos. Die lebenden Toten
Leipoldt-und Teixeira-Reihe Band II
ISBN: 978-3-819025-47-1
Von Raben, Orcas und anderen Leuten ISBN: 978-3-819025-48-8
Über den Autor:
K. Ingo Schuch lebt und arbeitet überwiegend im Hoch-taunus, unweit von Frankfurt am Main. Nach mehr als drei-ßig Jahren in der Reisebranche fing er mit dem Schreiben an. Alle Länder, in denen seine Geschichten spielen, hat er selbst bereist.
Über dieses Buch:
Kairos (altgriechisch Καιρός Kairós, deutsch ‚das rechte Maß, die gute Gelegenheit‘) ist ein Begriff für den günsti-gen Zeitpunkt einer Entscheidung, dessen ungenutztes Ver-streichen nachteilig sein könnte. Im Neuen Testament be-deutet Kairos „die festgesetzte Zeit im Plan Gottes“, die Zeit, in der Gott handelt.
Der uralte Konflikt zwischen Abendland und Morgenland eskaliert. Im Nahen Osten tobt seit Jahren ein erbitterter Krieg, der seine Fortsetzung auch in europäischen Groß-städten findet.
Auf den jungen Ermittler Julien von der Pariser Polizei wird ein Anschlag verübt. Jemand will offenbar verhin-dern, dass er einem Komplott auf die Spur kommt. Sein Vorgesetzter Commandant Clement begibt sich auf die Suche nach den Drahtziehern.
In einem Wildpark bei Wiesbaden wird eine junge Frau tot aufgefunden. Verena Leipoldt vom LKA Hessen und ihre Kollegen ahnen zunächst nicht, dass es Verbindungen zu Clements Fall gibt.
Die Polizisten geraten zwischen die Fronten religiöser Fa-natiker und einer Verschwörung rechtsradikaler Kräfte. Selbst Leipoldts alter Bekannter Delegado Teixeira aus São Paulo wird in die Ermittlungen hineingezogen.
K. Ingo Schuch
Kairos.
Der vorletzte Tag
Roman
Texte: © 2025 Copyright by K. Ingo Schuch Umschlaggestaltung: © 2025 Copyright by K. Ingo Schuch
Verlag:
K. Ingo Schuch
www.schuchbuch.info
Herstellung: epubli – ein Service der neopubli GmbH, Köpenicker Straße 154a, 10997 Berlin
Kontaktadresse nach EU-Produktsicherheitsverordnung: [email protected] 1 Clement
1 Clement
2 Leipoldt
3 Der Mahdi
4 Alte Bekannte
5 Nykøbing
6 Barcelona
7 Paris
8 Wiesbaden
9 Der Tote aus dem botanischen Garten
10 Das Flugzeug
11 Eine Zusammenkunft
12 Ermittlungen
13 Lyon
14 Entscheidungen
15 Kairos. Der letzte Tag
Carles, li Reis, nostre emperere magnes, Set anz tuz pleins ad estet en Espaigne: Tresqu’en la mer cunquist la terre altaigne. N’i ad castel ki devant lui remaignet;
Murs ne citet n’i est remés à fraindre
Fors Saraguce, k’est en une muntaigne. Li reis Marsilies la tient, ki Deu nen aimet; Mahummet sert e Apollin reclaimet:
Ne s’poet guarder que mals ne li ataignet.
Unser großer Kaiser, König Karl,
sieben volle Jahr’ in Spanien er blieb:
Bis zur Küste gewann er das hohe Land. Seinem Ansturm hielt keine Festung stand, weder Stadt noch Mauern blieben verschont außer Saragossa, hoch auf dem Berg.
Marsilius hält sie, der Gott nicht liebt, der Mohammed dient und anfleht Apoll; doch Unheil trifft ihn ohne Schutz und Schirm
Aus dem Rolandslied, la Chanson de Roland
7
„Ich bin nicht Charlie, ich bin Ahmed, der tote Polizist. Charlie machte sich über meinen Glauben und meine Kul-tur lustig, und ich starb bei der Verteidigung seines Rechts, dies zu tun.“
Dyab Abou Jahjah
8
Es war so dunkel wie im Darm eines Wals, der kurz über dem Boden des Marianengrabens nach Tintenfischen grün-delte. Wenn er die Augen zukneifen und sich ganz viel Mühe geben würde, könnte er winzige Punkte erkennen, die Lichtjahre entfernt irgendwo am Ende des schwarzen Universums pulsierten wie ein Stroboskop. Wahrscheinlich die Scheinwerfer der Fischerboote, die unendlich weit oben auf der Meeresoberfläche in den Wellen schaukelten. Das Flackern und Schaukeln bereitete ihm Übelkeit. Er musste aufstoßen, was einen intensiven Geschmack nach Galle und Blut an seinem Gaumen auslöste. Mit Verzögerung re-gistrierten seine Rezeptoren den Schmerz, sein Vagusnerv quittierte die Reizüberflutung mit einer Erweiterung der Gefäße. Dies führte zu einem Blutdruckabfall. Julien wurde wieder bewusstlos.
9
Eva Green sprach mit einem Asiaten, der in seinem blü-tenweißen Arztkittel aussah wie ein Darsteller in einer Krankenhausserie. Julien konnte sich nicht satt sehen an dieser wunderschönen Frau. Mit steigender Faszination re-gistrierte er die feinen Härchen auf ihrer Wange, die das einfallende Sonnenlicht reflektieren. Er liebte bei blonden Frauen diese Härchen, die sich bei Erregung aufstellten. Doch langsam veränderte sich seine Stimmung. Seine Be-geisterung verschwand und wandelte sich in Ärger. Irgend-jemand hatte hier was vertauscht.
Eva Green war nicht blond.
Die Frau drehte sich zu ihm um und bemerkte, dass er wach war. Sie hatte überhaupt keine Ähnlichkeit mit Eva Green. Eigentlich war sie sogar nur durchschnittlich attrak-tiv.
„Monsieur Bossis, wir können Ihre Verletzungen nicht wirklich gut versorgen, aber in der Salpêtrière sind sie vor-bereitet.“
„…chhh?“
„Sie sind im Krankenhaus in Meaux. Der Rettungswa-gen hat Sie erst mal hierher gebracht, aber sie werden jetzt verlegt, der Krankenwagen kommt jede Minute. Wir haben Ihre Vorgesetzten informiert.“
„…pffffsss?“ Julian wollte sprechen, aber etwas ver-sperrte den Worten den Weg nach draußen.
„Versuchen Sie nicht zu reden. Sie haben sicher starke Schmerzen. Dr. Nguyen, können wir die Dosis erhöhen?“
Der Angesprochene nahm einen Kugelschreiber aus sei-ner Brusttasche und leuchtete Julien damit durchs Auge
10
direkt ins Gehirn. „Der Patient hat bereits fünfzig Milli-gramm Morphinhydrochlorid erhalten. Wenn ich die Dosis erhöhe, wird er morgen als Blumenkohl aufwachen.“
Die falsche Eva Green tätschelte ihm den Arm und rang sich ein mitfühlendes Lächeln ab.
„Nun, da kann man nichts machen. Das wird schon wie-der, nicht wahr?“
11
Es war ein anderes Bett, sehr hart. Julien fror erbärm-lich; er konnte nicht aufhören zu zittern. Seine Eva Green war nicht zu sehen, nicht einmal eine leidliche Sofia Boutella, aber dafür gab es hier viele Leute in hellgrünen OPKitteln. Jemand trat nahe an ihn heran. Durch den Mundschutz hindurch konnte er den sauren Atem des Man-nes riechen. Er hatte kürzlich Kaffee getrunken.
„Ich bin Oberarzt Regarde. Wir beginnen gleich mit der Operation. Der Anästhesist hat Ihnen einen schönen Cock-tail gemixt, gleich werden Sie schlafen wie ein Baby. Zum Ablauf: Vor dem Eingriff werden Schienen mit Markie-rungspunkten an Ihrem Schädel fixiert und von Kameras fokussiert. Sie liefern uns räumliche Daten vom realen Kopf, die dann passgenau von seinem virtuellen Abbild überlagert werden. So sehen wir auf dem Monitor trotz der ganzen Zerstörung, in welchem Abschnitt des Kopfes wir gerade arbeiten. Ich kann dann, während ich etwa einen ab-gesägten Teil Ihres Unterkiefers in eine neue Position bringe, am Computermodell mitverfolgen, ob dabei das Schlucken, die Speichelbildung oder die Nerven der Zunge gestört werden und ob die Zähne aufeinander passen. Mit etwas Glück werden wir Ihnen ein neues Gesicht modellie-ren, das noch besser aussieht wie das alte. Ich zeige Ihnen dann in den kommenden Tagen in der virtuellen Simula-tion, wie die Gesichtskorrektur wirken wird. Die distale Radiusfraktur werden wir mit einer schönen Platte stabili-sieren, das machen wir gleich mit.“
Merkwürdigerweise hatte Julien keine Angst. Dieser Regarde war eine wahre Frohnatur und was er da vom
12
Absägen und Platten und über gestörte Nerven zu sagen hatte, bezog Julien nicht auf sich. Aber warum lag er ei-gentlich hier in diesem Metallbett in dem bitterkalten Raum, der ihn an ein Schlachthaus erinnerte? Und warum war hier alles so angestrahlt wie eine Großbaustelle bei Nacht? Noch bevor er den Gedanken weiterführen konnte, machte jemand das Licht gründlich wieder aus.
Julien wurde von einem Rascheln geweckt, das er lange Zeit nicht mehr gehört habe. Aber das Geräusch war weit weg. Er musste mit den Armen rudern, dann würde er durch diesen Ozean voll Watte an die Oberfläche kommen, ans Licht! Mit einer unmenschlichen Willensanstrengung ge-lang es ihm, die Augen aufzuschlagen und er drehte den Kopf in die Richtung des Geräusches.
„Maman. Wie kommst du denn hier her?“ wollte er fra-gen, aber er konnte seine Lippen nicht bewegen.
„Ach Julien, mein Liebling. Was ist nur mit dir passiert? Sie sagen, du hast die OP gut überstanden. Der Sport und dass du nie geraucht hast. Schau mal, ich habe dir was Gu-tes mitgebracht.“
Maman nestelte eine Flasche aus einer Stofftasche und stellte sie auf den Nachttisch neben die fadenscheinige OPHaube. Sie hatte, seit er denken konnte, damals, als Ju-lien noch so etwas wie einen Gedanken formulieren konnte, immer eine dieser Reformhaustaschen dabei und benutzte sie, um kleinere Einkäufe darin nach Hause zu tra-gen oder wie heute, eine Literflasche selbst gekelterten Ap-felmost vom letzten Herbst darin zu befördern. Selten hatte
13
er seine Mutter mit einer Handtasche gesehen. Nur zu den seltenen Gelegenheiten, wenn sie mit seinem Vater mal ausgegangen war. Dann hatte sie sich immer so eine kleine Handtasche aus KrokodillederImitat unter den Arm ge-klemmt und dabei um sich geschaut, als sei sie die De-neuve.
„Es war kein Apfeljahr, wir hatten keine zweihundert Liter. Und langsam wird es mir auch zu viel mit dem Bü-cken, weißt du. Aber er wird dir schmecken. Wenn, wenn dieser Schlauch da weg ist und die ganzen Verbände…“
Sie fing an zu weinen und legte ihm zaghaft die Hand auf den bandagierten Arm.
Julien sah an ihr vorbei an die cremefarben gestrichene Wand. Unterhalb des geschmacklosen Stilllebens war ein Fleck, der aussah wie die Umrisse von Afrika, nur dass Mauretanien, Marokko und Algerien merkwürdig zusam-mengequetscht waren. Und Madagaskar lag auf der fal-schen Seite. Seine Mutter zog eines ihrer unvermeidlichen Papiertaschentücher hervor, die man in der Apotheke als kostenlose Dreingabe bekam und schnäuzte sich.
„Ach was weine ich hier rum wie eine dumme alte Henne. Aber sieh dich nur an! Ganz eingewickelt haben sie meinen Julien, wie eine Mumie. Kannst wohl auch gar nicht sprechen, was mein Liebling? Und der Arm ist auch noch eingegipst. Ach, wenn ich nur etwas für dich tun könnte. Ich kann ja auch gar nicht lange bleiben. Manon wartet unten. Sie war so lieb, mich herzufahren. Du weißt ja, seit der Sache damals kann ich ihn nicht lange allein las-sen.“
14
Julien versuchte, das Gesagte zu sortieren. Seine Eltern wohnten noch immer in ihrem kleinen Fachwerkhaus auf dem Land bei Senlis. Manon war eine Nachbarin, die manchmal einige Erledigungen für seine Mutter machte. Die ‚Sache‘ war, dass sein Vater seit einer Schießerei mit einem Drogendealer vor siebzehn Jahren im Rollstuhl saß und seitdem das Haus kaum mehr verlassen hatte. Von sei-ner Invalidenrente konnten sie mehr schlecht als recht le-ben.
„Und übrigens, Clement hat mit Papa telefoniert. Er wird nach dir sehen, sobald er kann.“
„…“
„Mach dir keine Sorgen, Julien. Die kriegen dich schon wieder hin. Schau mal, ich habe mir vorne von der Anmel-dung etwas Papier und diesen Kugelschreiber ausgeliehen. Du schreibst auf, was du brauchst und ich komme später in der Woche wieder und besorge dir die Sachen.“ Sie warf einen Blick auf die kleine goldene Uhr, die Papa ihr zur Silberhochzeit geschenkt hatte. „Jetzt muss ich aber wirk-lich los“, log sie.
In der Tür winkte sie ihrem Sohn unbeholfen zu und schnäuzte sich bei Hinausgehen noch einmal kräftig in ihr Papiertaschentuch. Im Krankenzimmer wirkte noch für eine Weile der für sie so typische Geruch nach Spülmittel, frischem Brot und Lavendel, den er als Kind geliebt hatte und später kaum noch ertragen konnte.
15
Als Julien das nächste Mal aus seinem Dämmerschlaf erwachte, war es draußen vor dem Fenster noch hell. Es musste um die Mittagszeit sein, denn vorhin hatte ihm eine Schwester mit tätowierten Armen und dickem Hintern ei-nen undefinierbaren Schleim in einer Art Trinkflasche ge-bracht, den er mit größter Konzentration in homöopathi-schen Dosen herunterwürgte. Er schmeckte wie ein Pro-teinshake aus Mehlwürmern.
„Hast du eine Ahnung, wer das andere Auto gefahren hat?“
Julien schielte zu dem Schreibblock auf seinem Nacht-tisch. Sein Besucher registrierte den Blick und reichte ihm das Papier. „Hier. Reden ist wohl nicht mit der Fresse. Siehst aus wie die verkackte Mumie.“
Er kritzelte hastig: Die Scheißkerle wollten mich um-bringen!
„Das kann man nicht wissen, vielleicht war es auch nur ein Installateur, der auf dem Weg zu seinem nächsten Auf-trag war, schon verspätet, besser mal aufs Gas getreten und dann war da auf einmal dieser Kleinwagen vor ihm und un-ser Handwerker konnte so schnell das Bremspedal nicht finden. Und dann ist er eben einfach weitergefahren, du weißt ja, der Auftrag. Und außerdem hatte man vorhin schon einen Kurzen oder zwei und da ist es eben besser, wenn… Merde, das hätte ins Auge gehen können!“
Aus dem Handgelenk hatte Julien den Block nach ihm geworfen. Clement hob das Papier vom Boden auf und legte es ihm auf die Bettdecke. „Okay, im Ernst: Hast du
16
eine Ahnung, wer die Typen waren, Julien? Ich muss das wissen.“
Du musst das wissen? Sieh mich an. Die haben mir das Gesicht zertrümmert, Mann! Ich konnte den Wagen nicht sehen. Hatte keine Chance. Ich finde die, das schwöre ich dir!!!
Clement versuchte, Juliens krakelige Handschrift zu entziffern, die im letzten Satz auch noch sehr klein wurde, weil der Platz auf der Seite nicht ausreichte. Dann sah er ihn spöttisch an.
„Das wird aber noch eine ganze Weile dauern, Kleiner. Ich habe mit der algerischen Assistenzärztin geflirtet. Wenn’s gut läuft, drei bis vier Wochen, bis sie dich hier rauslassen. Und das nur, wenn du gutes Heilfleisch hast. So lange will ich nicht warten. Das war ein Mordanschlag auf einen Polizeibeamten und selbst, wenn sie allen einen Ge-fallen getan haben, die deine dämliche Visage nicht mehr sehen konnten, werden wir diese Typen dafür drankriegen. Woran hast du gearbeitet? Was hast du da bei Meaux zu suchen gehabt?“
Julien starrte trotzig zur Zimmerdecke. Dann griff er nach dem Stift und kritzelte einen Namen hin: Prunis.
Clement schlug mit der flachen Hand auf seine Stuhl-lehne. „Prunis? Das wird immer besser! Und warum hast du mir nichts davon gesagt?“
Julien fixierte wieder die Zimmerdecke und schwieg.
Der Commandant bückte sich und legte ihm eine Pa-piertüte auf den Bauch. „Hier. Eine Zahnbürste. Kannst du dir für später aufheben. Und Boxershorts.“
17
Er deutete auf die Netzhose, die der Jüngere seit der OP noch immer trug und die unter der Bettdecke hervorlugte.
„Wie ich sehe, kannst du zumindest die Unterhosen ge-brauchen. Und ich frage die Schwestern, ob sie dir einen Strohhalm bringen können“, fügte er mit einem Blick auf die Saftflasche hinzu. „Aber erst musst du mir erklären, wer dich zu Prunis geschickt hat.“
Julien fühlte sich wie zerkaut und ausgekotzt. Clement ging ihm auf die Nerven. Er wollte seine Ruhe haben. Schließlich griff er nach dem Block und kritzelte einen wei-teren Namen und eine Adresse darauf. Dann setzte er noch ein verschwinde jetzt, muss schlafen darunter und schloss die Augen.
18
Durch die von vereinzelten Schneeflocken gesprenkelten Fensterscheiben hielt Clement Ausschau, bis er die richtige Stelle entdeckt hatte. Er stellte den Jeep am Straßenrand ab, machte den Warnblinker an und stieg aus. Es war kalt. Wahrscheinlich würde der Graupelschauer sich bald zu Schnee verdichten. Aus der Jackentasche kramte er nach einem Honigbonbon und steckte sich eines in den Mund. Er hatte vor gut vier Jahren aufgehört zu rauchen, aber manchmal musste er noch immer auf Ersatzhandlungen zu-rückgreifen, wie seine Psychotherapeutin sagte. Er hatte ihre Sitzungen erst kürzlich abgebrochen.
Neben der Fahrbahn markierten gelbe Absperrbänder die Stelle, an der Juliens Peugeot die Leitplanke durchbro-chen hatte, einige Meter die Böschung hinuntergerutscht und auf der Seite liegend in dem Bach gelandet war, der nach dem Jahrhunderthochwasser vom Dezember jetzt zum Glück wieder nur etwa einen halben Meter tief war. Wenn du betrunken hinfällst und dir den Kopf anstößt, kannst du schon in fünf Zentimeter Wasser ertrinken, hatte Clement mal gelesen. Das Fahrzeug hatte man längst abgeschleppt. Er ließ den Blick über die Szenerie schweifen. Die zwei-spurige Route Nationale, rechts und links Felder, ab und zu ein paar vereinzelte Bäume. In einiger Entfernung konnte man den spätgotischen Turm der Kathedrale St. Étienne er-kennen. Auf den Feldern lag Raureif. Ein paar Krähen flat-terten über die Felder und verbreiteten schlechte Stimmung mit ihrem Gekrächze.
Der Lieferwagen war neben Julien gefahren und hatte das Polizeifahrzeug von der Straße gedrängt. Der oder die
19
Fahrer waren geflüchtet. Auf der einspurigen Straße, die etwa hundert Meter weiter vorne in die N3 mündete, war ein Versicherungsvertreter mit seinem Audi unterwegs. Der Mann hatte den ‚Unfall‘ aus einiger Entfernung mit ange-sehen und den Notruf verständigt. Clement bückte sich und hob einen geriffelten Glassplitter auf, der von einem Blink-licht des Kleinlasters stammen konnte. Man hatte weiße Lackspuren an dem zertrümmerten Peugeot gefunden. Sie hatten die Fahndung auf alle weißen Lieferwagen einge-schränkt, aber das müssten im Großraum Paris immer noch Tausende sein und vielleicht befand sich das Fahrzeug in-zwischen bereits auf dem Weg nach Rumänien oder Finn-land. Clement hoffte, dass das Labor wenigstens die Marke bestimmen konnte, sonst wäre die Suche von vornherein aussichtslos. Der Vertreter hatte sich weder das Modell noch irgendwelche Beschriftungen auf dem Tatfahrzeug gemerkt. Wahrscheinlich war alles zu schnell gegangen.
Clement erklomm fluchend die Böschung, weil das feuchte Gras seine Schuhe und die Hosenbeine einnässte, dann setzte er seine Fahrt fort. Inzwischen schneite es kräf-tiger. Der Jeep hatte Ganzjahresreifen und muckte nicht. Kurz vor Meaux bog er rechts in eine unbefestigte Seiten-straße ab und hielt schließlich bei einem Autohändler, der offenbar auf ältere Modelle von teuren Marken spezialisiert war. Ein paar struppige Hunde begrüßten seine Ankunft mit heißerem Bellen. Er lugte durch die Seitenscheibe einer E-Klasse in den mit Wurzelholz verkleideten Innenraum. Baujahr 2005, nur hundertneunzigtausend Kilometer auf dem Tacho. Unter zwanzigtausend Euro. Bevor der
20
schleimige Verkäufer sich auf den Weg zu ihm machen konnte, winkte er abwehrend und ging zügig an dem Ver-kaufsgebäude vorbei auf das Wohngebäude zu, das dem äu-ßeren Anschein nach aus dem neunzehnten Jahrhundert stammte. Neben der Eingangstür war ein Blechschild an-gebracht, dessen Text ihm ein Stirnrunzeln entlockte:
Lieber Einbrecher,
den Schmuck findest du in der Küchenschublade links neben dem Herd.
Mein Geld liegt unter der linken Matratze im Schlafzimmer.
Die Wärme in deinem linken Schuh stammt von meinem Schäferhund, der dir gerade ans Bein pisst. Und der Typ mit der Schrotflinte, der rechts hinter dir steht, bin ich.
Er betätigte den Türklopfer aus Messing und wartete. Nach einer Weile waren im Haus schwere Schritte zu hö-ren. Die Eichentür öffnete sich.
„Salut Colonel.“
„Salut Clement. Komm rein. Ich habe dich erwartet.“
Er folgte dem Hausherrn in die Wohnküche und nahm auf einem der rustikalen, aber gemütlichen Stühle Platz und prüfte kurz, ob sich seit seinem letzten Besuch etwas ver-ändert hatte. Die Wände halbhoch mit Profilholzlatten ver-kleidet, der aus massiven Eichenbohlen gezimmerte Tisch, an den Haken über dem Herd die gusseisernen Töpfe und Pfannen. Zwei einzelne gerahmte Fotos an der Wand. Eine
21
dunkelhaarige Frau mit melancholischem Blick. Er wusste natürlich, dass es Prunis’ verstorbene Frau zeigte. Daneben die ganze Familie. Vater, Mutter, ein Junge, vielleicht zwölf Jahre alt, er hatte die gleichen dunklen Augen. Und ein et-was älteres Mädchen, ein Abbild der Mutter. Neben dem Lichtschalter an der Tür ein aktueller Kalender mit Blu-menmotiv, ein Werbegeschenk des lokalen Supermarktes. In dem überheizten Raum hing ein Geruch nach alten Män-nerfürzen, arabischen Gewürzen und Bohnerwachs.
Prunis stellte einen Krug mit Wasser und zwei Gläser auf den Tisch, dann langte er in das antike Weichholzbuffet und holte eine Flasche mit einer trüben Flüssigkeit heraus. Er goss ihnen beiden reichlich ein. „Auf die Toten aller Kriege.“
„Mögen sie in Frieden ruhen.“
Der Alte leerte sein Glas in einem Zug, dann schnalzte er mit der Zunge und ließ sich in seinen Lieblingsstuhl fal-len, der als einziger mit einem zerschlissenen Sitzkissen ausgestattet war. „So. Dem Jungen haben sie ja übel mitge-spielt. Wie geht es ihm?“
Natürlich wusste Prunis von dem Unfall.
„Es wird sicher hart für ihn, wenn die Verbände abkom-men und er zum ersten Mal sein Gesicht sieht. Die ASäule hat ihm unterhalb der Stirn alles zertrümmert, nur sein sprichwörtlicher Dickschädel hat ihn gerettet. Jochbein, Wangenknochen, Kiefer, alles kaputt. Ein Arm ist auch ge-brochen. Zum Glück keine inneren Verletzungen.“ Clement machte eine kleine Pause. „Er war auf dem Weg zu Ihnen. Was gab es denn zu besprechen?“
22
Prunis hob seine buschigen Augenbrauen. „Er hat mich vorgestern angerufen. Aber was er von mir wollte? Am Te-lefon wollte er nichts rauslassen, hat nur gefragt, ob ich eine halbe Stunde Zeit hätte. Und Zeit habe ich ja noch ge-nug. Ein Auto wollte er wohl kaum kaufen.“
„Schöne EKlasse draußen. Die silberne.“
„Nicht wahr? Die wussten eben noch, wie man Autos baut. Heutzutage ist alles nur noch Plastik. Du fährst deinen Cherokee noch, wie ich sehe?“
Er nickte. „Nichts dran. Er schluckt zwölf, vierzehn Li-ter, aber technisch alles tiptop. Ich warte, bis sie das Fahr-verbot umsetzen, dann sehe ich weiter. Wie läuft das Ge-schäft?“
„Ich kann nicht klagen. Meine Pension würde reichen, ich habe keine größeren finanziellen Verpflichtungen. Aber der kleine Laden zwingt mich, jeden Tag aufs Neue meinen faltigen Arsch aus dem Bett zu heben und wenn es auch nur darum geht, meinem Angestellten das Leben schwer zu ma-chen. Die meisten Autos gehen nach Nordafrika, da sterben die Menschen durch Bomben und nicht durch Feinstaub oder Stickoxide.“
„Colonel. Ich vermute, Lieutenant Bossis wollte Sie gestern besuchen, um mit Ihnen über den Mord an Richter Cocteau zu reden. Aber bevor er dazu kommt, rammt je-mand sein Auto und nimmt in Kauf, dass er dabei ums Le-ben kommt. Erklären Sie mir das?“
Der ExPolizist goss sich einen weiteren Schluck ein, ohne seinen Gast zu fragen, und hob warnend die Hand. „Clement, ich bitte dich, die Finger von der Sache lassen.
23
Wer nicht davor zurückschreckt, einen Richter zu beseiti-gen, wird sich auch nicht lange mit einem Commandant der Kriminalpolizei aufhalten. Und was viel schlimmer ist: Die werden herausfinden, dass ich gequatscht habe und dann kann ich mich gleich da vorne an die Hauptstraße stellen und warten, dass sie mich holen.“
„Wer sind die?“
Prunis erhob sich ächzend und trat ans Fenster. Durch die vergilbten Gardinen spähte er hinaus in den Hof. Es hatte bereits wieder aufgehört zu schneien, der Boden war maximal zwei Zentimeter bedeckt. Er drehte sich zu Clement um, ohne auf die Frage einzugehen.
„Ich werde im Oktober achtundsiebzig. Zarah ist jetzt schon seit fünf Jahren tot. Phillipe lebt unten im Départe-ment AlpesMaritimes. Biot. Wohl irgend so ein Nest. Er hat mir mal eine Postkarte geschickt, da war vorne das Mu-seum Fernand Léger abgebildet. Interessanter Künstler. Wusstest du, dass er im ersten Weltkrieg gegen die Deut-schen gekämpft hat? Seit Zahras Begräbnis habe ich Phil-lipe nicht mehr gesehen. Er verdient jetzt das große Geld mit Computersoftware.“
Prunis setzt sich wieder auf seinen Stuhl. „Und du?“ Er sah Clement prüfend an. „Gehst auch auf die fünfzig zu, nicht wahr? Himmel, wie die Zeit vergeht. Wie geht es mit dir und Irène?“
„Wir haben uns getrennt. Zu Ostern werden es zwei Jahre. Sie ist zurück nach Lyon gegangen, sie hat dort eine Stelle an einer Privatschule angenommen.“
24
„Das tut mir leid, aber Irène und du, ihr habt niemals zueinander gepasst. Sie ist eine ehrgeizige Frau. Hielt sich immer für was Besseres. Wie kommst du damit zurecht?“
Clement hätte jetzt gerne noch einen weiteren Pastis, aber im Dienst trank er eigentlich nichts. „Ist schon okay“, presste er zwischen den Zähnen hervor.
Der alte Mann kratzte sich ausgiebig am Hinterkopf, auf dem ein hartnäckiger Rest Haare ein einsames Dasein fris-tete, dann legte er beide Hände auf den Tisch. Clement konnte sehen, dass die unversehrte Hand schwielig war, die Fingernägel eingerissen. Die Hand eines Mannes, der es zeitlebens gewohnt war, anzupacken. Die Prothese war un-ter einem schwarzen Lederhandschuh verborgen.
„Richter Cocteau hatte eine schwerwiegende Charakter-schwäche. Er glaubte ernsthaft daran, dass seine Standhaf-tigkeit und Integrität etwas an den Verhältnissen ändern würden. Ein hoffnungsloser Idealist. Aber diesmal hat er sich mit den falschen Leuten angelegt. Ich kannte schon seinen Vater. Das war auch so ein sturer Hund. War im Al-gerienkrieg mein Bataillonskommandeur. Hat bis zuletzt daran geglaubt, er könne die Zeit aufhalten. Cocteau hat im letzten Herbst ein Urteil aufgehoben. Saadi, der Medienun-ternehmer, war in erster Instanz freigesprochen worden. Die Anklage lautete auf Bestechung, Erpressung, Nötigung und Bildung einer kriminellen Vereinigung. Das war über-fällig, wenn man glaubt, welche Rolle Saadi angeblich be-reits bei dem Attentat auf den ehemaligen Bürgermeister Delanoë gespielt hat. Auf jeden Fall brachte die Staatsan-waltschaft den Fall vor die Cour de cassation und Cocteau
25
als Vorsitzender der zuständigen Strafkammer kassierte das Urteil aufgrund eines Verfahrensfehlers. Damit kann Saadi erneut angeklagt werden und der Generalstaatsanwalt wird nicht zweimal denselben Fehler begehen. Diesmal wird er hoffentlich dafür sorgen, dass der Libyer für einige Jahre ins Zuchthaus kommt.“
„Und Sie meinen, Saadi hat deswegen Cocteau beseiti-gen lassen? Er wurde mit einem Genickschuss hingerichtet, das waren Profis. Wem wäre zuzutrauen, einen Richter zu ermorden und sich der vollen Wucht der Justiz auszuset-zen? Es muss doch jedem klar sein, dass der Generalstaats-anwalt alle Hebel in Bewegung setzen wird, um den oder die Täter medienwirksam grillen zu können. Ich meine, wir sind doch schließlich nicht im Sizilien der Neunziger.“
„Das wirst du selbst herausfinden müssen. Da du es so-wieso nicht bleiben lassen kannst: Sprich mit dem Hutten.“
„Simeon der Hutte?“
„Ja. Aber sei vorsichtig. Er ist so verrückt wie eine Scheißhausratte, nur gefährlicher.“
Auf der Rückfahrt nach Paris dachte er darüber nach, was Prunis über Irène und ihn gesagt hatte. Jedes Mal, wenn er in ihre gemeinsame Wohnung zurückkehrte, ver-fluchte er seine Unfähigkeit, sein Leben endlich neu zu ord-nen. Wie oft schon hatte er sich vorgenommen, die leeren Stellen an den Wänden zu überstreichen, die Irènes selbst gemalten Bilder hinterlassen hatten, aber der richtige Zeit-punkt war bislang nicht gekommen. Überhaupt hatte es nie den richtigen Zeitpunkt für irgendetwas anderes gegeben
26
als Selbstmitleid. Er wusste, dass Irène in Lyon mit einem älteren Mann zusammenlebte. Anwalt. Geschieden, eine halbwüchsige Tochter, die bei ihrer Mutter lebte. Einer die-ser Typen, die immer alles mitnehmen. Selbstoptimierer. Tauchschein, Segelschein, Jagdschein. Dabei sah er aus wie Michel Piccoli in seinen mittleren Jahren. Er wollte sich einreden, dass die fröhliche, aufgeschlossene, empha-tische Irène bereits vor Jahren aufgehört hatte zu existieren und dass der Rechtsverdreher nun die Frau mit den harten Falten um die Mundwinkel gewonnen hatte, die vor lauter Angst, sie könne wie ihre Mutter ebenfalls viel zu früh an Demenz erkranken, sich permanent auf merkwürdiges Ver-halten überprüfte. Was dazu führte, dass sie sich permanent merkwürdig verhielt, was ihn schier in den Wahnsinn trieb. Getrieben hatte, jetzt musste Michel Piccoli damit klar-kommen.
Clement versuchte sich auf den aktuellen Fall zu kon-zentrieren. Prunis. Der ehemalige Colonel war aus dem Mi-litärdienst zur Polizei gewechselt und so etwas wie eine Le-gende in der Police judiciaire geworden. Durch seine aktive Zeit in Algerien und wahrscheinlich auch durch den Um-stand, dass er dort seine Zarah kennen und lieben gelernt hatte, pflegte Prunis während seiner gesamten Dienstzeit und auch danach engen Kontakt zu den Migranten aus dem Maghreb. Sein ehemaliger Ausbilder war bereits seit fast fünfzehn Jahren pensioniert, aber der Präfekt persönlich zog ihn während der immer wieder aufflackernden Unru-hen zu Rate, wenn die angespannte Situation in den
27
Banlieues wieder einmal in gewaltsamen Auseinanderset-zungen eskalierte.
Auf dem Quai de la Rapée hatte es einen Unfall gege-ben. Clement betätigte ungeduldig die Hupe und drängelte sich an der Ambulanz vorbei. In Höhe der Rue des Rosiers hielt er Ausschau nach einem Parkplatz. Er stellte den Wa-gen vor einer Boutique ab, schlug den Kragen seiner Jacke hoch, zog den Schal fester und machte sich auf den Weg zur Rue Pavée. Das Schneetreiben hatte nachgelassen. Aus den Schaufenstern schrien ihn knallrote und gelbe SALE-Schilder an. Früher hatte man es Sommer und Winter-schlussverkauf genannt, heutzutage gab es gefühlt alle paar Wochen eine Sonderpreisaktion. Black Friday, Black Week, Cyber Monday. An der Synagoge vorbei, das Haus vor dem Restaurant. So hatte Prunis den Weg beschrieben. Er sah sich um. Er stand vor einem schmiedeeisernen Tor, rechts und links waren Kameras an den Hauswänden ange-bracht. Es gab eine Klingel. Nach einer Weile meldete sich eine blecherne Stimme. „Was wollen Sie?“
„Commandant Clement. Ich würde gerne mit Simeon sprechen.“
„Warten Sie.“
Simeon der Hutte war ein Pariser Phänomen. Man mun-kelte, dass er im Marais vom Wohnungseinbruch bis zum Handel mit synthetischen Drogen so ziemlich alles organi-sierte, was illegal war. Angeblich war er eigentlich ein kop-tischer Christ aus Ägypten und kontrollierte die Araber, was ihn zu einem unverzichtbaren Gegengewicht zu den Russen und Armeniern machte.
28
Endlose Zeit später summte der Türöffner und er konnte durch das Tor in einen Hof treten. Ein junger Mann mit breiten Schultern und militärisch kurz geschorenen Haaren trat auf ihn zu. „Moment, Bulle! Deine Waffe.“
„Was willst du mit meiner Waffe? Ich bin dienstlich hier. Was soll das?“
„Niemand geht mit einer Waffe zu Simeon. Wenn du ihn sprechen willst, gib mir das Ding, sonst.…“ Der Kerl zeigte auf das Tor.
„Na was soll’s. Hier.“ Clement zog mit der Linken vor-sichtig seine Pistole aus dem Halfter und reichte sie dem Leibwächter.
„Folge mir.“
Es ging durch einen düsteren Hausflur in den zweiten Stock. Ein weiterer Gorilla versperrte den Eingang zur Wohnung. Er sah aus wie Ivan Drago aus dem RockyFilm.
„Sie gestatten. Arme hoch.“
Clement fragte spöttisch: „Meinst du, ich habe noch eine Knarre im Arsch versteckt?“ und hob dennoch die Arme.
Drago tastete ihn geübt ab, einen urologischen Kontroll-griff inklusive, und trat dann zur Seite. Er nickte. „Gehen Sie rein. Die Tür geradeaus.“
Sie befanden sich in einer geschmacklos eingerichteten Altbauetage. Von dem Flur gingen etliche deckenhohe Flü-geltüren ab. An den Wänden befanden sich zwischen schwülstigen orientalischen Szenen einige hochwertige Drucke historischer NachtclubSzenen der Pariser Bohème. De ToulouseLautrec, Steinlen und Picasso. Clement
29
klopfte an den Türrahmen und betrat den Raum. Er hatte von Simeon, dem Hutten gehört, ihn aber bislang noch nie gesehen. Der Anblick traf ihn mit voller Wucht.
Der abgedunkelte Raum wurde fast vollständig von ei-nem überdimensionierten Bett in Anspruch genommen. Massives Holzgestell. Blutroter Bezug. Dutzende Kissen mit orientalischen Mustern, überwiegend in Gold. Darauf lagerte ein Mensch, der so unfassbar dick war, dass der Kommissar im selben Moment begriff, dass der Mann die-ses Apartment niemals wieder verlassen würde. Zumindest nicht in einem Stück. Unter dem voluminösen Kopf waber-ten unzählige Schichten Fett herab, die unter der Bettdecke zu einem konturlosen Brei verflossen. Das Gesicht bestand aus einer teigigen Masse, auf der zwei Knopfaugen schwammen wie in einer Suppe. Clement fühlte sich an den alten OrangUtan erinnert, den Irène und er vor einigen Jah-ren im La Vallee des Singes bewundert hatten.
Es dauerte eine Weile, bis Simeon ihn ansprach. Er musste notgedrungen näher herantreten, um den Fettklops verstehen zu können, der eine ekelerregende Mischung aus Knoblauch, ranziger Butter und teurem Rasierwasser ver-strömte. „Was willst du, Polizist?“
„Hör zu, ich habe keinerlei Ehrgeiz, Einblick in deine Geschäfte zu bekommen, ich habe generell nichts mit dir zu schaffen. Ich will nur herausfinden, wer Cocteau, den Richter ermordet hat. Und ich will wissen, wem mein Part-ner auf die Füße getreten ist. Er liegt im Krankenhaus, weil ihn irgendwelche Idioten über den Haufen gefahren ha-ben.“
30
„Bin ich das Orakel von Paris? Warum sollte ich der Po-lizei helfen, ihre Arbeit zu machen?“
Simeons Stimme klang, als würde jemand mit einer Kelle die Reste aus einem Schmortopf kratzen.
„Weil jemand denken könnte, dass Saadi etwas mit der Sache zu tun hat. Und ich weiß, dass bei den Arabern keiner einen Furz lässt, ohne dass du es mitbekommst.“
Die Masse geriet in Wallung. Offenbar amüsierte sich der Hutte.
„Du gefällst mir, Commandant. Saadi ist ein Schakal. Du aber suchst einen Skorpion. Der Libyer hat nicht genü-gend Mumm, einen Richter beseitigen zu lassen. Außerdem wird es nicht zu einer Verurteilung kommen.“
„Warum? Wen hat Saadi bestochen?“
„Wer bezahlt dein Gehalt, Commandant?“
„Du auf jeden Fall nicht, Simeon.“
„Bist du dir da so sicher? Wer kann schon sagen, wer auf wessen Gehaltsliste steht? Wusstest du, dass der älteste Sohn des Generalstaatsanwalts Spielschulden hat? Und wem gehören die Spielsalons? Den Arabern.“
„Du widerst mich an, Simeon.“
Wieder bebte der Fleischberg.
„Also, was ist? Hast du etwas für mich oder ver-schwende ich hier nur meine Zeit? Man erzählt sich überall, dass du den absoluten Durchblick hast.“
Für einige Momente war nur das röchelnde Atmen zu hören. Dann sagte Simeon leise: „Geh ins Barbès. In der Rue Ronsard gibt es eine Wäscherei. Kann sein, dass die dort mehr waschen als schmutzige Wäsche. Aber: Wenn du
31
den Berg Mâschu betrittst, hüte dich vor den Skorpionmen-schen, deren Furchtbarkeit ungeheuer ist, deren Anblick Tod ist.“
Nach seinem Besuch bei dem Hutten rief er in der Prä-fektur an. Die Fahndung nach dem Lieferwagen lief, aber bislang war bei den Fahrzeugkontrollen noch kein demo-lierter weißer Transporter aufgefallen.
Clement dachte nach. Bossis hatte auf eigene Faust re-cherchiert. Sein Informant hatte ihm eingeredet, Prunis könne ihm weiterhelfen und auf dem Weg zu dem ehema-ligen Polizisten versuchte jemand, den jungen Ermittler aus dem Weg zu räumen. Prunis schickte Clement zu dem Hut-ten und dessen gichtgekrümmten Finger deuteten auf das Barbès. Jemand spielte Katz und Maus mit ihnen. Er wollte dennoch dem Hinweis des Ägypters folgen. In der Rue Ronsard einen Parkplatz zu finden, würde schwer werden, deshalb stellte er den Jeep in einem Parkhaus in der Rue de la Goutte d’Or ab, was der Servolenkung einiges abver-langte. Vor dem Parkhaus lungerten trotz der Verschärfung der Aufenthaltsregeln dutzende Nordafrikaner herum, die ihn scheinbar gelangweilt beobachteten. Sie schienen zu wissen, dass er nichts von ihnen wollte. In der Luft lag der süßliche Geruch von Cannabis.
Bis zur Rue Ransard waren es nur einige Gehminuten. Seine Schritte hinterließen platschende Geräusche auf der nassen Straße. Die Wäscherei befand sich auf der linken Seite in einem ehemals sicher stattlichen Haus, dem man ansah, dass es seine besten Zeiten hinter sich hatte.
32
Gegenüber parkten zwei weiße Lieferwagen mit dem Schriftzug der Wäscherei an Seite und Heck. Natürlich wies keines der Fahrzeuge eine Beschädigung auf, die auf einen frischen Zusammenstoß hinwiesen würden. Er holte sein Mobiltelefon aus der Tasche und suchte nach den Fo-tos, die er am Unfallort von dem Blinkerglas gemacht hatte. Dasselbe Fabrikat, daran bestand kein Zweifel. Er betrat die Wäscherei, in der es nach Stärke und Reinigungsmittel roch. Hinter der Ladentheke stand eine griesgrämig drein-blickende Frau unbestimmten Alters. Ihre Tränensäcke reichten bis auf die Wangen.
„Ihr Abholschein?“
Clement tat so, als suche er in seinen Taschen nach dem Zettel. „Tut mir leid, den muss ich wohl vergessen haben.“
„Dann kann ich Ihnen nicht helfen. Ohne Abholschein keine Wäsche.“
„Ich bin aber jetzt hier. Drei graue Anzüge. Habe ich letzten Freitag abgegeben. Auf den Namen Cocteau.“
„Monsieur, ich kann hier nicht jeden Auftrag durchsu-chen.“
Die Frau hatte bei dem Namen des getöteten Richters keine Regung gezeigt.
„Was ist, wenn ich den Abholschein verloren habe? Be-halten Sie dann meine Anzüge?“
„Hören Sie, ich habe viel zu tun. Wie viele Anzüge?“
„Drei. Alle dunkelgrau. Größe zweiundfünfzig.“
„Warten Sie, ich sehe mal nach.“
Die Angestellte verschwand im rückwärtigen Bereich. Clement verließ den Laden. Auf der Straße rief er wieder
33
in der Präfektur an. „Chloé, finde mal heraus, wer der Be-sitzer einer Wäscherei in der Rue Ronsard ist. Ja, es gibt nur die eine. Warte, oben haben sie ein Schild: ‚netto‘.“
Zwei Minuten später hatte er einen Namen. Er ging zu-rück in die Wäscherei. Die Frau rief ihm zu: „Sind Sie si-cher, dass Sie die Sachen am Freitag abgegeben haben? Ich habe keine drei grauen Anzüge, die abgeholt werden könn-ten.“
„Das ist doch wirklich unmöglich! Was ist das denn für ein Saftladen? Ich will jetzt sofort mit Monsieur Bashir sprechen.“
Der Angestellten war es sichtlich unangenehm, dass dieser aufgebrachte Kunde den Namen des Besitzers kannte. Ihre Mundwinkel verzogen sich zu einem umge-drehten U und sie grummelte: „Monsieur Bashir ist nicht hier.“
„Dann geben Sie mir seine Telefonnummer. Ich werde ihn anrufen.“
Tatsächlich kramte die Frau in einer Schublade, bis sie einen Zettel gefunden hatte. Sie nahm den Quittungsblock und malte die Ziffern mühsam ab. Dann reichte sie ihm das Papier. „Hier, Monsieur. Aber bitte sagen Sie ihm, dass ich alles abgesucht habe. Da sind keine grauen Anzüge in zwei-undfünfzig.“
„Schon gut, Sie trifft ja keine Schuld. Aber ich werde Monsieur Bashir sagen, dass ich jetzt ein großes Problem bekomme. Ich verreise morgen und brauche meine Anzüge. Auf Wiedersehen.“
34
Clement hätte die Nummer auch auf anderem Wege her-ausfinden können, aber der Auftritt hatte ihm Spaß bereitet. Auf der Straße tippte er die Ziffern ein.
„Spreche ich mit Monsieur Bashir? Hier ist Ferrault von der Autowerkstatt. Der Kostenvoranschlag für den Trans-porter ist fertig. Bis wann wollen Sie ihn repariert haben?“
„Welcher Transporter? Wovon sprechen Sie?“
„Sie haben uns doch den weißen Lieferwagen gebracht. Der Frontschaden. Wird eine Menge Arbeit, aber danach sieht er wieder aus wie neu. Hallo? Monsieur?“
Sein Gesprächspartner hatte aufgelegt.
Er ging zurück in den Laden und zeigte der Alten seinen Dienstausweis. „Rufen Sie Ihren Chef an und sorgen Sie dafür, dass er in einer Stunde hier im Laden ist, sonst muss er morgen früh um sieben in der Mordkommission erschei-nen.“
Sie sah ihn an, als hätte er soeben verlangt, sie solle nackt Tango auf dem Tresen tanzen, griff aber nach dem Telefon.
Clement wartete nicht, sondern beschloss, in der Zwi-schenzeit Juliens Informanten einen Besuch abzustatten. Von der Kreuzung Rue de Chartres/Rue de la Charbonnière warf er einen Blick auf die SacréCœur. In kaum einem an-deren Viertel zeigte die Metropole ihre Janusköpfigkeit so brutal und unverhohlen. Im Barbès, oder Goutted’Or, schnitten sie einem abends die Gurgel durch, sofern man nicht zahlungswilliger Kunde bei einer der zahllosen afri-kanischen Drogenhändler oder bei den abgetakelten Huren war. Nur zehn Gehminuten weiter konnte man sich in ein
35
Café am Montmartre setzen und dem bunten Treiben der Künstler und Touristen zusehen, ohne allzu häufig arabi-sche Dialekte zu hören. Wo Émile Zolas Goutted’Or Ende des neunzehnten Jahrhunderts den zugewanderten Arbei-tern aus Süd und Osteuropa Wohnstätte wurde, diente der Märtyrerhügel zu Zeiten eines de ToulouseLautrec den Ab-sinthtrinkenden Hurenböcken aus der sogenannten Bohème als Zuflucht. Durch die massive Einwanderung aus den nordafrikanischen Staaten hatte sich das Straßen-bild des Goutted’Or über die Jahre verändert und der Bei-name petite Afrique war keinesfalls überzogen, wogegen der Bereich um die SacréCœur einer der touristischen Zen-tren von Paris war.
Clement stand vor dem Billig-Modehaus Tati, das wäh-rend der Terrorwelle vor über dreißig Jahren Schauplatz ei-nes Bombenattentats geworden war, und sah sich um. Julien hatte die Adresse seines Informanten Jamal aufge-schrieben. Offenbar war es einer dieser zahllosen Telefon-läden, vor denen sich die nordafrikanische Jugend drängte. Ihre argwöhnischen Blicke ignorierend betrat er den Laden. An den Wänden hingen in langen Reihen die üblichen Adapter, Handyhüllen und sonstiges Zubehör. Plakate war-ben für scheinbar günstige Tarife. Aus den Lautsprechern an der Wand dröhnte der aktuelle AfroTrap Sound. Clement hielt nach einem Menschen Ausschau, der hier angestellt sein könnte. Ein spindeldürrer Kerl mit einem Ziegenbärt-chen kam auf ihn zu und hob fragend die Augenbrauen. „Was willst du, Bulle? Hier gibt es für dich nichts zu sehen. Habt ihr nichts Wichtiges zu tun?“
36
In der Präfektur sagte man ihm nach, er hätte nun einmal ein Bullengesicht und würde niemals als verdeckter Ermitt-ler arbeiten können. Clement musterte das Bürschchen und fragte: „Bist du Jamal?“
„Wer soll das sein? Hier gibt es keinen Jamal. Geh nach Hause, Alter.“
Heute war nicht sein Tag. Er verdrehe die Augen, streckte die Hand aus und zog das verdutze Männchen an der Oberlippe zu sich heran. Aus wenigen Zentimetern Ent-fernung schnaubte er ihm ins Ohr: „Hör zu. Ich bin zu alt, um eure Spielchen mitzuspielen. Mein bester Ermittler liegt im Krankenhaus, weil ihm ein gewisser Jamal einen falschen Tipp gegeben hat und irgendwie glaube ich, dass du dieser Mensch bist. Entweder du redest jetzt mit mir oder ich rufe einen Bekannten von der Gewerbeaufsicht an. Ich denke, man würde irgendwas finden. Alles ordnungs-gemäß angemeldet, zahlt ihr brav eure Steuern?“
Der Bursche nuschelte: „Au verdammt! Lass mich los, sonst kann ich schlecht mit dir sprechen!“
Clement löste seinen Griff, drängte sein Gegenüber aber gegen ein Regal, um zu verhindern, dass er sich verdünni-sierte. Die Besucher des Ladens waren entweder Kummer gewohnt oder zumindest der Ansicht, dass das nicht ihre Angelegenheit war. Niemand machte Anstalten, sich einzu-mischen. In diesen Zeiten war man besser dran, wenn man sich um seinen eigenen Kram kümmerte.
„Ich höre.“
Er zischte: „Ich bin Jamal. Dein Partner ist Julien, nicht wahr? Was ist mit ihm passiert?“
37
„Was hast du mit Prunis zu schaffen?“
„Sag mir erst, was mit Julien ist.“
„Man hat ihm die Fresse zermatscht. Jemand hat sein Auto zu Schrott gefahren als er auf dem Weg zu dem Colo-nel war. Und du hast ihn da hingeschickt. Wieso?“
Jamal wand sich wie ein Wurm am Haken.
„Das ist alles kompliziert, Mann. Wenn die sehen, wie ich hier mit dir quatsche, werde ich irgendwann mit einem Messer im Bauch hinter einer Mülltonne liegen. Pass auf: Hau mir eine rein!“
„Hein?“
„Du sollst mir eine in die Fresse hauen!“
„Bitte schön.“
Jamals Kopf flog an das Regal. Es regnete Handyhüllen. Er rieb sich gleichzeitig die Wange und den Hinterkopf und schnauzte Clement an: „Muˈɣaffal! Bist du überge-schnappt?“
Der Polizist zuckte mit den Schultern und raunte: „Du hast gesagt, ich soll dir eine scheuern. Jetzt beschwere dich nicht. Und stell dich nicht so an, das war mit der flachen Hand! Okay, jetzt glauben sie also, dass wir keine Freunde sind. Und nun? Wann hast du Feierabend?“
Der Bursche brummelte etwas aus Arabisch in seinen Bartflaum und rieb sich weiter eifrig die Wange. „Um sie-ben. Oben vor dem Musée de Montmartre.“
Clement nickte und lies von seinem Opfer ab. Er rich-tete ihm den Kapuzenpullover und trat zurück. „Dass wir uns verstanden haben! Wenn du das Handy nicht reparieren lässt, komme ich wieder!“
38
Im Hinausgehen warf er den Typen am Eingang noch einen finsteren Blick zu, bevor er breitbeinig in Richtung Rue d’Orsel stampfe. An der nächsten Ecke stellte er das Schauspiel ein und schlenderte langsam zur Rue Ronsard zurück, um der Wäscherei einen weiteren Besuch abzustat-ten. Auf dem Weg zu seiner Verabredung hielt er noch an einem Gemüseladen und kaufte Zwiebeln, Thymian und ei-nige Feigen. Im Kühlschrank warteten zwei Hähnchenkeu-len, die er sich provenzalisch zubereiten wollte. Seit Irène ausgezogen war, hatte er es sich zur Gewohnheit gemacht, ausnahmslos gut zu essen. Er wusste von etlichen Kollegen in ähnlicher Situation, dass sie sich nur noch aus der Papp-schachtel ernährten, aber das Kochen war für ihn ein Mit-tel, um sich einen Rest Selbstachtung zu erhalten.
Die Griesgrämige war offenkundig nicht sehr erfreut über sein Erscheinen, aber sie drehte sich um und rief: „Monsieur Bashir, der Polizist ist hier!“ Dann schnappte sie sich einen Korb mit Hemden und verschwand in den rück-wärtigen Räumlichkeiten. Gleich darauf erschien ein Mann mittleren Alters mit streng nach hinten gekämmten Haaren und kam zielstrebig auf Clement zu.
„Monsieur Commandant, mein Name ist Muammar Bashir. Ich bin der Besitzer dieser Wäscherei, wie Sie ja wissen. Und Ihr Name ist Clement, richtig? Was verschafft mir die Ehre Ihres erneuten Besuchs? Haben Sie wieder ei-nige Anzüge verlegt?“ fragte er scheinheilig und entblößte ein brüchiges Gebiss. Er roch nach Zigaretten, Kardamom und schwarzem Tee.
39
„Monsieur Bashir, mir liegt dieses orientalische Tarnen und Täuschen nicht. Wir beide wissen, dass es ein Problem gibt und ich wäre sehr daran interessiert, wenn wir Klartext reden könnten. Ist das in Ihrem Sinne?“
Der freundliche Gesichtsausdruck Bashirs änderte sich nicht, als er mit schneidender Stimme antwortete: „Wie Sie wollen, Monsieur Commandant. Ich habe keine Veranlas-sung mich mit Ihnen zu unterhalten. Wie ich Ihnen bereits am Telefon gesagt habe, vermisse ich keinen Lieferwagen.“
Clement beschloss, einen Versuchsballon steigen zu las-sen. „Ich treffe mich nachher mit einem Informanten. Er ist bereit, mit uns zu kooperieren. Ich denke, dass wir sehr schnell die Verbindung zwischen ihnen beiden, Saadi und dem ermordeten Richter Cocteau aufgedeckt bekommen. Ich halte es für besser, wenn Sie mir offen sagen, was Sie wissen. Das erspart uns allen eine Menge Arbeit und ich muss auch nicht alle Ihre Lieferwagen abholen und ausei-nandernehmen lassen.“
Der Versuchsballon stieg an die Decke der Wäscherei und platzte mit einem lauten Knall. Clement war sicher, dass Bashirs Fassade Risse bekommen hatte. Der Mann ließ seine Gebetskette zwischen den Fingern rotieren. Das könnte ein Zeichen von Nervosität sein.
„Hören Sie, Monsieur Commandant. Ich weiß nicht, was Sie mir da anhängen wollen. Ich kenne keinen der Herrschaften, deren Namen Sie genannt haben. Alles, was ich will, ist hier weiter mein bescheidenes Geschäft zu be-treiben. Also darf ich Sie bitten, jetzt zu gehen und Ihre haltlosen Verdächtigungen irgendwo anders vorzubringen?
40
Ich rufe jetzt meinen Anwalt an und werde Beschwerde über Sie erstatten. Ich bin ein unbescholtener Bürger und muss mich von Ihnen hier nicht verhören lassen wie irgend so ein Straßendealer. Wenn Sie mir etwas unterstellen, le-gen Sie die Fakten auf den Tisch. Und jetzt verlassen Sie bitte mein Geschäft.“
Clement beschloss, es für diesen Tag gut sein zu lassen und drehte sich wortlos um. Mit seiner Einkaufstüte in der Hand grübelte er darüber nach, ob es klug gewesen war, Bashir wissen zu lassen, dass er sich mit dem Mord an Richter Cocteau befasste, aber seine jahrelange Erfahrung als Ermittler hatte ihn gelehrt, dass es keine Zufälle gab, nur Gelegenheiten. Er stieg gemächlich die Stufen hinauf zur SacréCœur. Bis zu seinem Treffen mit Jamal, dem Han-dymann, hatte er noch hinreichend Zeit, daher beschloss er, die Basilia zu umrunden. Das Touristenheer wogte nur an der Vorderseite. Er musste schmunzeln. Jemand hatte an eine Mauer gesprüht: Unter dem Pflaster liegt der Strand. Was wussten diese Kinder der Nullerjahre schon vom Geist der Achtundsechziger! Er selbst hatte seine Sturm und Drangphase mit der Aufnahmeprüfung zur Polizeiakade-mie abgeschlossen, konnte sich aber problemlos auch als literarisch oder künstlerisch tätiger Bohémien sehen, der in natürlicher Symbiose existierte mit der ihn umgebenden Großstadt, ohne gezwungen zu sein, sich ihrem rastlosen Puls anzugleichen. Ein Zimmerchen in diesem Eckhaus aus dem 19. Jahrhundert, gleich über dem Restaurant und wenn die Sonne herauskommt, setzt man sich hier an den Tisch und rührt gedankenschwer in seinem Milchkaffee, bevor
41
man sich wieder… Jäh wurde er aus seinem Tagtraum ge-rissen. In Richtung SacréCœur schrien Menschen. Rück-sichtslos bahnte er sich einen Weg durch die Touristen, von denen nicht wenige ihn verängstigt anstarrten, während an-dere unbeirrt die Souvenirläden belagerten. Suchend blickte er sich um. Unweit des Centre Israélite standen oder knieten einige Leute vor einem Restaurant. Zwischen ihnen lag jemand auf dem Kopfsteinpflaster. Er hielt seinen Dienstausweis in die Höhe und schob sich zwischen eini-gen Schaulustigen hindurch. Eine junge Frau mit Pferde-schwanz erhob sich. Sie sah ihn mit vor Entsetzen aufge-rissenen Augen an. Der Mann neben ihr versuchte offenbar mit einem Schal den Blutstrom zu stoppen, der dem Opfer aus einer Halswunde strömte. Er zischte Clement an: „Was ist das nur für eine Stadt? Warum kann jemand diesen Mann auf offener Straße abstechen, während die Polizei hier spazieren geht?“
Clement sah dem Sprecher fest in die Augen, woraufhin dieser den Blick senkte.
„Ich war zufällig hier. Haben Sie einen Notarzt geru-fen?“
„Halten Sie uns für dumm? Aber ich denke, der braucht keinen Arzt mehr. Sehen Sie sich ihn doch an!“
Clement beugte sich über das Opfer. Der junge Mann hatte die Augen unnatürlich verdreht, aus einer Wunde am Hals trat enorm viel Blut aus. Er hatte bereits genug tote Menschen gesehen, um zu wissen, dass man diesem hier nicht mehr helfen konnte. Den hier hatte er noch vor einer
42
Dreiviertelstunde geohrfeigt. Clement zog das Telefon aus der Tasche und rief in der Präfektur an.
„Ich will, dass jemand einen gewissen Muammar Bashir festnimmt. Besitzer der Reinigung in der Rue Ronsard. Verwicklung in einen Mordfall. Ich komme später ins Büro, es gibt hier noch was zu erledigen.“
Das Ganze begann kompliziert zu werden.
43
Die Nachmittagssonne zauberte Lichtreflexe auf die Schneeflocken, die durch die Luft wirbelten und lies sie funkeln wie kleine Sterne. Jamila ärgerte sich, dass sie ihre Sonnenbrille zuhause gelassen hatte. Ihre Schritte erzeug-ten auf der Mischung aus Splitt und Streusalz ein Geräusch wie die Kichererbsen, die sie für die Socca manchmal selbst mahlte. Sie erfreute sich an der Reinheit der kalten Luft, die sie tief durch die Nase einsog und durch den Mund ausstieß.
Yasmine gurrte zufrieden in ihrem Kinderwagen und nuckelte eifrig an ihrem Schnuller herum. Die Kleine schien den Ausflug ebenfalls zu genießen. Madame be-stand darauf, dass sie zweimal täglich an die Luft kam, um ihre Abwehrkräfte zu stärken. In Höhe des Pavillons erwi-derte Jamila den Gruß der vornehm gekleideten älteren Dame, die morgens immer mit ihrem Mops hier entlang-ging und lenkte den beigen Designerwagen in Richtung Brücke. Auch wenn sie nur das Aupair war, war sie doch nicht wenig stolz darauf, wie adrett die kleine Yasmine in ihrem Kinderwagen ausschaute. Und Madame kaufte ihr alle paar Wochen neue Kleidungsstücke. Sie achtete sehr darauf, dass sie zusammen wie jemand aus gutem Hause aussahen, ihre Yasmine und Jamila.
Zu dieser Stunde waren meist nur einige Jogger und Hundebesitzer unterwegs und natürlich der Clochard. Jamila sah den Mann fast jeden Tag hier herumschleichen. Manchmal stieß er Verwünschungen aus oder starrte lau-schend in den Himmel. Wahrscheinlich hörte er Stimmen. Man hatte ihr gesagt, er sei harmlos, aber sie wollte
44
dennoch nicht in seiner Nähe sein. Heute würde sie hinüber zum Sybillentempel gehen, obwohl es auf dem Weg einige Stufen gab. Der Kinderwagen hatte Luftreifen und würde die Strecke trotz der zunehmenden Schneeschicht bewälti-gen. Jamila liebte den Ausblick und heute war gefühlt der erste helle Tag seit Weihnachten.
Unterhalb des kleinen Tempels stellte sie den Kinder-wagen neben einer Parkbank ab und stieg die elf Stufen bis zur kleinen Aussichtsplattform hoch. Wie jedes Mal ver-suchte sie, das Haus ihrer Arbeitgeber zu erspähen, aber die Fenster der Hochhäuser reflektierten die Sonne und sie musste die Augen fest zukneifen, um überhaupt etwas zu erkennen.
Nach einer Weile wurde Yasmine unruhig, wahrschein-lich war es ihr zu kalt. Sie ging hinunter, gab dem Baby einen kleinen Stups auf die Nasenspitze, die aus dem Dau-nenschlafsack hervorlugte und erntete die Mischung aus Lächeln und Verzweiflung, wie sie nur kleine Kinder hin-bekommen, dann löste sie die Bremse des Kinderwagens und machte sich auf den Rückweg.
Kurz vor der Brücke verengte sich der Weg. Und genau hier stand der Verrückte und kramte aus dem Mülleimer et-was hervor, um es in seiner Plastiktüte verschwinden zu lassen. Er stieß dabei wüste Beschimpfungen gegen all jene aus, die nur er sehen konnte. Jamila spürte, wie ihr die Be-klemmung die Kehle zudrückte. Sie umfasste den Griff des Kinderwagens etwas fester und versuchte, sich an dem Mann vorbeizuquetschen. Jetzt roch sie, dass er nach Alko-hol und Urin stank. Entsetzt schrie sie auf, als der Kerl mit
45
erstaunlicher Grobheit nach ihr grapschte. Sein Gesicht war verzerrt, als litte er unerträgliche Schmerzen. Er hatte Hände wie ein Oktopus und sie waren überall. Der Kinder-wagen bekam einen Stoß und machte einen Satz ins Ge-büsch. Jamila erstarrte. Die Angst war so übermächtig, dass sie nicht einmal wahrnahm, wie sie immer wieder Yas-mines Namen rief.
Der erste Schlag traf den Clochard aufs rechte Ohr. Sein Kopf wurde zurückgeworfen und sein Griff löste sich. Mit dem zweiten Schlag wurde er zu Boden geworfen, wo er liegenblieb und ein ganz merkwürdiges Geräusch von sich gab, fast wie ein Gespenst in der Geisterbahn auf dem Rummelplatz in den Tuilerien Gärten, wo Madame Jamila mit hingenommen hatte, und das war beinahe der schönste Tag in ihrem Leben, seit sie aus Marrakesch nach Paris ge-kommen war.
Sie hatte beide Arme fest um ihren Oberkörper ge-schlungen, als wolle sie damit verhindern, dass ihr das Herz aus der Brust sprang. Mit einer Mischung aus Erleichte-rung, Bewunderung und Fassungslosigkeit musterte sie den großgewachsenen, hageren Mann in Jogginghosen und Daunenjacke, der sie aus der misslichen Lage befreit hatte. Er trug einen langen Bart wie ein Geistlicher und sie schätzte sein Alter auf Anfang Dreißig.
„Wie heißt du?“
„Jamila.“
„Jamila“, wiederholte der Mann und fügte hinzu: „Das bedeutet ‚die Schöne‘ und das ist wahr. Aber junge Frauen, schon gar nicht so hübsche wie du, sollten ihr Antlitz nicht
46
offen zur Schau stellen. Warum trägst du nicht den Nikab, wie es eine gottesfürchtige Frau tun sollte? Hat er dir weh-getan?“ fragte er mit einem Blick auf ihren Peiniger, der jetzt ganz still dalag.
„Nein, aber ich glaube, er wollte mir etwas antun.“
Als sie es ausgesprochen hatte, kam die Angst zurück. Sie begann wieder zu zittern.
„Ist dir kalt? Wo wohnst du? Dein Kind?“ fragte er mit einem Nicken in Richtung Kinderwagen.
Yasmine! Sie trat an den Kinderwagen und richtete die Decke. Ihr Schützling sah sie aus ihren großen blauen Au-gen an. Die Mundwinkel zitterten, als wolle sie gleich an-fangen zu weinen. Jamila tastete in den Ritzen des Kinder-wagens nach dem Schnuller und steckte ihn der Kleinen in den Mund. Nicht auszudenken, wenn der Kerl Yasmine et-was angetan hätte.
„Nein, ich bin nur das Aupair. Die Herrschaften arbeiten beide. Sie wohnen in der Rue Miguel Hidalgo, das ist nicht weit weg.“
„Ich werde dich nach Hause begleiten.“
Es klang nicht wie ein Vorschlag. Als er ihren unsiche-ren Blick sah, fügte er hinzu: „Hab bitte keine Angst. Mein Name ist Osama. Ich stamme aus Nablus. Das liegt in Pa-lästina. Mein Vater ist Arzt, er hat eine Praxis im 16. Arron-dissement.“
„Dann ist er sicher wohlhabend. Und was machst du? Bist du ein Kämpfer oder so was? Ich meine, du hast den Verrückten ganz schön vermöbelt. Was ist eigentlich mit
47
ihm? Müssen wir nicht die Polizei rufen oder einen Kran-kenwagen?“
Osama sah ihr fest in die Augen. Sein Blick ließ ein war-mes Gefühl in ihrem Bauch entstehen. „Mach dir um den keine Sorgen. Ich rufe meinen Vater an, der weiß, was zu tun ist. Komm jetzt, lass uns gehen, bevor irgendwelche Leute unnütze Fragen stellen.“
Er sieht aus wie ein Löwe, dachte sie und langsam wich die Anspannung zurück. Sie hatte nicht einmal bemerkt, dass sie die ganze Zeit Arabisch gesprochen hatten. Osama. Mein Löwe.
48
„He Leute! Ich glaube, es geht wieder los!“
„Noah! Chen hat was auf dem Screen. Alles bereit für den Trace?“
Der Angesprochene hob gelangweilt die Augenbrauen. „Wenn Bruce Lee bereit ist, bin ich’s auch.“
Chen zeigte ihm den Mittelfinger. Isabel trat hinter den schmächtigen Vietnamesen. „Wie stark ist er?“
„Zweihundert Gigabit pro Sekunde. Noah. IPRange ir-gendwo im ZwofünfundfünfzigerBereich.“
„Wow. Wer sind die? Das ist ein verdammter Mega-Hack. Echt abgefahren. Warte, ich hab’s gleich. Hier.“ Noah deutete auf eine Grafik, die einen seinen 32Zöller ausfüllte. „Die haben versucht, eine falsche Spur zu legen. Anfänglich deutet alles darauf hin, dass die Server ir-gendwo im Nahen Osten stehen. Aber die haben nicht mit Scarface gerechnet.“
Scarface war Noahs HackerName aus seinen Zeiten beim CCCF, dem französischen Ableger des Chaos Com-puter Club. Isabel war die Gründerin und CEO der Firma. Noah und sie waren damals auch schon gemeinsam aktiv gewesen. Jetzt stand sie neben dem untersetzten Mann mit den Rastalocken und bewunderte seine Loyalität, seine In-telligenz und die Tatsache, dass er Berufliches und Privates trennen konnte, was ihr im Gegensatz zu ihm nicht immer leichtfiel.
„Und? Wo kommt der Angriff her?“
Noah bleckte die Zähne. Seine Finger hetzten über die Tastatur. Datenströme wurden visualisiert. Wie Nervenbah-nen wuchsen Verbindungen über Kontinente hinweg.
49
Schließlich blinkte ein heller Punkt über einer angedeute-ten Landkarte.
„Echt? Mann, das glaubt uns doch keiner.“ Chen hatte sich zu ihnen gesellt. „Elsass?“
„Leute, ich denke, ich kann mit ziemlicher Sicherheit behaupten, dass der Angriff aus der Gegend um Straßburg kam.“
„Straßburg? Wer ist dort? DGSE?“
„Denke nicht. Tippe eher auf das Commandement du renseignement.“
„Wer sind die denn?“
„Bis Ende des letzten Jahrtausends hießen sie noch Bri-gade de renseignement et de guerre electronique. Warum man die Einheit umbenannt hat, leuchtet mir nicht ein. Je-denfalls haben diese Leute gerade einen massiven Angriff auf Zielserver in Israel ausgeführt.“
„Wartet mal. Wir greifen Israel elektronisch an? Warum sollten wir so etwas tun? Ob die Amis das wissen?“
Chen zog nervös an seiner Vape, was ihm einen vernich-tenden Blick von Isabel einbrachte. Allerdings sagte sie nichts, da sie wusste, dass jeder Einzelne im Team seine Angewohnheiten und Laster hatte, die es ihm ermöglich-ten, ständig Höchstleistungen zu bringen. Alle hatten sie dunkle Ringe unter den Augen. Der aktuelle Auftrag hatte ihnen schon einige schlaflose Nächte bereitet.
„Okay. Ich rufe Raphaël an. Sollen die Experten beim DGSI versuchen, sich einen Reim daraus zu machen. Wir sind nur die Nerds, die ein paar verdammt gute Tricks auf
50
Lager haben. Für Politik fühle ich mich nicht zuständig. Noah, stell mir die Logs ins sichere Verzeichnis.“
„Schon passiert. Die ZIPDatei heißt DeepIm-pact_trclog_Israel.“
51
Isabel war mit ihrem Bruder Raphaël auf ein frühes Abend-essen in ihrem Lieblingsrestaurant in der Rue du Chevalier de la Barre verabredet, unweit der Basilika SacréCœur.
„Das musst du dir vorstellen wie bei den Matroschkas, den russischen Stapelpuppen. Dich nervt beim Surfen, dass du ständig auf dich zugeschnittene Werbung erhältst. Die wird verursacht durch sogenannte Spyware. Das googelst du, bekommst einen Link zu einem bekannten Computer-magazin und lädst dir eine Software runter, die diese Spyware entfernen soll. Sieht alles prima aus, dein Antivi-renprogramm sagt, die Software ist okay. Dann legst du los, lässt das Programm deine komplette Festplatte durchsu-chen. Und du staunst, wie viele Schadprogramme gefunden werden. Jetzt wirst du langsam neugierig, googelst einige von den gefundenen Trojanern, liest nach, was die so alles treiben. Und dann stößt du auf einen Eintrag, der vor genau dieser Software warnt, die du vor zehn Minuten runterge-laden hast. Das ist nämlich auch nur eine Spyware, die zwar tatsächlich andere Schadprogramme erkennt und entfernt, sich dabei aber so tief in die Systemdateien reinfrisst, dass sie nur noch zu entfernen ist, wenn du deinen Computer komplett platt machst. Und wenn du Pech hast, sind inzwi-schen deine Bankdaten geknackt und an einen Server in Russland oder Nordkorea übermittelt. Und bei jedem Ein-kauf über ein OnlinePortal werden ein paar Cent abge-zwackt. Merkst du gar nicht.“
Ihr Bruder beugte sich über die Skizze, die sie auf eine Serviette gekritzelt hatte. „Da verliert man tatsächlich die Lust, noch im Internet einzukaufen. Ich halte auch nichts
52
von diesen Kryptowährungen und dem ganzen neumodi-schen Zeugs. Okay, wenn die mit der Masche weltweit ein paar Millionen PCs verseuchen, läppert sich das. Aber dann ist doch schon der erste Link faul. Merken die von dem Computermagazin das denn nicht? Da geht man doch ge-rade drauf, weil man annimmt, das sei sicher.“
„Das ist ja das perfide. Du merkst nicht, dass der Link getürkt ist. Nachgebaut. Sieht genauso aus, wie du es viel-leicht schon mal gesehen hast. Die erste Einstiegsseite ist die oberste Hülle der Puppe. Und im Kern liegt der ganz böse Schädling. Nun, im privaten Bereich ist das eher ner-vig und schadet im Zweifelsfall einer einzelnen Person. Stell dir das Ganze mal in einer anderen Dimension vor. Zielgruppe ist eine Behörde, eine Bank oder möglicher-weise sogar eine Regierung, der man maximalen Schaden zufügen will.“
Raphaël wich ihrem forschenden Blick aus. Er rührte seinen Espresso um und beobachtete scheinbar interessiert ein Plakat an der Tür, welches eine Sonderausstellung im Musée de Montmartre bewarb.
„Raphaël, gibt es in der französischen Regierung eine Strategie für digitale Kriegführung? Die Abhöraktion des deutschen Generalstabs durch die Russen war damals nur ein prominentes Beispiel dafür, dass wir uns seit Jahren mitten im CyberWar befinden. Wer muss denn noch Ge-heimagenten einschleusen, die unter Gefahr für ihr eigenes Leben und das ihrer Informanten Plastiksprengstoff in ir-gendwelchen Abflussrohren anbringen? Das geht heute di-gital. Virus ins öffentliche Stromnetz, was meinst du, wie
53
lange eine Zivilisation ohne Energie auskommt? Nach vier-undzwanzig Stunden hast du Plünderungen, die ersten To-desfälle in den Krankenhäusern und spätestens nach zwei-undsiebzig Stunden fällt die Kühlung für die Atomkraft-werke aus. Riskieren wir damit nicht eine massive Ant-wort?“
Raphaël beugte sich über den Tisch und schenkte ihr ein spöttisches Lächeln. „An dieser Stelle, kleine Schwester, geht deine Fantasie mit dir durch. Man munkelt zwar, dass die Regierung jetzt bald diese CyberDéfense Commune umsetzen wird. Mir ist nur noch nicht klar, ob es dabei um eine europäische Einrichtung handeln wird oder eine wei-tere von den unerträglichen deutschfranzösischen Allein-gängen. Ob die CDC allein der Terrorabwehr dienen wird oder aber eigene aktive Aktionen durchführen soll, werden wir so schnell nicht erfahren.“
Raphaël arbeitete beim Inlandsgeheimdienst DGSI. Isabels Firma war auf Spezialsoftware für Netzsicherheit spezialisiert, ihre Klientel stammte vorwiegend aus der Wirtschaft. Hin und wieder gab sie Raphaël einen Tipp, wenn sie wie in dem aktuellen Fall der Ansicht war, dass sie einer größeren Sache auf der Spur waren. Sie winkten dem Kellner und Raphaël zahlte. Isabel griff nach ihrer Ta-sche.
„Nun, was immer die Regierung plant: Es hat diesen Angriff gegeben und die Beweise habe ich dir hier auf dem Stick übergeben. Es liegt an dir, ob du der Sache nachgehen willst.“
54
„Hast du denn Indizien dafür, dass es bereits im größe-ren Stil Attacken auf unsere Infrastruktur gegeben hat?“





























