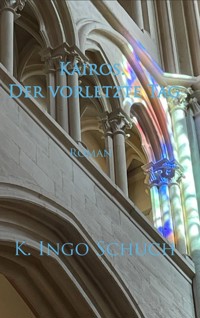Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
Delegado Ernesto Aparecido Teixeira arbeitet seit ungefähr einem Vierteljahrhundert in der Mordkommission bei der D. H. P. P. der Polícia Civil do Estado de São Paulo. Gemeinsam mit dem jungen Polizeischüler Wanderlei ermittelt er in einer Serie mysteriöser Todesfälle, in denen die Armadeira, die brasilianische Wanderspinne, eine geheimnisvolle Rolle spielt. Die Spuren führen in den Regenwald des Amazonas und bis nach Deutschland, in den Hochtaunus. Kommissarin Verena Leipoldt und ihr Team unterstützen die Kollegen aus Brasilien bei der Suche nach dem Spinnenmörder. Tod im Regenwald ist das erste aus eine Reihe von Büchern rund um die Ermittler Teixeira, Wanderlei und Meireles in Brasilien und Verena Leipoldt vom LKA Hessen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 542
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
K. I. Schuch
Tod im Regenwald
Thriller
Inhaltsverzeichnis
Widmung
Die Xa’o
Teixeira
Auf dem Rio Moju
Strandgut
Dschungelkrieger
Wanderlei
Leipoldt
Verbindungen
Im Spinnennetz
Epilog
Danksagung
Über K. I. Schuch
Über dieses Buch
Urheberrecht
Impressum
Widmung
Dieses Buch ist Wanderlei Freitas de Conceição gewidmet, der Spinnen wirklich nicht mag.
Die Xa’o
Nordwestlich von Itaituba, Bundesstaat Pará, Brasilien. 1996.
Die Onça duckte sich unter die Farne. Ihr Schwanz peitschte den Boden. Misstrauisch spähte sie zwischen den Bäumen hindurch und versuchte zu erkennen, ob ihr eine Gefahr drohte. Die Katze war hungrig. Seit Wochen musste sie sich mit Kleingetier begnügen, die Guti, Paka und Sumpfhirsche waren längst vor dem Lärm und Gestank geflüchtet, der immer unerbittlicher den Wald durchdrang. Bereits aus großer Entfernung hatte sie heute der unwiderstehliche Duft des Blutes herangeführt. Außer dem anschwellenden Zirpen der Zikaden und dem Schnattern der Sittiche hoch oben in den Bäumen war jetzt nichts zu hören. Die Sonne war bereits hinter den Bäumen versunken, aber die Onça sah auch im Dämmerlicht noch ausgezeichnet. Sie prüfte nochmals die Witterung, dann betrat sie die Lichtung. Ihr Kopf pendelte hin und her und sie war bereit, bei dem geringsten Anzeichen von Gefahr das Weite zu suchen. Nach wenigen Schritten hatte sie ihr Ziel erreicht. Die Raubkatze stieß ein heiseres Grollen aus und fletschte die Zähne. Ihre Beute bewegte sich nicht. Das Wesen war tot. Wolken von Fliegen schwirrten um den Körper. Sie schnupperte an der Leiche. Ihre Barthaare sträubten sich, aber ihr Hunger siegte über die Abscheu vor dem fremden Geruch. Mit ihrer rauen Zunge leckte sie das getrocknete Blut auf, das aus der Halswunde ausgetreten war, dann schlug sie gierig ihre Zähne in den Kadaver. Plötzlich kam etwas geflogen und ein brennender Schmerz fuhr ihr in die Schulter. Die Onça fauchte laut vor Ärger und Überraschung und warf sich herum. Sie spannte ihre Sehnen zum Sprung auf den unsichtbaren Feind, aber etwas ließ sie zögern. Vor ihren Augen schien plötzlich alles zu verschwimmen. Mit den Zähnen versuchte sie den brennenden Stachel aus ihrem Fell zu ziehen, aber er löste sich nicht. Sie hustete und hockte sich auf den Boden. Der Schmerz wanderte in ihre Eingeweide, ihre Muskeln erlahmten. Schon bald konnte sie den Kopf nicht mehr oben halten. Die Zunge hing ihr aus dem halb geöffneten Rachen, dunkler Speichel troff zwischen den mächtigen Reißzähnen hervor. Ihre Flanken zuckten bereits heftig im Todeskampf. Dann streckten sich ihre Beine. Ihre gelben Augen wurden glasig.
Padre Jerome setzte das Blasrohr mit zitternden Händen ab. Normalerweise erlegten die Xa’o mit ihren Waffen Paka, Vögel oder kleinere Affen. Er wusste aber, dass das spezielle Gift, das sie zum Präparieren ihrer Pfeile benutzen, auch ein größeres Tier wie ein Pekari schnell und zuverlässig tötete. Der Padre tat ein paar zaghafte Schritte auf den Jaguar zu und stieß ihn mit dem Fuß an. Die wunderschöne Katze war warm und weich und regte sich nicht. Er blickte von dem toten Tier hinüber zu der Leiche des Mannes. Die Kleidung machte ihm schmerzhaft bewusst, dass es sich um Doktor Montand handelte. Der stets fröhliche Ethnologe aus Belém lag kalt und tot auf dem Waldboden. Der Zersetzungsprozess hatte bereits begonnen. Käfer krabbelten durch die leeren Augenhöhlen. Sein Kopf war bis zum Gebiss herunter gespalten, wohl durch den Hieb mit einem Buschmesser.
Der hagere Mann mit dem lichten Haar und dem notdürftig geflickten Habit wandte sich ab. Ein Wimmern entrang sich seinen bebenden Lippen in Erahnung dessen, was ihn im Zelt erwarten mochte. Durch die Blätter der Bäume drang ein letzter Lichtrest und zeichnete die Silhouetten der Gegenstände nach. Das Zelt diente der Familie als Schlafstätte. Es duckte sich gegen eine einfache, mit Palmwedeln gedeckte Hütte, auf der einige Metallkisten standen, die gleichermaßen als Schreibtisch und Kleiderschränke dienten und zudem das wissenschaftliche Gerät von Doktor Montand beherbergten. Padre Jerome hob die Plane an und warf einen Blick ins Halbdunkel. Vitória Montand lag auf dem Boden. Sie war nackt. Man hatte ihr den Hals von einem Ohr zum anderen aufgeschnitten. Ihr Blut hatte auf der Erde eine schwarze Pfütze gebildet. Dutzende, nein hunderte Insekten labten sich an der klumpigen Masse. Jerome konnte den Anblick nicht ertragen, er erhob sich und taumelte durch den Eingang ins Freie. Würgend und spuckend erbrach er seine letzte Mahlzeit in einen Busch. Dann ließ er sich auf die Knie sinken. Seine Schultern bebten, er weinte lautlos. Anklagend blickte er hoch zum Blätterdach. Er wollte etwas sagen, wollte schreien, wollte Gott alles entgegen schleudern. Aber sein Gott würde nicht antworten. Er hatte noch nie geantwortet. Hoffnungslos verbarg er sein tränennasses Gesicht in den zitternden Händen. Plötzlich vernahm er einen erstickten Laut. Es klang wie das Winseln eines kleinen Hundes. Padre Jerome wischte sich mit dem Ärmel über die Augen, fasste das Blasrohr wie einen Prügel und erhob sich mit einem Ächzen. Vorsichtig trat er näher heran und blinzelte zwischen den Kisten hindurch. Zaghaft hob er das Deckenbündel an. Darunter kauerte ein Mädchen. Sie hatte sich zusammengekrümmt und hielt etwas fest umklammert. Jetzt stieß es wieder einen klagenden Laut aus, dem nichts Menschliches innewohnte. Der Padre beugte sich behutsam zu dem Kind herab. „Yara!“ Aus leeren Augen blickte sie durch ihn hindurch und schien seine Anwesenheit nicht zu bemerken. Das Grauen darüber, was man ihren Eltern angetan hatte, musste ihr die Sinne vernebelt haben. Wohl eine Art Schutzmechanismus. Widerstandslos ließ sie sich hochnehmen. Das Mädchen hing schlaff in seinem Armen. Ihre zarten Hände hielten ein Tuch fest, das der Padre bei Dona Vitória gesehen hatte. Padre Jerome überlegte nicht lange. Er musste sie von hier wegbringen, falls die hierher zurückkamen, die ihre Familie getötet hatten und die annähernd zwei Dutzend Mitglieder des Stammes, die zerhackt und erstochen in und vor den primitiven Hütten lagen. Dem Zustand der Leichen nach zu urteilen, lag das Gemetzel schon mindestens vierundzwanzig Stunden zurück. Er setzte das Kind behutsam an einem großen Andiroba-Baum ab. Sie musste völlig dehydriert sein. Aus einem Flaschenkürbis flößte er ihr vorsichtig ein paar Schlucke Wasser ein. Das Mädchen trank gierig, ohne aus seinem apathischen Zustand zu erwachen. Hin und wieder stieß sie ein gequältes Stöhnen aus. Der Padre holte die Decke und legte sie über das Mädchen. Nach einer Weile schloss sie die Augen und versank in einen unruhigen Dämmerschlaf.
Der Padre machte sich an die Arbeit. Anfangs trug, später schleifte und zerrte er die getöteten Xa’o auf einem Haufen zusammen. Zwischendurch musste er immer wieder innehalten, weil ihm der Verwesungsgeruch fast die Sinne raubte. Hier lag Páohi, daneben seine Tochter Kahái, auch sie war offenbar geschändet worden, dort drüben der kleine Baai, der immer so frech durch seine Zahnlücken gegrinst hatte, wenn er mit den anderen Kindern Taranteln mit Stöcken zum Wettlauf angetrieben hatte. Für die Montands hob er eine Grube aus und steckte ein aus zwei Ästen notdürftig zusammengebundenes Holzkreuz darüber. Wo die primitiven Geräte, die er im Lager gefunden hatte, nicht ausreichten, nahm er seine Hände zu Hilfe. Der Mond spendete ihm dabei sein spärliches Licht.
Stunden später war es getan. Über den Leichen der Xa’o hatte er aus den Ästen und Palmwedeln der Hütten einen großen Haufen aufgetürmt. Jetzt nahm er das Feuerzeug, das Montand gehört hatte, und entzündete den Stapel. Nach einer Weile zauberte der Feuerschein gespenstische Schatten auf die Baumriesen, die die Siedlung umgaben. Dutzende von Faltern und anderen fliegenden Insekten flatterten sinnentleert durch den Rauch ins Feuer und versengten. Hoch in den Bäumen ertönte das aufgeregte Gebell der Brüllaffen, ein paar Papageien protestierten. Padre Jerome stierte in die Feuersbrunst, bis ihm die Augen brannten. Er war aufgewühlt und verzweifelte fast an seinen widersprüchlichen Gefühlen, die ihn letztendlich in den Dschungel getrieben hatten. Dann rezitierte er mit sonorer Stimme aus einem uralten Klagelied:
„Aber ich rief deinen Namen an, o Herr, tief unten aus der Grube!
Du hörtest meine Stimme: Verschließe dein Ohr nicht vor meinem Seufzen, vor
meinem Hilferuf! Du nahtest dich mir an dem Tag, als ich dich anrief; du sprachst:
Fürchte dich nicht!
Du führtest, o Herr, die Sache meiner Seele; du hast mein Leben erlöst!
Du hast, o Herr, meine Unterdrückung gesehen; schaffe du mir Recht! Du hast all
ihre Rachgier gesehen, alle ihre Anschläge gegen mich.
Du hast, o Herr, ihr Schmähen gehört, alle ihre Pläne gegen mich, das Gerede
meiner Widersacher und ihr dauerndes Murmeln über mich.
Sieh doch: Ob sie sich setzen oder aufstehen, so bin ich ihr Spottlied!
Vergilt ihnen, o Herr, nach dem Werk ihrer Hände! Gib ihnen Verstockung des
Herzens; dein Fluch komme über sie! Verfolge sie in deinem Zorn und vertilge sie
unter dem Himmel des Herrn hinweg!“
Ῠ
Die Xa’o lebten auf einer natürlichen Lichtung unweit des Flusses, der Quelle allen Lebens war. Sie hatten ihre einfachen Hütten errichtet, wie es viele Generationen vor ihnen getan hatten und rangen dem Urwald das Lebensnotwendige ab. Die Männer gingen fischen oder jagen, die Frauen bauten etwas Mais und Maniok an. Die Xa’o hatten kaum Kontakt zu Fremden, nur zu den Flusshändlern, die ab und zu mit ihren Booten den Seitenarm des Rio Anapu heraufkamen.
Eines Tages kam ein nicht mehr junger weißer Mann zu ihnen. Er sah aus wie einer der Missionarios, die einst die ersten Weißen gewesen waren, denen die Xa’o vor langer Zeit begegnet waren. Der Fremde nannte sich Padre Jerome und er kam ohne Waffen und ohne Versprechungen. Er war allein und seine Augen waren ohne List. Von ihm schien keine Gefahr auszugehen und so duldeten sie ihn in ihrer Mitte.
Der Padre kam immer wieder. Mit der Zeit hatten die Xa’o sich daran gewöhnt, dass er abends mit ihnen am Feuer saß und versuchte, ihren Geschichten von den Ahnen und den Waldgeistern zu folgen. Unter ihnen sprachen und verstanden zwei Männer einige Brocken ‚krummer Hals‘, wie sie die portugiesische Sprache nannten. Die Xa’o waren freundlich und lachten gemeinsam mit ihm über seine Versuche, ihre eigene tonale Sprache zu erlernen, die für sie ‚gerader Hals‘ war und die mit drei Vokalen und sieben Konsonanten auskam. Sie ließen ihn mit dem Bogen und dem Blasrohr auf Cupuaçu-Früchte zielen und dann durfte er die Männer zum Fischen und auf die Jagd begleiteten. Der Padre versuchte ihnen zu erklären, dass ihre Art zu leben ihm sehr gefiel. Er sprach nicht darüber, wohin er ging, wenn er sie wieder flussabwärts für Tage, Wochen oder Monate verließ und sie fragten nicht danach.
An einem regnerischen Tag im Sommer kam Jerome nicht allein. In seiner Begleitung befanden sich ein Mann und eine Frau. Sie brachten ihre kleine Tochter mit. Das Mädchen mochte vielleicht acht oder neun Jahre alt sein. Sie kamen mit einem langen Canoa den Fluss herauf, das zudem mit Gepäckstücken und einigen merkwürdig aussehenden Gerätschaften beladen war. Die Fremden erklärten mit Unterstützung des Padre, dass sie gerne einige Zeit bei den Xa’o leben würden. Doktor Jacques Montand war Dozent für Linguistik und Ethnologie an der Universität von Belém und er wollte in einem gemeinsamen Projekt mit der FUNAI, der Fundação Nacional do Índio, der Nationalen Behörde für Indigene, untersuchen, welche sozialen Strukturen die Xa’o sich ohne engeren Kontakt zur Außenwelt erhalten hatten und wie ihr Verhältnis zu anderen indigenen Völkern war. Man hatte keine klare Vorstellung, wie viele Stämme oder Gruppierungen noch ohne den segensreichen oder zerstörenden zivilisatorischen Einfluss in den Wäldern Amazoniens lebten. Vitória Montand arbeitete an der Universität als wissenschaftliche Assistentin im Fachbereich Zoologie und sie interessierte sich sehr für die Biodiversität des noch weitestgehend unberührten Waldes. Sie hatte den Franzosen auf einer früheren Reise in die Regenwälder Paraguays kennen und lieben gelernt. Es war klar, dass die Xa’o weder wussten, was eine Universität war noch jemals von der FUNAI gehört hatten. Padre Jerome versuchte, den Sinn einer Indianerbehörde in ihre Sprache zu übersetzen, aber das war schier unmöglich. Den Xa’o fehlte jegliche Vorstellung von Organisationsformen, die komplexer waren als ihre Clanstruktur. Páohi war so etwas wie der Stammesälteste oder Häuptling. Er lachte viel und war wie alle Xa’o ohne Arglist. Er bedeutete den Fremden, dass sie natürlich ihr tapýi aufstellen durften, deren graue Leinenwände sich gegenüber dem Tiefgrün des Waldes deutlich hervorhoben. Die Xa’o halfen den Fremden beim Ausladen der höchst ungewöhnlichen Gerätschaften und nach einiger Zeit hörten die Kinder auf, sich über ihre helle Haut und ihre Kleidung lustig zu machen. Das kleine Mädchen hieß Anaïs, aber die Xa’o nannten sie Yara. Sie sagten, mit ihrem langen Haar und ihren Augen in der Farbe des Meeres sehe sie aus wie eine Mãe-d’água, eine Sirene, die in den Flüssen lebt und mit ihren Liedern die Männer verzaubert.
Ῠ
Padre Jerome saß die ganze Nacht auf dem Boden, bis die Glut erloschen war. In seinen Armen wiegte er die kleine Yara. Er hatte ihr behutsam das Blut abgewischt und sie in ein Tuch eingewickelt. Irgendwann hatten sie endlich zusammen weinen können.
Am nächsten Morgen fuhr er in seinem Boot mit ihr fort.
Acht Jahre danach. In der Nähe von Santarém, Pará.
Dem Mann war kalt. Schwester Beatriz hatte eine Wolldecke mitgebracht und sie über seine dürren Beine gebreitet, aber die Kälte kam von innen. Er spürte, wie seine Lebenskraft mit jedem rasselnden Atemzug aus seinem ausgemergelten Körper sickerte. Er war aber noch nicht bereit, seinem Schöpfer entgegen zu treten. Es gab da etwas, das wie ein Bleigewicht auf seiner Brust lastete. Ächzend versuchte er sich auf seinem einfachen Lager aufzurichten. Wieder schüttelte ihn ein Hustenanfall. Er spuckte roten Schleim in das Taschentuch, das die Schwester ihm vor den Mund hielt. Als der Anfall verebbt war, flößte Schwester Beatriz ihm etwas Wasser ein. Aus seinen tief in den Höhlen liegenden Augen sah er die Nonne dankbar an. Er umklammerte ihren Arm. Seine Hand wirkte wie die Klaue eines Skeletts. Sie brachte ihr Ohr nah an seinen Mund. Sein Atem roch sauer und faulig. Mit zittriger Stimme bat er sie: „Bitte. Hol die Abadessa, ich möchte beichten, bevor es mit mir zu Ende geht.“
Schwester Beatriz nickte stumm und verließ die karge Zelle. Draußen stieß sie beinahe mit einer anderen Nonne zusammen, die offenbar gelauscht hatte. Sie drohte ihrer Schwester im Glauben mit dem Finger „Maria, soll ich der Abadessa berichten, dass du dich der Neugierde schuldig gemacht hast? Du weißt, das bedeutet eine Woche Arbeit in den Ställen.“
Oberin Anthelma Schellnhuber war bereits in den frühen achtziger Jahren aus Österreich nach Pará gekommen und seitdem bestellte sie zusammen mit ihren Mitschwestern unermüdlich den Garten des Herrn in diesem wundervollen Land mit seinen einfachen und dankbaren Menschen. Das Mutterhaus war in einem alten Kloster aus dem 16. Jahrhundert untergebracht, das den gleichen Namen trug wie die Kathedrale Nossa Senhor da Conceição in Santarém, in der der Bischof residierte. Vor nunmehr fünf Jahren hatte man sie zur Äbtissin gewählt, nachdem der Herr ihre Vorgängerin zu sich gerufen hatte.
Am Vortag hatten Indios den gebrechlichen Bruder im Glauben in ihrem Kanu zu ihnen gebracht. Er war unschwer als Mitglied des Ordo Fratorum Minorum zu erkennen. Die Äbtissin hatte in der Heimat einige Zeit in einem Hospital gearbeitet und verstand sich ein wenig auf Naturheilkunde. Hier in der Neuen Welt hatte sie bereits Fälle von hämorrhagischem Denguefieber gesehen. Die Haut des Padre wies die typischen roten Punkte auf und sein Zahnfleisch sah aus wie eine frische Wunde. Abadessa Anthelma ahnte, dass ihm nicht mehr zu helfen war. Die Benediktinerinnen hatten den Bruder am Ende des Zellengangs untergebracht und flößten ihm Wasser und etwas Hühnerbrühe ein. Er mochte die Sechzig erreicht haben, aber aufgrund seines jämmerlichen Zustands wirkte er älter. Sie musste sich anstrengen, um sein Flüstern zu verstehen. Sein Bericht wurde immer wieder von Hustenanfällen unterbrochen. Nach einiger Zeit erhob sie sich, um ihm frisches Wasser zu holen. Als sie zurückkam, blickten die Augen Padre Jeromes starr zu Decke. Anthelma drückte ihm sanft die Lider zu und betete für seine Seele. Den Padre bestatten sie an der südlichen Mauer, im Schatten der Pfirsichpalme, um deren Früchte sich die Papageien und Sittiche stritten.
Drei Tage später machte sie sich gleich im Anschluss an Laudes auf den Weg über den Rio Tapajós zur Guarda Municipal in der Stadt. Was der Bruder ihr berichtet hatte, musste sie den Behörden anvertrauen. Gott würde die Missetäter strafen, aber es konnte nicht schaden, die weltliche Gerichtsbarkeit ebenfalls einzuweihen.
Auf der Station der Gemeindepolizei tippte ein tüchtiger Beamter in makelloser Uniform ihre Aussage mittels einer uralten Schreibmaschine in das dafür vorgesehene Formular. Das Schriftstück wurde danach begutachtet und von beiden unterschrieben. Ein Durchlag wanderte in einen Ordner im Aktenschrank, der in den sechziger Jahren eine Amtsstube in der Provinzhauptstadt verziert haben mochte, ein weiteres Exemplar durfte die Abadessa mitnehmen und das Original legte der dienstbeflissene Polizist seinem Vorgesetzten auf den Tisch, der sich gerade beim Haareschneiden befand und mit den anderen Honoratioren des Ortes die aktuellen Fofocas austauschte. Oberin Schellnhuber machte sich auf den Rückweg. Sie trieb den Außenbordmotor kräftig zur Leistung an und gelangte noch zur Vesper zurück im Kloster, wo sie erfuhr, dass Maria verschwunden war.
Teixeira
Nordöstlich von São Paulo, 2019.
Die mittelgroße, dunkelhaarige Frau schlenderte gemächlich die Straße entlang. Sie trug einen Wischmopp und einen Eimer mit Putzmitteln. Offenbar war sie eine Empregada, ein Hausmädchen, das auf dem Weg zu ihrer Arbeit war. Besonders eilig hatte sie es nicht, wie überhaupt die Leute auf der Straße der für die Küstenbewohner typischen Gemächlichkeit ihrem Tagwerk nachgingen. „Sossegado“, sagte der Landbewohner, wenn er zum Ausdruck bringen wollte, dass das Leben ein ruhiger, langer Fluss sei. Hektik war etwas für Großstädter und auch wenn schon viele davon kurz vor den Osterfeiertagen in dem Städtchen unterwegs waren, hatten die Paulistanos sich dem gemächlichen Tempo angeglichen.
Noch fünfzehn Jahre zuvor war Juquehy eine verträumte Siedlung mit einem Lebensmittelladen und ein paar Wochenendhäusern entlang der Strandlinie. Damals gab es nur eine Erdstraße zur Rio-Santos, die nach den nachmittäglichen sintflutartigen Regenfällen nur mit einem Geländewagen befahrbar war. Natürlich scherten sich die Dorfbewohner nicht darum. Einen Geländewagen hatte damals hier niemand, man umfuhr mit seinem Fusca oder mit dem Fahrrad so gut es ging die metertiefen Schlaglöcher, die irgendwann mit Schotter wieder aufgefüllt wurden, bis der nächste Regen die Löcher wieder ausspülte. Mit der Zeit hatten die Wochenendbesucher zugenommen. Es wurden weitere Häuser gebaut, die Hauptstraße wurde asphaltiert, ein Shopping kam hinzu und mehrere kleine Pousadas sowie ein Hotel einer amerikanischen Kette buhlten um die Gäste, die aus São Paulo und zunehmend sogar aus dem Ausland anreisten, um die Wochenenden oder Ferien am Strand zu verbringen.
Die Frau bog an der nächsten Ecke rechts ab. Wahrscheinlich hatte sie den Auftrag, in einem der älteren Wochenendhäuser sauber zu machen, die ein paar Querstraßen weiter weg standen von der Uferpromenade und vom Strand mit seinem weißen, feinen Sand. Die meisten standen unter der Woche leer, jetzt dürften einige vermietet sein. Ihr Ziel war das letzte Haus am Ende der Erdstraße. In unregelmäßigen Abständen waren hier Metallständer in die rote Erde versenkt, auf die man die schwarzen Müllsäcke legen sollte, um sie vor Ratten oder streunenden Hunden in Sicherheit zu bringen. Seit einigen Jahren warben verschiedene Bewegungen für Ökotourismus und Naturschutz in den Touristenorten des Litoral und langsam begann sich so etwas wie ein Umweltverständnis auch bei den Bewohnern einzustellen. Vor dem Haus war ein silberner Chevrolet geparkt. Offenbar war jemand zu Hause. Es war schwül. In der Luft hing der Geruch der Jacas, die überreif von den Bäumen gefallen waren und nun am Wegesrand verfaulten. Die Frau prüfte die hintere Eingangstür und stellte fest, dass sie verschlossen war. Leise ging sie um das Haus herum. Der Rasen war gesäumt von Bougainvillea mit violetten Blättern und blauen Tumbérgia. Von der Hauswand hingen die gelben und roten Blüten der Sapatinho-de-Judia herab. Winzige, blaugrün schimmernde Beija-Flor versenkten ihre langen, spitzen Schnäbelchen in die Blütenkelche. Die Terrassentür stand offen, gedämpfte brasilianische Musik war zu hören. Die glockenhelle Stimme von Elba Ramalho. Die Empregada klopfte an den Fensterladen und rief halblaut: „Alô. Ist jemand zu Hause? Senhor?“
Sie bekam keine Antwort. Vorsichtig trat sie ins Haus und blickte sich um. Das Wohnzimmer war mit einer Sitzgruppe mit bunten Auflagen ausgestattet, die Wände waren weiß gestrichen. In einer Ecke stand ein einfacher Holztisch mit ein paar Stühlen, auf einem Sideboard stand die Stereoanlage. Auf einem Sitzmöbel lag ein Mann. Sein Brustkorb hob und senkte sich gleichmäßig. Er schlief. Ein Glastisch beherbergte neben einer leeren Flasche Rotwein und einem Glas die Reste einer einfachen Mahlzeit. Reis und Bohnen. Ein Buch lag aufgeschlagen auf dem Fußboden. Offenbar hatte der Mann es sich nach dem Essen gemütlich gemacht und war dabei eingeschlafen. Die Frau stellte den Eimer ab und legte den Mopp vorsichtig daneben. Sie schlüpfte aus ihren Chinelos und ging barfüßig zur Küche. Niemand da. Auch die beiden Schlafzimmer und das Bad waren leer. Das Haus hatte nur das eine Stockwerk. Sie ging zurück ins Wohnzimmer und schloss leise die Terrassentür ab. Mit einer geübten Bewegung zog sie die Träger herunter und streifte ihr Kleid ab. Sie trug keine Unterwäsche. Ihre Brüste waren klein und fest. Der flache Bauch und die kräftigen Beine zeugten von sportlicher Betätigung. Ein feiner Schweißfilm überzog ihre nahtlose Bräune. Sie löste ihre langen Haare und schüttelte den Kopf. Während sie die Sitzgruppe umrundete, warf sie einen Blick auf den Schlafenden. Ungefähr Fünfzig. Schlank. Gepflegte Erscheinung. Er trug Shorts und ein Poloshirt. Sie drehte den Lautstärkeregler der Musikanlage hoch, dann ging sie mit wackelnden Pobacken hinüber zur Couch und betrachtete beinahe zärtlich den Mann, der wie ein Embryo eingerollt vor ihr lag. Sie bückte sich und holte behutsam noch etwas aus dem Eimer. Aus den Lautsprechern drang jetzt die kraftvolle Stimme Zé Ramalhos:
‘Agora pego um caminhão na lona, vou a nocaute outra vez
Pra sempre fui acorrentado no seu calcanhar
Meus vinte anos de boy, that’s over, baby, Freud explica!
Não vou me sujar fumando apenas um cigarro
Nem vou lhe beijar gastando assim o meu batom
Quanto ao pano dos confetes já passou meu carnaval
E isso explica porque o sexo é assunto popular
No mais, estou indo embora!
No mais, estou indo embora!
No mais, estou indo embora!
No mais…‘
Der Mann schreckte hoch. Seine Haare waren auf einer Seite schweißnass an den Kopf geklebt, auf der Wange hatte er den Abdruck des Sitzkissens. Schlaftrunken starrte er auf die nackte Frau. Er verstand nicht. „Wer bist du? Wie bist du hier reingekommen und mach die Musik leiser“, brüllte er gegen den Refrain an. Er wollte sich erheben. Die Frau machte einen Satz auf ihn zu und kauerte auf einmal auf seiner Brust. Er konnte seine Arme nicht heben, weil sie ihn mit Ihren Schenkeln fest auf das Sitzmöbel drückte. Der Mann versuchte zu strampeln und sie abzuwerfen, aber sie war überraschend kräftig. Als seine Nase ihren Bauchnabel berührte, begann sich in seiner Hose etwas zu regen. Sie griff mit einer Hand nach hinten und nestelte an seinem Gürtel herum. Ihre Lippen waren auf einmal nah an seinem Mund. Züngelnd fuhr ihre Zunge ihm ins Ohr. Sein Körper reagierte. Er wollte es tun. Er versuchte sie mit seinen Lippen zu erreichen, aber die Frau drehte den Kopf zur Seite. Plötzlich fuhr ihm ein brennender Schmerz in den Nacken. Etwas hatte ihn gestochen! Er spürte Panik aufsteigen. Nochmals versuchte er sich hoch zu stemmen, aber die Frau saß wie ein Alb auf ihm. Der Schweiß brach ihm aus allen Poren. Sein Herzschlag schien sogar die laute Musik aus den Lautsprechern zu übertönen. Jetzt wurde ihm schlecht. Merkwürdigerweise hatte er nach wie vor einen Ständer. Die Frau rutsche ans Fußende, zog ihm mit einem Ruck Hose und Unterhose herunter, dann bestieg sie ihn wie ein Reittier. Dabei stieß sie gutturale Töne in einer Sprache aus, die er noch nie gehört hatte. Er lag nur da und ließ es geschehen. Jetzt kamen die Schmerzen. Er stöhnte und warf den Kopf hin und her. Dann begann er zu schreien. Er hörte nicht mehr auf zu schreien, während die Frau es ihm antat. Während sie das Unaussprechliche tat. Draußen begann es zu regnen.
Ῠ
Ernesto Teixeira saß auf der Terrasse, die zum Garten hinführte, und blätterte im O Estado De São Paulo. Der Sportteil wurde dominiert durch die ausländischen Ligen. Im Kommentar gab es eine Neuauflage der Diskussion, warum im aktuellen Kader kaum ein Spieler aus der heimischen Liga eingesetzt wurde. Im letzten Freundschaftsspiel gegen Panama, das man knapp mit 1:0 gewonnen hatte, spielte gerade mal Fagner bei einem brasilianischen Verein, und das auch noch bei den Corinthians. Nach der Mineiraço von 2014 und dem schlechten Abschneiden bei der letzten WM hielt sich die Begeisterung für die Seleção in Grenzen. Teixeira war selbst Anhänger von Palmeiras, die in der letzten Saison wieder einmal die Campeonato Brasileiro gewonnen hatten, allerdings bezeichnete er sich selbst als Mitläufer. Seine Besuche im Stadion beschränkten sich auf einige wenige Spiele, was nur zum Teil seinen ungeregelten Arbeitszeiten anzulasten war. Ihm war die zunehmende Gewalt zuwider, die sich der Fußballstadien bemächtigt hatte. Er legte die Zeitung weg und goss sich noch einen Kaffee nach. Aus dem Nachbarhaus drang gedämpftes Gitarrenspiel. Es gefiel ihm, wenn Danilo übte, vor allem, wenn er es leise tat. Irgendwas von Alceu Valença. Mit dem Fuß wippte er im Takt. Es würde wieder ein heißer Tag werden, aber hier wehte immer ein sanftes Lüftchen. Er würde Silvana bitten, nach den Feiertagen José Luiz anzurufen, das Ameisennest neben der Treppe breitete sich schon wieder aus. Oben in der Palme zeterten die Sittiche, auf der Straße ließen ein paar Jungs Böller krachen. Drüben schnappte der Köter über. Der verdammte Pitbull stieß jedes Mal, wenn jemand am Haus vorbeiging, sein heißeres Gebell aus. Das war kein Hund, sondern eine Hyäne. Nachts heulte er den Mond an. Im Gegensatz zu Danilo waren die Nachbarn zur Rechten komplett resistent gegen Lärm, insbesondere gegen den durch sie selbst verursachten. Irgendwann würde Teixeira sich etwas einfallen lassen müssen.
Das Telefon klingelte. Er wartete, dass das Hausmädchen abheben würde. Dann fiel ihm ein, dass sie heute frei hatte. Silvana war im Garten und striegelte Ronaldo, ihren Mischlingsrüden. Sie rief gegen das Hundegebell an: „Ernesto, willst du nicht ran gehen?“ Nun merkte er, dass es sein Handy war, das drinnen auf dem Tisch hartnäckig läutete. „Droga.“ Fluchend stemmte er sich hoch und ging ins Wohnzimmer. Er erkannte die Nummer des Anrufers im Display. „Fernanda. Es ist noch zu früh, mir Frohe Ostern zu wünschen. Was willst du?“
Am anderen Ende der Leitung erkannte er das leichte Lispeln der Sekretärin, die die unfreundliche Begrüßung konterte, indem sie seinen Dienstgrad wegließ: „Teixeira. Es tut mir außerordentlich leid, dass ich Sie beim Frühstück stören muss, aber in Juquehy gibt es einen Toten.“
Teixeira fuhr sich mit einer Hand durchs Gesicht und verfluchte den Tag, an dem er dieses Mobiltelefon akzeptiert hatte. Er griff nach der Schachtel und steckte sich eine Mentholzigarette an. Das machte es nicht besser. „Fernanda, in São Paulo gibt es statistisch jeden Tag fünfzig gewaltsame Todesfälle. Juquehy liegt im Bezirk São Sebastião und dafür dürften die Kollegen von DEINTER 1 zuständig sein. Was ist denn an dem so besonders, dass du mich deswegen am Karfreitag anrufen musst?“
„Desculpa. Aus irgendwelchen Gründen will der Geral, dass Sie selbst hinfahren und den Fall übernehmen.“
Fernanda war so etwas wie die rechte Hand des Responsável pelo Homicídio, des Leiters der Mordkommission. Teixeira wurde hellhörig. „Wer ist es denn?“, brummte er ins Telefon. Seine Stimme klang, als habe er mit Reißnägeln gegurgelt. Er drückte angewidert die gerade angerauchte Zigarette in einem Blumenkübel aus. Wenn Silvana die Kippe fand, war eine Gardinenpredigt fällig.
„Das Opfer heißt José Gabriel Tavares. Er war leitender Angestellter in einer Holzfirma. Warum das so dringlich ist, dass ich Sie anrufen musste, weiß ich auch nicht.“
Fernanda erzählte noch irgendwas von einem Wochenendhaus und von einer Empregada und einem Wachmann. Teixeira hörte gar nicht genau hin. Er würde die Details früh genug mitbekommen. Wenn der Geral sich selbst in die Ermittlungen einschaltete, bedeutete das Ärger. Besser, er versuchte gar nicht erst, dagegen aufzubegehren. Er knurrte ins Telefon: „Ich gehe jetzt duschen und schaue, ob ich meine Badehose finde. Ein herrlicher Tag, um an den Strand zu fahren.“
Nachdem er Silvana erklärt hätte, dass sie die Vorbereitungen für heute Abend allein treffen musste.
Ῠ
Der mittelgroße, kräftig gebaute Mann stapfte auf das Haus zu. Sein weißes Hemd mit den Knitterfalten und den handtellergroßen Schweißflecken unter den Achseln verrieten den Städter. Er trug eine graue Anzughose und Slipper. Graumelierte, ehemals schwarze Haare fielen ihm hinten wellig über den Kragen. Das Gesicht mit der Adlernase dominierte eine altmodische Brille im Onassis-Stil. Dem Gesamteindruck nach konnte es sich um einen Mathematiklehrer oder Soziologen handeln. Dagegen sprach, dass ein junger Polizist zackig salutierte und das orangefarbene Absperrband anhob, als er den Herankommenden sah. Ein Abzeichen am Ärmel wies den Uniformierten als Mitglied der Polícia Civil aus São Sebastião aus. Vor dem Haus standen einige Gaffer herum, die aufgeregt die Köpfe zusammensteckten, als sie sahen, dass da offenbar jemand von Bedeutung gekommen war. Die Küchentür stand offen. Rund um die Türklinke und am Türrahmen hafteten die Reste von Mangandioxidpulver, das die Kollegen der Spurensicherung aufgebracht hatten, um Fingerabdrücke sichtbar zu machen. Der Neuankömmling bewegte seinen massigen Körper durch die Küche und betrat den Wohnraum. Hinter der Türschwelle hatte jemand seine letzte Mahlzeit wieder von sich gegeben. Ein säuerlicher Geruch hing in der Luft. Dutzende Fliegen schwirrten umher. Sein Magen protestierte und er machte einen großen Schritt um die Lache. Aus der Brusttasche zog er die Zigaretten-Packung und zündete sich eine an. Er blickte sich in dem Raum um. An den Wänden hingen einige vergrößerte und gerahmte Fotos. Zwei blonde Kinder, mal in Winterkleidung vor einer Bergkulisse, mal mit ihren Eltern abgelichtet, im Hintergrund das Meer und Backsteinhäuser. Wahrscheinlich eine europäische Stadt. Auf dem Holzfußboden vor der Sitzgruppe war mit Kreide der Umriss eines Menschen eingezeichnet. Kein Blut. Ein junger Mann in Designerjeans und einem neongrünen T-Shirt mit einem Alienkopf und dem Aufdruck CANTINA BAR MOS EISLEY löste sich aus dem Schatten eines Mangobaumes und kam auf ihn zu. Seine auffallend weit auseinanderstehenden, großen, dunklen Augen verliehen ihm einen etwas melancholischen Ausdruck. Mit seiner struwweligen Frisur sah er nicht aus wie ein Kriminalbeamter, eher hätte man ihn sich noch hinter der Konsole eines Computerspiels vorstellen können. „Delegado. Gut, dass Sie da sind. Die haben ihn schon weggebracht“, sprach er mit einem abfälligen Blick auf die Gruppe von Uniformierten, die rauchend auf der Terrasse und im Garten herumstanden.
Teixeira grunzte: „Was machen die ganzen Dorfsheriffs hier? Die sollen weiter Verkehrssünder auf der Rio-Santos erschrecken. So, Wanderlei, nun erkläre noch mal in Ruhe, wofür ich mich bei der Affenhitze stundenlang ins Auto gesetzt habe. Ist das ein Scheiß-Verkehr an einem Feiertag! Ich nehme an, du bist mit deiner Maschine wesentlich schneller durchgekommen. Meine Klimaanlage streikt schon wieder. Wer von den Typen da ist der Tote?“
„Die Leiche hat man erst mal nach Bertioga in die Krankenstation gebracht. Heute Abend soll sie nach São Paulo in die Gerichtsmedizin überführt werden, aber dafür müssen sie erst einen Kühlwagen auftreiben. Bis dahin musste der Bestand des Supermarkts an crushed ice herhalten“, führte der junge Mann sachlich aus, ohne auf Teixeiras Bemerkung einzugehen. Wanderlei zog sein Smartphone aus der Tasche und wischte auf dem Display herum.
Teixeira kannte sich mit dem modernen Zeug nicht aus. iPhone, iPad, Notepad, Tablet. Wo sollte der Vorteil darin liegen, dass man seine Notizen in so ein Ding eintippte, zumal er mit seinen Wurstfingern wahrscheinlich niemals die richtigen Tasten treffen würde? Wobei die Telefone noch nicht einmal mehr Tasten hatten, sondern so komische bunte Symbole, Icons. Spielzeug. Er hatte sich gerade mit seinem einfachen Klapphandy arrangiert und im Büro musste er notgedrungen auch mit einem PC arbeiten. Ansonsten versuchte er, unwichtige Informationen schnell zu vergessen und wichtige in seinem Kopf aufzubewahren.
Der junge Ermittler hatte gefunden, wonach er gesucht hatte. „José Gabriel Tavares, geboren am 28.06.1967 in Mogi Das Cruzes. In der Schale auf dem Schränkchen da drüben lagen seine Papiere zusammen mit den Autoschlüsseln. Ich habe inzwischen etwas recherchiert. Er war der Sohn eines Kommunalpolitikers. Nach seinem Wirtschaftsstudium in São Paulo verschlug es ihn nach Pará. In den Neunzigern heuerte er bei Indústria Madeiras an, einem holzverarbeitenden Betrieb oben in Manaus, und machte in dem Unternehmen Karriere. Zuletzt war er für das Europageschäft verantwortlich und er war Sprecher der Vereinigung der Holzbetriebe in Pará. Offenbar hatte er gute Kontakte zur ABP.“
Die Aliança pelo Brasil war eine rechtsnationale Gruppierung, deren bekanntestes Mitglied der frisch gewählte Präsident Bolsonaro war. Nun war auch klar, warum der Geral sich in die Sache eingeschaltet hatte. Der Leiter der Mordkommission hegte gerüchtehalber Sympathien für den Verein. Wanderlei fuhr fort: „Das Haus gehört einem gewissen Gerhart Wagner, ein mittlerweile pensionierter, ehemaliger Direktor von Volkswagen. Ich habe vorhin mit seiner Haushälterin telefoniert und ihm ausrichten lassen, dass er mich zurückrufen soll, wenn er nach Hause kommt. Sie sagt, er sei Tennis spielen. Dieser Wagner ist übrigens quasi ein Nachbar von Ihnen. Então, was wir bislang wissen, ist, dass eine gewisse Flora Maria da Fonseca heute Morgen hier das Strandhaus sauber machen wollte. Sie ist bei einer Reinigungsfirma angestellt, die hier im Ort die ganzen Pousadas und einige von den privaten Ferienhäusern in Ordnung hält. Senhora da Fonseca hat einen Schlüssel und ist hinten zur Küchentür rein, wie sie sagt. Wie üblich fängt sie in der Küche an, wäscht die paar Teller und Gläser ab, die Sie draußen neben der Spüle sehen könnten, bringt den Müll raus und so was. Dann schnappt sie sich das Putzzeug und arbeitet sich zum Wohnzimmer vor. Hier muss sie dann den Toten gesehen haben, rennt völlig aufgelöst zwei Männern einer privaten Sicherheitsfirma vors Auto und fällt in Ohnmacht. Da hinten sitzt sie bei dem gelben Mann.“
Teixeira warf die Kippe in den Putzeimer, zog ein fleckiges Taschentuch aus der Hosentasche und wischte sich den Schweiß vom Nacken. Es war mittlerweile kurz vor eins und die Sonne stand hoch am wolkenlosen Himmel. „Bom, jetzt weiß ich, dass die Gute den Toten findet, aus dem Haus rennt und umfällt. Hat Fernanda am Telefon nicht irgendwas davon gesagt, dass die Leiche irgendwie ungewöhnlich aussah? Kennen wir inzwischen die Todesursache?“ Wanderlei verzog keine Miene, als er die Fakten aufzählte: „Der Arzt sagt, dass Tavares sehr wahrscheinlich vergiftet wurde, wobei er noch nicht sagen konnte, womit. Seiner Meinung nach lag Tavares hier schon ein paar Tage, dem Grad der Verwesung nach zu urteilen. Das ist aber noch nicht alles. Seinem Pinto muss etwas widerfahren sein, was die Reaktion der guten Flora Maria erklärt.“
Teixeira grunzte: „Kannst du dich vielleicht etwas deutlicher ausdrücken? Vergiftet? Und was ist das für ein Unsinn mit seinem besten Stück?“
Wanderlei drehte sich um und winkte die ältliche Matrone und einen Mann zu sich, der die Phantasieuniform eines privaten Wachdienstes trug. Über dem Kopf des Mannes schwebten graue Wattebäusche. „Erzählt dem Delegado hier noch einmal, wie das war, als ihr den Verblichenen gefunden habt!“
Der Mann sah aus, als hätte er seit einigen Nächten nicht geschlafen. Er hatte dunkle Augenränder und eine ungesunde Gesichtsfarbe. Man sah ihm an, dass er lieber zuhause an einer Flasche Fusel nuckeln würde, als den ganzen Polizisten hier die Geschichte wieder und wieder zu erzählen. Er trat unruhig von einem Bein aufs andere. Die Frau sah eingeschüchtert von einem zum anderen und schwieg. „Senhor Delegado, mein Kollege Henrique da hinten und ich saßen in unserem Auto draußen an der Straßenecke, unsere Schicht war beinah vorbei, als diese Frau auf uns zu gerannt kam und dabei wie eine Furie gebrüllt hat und sich immer wieder umgeblickt hat, als sei der Leibhaftige hinter ihr her. Direkt vor meinem Fenster hat sie dann die Augen verdreht und ist auf die Straße gefallen. Ich hab’ die Tür nicht aufgekriegt und Henrique musste erst ums Auto ’rum gehen und die Frau wegzerren, ne? Wir ham’ dann über Funk den Krankenwagen gerufen und ich bin dann zu dem Haus hier gegangen, weil ich doch wissen wollte, was die Arme so erschreckt hat, ne?“
Jetzt rief die Matrone dazwischen: „Ai, que coisa. Da spricht dieser Mensch hier, als wenn ich nicht dabei gewesen wäre. Natürlich habe ich gerufen. Ich wollte ja schließlich, dass jemand kommt und sich das mit ansieht. Und dass mir dann etwas schwindlig geworden ist, kann man doch auch verstehen, nicht? Man findet ja nicht jeden Tag einen Toten und dann auch noch so nackt und sein …“ Sie blickte verschämt zu Boden.
Teixeira war sich sicher, dass sie noch für Wochen und Monate was zu erzählen hatte.
Der Wachmann fuhr mit seinem Bericht fort: „Die Hintertür war offen. Ich hab’ gerufen, aber es hat sich niemand gemeldet. Es hat ganz komisch gerochen. Letzte Woche lag auf der Straße vor dem Haus, wo ich mit meiner Familie wohne, ein toter Hund. Der hat auch so gestunken. Ich bin dann rein gegangen und da habe ich den armen Kerl dann liegen sehen, ne?“ Er deutete über die Schulter auf die Kreideumrisse auf dem Fußboden. „Als ich den da so liegen sah, musste ich erst mal kotzen, ne? Der Typ war ganz schwarz und aufgequollen. Am schlimmsten war aber, dass der untenrum ganz komisch aussah, irgendwie aufgeplatzt.“
Die Empregada zerzauste sich die Haare und rief dazwischen: „Ai, o Delegado, wie der aussah!“
Sie ließ die Männer im Unklaren, ob DER sich auf den ganzen Toten oder nur auf bestimmte Teile bezog. Meireles nickte zustimmend. Es sah aus, als würde ein dürres Huhn nach Körnern picken. „Ich hab’ zugesehen, dass ich nichts anfasse und bin zurück zu Henrique und dann zur Polizeistation gelaufen. Sind ja nur zwei Straßen, ne. Aber das habe ich ja alles schon den Polizisten erzählt und dem jungen Delegado hier. Bitte, kann ich jetzt gehen? Meine Frau wird sich sicher nicht freuen, wenn sie alles allein vorbereiten muss.“
Teixeira brummte: „Ich danke Ihnen, dass Sie sich nochmals die Zeit genommen haben, mir das selbst zu berichten. Sie können jetzt gehen und Sie auch, Senhora da Fonseca. Ich wünsche Ihnen Frohe Ostern. Halten Sie sich aber bitte beiden den hiesigen Kollegen zur Verfügung, falls sie noch Fragen haben.“
Der Wachmann beeilte sich, aus dem Haus zu kommen, die Matrone schnappte sich ihren Putzeimer und watschelte ebenfalls hinaus. Vor der Tür konnte man sie noch hören: „Senhora hat er mich genannt, der Delegado. Der weiß, was sich gehört, nicht so unfreundlich wie der Junge.“
Teixeira fuhr sich mit den Fingern durch die Bartstoppeln. „Wanderlei, Mittag ist durch und mein Magen knurrt. Ich denke, wir sollten eine Kleinigkeit essen gehen und dabei überlegen, was hier eigentlich vor sich geht.“
Sie fuhren in das Restaurant gegenüber des Shopping, das natürlich kein richtiges Einkaufszentrum war, sondern eine Reihe von Geschäften beherbergte, die Badekleidung, Spielsachen und Kunsthandwerk anboten. Das Ganze war österlich geschmückt, was hier am Strand besonders befremdlich wirkte. Teixeira nahm einen Pescado a Cambucu, der ganz ausgezeichnet war. Um diese Tageszeit waren sie fast die einzigen Gäste, obwohl der Ort sich bereits immer weiter füllte. Wanderlei nahm wie immer eine Portion Pommes Frites mit einer Unmenge Ketchup und trank dazu seine unvermeidliche Guaraná.
Ernesto Aparecido Teixeira arbeitete seit ungefähr einem Vierteljahrhundert in der Mordkommission bei der D. H. P. P. der Polícia Civil do Estado de São Paulo und war seit nunmehr acht Jahren Leiter der 1a delegacia. Er nannte Wanderlei zwar seinen Assistenten, aber das war genau genommen nicht korrekt. Wanderlei Freitas de Conceição absolvierte ein Duales Studium der Kriminologie an der Academia Nacional de Policia und leistete derzeit ein Praktikum als Ermittler bei der D. H. P. P. ab. Der Geral war der Ansicht, Teixeira habe genug Lebenserfahrung, um mit der ‚besonderen Situation‘ umzugehen. Die Besonderheit bestand darin, dass Wanderlei Synästhetiker war. Wer den jungen Mann nicht näher kannte, mochte sich über sein manchmal wunderliches Verhalten amüsieren. Seine Eltern und Lehrer in der Schule hatten sich offenbar bemüht, ihm einige Grundregeln für die Interaktion mit anderen Menschen zu vermitteln, aber es gab Situationen, in denen seine ungewöhnlichen Sinnesempfindungen seine Kollegen und Mentoren in Erklärungsnot brachten. Wanderlei ‚sah‘ Emotionen. Er hatte Teixeira versucht zu erklären, dass sich die Empfindungen anderer Menschen für ihn in Farben und Formen manifestierten.
Teixeira hatte gefragt: „Du meinst, wenn jemand wütend ist, schwebt ein rotes Dreieck über ihm?“
„Nun, ganz so einfach ist es nicht, aber damit wir eine gemeinsame Kommunikationsebene haben, lassen wir das mal als simples Beispiel so stehen. Ein Kinderpsychologe hat es mich einmal malen lassen. Er hat die Bilder genommen und sie in einer Fachzeitschrift veröffentlicht. Meine Mutter hat ein Exemplar aufbewahrt und es mir einige Jahre später gezeigt. Ich habe sie abfotografiert. Hier.“
Wanderlei hatte Teixeira das Smartphone hingehalten und der Delegado hatte die Bilder betrachtet, die einen zutiefst verstörenden Eindruck auf ihn ausgeübt hatten. Teixeira fehlte wie jedem Nicht-Synästhetiker die Fantasie sich vorzustellen, wie sich so etwas in dem Jungen anfühlen musste, aber er wusste, dass in dem Lockenkopf ein ausgewiesen heller Verstand arbeitete. Er mochte den Jungen und stellte sich nicht selten vor ihn, wenn er durch sein Verhalten mal wieder angeeckt war. Der Delegado stellte noch einmal seine Frage: „Was hat Tavares hier getrieben? Ostern am Strand. Ganz allein? Hat er keine Familie?“ Wanderlei schnalzte verneinend mit der Zunge. „Er ist geschieden und seine greise Mutter wohnt irgendwo im Landesinneren. Die Ehe war kinderlos. Alles, was ich über ihn gefunden habe, steht in Verbindung mit seinem Engagement für die Holzindustrie. Diese Provinzpolizisten versuchen seit heute Morgen seine Exfrau aufzutreiben. Irgendwer muss sich schließlich darum kümmern, dass der Mann unter die Erde kommt.“
Der Delegado versuchte sich zu erinnern, was er über die Holzindustrie wusste. Das war nicht viel. Seit einigen Jahren hatte sich durch den weltweit entstandenen Druck wohl so etwas wie ein Grünes Gewissen entwickelt und man versuchte, der unkontrollierten Abholzung des Regenwaldes Einhalt zu gebieten. In der Folha hatte er mal etwas gelesen von einem Conselho Brasileiro Florestal oder so ähnlich. Wanderlei würde hier nachforschen müssen. „Pronto. Fahren wir zurück und reden wir mit dem Hausbesitzer. Vielleicht kann er uns erklären, was Tavares allein hier unten wollte.“ Er winkte den Kellner herbei und drücke seine Kippe im Aschenbecher aus.
Sie machten sich auf den Rückweg nach São Paulo. Die Imigrantes war stadteinwärts nicht sehr befahren. Wanderlei auf seiner Enduro und hinter ihm Teixeira in seinem verbeulten SUV schoben sich an den bunt bemalten LKWs vorbei, die sich mit Früchten und Fisch für die Hauptstadtmärkte schwer beladen die Serra do Mar hoch quälten. Nach knapp zwei Stunden gelangten sie über Diadema nach Interlagos.
Teixeira fluchte. Ostern war so gut wie gelaufen. Er rief seine Frau an und sie bat ihn gereizt, wenigstens noch schnell im SP-Market vorbeizufahren und etwas Wein und frisches Brot mitzubringen. Das Haus von Gerhart Wagner lag unweit des Parque Jacques Cousteau. Wanderlei hatte maßlos übertrieben. Das Häuschen der Teixeiras befand sich zwar auch in Interlagos, unweit der Humboldt-Schule, aber von Nachbarschaft zu sprechen, verbot sich schon angesichts der Ausmaße dieses Palastes. Teixeira meinte sich zu erinnern, dass das ebenso große Anwesen nebenan ein Geschenk eines Formel 1-Fahrers an seine Eltern gewesen war. Schräg gegenüber an der Straßenecke saß ein alter Mann vor einem provisorischen Wachhäuschen und schaute gelangweilt den Joggern und Hundehaltern zu, die um den See hechelten. Einige Jahre und etliche Kilo früher war Teixeira auch hier entlang gejoggt, zu der Zeit war das hier überwiegend noch Erdstraße gewesen.
Sie hatten ihren Besuch vorher angekündigt. Ihr Klingeln wurde von dem heiseren Gebell zweier Schäferhunde beantwortet. Eine Empregada öffnete ihnen die Haustür, nachdem sie das Tor per Fernsteuerung geöffnet und hinter ihnen wieder geschlossen hatte. Das Hausmädchen geleitete sie in den ersten Stock ins Arbeitszimmer. Das ganze Haus war ein einziges Museum. An jeder Wand hingen Skulpturen, Schnitzereien, Keulen, Speere, Wandteppiche und Gegenstände aus Metall, wahrscheinlich Messing. Das Arbeitszimmer war geradezu überladen. Vor dem imposanten Schreibtisch stand ein bestimmt anderthalb Meter langer Löwe aus einem wunderschönen, honigfarbenen Holz. Die hintere Wand war übersät von dutzenden Masken unterschiedlichster Form. Senhor Wagner schien viel gereist zu sein und er war eindeutig ein Sammler. Wagner war ein freundlicher, älterer Herr. Er mochte Mitte Sechzig sein. Seine Kleidung war leger, aber teuer. Seine ihm verbliebenen Haare waren schlohweiß. Er kam hinter dem Schreibtisch hervor, begrüßte sie freundlich und bat sie Platz zu nehmen. Die Sessel waren schwer und aus einem ähnlichen Holz gefertigt wie der Löwe.
Teixeira eröffnete die Unterhaltung: „Senhor Wagner, ich danke Ihnen, dass Sie so kurzfristig Zeit für uns haben. Angesichts des besonderen Tages sind wir auch gleich wieder verschwunden. Wir wissen noch nicht wirklich viel. Klar scheint, dass Sie dem Verstorbenen Ihr Wochenendhaus vermietet haben. Kannten Sie den Mann?“
Wagner sprach ein sehr flüssiges Portugiesisch, der leichte Akzent störte nicht: „Ihr Kollege hier hat am Telefon erwähnt, dass der arme Mensch wahrscheinlich an Gift gestorben ist. Haben Sie inzwischen schon Näheres über die Todesumstände herausgefunden? Die Nachricht hat mich doch etwas mitgenommen, wissen Sie? Auch wenn ich ihn nicht persönlich kannte, so ist für mich der Tod doch nichts Alltägliches, zumal der Mann in unserem Strandhaus verstorben ist. Warum interessiert sich die Polizei dafür? Mordkommission, sagten Sie?“
„Wir wissen nur so viel, dass die Todesursache eine Vergiftung ist. Wir ermitteln zunächst gegen Unbekannt. Das ist die normale Vorgehensweise bei einem Tod mit unklarem Hergang“, log er. „Vielleicht können Sie uns ein wenig helfen, Näheres über den Hintergrund herauszufinden. Wieso haben Sie dem Mann eigentlich Ihr Strandhaus vermietet, machen Sie das öfter?“
Wagner zögerte etwas mit der Antwort. „Der Mann ist, war, offenbar der Bekannte einer guten Freundin, mit der meine Frau und ich gelegentlich Bridge spielen.“
Teixeira unterbrach ihn: „Wo ist eigentlich die Senhora? Ist sie zuhause?“
„Meine Frau macht noch ein paar Erledigungen für das Fest. Sie wird sicher bald zurück sein. Ich denke aber nicht, dass Sie etwas zur Aufklärung Ihres Falles beitragen kann.“
Teixeira hakte nach: „Zurück zu dem Mieter und Ihrer Bekannten, bitte.“
„Das ist ganz einfach. Unsere Freundin fragte mich vor ungefähr drei Wochen, ob wir das Haus für die Feiertage vermieten wollen. Seit unsere Kinder aus dem Haus sind, sind meine Frau und ich immer seltener am Strand. Das Häuschen haben wir uns schon vor vielen Jahren zugelegt und anfangs sind wir fast jedes Wochenende mit den Kindern hinuntergefahren. Damals war die Verkehrssituation noch nicht so chaotisch. Seit Juquehy sich zu einem Touristenort entwickelt hat, fahren wir eigentlich kaum noch hin. Manchmal fragt jemand aus dem Bekanntenkreis an, ob er das Häuschen für ein Wochenende oder über die Feiertage anmieten kann. Da wir ja auch ein wenig Instandhaltungskosten haben, nimmt man solche Gelegenheiten schon mal wahr. Der Schlüssel ist bei einem Hausverwalter hinterlegt und über diesen wickeln wir auch die Bezahlung ab.“
Teixeira dachte sich, dass Wagner eigentlich nicht danach aussah, als sei er auf die Einnahmen aus der Vermietung von Strandhäusern angewiesen. „Würden Sie uns freundlicherweise den Namen und die Adresse Ihrer Bekannten geben? Wir würden gerne mit ihr über ihr Verhältnis zu dem Toten sprechen.“
„Natürlich. Sie heißt Anna do Nascimento. Sie unterhält seit der Trennung von ihrem Mann in Embu eine kleine Galerie. Heute dürfte sie allerdings geschlossen haben.“
„Wir werden über Ostern nicht mehr nach Embu fahren. Tavares ist tot, da kommt es auf einen Tag nicht an.“
Wagner fragte: „Tavares? Das ist der Name des Toten?“
Teixeira erhob sich und der junge Ermittler machte es ihm nach. „Senhor Wagner, wir danken Ihnen für Ihre Zeit. Es ist leider nicht ausgeschlossen, dass wir Sie nochmals behelligen müssen, falls sich im Laufe der Ermittlungen weitere Fragen ergeben sollten. Ja, der Tote hieß José Gabriel Tavares. Sie werden davon in der Zeitung lesen. Wenn Sie Glück haben, werden die Schreiberlinge dabei nicht Ihren Namen als Vermieter des Hauses nennen.“
Er machte einen Schritt auf das Fenster zu. Im Garten standen einige meterhohe Dattelpalmen und ein Pool mit olympischen Ausmaßen lud zum Abkühlen ein. Teixeira interessierte sich insbesondere für zwei Blasrohre, ein kurzes und ein längeres, die zusammen mit einigen archaisch anmutenden Keulen oder Holzschwertern über dem Fenster arrangiert waren. „Indios?“, fragte er.
„Ach die. Die haben wir vor Jahren einmal von einer Reise nach Zentralbrasilien mitgebracht. Sie sind das Geschenk eines Stammes der Awaeté, die am Rio Xingu leben. Sie haben sich sicher schon gewundert, dass wir unser Haus zum Museum gestaltet haben. Ich liebe all diese Dinge. Jedes einzelne Stück hat seine ganz persönliche Geschichte. Manchmal schaue ich mir eines an und fühle mich in Zeit und Raum an den Ort versetzt, an dem es seinem Ursprung hatte. Meine Herren, ich wünsche Ihnen Frohe Ostern.“
„Das wünsche ich Ihnen auch und richten Sie bitte unbekannterweise einen Gruß an die Senhora aus.“
Als sie draußen waren, sah Teixeira auf die Uhr. „Mein lieber Wanderlei, wenn ich jetzt nicht heimfahre, komme ich zu spät zu unserem Abendessen und Silvana reißt mir den Kopf ab.“
Wanderlei stellte sich vor, wie Teixeira ohne Kopf aussehen mochte. Wahrscheinlich wurde jetzt eine ähnlich sinnlose Information von ihm verlangt. „Ich fahre jetzt zuhause vorbei, um mich umzuziehen und dann besuche ich meine Eltern.“
„Frohe Ostern und danke, dass du an einem Feiertag mitgekommen bist.“ Teixeira versuchte sich daran zu erinnern, wo Wanderleis Eltern wohnten, aber er kam nicht darauf.
Ῠ
João schlurfte über den Hof und stellte den Blecheimer vor dem Brunnen in den staubigen Boden. Mit einer Hand schirmte er seine Augen gegen die Nachmittagssonne ab und schaute den Pinselohräffchen zu, die sich den grauen Stamm des riesigen Kapokbaumes hinauf und hinab jagten. Der Patrão müsste bald zurückkommen. Sonntags fuhr Dom Alfonso mit Dona Emilia in die Stadt. Erst besuchten sie den Gottesdienst in der Capela de São Benedito und danach saßen sie mit den anderen Patrões im Haus des Prefeito auf der Veranda und tranken Kaffee. Er wusste das nur, weil Gigante, der die Kutsche fahren durfte, ihm hinterher immer alles genau erzählte. João war nicht mehr in einer Stadt gewesen seit damals, vor nunmehr fünf Ernten, als Dom Alfonso ihn gekauft hatte. Er schob den Eimer unter die Pumpe und bediente den Schwengel. Den vollen Eimer trug er ins Haus und stellte ihn vor der Treppe ab. Das musste reichen. Wenn die Kutsche auftauchte, würde eines von den Mädchen für die Patroa die Holzscheite unter der Wanne entfachen. Sonntag war Badetag. Drinnen lagen die Frauen auf den Knien und schrubbten den Holzboden. Sonntag war auch der Tag, das Haus von oben bis unten zu putzen. An den anderen Tagen waren die Frauen auf dem Feld oder kümmerten sich um das Vieh.
João griff im Hinausgehen der drallen Gabriela an die Brüste. Das Mädchen stieß einen Schrei aus und warf den Scheuerlappen nach ihm. João lachte dröhnend. Er wusste, dass Elumbu, wie sie mit ihrem alten Namen hieß, scharf auf ihn war. Er trat auf die Veranda und suchte den Horizont ab. Noch war nichts zu sehen. Der Patrão hatte einmal erwähnt, dass die Fazenda nicht sehr groß war, dennoch reichten die Zuckerrohrfelder von dem Fluss im Westen bis zu den Hügeln im Norden. Die Stadt lag hinter den Hügeln, mit der Kutsche etwa zwei Stunden entfernt. Er ging hinüber zu den aus Holzstämmen gefertigten Behausungen der Sklaven und rief zu dem alten Esaia, der auf dem Boden hockte und mit einem Stein die Macheten schärfte: „Mzee, pass auf, dass du dir nicht noch einen Finger abschneidest, sonst hast du irgendwann überhaupt keine mehr und musst dich von den Frauen füttern lassen!“ Der Alte entblößte seine Zahnstummel und legte den Kopf schief. „Mavinga, mein Sohn, und dir rate ich, dass du heute nicht wieder durch das Fenster schielst, wenn die Patroa badet, sonst wird der Patrão dich irgendwann den Hunden überlassen! Und was sollen die Hühner ohne ihren Gockel anstellen? Von mir alten Hahn lassen sie sich nicht mehr scheuchen.“
Der Jüngere machte eine obszöne Geste und schlenderte an dem alten Mann vorbei hinter die Hütte. Dort schlug er geräuschvoll sein Wasser ab und hockte sich in den Schatten eines Mangobaumes, nicht ohne sich eine von den reiferen Früchten gepflückt zu haben. Auf den obersten Ästen schnatterten die Sittiche um die Wette und grün und blau glänzende Kolibris flogen von Blüte zu Blüte. Genüsslich riss er mit seinen kräftigen Zähnen das Fleisch von der Frucht. Der Saft tropfte ihm auf die nackte Brust, auf der die knotigen Linien der Stammeszeichen deutlich hervortraten. João mochte die Sonntage. Der Patrão war ein frommer Mann. Sonntags wurde nicht gearbeitet. Wenigstens nicht auf dem Feld. Gegen leichte häusliche Tätigkeiten hatte der Eine Gott offenbar nichts einzuwenden. Aber der Eine Gott mochte das Tanzen nicht und das machte João zu schaffen. Als der Padre ihn getauft hatte, hier auf der Fazenda, hatte er den Sklaven sehr drastisch erklärt, dass ihre Seele nicht in den Himmel auffahren würde, wenn sie nicht abließen von den Bräuchen ihrer Vorfahren. Sie würden in der Hölle schmoren, wo Teufel und Dämonen wohnten, und wo es noch heißer war als auf dem Feld bei hochstehender Sonne. João dachte sich, dass die Hölle vielleicht nicht heißer sein konnte als in dem stinkenden Bauch des Schiffes, das ihn und seine Stammesgenossen hergebracht hatte. Der alte Esaia, der schon hier war, als sie in vielen Tagesmärschen von der großen Stadt am Meer bis zu dieser Fazenda hier gelaufen waren, hatte ihnen erzählt, dass diese Schiffe Caravela genannt wurden. Esaia hatte bereits über zwanzig Ernten auf dieser Fazenda erlebt und hatte in dieser langen Zeit genug gelernt, um ihnen immer wieder Dinge zu erklären. Esaia war an der Küste eines Landes gefangen worden, dessen Namen er nicht kannte. Er sagte, er sei ein Bemba. Seine Sprache war ähnlich wie das Umbundu, das João und die anderen früher sprachen.
Dom Alfonso saß mit den anderen Männern auf der Veranda des stattlichen Hauses, das der Prefeito, Dom Rui de Guzmão, mit seiner reizenden Gattin und seinen fünf Töchtern bewohnte. Die Damen nahmen ihren gekühlten Tee im großen Salon ein, wogegen die Herren ihren Kaffee und ihre Zigarren in der Mittagshitze, aber immerhin im Schatten genossen. Während man in den vergangenen Monaten die spärlichen Nachrichten aus der Heimat und in erster Linie den Verfall der Zuckerpreise auf den europäischen Märkten diskutiert hatte, dominierten die zunehmenden Berichte über entlaufene Sklaven inzwischen die Gespräche. Dom Felipe wetterte gerade: „Man stelle sich nur vor! Dieser Zumbi, oder wie immer dieser Negro sich nennt, und seine marodierenden Banden haben letzten Monat eine ganze Schwadron Reiterei, die der Provinzgouverneur zu seiner Züchtigung in Marsch gesetzt hat, in der Serra da Bariga abgeschlachtet. Wie sollen die Plantagen mit Gewinn weitergeführt werden, wenn die Sklaven ihren Herren entfliehen und die Companhia immer neue Schiffe nach Afrika entsenden muss, um den Nachschub sicherzustellen!“
Die anderen Männer pflichteten ihm bei. Dom Rui richtete sich an Dom Alfonso: „Sagt, habt ihr inzwischen den Verwalter, der Euch auf Eurer Fazenda mit der Beaufsichtigung Eurer zusätzlichen Sklaven zur Hand gehen soll?“
Dom Alfonso blies den Rauch seiner Zigarre an die Decke und zwirbelte seinen spärlichen Schnurrbart, der ihm das Aussehen eines Katers verlieh. Er hatte sich nur widerwillig mit dem Gedanken angefreundet, einen Verwalter einstellen zu müssen. Sein Großvater, Dom Felipe Gonçalves da Fonseca, hatte die Plantage vor nunmehr fast sechzig Jahren auf dem fruchtbaren Boden angelegt und im Laufe der Zeit ihre Grenzen immer weiter ausgedehnt. Die Sklaven, anfangs einheimische Indios, später schwarze Männer von der Küste Südwestafrikas, waren der Garant für den stetigen Gewinnzuwachs gewesen. Jetzt steckte das Kerngebiet des kolonialen Brasilien in einer schweren Wirtschaftskrise, weil das Überangebot an billigen Arbeitskräften durch die schnell wachsende Konkurrenz aus den französischen, niederländischen und britischen Kolonien in der Karibik noch verstärkt wurde.
„Wisst ihr, Dom Rui, ich will nicht, dass mein Vater in der Schlacht von Guararapes sein Leben im Kampf um unser neues Heimatland umsonst hingegeben hat. An seiner Seite sind etliche unserer Sklaven gefallen. Manch einer von ihnen hat zusammen mit seinem Herrn tapfer gegen die holländischen Okkupanten gekämpft. Ich werde aber verdammt nochmal auch um meine Ländereien kämpfen und wenn das bedeutet, dass ich zusätzliche Anbaufläche bewirtschaften muss, dann soll es eben sein. Der Mann ist gestern aus Maceió hier angekommen und er wird mit mir heute noch zurückfahren.“
Dom Felipe sah ihn lauernd an. „Man sagt, der Mann sei Spanier. Befürchtet Ihr nicht Insubordination?“
„Spanier, Engländer, selbst Deutscher. Wisst Ihr, die Herkunft sollte nicht von vorrangiger Bedeutung sein. Wichtig ist doch, dass der Mann etwas von seiner Arbeit versteht und sich mit Herzblut der brasilianischen Identität verschrieben hat. Er war zuletzt auf einer großen Plantage in der Nähe von Recife angestellt und bringt hervorragende Referenzen mit.“
Den Seitenhieb gegen Dom Felipe wegen der brasilianischen Identität konnte sich Dom Alfonso nicht verkneifen. Es war bekannt, dass Dom Felipe noch sehr enge Verbindungen ins Mutterland unterhielt und das Land am westlichen Ende des Atlantiks nach wie vor als Kolonie betrachtete, die es finanziell auszubeuten galt. Ihm gehörte die größte Fazenda weit und breit, zudem hielt er nicht unerhebliche Anteile an der Companhia Geral do Comércio do Brasil.
Dom Alfonso erhob sich. „Dom Rui. Ich bedanke mich für Eure Gastfreundschaft, aber wenn ich noch vor Sonnenuntergang zuhause sein will, muss ich mich nun auf den Weg machen. Zumal die Rückfahrt heute länger dauern wird.“
Mittlerweile waren die Schatten länger geworden. Die Sonne stand jetzt schon sehr niedrig. Plötzlich meinte João, den Ruf eines durstigen Ochsen gehört zu haben. Er stand auf und kletterte behände auf den Baum. Dort! Vor dem nächsten Hügel war eine Staubwolke zu sehen. Fast meinte er das Stampfen der Hufe auf der Erde zu spüren. Für die Kutsche des Patrão war es zu viel Staub. Er sprang rückwärts von dem Ast und kam federnd wie eine Katze auf dem Boden auf. Er klatschte laut in die Hände und rief: „Es kommt jemand! Tut so, als wenn ihr beschäftigt wärt!“
Grinsend und feixend rannte er über den Hof und scheuchte dabei einige Agutis auf, die sich am Fuße eines noch jungen Paranussbaumes um heruntergefallene Nüsse gebalgt hatten. In ihrem Zwinger hinter dem Haus schlugen die Mastim des Patrão an. Diese Biester durften nicht frei herumlaufen, weil sie den Anblick der Negros nicht ertragen konnten und jedes Mal ganz wild wurden, wenn einer der Sklaven in ihre Nähe geriet. Die männlichen Sklaven versammelten sich vor dem Tor und tuschelten aufgeregt miteinander. Einige hielten die langen Messer fürs Zuckerrohrschneiden in den Händen. Man wusste ja nicht, wer da kam. Inzwischen konnte man erkennen, dass es doch die Kutsche des Patrão war. Aber hinter ihr rumpelte ein Ochsenkarren über die rote Erde. Es hatte seit drei Wochen nicht geregnet, deshalb wirbelten die Hufe der Zugtiere Staub und trockenes Gras auf. Die dummen Ochsen brüllten vor Durst und Anstrengung und versuchten mit ihren Zungen die Fliegenschwärme von ihren hervorquellenden Augen zu vertreiben. Was João und die anderen aber verstummen ließ, war der Anblick des knappen Dutzend halbnackter schwarzer Männer und Frauen, die auf dem Karren hockten und sich ängstlich umblickten. Der Patrão hatte neue Sklaven gekauft!
Der kleine Zug kam zum Stehen und Dom Alfonso stieg aus der Kutsche, um Dona Emilia persönlich aus dem Wagen zu helfen. Vom Bock des Ochsenkarrens sprang ein kleiner, drahtiger Weißer herab und klopfte sich den Staub von der Lederweste. Er blickte sich um und wandte sich an João, der am nächsten zu ihm stand. „He, du. Komm mal her.“ Er deutete hinter sich. „Nimm dir ein paar Männer und schaff die stinkenden Nigger hier vom Wagen. Am besten schrubbt ihr sie mal richtig ab. Die riechen, als wären sie vom Schiff direkt hierher gelaufen.“
João bewegte sich nicht, sondern blickte ratlos zu dem Patrão. Dom Alfonsos wasserblauen Augen schienen durch ihn hindurch zu blicken. Er rief: „Was steht ihr noch herum? Habt ihr nicht gehört, was Senhor Sánchez Navarro gesagt hat? Bewegt euch gefälligst! Hört mal alle her! Senhor Sánchez Navarro ist der neue Guarda. Ihr müsst ihm so gehorchen, als hätte ich die Anordnung selbst erteilt. Kommt, meine Liebe, gehen wir ins Haus.“