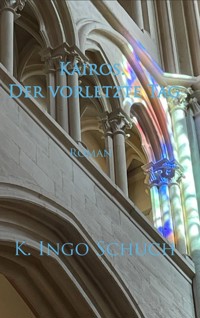Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
Delegado Anderson Luiz Meireles aus Belém steht vor seinem größten Rätsel. Scheinbar treibt im Regenwald der Abá jaguara, der Jaguarmann, sein Unwesen. Menschen verschwinden und kehren als wandelnde Tote zurück. Eine geheimnisvolle Seuche breitet sich aus. Auch Ernesto Teixeira in São Paulo und seine alte Bekannte Verena Leipoldt vom LKA Hessen geraten in die Ermittlungen. Der Albtraum einer neuen Epidemie nimmt Gestalt an. Und diesmal gibt es kein Gegenmittel. Mortos Vivos ist das zweite Buch eines Zyklus rund um die Ermittler Teixeira, Wanderlei und Meireles in Brasilien und Verena Leipoldt vom LKA Hessen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 395
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
K. Ingo Schuch
Mortos Vivos
Leipoldt-Reihe, Band II
Von K. Ingo Schuch bisher erschienen:
Tod im Regenwald
Leipoldt-und Teixeira-Reihe Band I
ISBN: 9783818777012
Über den Autor:
K. Ingo Schuch lebt und arbeitet überwiegend im Hochtaunus, unweit von Frankfurt am Main.
Nach mehr als dreißig Jahren in der Reisebranche fing er mit dem Schreiben an. Alle Länder, in denen seine Geschichten spielen, hat er selbst bereist.
Über dieses Buch:
Delegado Anderson Luiz Meireles aus Belém steht vor seinem größten Rätsel. Scheinbar treibt im Regenwald der Abá jaguara, der Jaguarmann, sein Unwesen. Menschen verschwinden und kehren als wandelnde Tote zurück. Eine geheimnisvolle Seuche breitet sich aus. Auch Ernesto Teixeira in São Paulo und seine alte Bekannte Verena Leipoldt vom LKA Hessen geraten in die Ermittlungen.
Der Albtraum einer neuen Epidemie nimmt Gestalt an.
K. Ingo Schuch
Mortos Vivos
Die lebenden Toten
Roman
Texte: © 2025 Copyright by K. Ingo Schuch
Umschlaggestaltung: © 2025 Copyright by K. Ingo Schuch
Verlag:
K. Ingo Schuch
www.schuchbuch.info
Erstkontakt
Übersprung
Der Jaguarmann
Entfaltung
Jagdfieber
Irrtum
Leipoldt
Eskalation
Der Urutau
Die Lichter der Stadt
Regenzeit
Die Flut
Gott ist nicht tot
Täter und Opfer
Verschwörung
Epilog
Erstkontakt
Nordwestlich von Marabá, Bundesstaat Pará, Brasilien
Seit sie in diesem Abschnitt des Waldes arbeiteten, häuften sich die Unglücksfälle. Vor drei Wochen hatte einer der Hilfsarbeiter den Warnruf überhört und war von einem über fünfzig Meter hohen Shihuahuaco erschlagen worden. Abgesehen von dem Verlust eines Menschenlebens bedeutete das auch jedes Mal einen bürokratischen Albtraum für Edson Coelho, der Vorarbeiter für diesen Trupp war. Formulare waren auszufüllen, für die Behörden in Belém, für die Firmenzentrale in Manaus und für die Versicherung, die die Bestattungskosten für den Jungen übernehmen sollte, der eigentlich als begabter Fußballer aus seinem Heimatort Rurrenabaque im Tiefland Boliviens Karriere bei einem der Clubs wie Bolívar oder San José hätte machen sollen, anstatt hier im elendigen Regenwald von einem fallenden Baum zermalmt zu werden.
Coelho war ganz und gar nicht damit einverstanden, dass die Firma Hilfsarbeiter aus Bolivien oder Suriname beschäftigte, aber für die galten die Vorgaben der Gewerkschaften nicht und sie konnten bei Abflauen der Auftragslage von einem auf den anderen Tag gefeuert werden. Aber an den Verwaltungskram dachte natürlich niemand von den Sesselfurzern in ihren klimatisierten Büroräumen in Manaus.
Ganz abgesehen davon, dass jemand die Schweinerei hier wegmachen musste.
Nach dem Unfall mit dem Hilfsarbeiter gab es den Zwischenfall mit Jairzinho, einem erfahrenen Mann, dem Coelho die Auswahl der zu fällenden Bäume überließ, weil er hier in der Gegend aufgewachsen war und er einen guten Instinkt dafür hatte, welcher Stamm die beste Maserung aufwies und damit den höchsten Preis bei der Weiterverarbeitung erzielen würde.
Seit die Umweltschützer den Druck so massiv erhöht hatten, hatte die Firma vorgegeben, dass man den Verschnitt reduzieren musste. Coelho hatte sogar in gewisser Weise Verständnis dafür, dass die Auflagen verschärft wurden. Bloß weil er bei einer Holzfirma angestellt war, bedeutete das schließlich nicht, dass er blind war für die Belange der Erhaltung des Regenwaldes und des Umweltschutzes. Solange er Vorarbeiter war, achtete er auch strikt darauf, dass die Arbeiter keinen Müll zurückließen. Immerhin befand sich ihr Arbeitsbereich mitten im Gebiet der Parakanã, was die Regionalregierung aber nicht zu stören schien, denn eine Kopie der Abholzungsgenehmigung hatte Coelho in der Brusttasche seines durchgeschwitzten Hemdes.
Jairzinho war keine fünfzig Meter von ihrem Lager entfernt von einer Spinne gebissen worden. Das passierte ab und an und normalerweise war es nicht gleich ein großes Drama, aber Jairzinho hatte wohl ein Herzleiden, wie sie bei der Untersuchung seiner Leiche in Marabá festgestellt hatten und darum hatte er das Spinnengift nicht überlebt. Eine Armadeira, eine Wanderspinne. Coelho wusste, dass die Viecher zu den gefährlichsten Spinnen weltweit gehörten, aber zum ersten Mal hatte er mitbekommen, dass jemand durch eine ums Leben kam. Jairzinho hinterließ vier Kinder und Coelho schrieb einen Brief an die Firmenleitung, in dem er hervorhob, wie viel Geld der Mann ihnen eingebracht hatte, weil er doch immer die guten Bäume ausgesucht hatte und ob sie nicht seiner Frau eine kleine Summe auszahlen könnten, damit sie eine Weile klarkommen konnte, bis sie eine Arbeit gefunden hatte.
Gestern hatte es den Caboclo erwischt. Coelho mochte die Stimmung, wenn die Männer nach einem arbeitsreichen Tag abends im Lager zusammen saßen, um das Feuer versammelt, und sich Geschichten erzählten. Meist ging es um irgendwelche Frauengeschichten, natürlich. Der Caboclo saß wie immer etwas abseits. Man war hier oben nicht rassistisch, aber Afonsinho war lieber mehr für sich. Coelho wusste aus der Personalakte, dass seine Mutter eine Araweté war, was für Coelho in Ordnung war, solange der Mann nicht anfing mit irgendwelchen indigenen Mätzchen. Mit Índios hatte er bislang keine guten Erfahrungen gemacht. Sie waren schwierig im Umgang und unzuverlässig.
Am gestrigen Abend hatten die Männer ihre Fleischstücke gebraten, die sie in einer Kühltruhe mitgebracht hatten. Wenn man eine Weile in einem Waldabschnitt arbeitete, konnte man kein Wild mehr finden. Die Biester verzogen sich kilometerweit in den dichten Dschungel und Coelho konnte es sich nicht leisten, dass die Männer stundenlang auf die Jagd gingen und dann unausgeschlafen waren oder sich eine Verletzung zuzogen, oder sich von einer Spinne beißen ließen wie der arme Jairzinho.
Afonsinho saß einfach nur auf einem der gefällten Urwaldriesen und glotzte ins Feuer, als er auf einmal quiekte wie ein angeschossenes Pekari und mit den Armen fuchtelte, als wolle er einen Waldgeist vertreiben. Nachdem er sich wieder beruhigt hatte, untersuchte José, der ihr Ersthelfer war, den Caboclo, der am Unterschenkel leicht blutete. Offenbar hatte ihn irgendein Tier gebissen, aber José war sich sicher, dass es keine Schlange war.
„Viel zu groß für eine Spinne, für eine Schlange zu nahe beieinander. Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich sagen, dich hat eine Ratte gebissen.“
„Ach ja, und warum sollte es keine Ratte gewesen sein?“
„Ratten fallen keine Menschen an, schon gar nicht so nahe an einem riesigen Feuer. Sicherheitshalber mache ich dir etwas Jod drauf und ein Pflaster. Pass auf, dass kein Dreck reinkommt, dann merkst du in ein paar Tagen nichts mehr von dem Kratzer.“
José irrte sich, denn in der Nacht bekam Afonsinho hohes Fieber. Er teilte sich ein Zelt mit einem der anderen Hilfsarbeiter aus Bolivien und der Mann rüttelte weit vor Morgengrauen an dem Zelt, in dem José schlief und versuchte ihm in gebrochenen Portugiesisch zu verstehen zu geben, dass es dem Caboclo sehr schlecht ginge. Fluchend erhob sich José und folgte dem Mann zu seiner Unterkunft. Drinnen fand er Afonsinho in einem schlechten Zustand vor. Im Schein seiner Taschenlampe konnte er erkennen, dass der Mann von Fieberschüben geschüttelt wurde und als er nach seiner Stirn tastete, erschrak er. Der Caboclo glühte regelrecht. Er leuchtete nach unten zu der Wunde und stellte fest, dass der gesamte Unterschenkel geschwollen war und sich anfühlte wie halb gar gebratenes Rindfleisch. José konnte hier nur Aspirin verabreichen, aber gegen eine Blutvergiftung konnte er nichts ausrichten. Wahrscheinlich musste der Mann wohl oder übel in die Klinik in Belém gebracht werden, was Coelho gar nicht gefallen würde, denn es waren zwei Leute vonnöten und sie würden fast drei Tage mit dem Boot unterwegs sein.
In diesem Augenblick öffnete Afonsinho die Augen. Es war der Blick eines Irren. José wollte sich in dem niedrigen Zelt aufrichten, aber der Caboclo griff mit beiden Händen nach seinem Hals und zog ihn unnachgiebig zu sich herab, als hätte eine Gottesanbeterin ihre Beute umklammert und wolle nun ihre grausame Mahlzeit beginnen. Und tatsächlich öffnete der Caboclo seinen Mund und er biss José mit aller Kraft ins Gesicht. José schrie und er strampelte und versuchte sich verzweifelt aus dem eisernen Griff des Wahnsinnigen zu befreien. Dann spürte er, wie helfende Hände an ihm zerrten und schließlich lag er vor dem Zelt auf dem Rücken und versuchte seinen Atem unter Kontrolle zu bekommen. Den Schmerz und das Blut, das ihm in den Kragen rann, nahm er erst mit Verzögerung wahr.
Der von dem Lärm aufgewachte Coelho stand mit einer starken Taschenlampe in der Hand über seinem Arbeiter und besah sich dessen Verletzungen. Der Caboclo hatte José die halbe Wange weggefressen. Durch das ganze Blut hindurch konnte man die obere Zahnreihe sehen.
„Was ist das für eine verdammte Schweinerei? Du und du, versucht den Irren zu fesseln! Aber passt auf, dass er euch nicht auch noch beißt. Verdammter Kannibale. Am besten zieht ihr ihm gleich mit dem Spaten eine über.“
Coelho kratzte sich am kahler werdenden Kopf. Das bedeutete eine Menge Papierkram. Aber jetzt musste er sich erst einmal um José kümmern, Der Mann musste dringend in ein Krankenhaus. Nur befanden sie sich hier über zweihundert Kilometer entfernt von Marabá und wenn man den Weg bis zur Transamazônica einrechnete, wären die Männer erst am nächsten Tag wieder zurück. Die Alternative war, einen Hubschrauber anzufordern, aber die Firma würde nie und nimmer die Kosten dafür freigeben. Nicht nach den Vorfällen mit dem Bolivianer und mit Jairzinho. Coelho stand sicher bereits unter Beobachtung.
Inzwischen war das ganze Lager wach und die Arbeiter umstanden die Szene. Auf dem Boden wand sich der gefesselte und geknebelte Caboclo, der am Kopf eine gehörige Beule hatte, und José wimmerte vor Schmerzen vor sich hin.
Coelho musste eine Entscheidung treffen. Er deutete auf zwei Männer, die sein Vertrauen genossen. „Packt Verpflegung und Wasser ein. Ihr bringt José und den Caboclo ins Krankenhaus nach Marabá. Ihr müsst erst mit dem Lastwagen durch den Wald und dann die Transamazônica nach Südosten fahren. Bringt die beiden gut unter und geht in der Stadt der Polizei aus dem Weg. Keiner muss hier dumme Fragen stellen, ich kläre das mit der Firmenleitung. Sein Verhalten kann ich mir nur damit erklären, dass er die Tollwut bekommen hat. Dann kommt ihr sofort zurück, die Arbeit kann nicht so lange liegenbleiben.“
Die Männer trafen ihre Vorbereitungen, nicht unzufrieden über die Abwechslung, auch wenn der Weg bis zur Straße eine einzige Schaukelei werden würde und man musste gut aufpassen, dass man den LKW nicht irgendwo festfuhr, auch wenn der jetzt nicht mit Holzstämmen beladen war. Mit dem Traktor wäre es einfacher gegangen, aber wenn sie erst einmal auf der Straße waren, wäre der schwere Holztransporter doch noch um einiges schneller. Der Caboclo wurde mit vereinten Kräften auf die Pritsche des langen Fahrzeugs gehoben und José nahmen sie in der Fahrerkabine zwischen sich. Aus seinem Erste-Hilfe-Koffer hatte ihm Coelho notdürftig einen Verband ums Gesicht gewickelt und ihm eine Packung Schmerztabletten in die Hand gedrückt.
„Eine verdammte Mumie und ein Menschenfresser. Gute Fahrt!“ rief er kopfschüttelnd und schlug mit der Hand auf die Motorhaube.
Die Männer kamen nie in Marabá an.
Übersprung
Belém, Bundesstaat Pará, Brasilien
Doktor Carvalho Souza setzte das Stethoskop ab. Die kleine Letícia hatte hohes Fieber und ihr Atem ging stoßweise. Die junge Ärztin war besorgt. Alle Tests waren negativ. Weder die Speichelprobe noch die Analyse der Hirnflüssigkeit ergaben einen Hinweis auf RNA des Rabies-Virus, des Tollwut-Erregers, dabei waren die Symptome eindeutig.
Die Mutter hatte das Mädchen in die Klinik gebracht, da ihre Tochter plötzlich unter Lähmungserscheinungen litt. Zunächst konnte sie den rechten Arm nicht mehr bewegen und als sie im Behandlungsraum der Notaufnahme lag, fing sie plötzlich an stark zu speicheln und zu spucken. Offenbar hatte die Lähmung den Rachenraum erfasst. Das Behandlungsteam hatte den Speichel abgesaugt, aber der Zustand des Mädchens verschlechterte sich zusehends.
Doktor Carvalho besah sich nochmals die Wunde im Nacken des Mädchens, das sich bereits im Paralysestadium befand und kaum noch auf Reize reagierte. Es war eindeutig eine Bisswunde, entzündet, eitrig und unvollständig versorgt.
„Wer hat die Wunde behandelt und womit?“, fragte die Ärztin die Mutter, die besorgt neben dem Krankenbett stand und nicht zu verstehen schien, was mit ihrer Tochter geschah.
„Der Heiler hat ihr einen Trank aus Mamica de Porca bereitet und die Wunde habe ich mit den zerstoßenen Blättern abgedeckt. Aber das Fieber ging nicht weg.“
Doktor Carvalho wusste, dass die indigenen Völker die Blätter des Tambataru-Baumes traditionell als Heilmittel zur Reinigung des Blutes, gegen Muskelschmerzen, Rheuma, Zahnschmerzen oder gar bei Schlaganfall einsetzten. Manche Indigene sprachen der Pflanze krebshemmende Eigenschaften zu. Sie war weit davon entfernt, die Volksmedizin abzutun, wenn auch Zweifel blieben, ob ein früherer Besuch in der Klinik nicht das Leben dieses Mädchens hätte retten können.
„Wer hat deine Tochter gebissen? Ich sehe doch, dass es der Biss eines Menschen war und nicht eines Tieres.“ Doktor Carvalho musste die Frage erneut stellen, obwohl sie sehen konnte, dass die Beantwortung der Mutter körperliche Qualen verursachte.
Die kleine Frau, die wie ihre Tochter dem Volk der Tembé angehörte, das am Ufer des Guamá-Flusses lebte, sah der Ärztin nicht in die Augen, als sie antwortete: „Es war der Abá jaguara. Er hat meine Tochter nachts aus der Hütte geholt und ihr Leid angetan.“
Doktor Carvalho verstand genügend Tupi, um sich zusammenzureimen, dass die Frau von einem ‚Jaguar-Mann‘ sprach. Sie nahm an, dass es sich um eine Umschreibung für den Angehörigen eines anderen Stammes handelte oder jemand hatte während einer zeremoniellen Handlung eine Jaguar-Maske getragen. Das Mädchen war nicht vergewaltigt worden, also konnte man ein Sexualdelikt wohl ausschließen. Aber wer fügte einem Kind eine fünf Zentimeter tiefe Bisswunde zu? Den Zahnabdrücken nach handelte es sich bei dem Täter um einen erwachsenen Mann.
„Wer ist der Abá jaguara? Du musst mir das sagen, sonst können wir deiner Tochter nicht helfen!“ Sie verschwieg, dass wahrscheinlich sowieso jede Hilfe zu spät kam.
„Ich habe ihn gesehen. Er hatte sie gepackt wie eine Onça eine Ziege packt und er wollte sie in den Wald schleppen, um sie zu fressen. Die Männer haben Speere auf ihn geworfen, aber er war so schnell verschwunden wie er erschienen war.“
Die Frau hatte die Augen weit aufgerissen, als sehe sie die Szene nochmals vor sich.
„War es das erste Mal, dass ein Kind angegriffen wurde?“
„Das erste Mal. Aber warum musste es meine Letícia sein?“ Die Mutter begann ein Lied in ihrer Stammessprache zu singen, von dem Doktor Carvalho annahm, dass es sich um ein rituelles Totenlied handelte. Es wurde Zeit, die Polizei zu verständigen.
- - -
Delegado Anderson Luiz Meireles war ein kräftiger Mann um die Fünfzig mit kurz geschnittenen Haaren und der mehrfach gebrochenen Nase eines Preisboxers. Er stand vor der Klinik und dachte nach.
Was ihm Kopfzerbrechen bereitete, war der Umstand, dass die Ärzte offenbar keine Ahnung hatten, woran das Mädchen gelitten hatte. Die Kleine war eine halbe Stunde, bevor Meireles mit seinem Dienstwagen das Hospital erreichte, gestorben. Jetzt hatte er also ein Tötungsdelikt mit Todesfolge, wobei die Todesursache eine durch einen menschlichen Biss verursachte, ‚unspezifische‘ Infektion war. Die Erinnerungen an die letzte Pandemie waren zu frisch, als dass man in dieser Region der Welt gleichgültig auf die Nachricht regieren konnte, ein bislang unentdecktes Virus könnte ein Kind getötet haben. Es gab bislang nur diesen einen Fall und keinesfalls bestand ein Anlass, nervös zu werden, aber Meireles Eltern waren an Covid gestorben und er war bei dem Thema sensibel.
Der Delegado ging langsam zu seinem Auto. Auf der Rückfahrt ins Büro überlegte er, wen von seinen Leuten er zu den Tembé schicken sollte, deren Siedlung am Ufer des Rio Guamá lag. Außerdem musste er die FUNAI, Fundação Nacional do Índio, die Nationale Behörde für Indigene, verständigen. Falls in ihrem Zuständigkeitsbereich ein Tollwütiger herumlief, konnte die Polizei von Belém etwas Unterstützung gebrauchen. Bom, die Ärztin war sich sicher, dass es sich nicht um Tollwut handelte. Der Delegado war kein Mediziner. Fakt war offenbar, dass jemand ein Kind gebissen hatte und jetzt war es tot. Genauso wenig war Meireles ein Spezialist in indigenen Überlieferungen und Bräuchen. Die Mutter hatte sehr nachdrücklich behauptet, das Mädchen sei von einem ‚Jaguarmann‘ gebissen worden. Für ihn klang das stark nach einem heidnischen Ritual, obwohl er bislang nicht davon gehört hatte, dass dabei Menschen gebissen wurden, es sei denn vielleicht im Ayahuasca-Rausch, aber er wusste nicht, ob dieser Brauch bei den Tembé überhaupt bekannt war.
Meireles war erst kurz wieder zurück in seinem Büro im Gebäude der Policia Civil, als sein Mobiltelefon klingelte.
„Meireles.“
„Hier Doktor Carvalho. Sie waren vorhin bei uns in der Klinik. Es ist etwas passiert.“ Die junge Frau klang sehr aufgeregt.
„Was meinen Sie? Was ist passiert?“
„Das Mädchen. Letícia. Sie ist verschwunden.“
„Was meinen Sie mit ‚verschwunden‘? Vorhin haben Sie mir erklärt, die Kleine sei an einer Infektion gestorben, und jetzt wissen Sie nicht, wo Sie ihre Leiche hingebracht haben?“
„Delegado, sie ist nicht mehr im Kühlraum. Man hat die Leiche gestohlen. Unser Labor wollte noch eine weitere Blutprobe nehmen und das Kind ist nicht da, glauben Sie mir!“
„Puta merda! Ist die Mutter noch bei Ihnen in der Klinik?“
„Sie ist kurz nach Ihnen gegangen.“
„Ich komme zurück. Warten Sie bitte am Empfang auf mich.“
Meireles ging erneut hinter in den Hof, wo sein Dienstwagen stand. Er konnte es sich nicht erklären, aber die ganze Angelegenheit begann, ihm körperliches Unbehagen zu bereiten.
Doktor Carvalho wartete tatsächlich am Empfang. Sie war in Begleitung eines älteren Herrn, der sich als Abner Ferreira vorstellte, Verwaltungsdirektor der Klinik. Der Mann war sichtlich nervös. Er drehte ein Taschentuch in seinen fleischigen Händen und alle paar Minuten tupfte er sich den Schweiß von der Stirn, obwohl es in der Klinik eine funktionierende Klimaanlage gab.
„Begleiten Sie uns bitte nach unten.“
Sie fuhren mit dem Personalaufzug ins Untergeschoss, in dem sich der Beschriftung nach Versorgungsräume, die Wäscherei und eben der Kühlraum befanden.
„Passiert Ihnen das häufiger, dass eine Leiche verlegt wird?“, fragte Meireles den Verwaltungsdirektor.
„Aber wo denken Sie hin, Delegado! Wir erfüllen mit unserem Krankenhaus die höchsten Qualitätsstandards und selbstverständlich passiert so etwas nicht. Niemals zuvor ist uns ein Patient, wie soll ich sagen, abhandengekommen. Schrecklich, das ist alles schrecklich.“
Der Kühlraum war nochmals um etliche Grade kälter. Doktor Carvalho hatte die Tür mit ihrer Chipkarte geöffnet. Sie standen vor einer Reihe von Stahltüren, hinter denen jene Patienten untergebracht wurden, die es leider nicht geschafft hatten.
„Aufmachen, alle“, befahl Meireles.
Ferreira gab Doktor Carvalho einen Wink, die wortlos eine Tür nach der anderen öffnete. Die meisten Fächer waren leer. Zwei waren belegt. Ein alter Mann und eine Frau in Meireles Alter. Irgendwann könnte er auch in einem dieser kalten, sterilen Fächer liegen und darauf warten, vom Bestatter abgeholt zu werden.
„Und Sie sind sicher, dass das Mädchen hier herunter gebracht wurde? Sie steht nicht in irgendeinem Aufzug, weil ein Pfleger kurz Mittagspause machen wollte?“
Er handelte sich einen vernichtenden Blick von Doktor Carvalho ein.
„Wie Doktor Ferreira bereits sagte, erfüllen wir alle Qualitätsstandards. Niemand von unserem medizinischen Personal würde eine solche Unterlassung begehen. Das Mädchen war hier drin, in diesem Fach. Und jetzt ist sie weg. Jemand muss die Leiche entwendet haben. Wollen Sie nicht Ihre Leute losschicken zu der Siedlung der Tembé? Ich nehme doch an, sie haben sie geholt, wenn ich mir auch nicht erklären kann, wie sie hier hereingekommen sein sollen.“
Die junge Frau hatte wahrscheinlich recht. Natürlich war es naheliegend, dass die Tembé ihr Kind nach ihren Riten bestatten wollten. Aber mussten sie dafür jemanden in das Krankenhaus einschleusen und den Leichnam entwenden, der sowieso in ein paar Tagen freigegeben worden wäre? Und das Ganze musste äußerst schnell gegangen sein, denn seit seinem ersten Besuch bei Doktor Carvalho waren maximal zwei Stunden vergangen.
„Es wird uns nichts anderes übrig bleiben, als das gesamte Gebäude zu durchsuchen. Ich fordere Verstärkung an. Wie viele Eingänge gibt es?“
„Nur den Haupteingang und einen Notausgang hinten heraus, der aber verschlossen ist.“
„Kameras?“
„Nein.“
Der Delegado sah sich in dem sterilen Raum um. Keine Kameras, wozu auch?
Einige Stunden später saß Meireles ratlos an seinem Schreibtisch. Sie hatten das komplette Gebäude auf den Kopf gestellt. Die Polizei, unterstützt von einigen Pflegern, hatte jeden einzelnen Raum der Klinik durchsucht, einschließlich der beiden OP-Säle, was den fetten Ferreira womöglich noch mehr ins Schwitzen gebracht hatte. Das Mädchen blieb verschwunden. Ebenso wenig gab es einen Hinweis auf den Verbleib ihrer Mutter, die wohl mit dem Boot die Strecke vom Rio Guamá bis in die Stadt bewältigt hatte. Nach Aussage der jungen Senhora an der Rezeption hatte sie mit ihrer Tochter auf dem Arm das Krankenhaus betreten und kurz nach Meireles verließ die Mutter mit gesenktem Kopf allein das Gebäude. Nun befand sie sich wahrscheinlich bereits auf dem Rückweg zu ihrem Dorf. Also mussten sie den Tembé einen Besuch abstatten. Er würde morgen selbst hinaus fahren. Vorher erledigte er aber sein Telefonat mit der FUNAI.
- - -
Delegado Meireles stellte den Ford am Rande der unbefestigten Straße ab und stieg aus.
„Muss ich etwas Besonderes beachten?“
Seine Begleiterin lächelte. „Sie überlegen, ob Sie Glasperlen oder Kochtöpfe hätten mitbringen sollen?“
„Das nun gerade nicht, aber ich bemühe mich schon, die Gepflogenheiten anderer Kulturen zu berücksichtigen. Ich meinte eher, ob es hier einen Häuptling gibt, mit dem ich vernünftig reden kann. Wenn wir richtig liegen, handelt es sich um ein einen Fall von Leichenraub, was kein sehr häufiges Delikt ist, und eigentlich möchte ich die Sache nicht zu hoch aufhängen.“
Die Mitarbeiterin der FUNAI war in etwa in Meireles Alter. Sie hatte sich als Selva Borges de Oliveira vorgestellt. Sie arbeitete bereits seit über zwanzig Jahren bei der FUNAI, sprach etliche Sprachen der im Amazonas-Gebiet angesiedelten Stämme und während der zweieinhalbstündigen Fahrt hatte sie dem Delegado etwas über die Tembé erzählt.
„Die Tembé haben christliche Feiertage und Taufen in ihr spirituelles Leben aufgenommen, haben aber nicht das Christentum als religiöses System anerkannt. Ich halte es nicht für ausgeschlossen, dass sie die Leiche des Kindes aus der Klinik entführt haben, aber eigentlich frage ich mich, warum sie das tun sollten. Außerdem haben Sie mir bestätigt, dass sie sich dafür durch den Personaleingang hätten schleichen müssen. Sie haben gesagt, dass niemand seine Chipkarte vermisst und soweit mir bekannt ist, verfügen die Tembé nicht über Zauberkräfte. Die Mutter und mögliche Begleiter befinden sich wahrscheinlich noch auf dem Fluss. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie jemand in die Stadt gefahren hat, aber wir werden das herausfinden.“
Das Dorf lag auf einem Steilufer über dem Rio Guamá, in der Näher der durch Brandrodung entstandenen Anbauflächen. Die Hütten waren mit Palmblättern bedeckt und die Wände bestanden aus dünnen Palmenstämmen, Baumrinde oder waren einfach nicht vorhanden.
„Jede Hütte beherbergt eine Familie, und diejenigen, die zur gleichen Großfamilie gehören, sind nahe beieinander“, erklärte Selva. „Wir müssen fragen, wer der Häuptling ist. Bei den Tembé ist das gleichbedeutend mit dem Oberhaupt einer Großfamilie.“
Sie betraten das Dorf und sahen sich um. Männer wie auch einige Frauen trugen ganz normale Kleidung, einige der jüngeren Mädchen liefen mit bloßem Oberkörper herum.
Meireles nahm zur Kenntnis, dass der ‚Monobloc‘, der einfache Plastikstuhl, auch seinen Weg in das Dorf der Tembé gefunden hatte. Er hatte bislang keinen Ort in Brasilien besucht, in dem nicht Menschen auf diesen Stühlen in gelb, grün, blau oder weiß vor ihren Häusern, in Bars oder Restaurants saßen und sich das Treiben auf der Straße ansahen.
In einem dieser Stühle saß ein älterer Mann, den Selva instinktsicher als Oberhaupt dieser Sippe identifizierte und ihn freundlich grüßte und sie beide vorstellte. Dann fragte sie: „Ihr kennt das Mädchen Letícia. Ihre Mutter war in der Stadt und hat sie ins Krankenhaus gebracht.“
Der Mann antwortete: „Letícia ist meine Enkelin. Wie geht es ihr?“
Selva sah hilfesuchend zu Meireles, der sich wieder einmal wünschte, er hätte einen anderen Beruf gewählt und dann behutsam erklärte: „Die Ärzte wussten nicht, was sie gegen die Infektion tun sollten. Das Kind war bereits sehr geschwächt. Sie konnten sie nicht retten. Sie ist eingeschlafen.“
Der Häuptling schien ein Weile zu brauchen, bis er die Information aufgenommen hatte. Dann erhob er sich aus dem Stuhl und rief den Personen in seiner Umgebung zu: „Sie ist tot! Sie konnten ihr nicht helfen! Der Abá jaguara hat sie getötet!“
Einige der Frauen und Mädchen brachen in Wehklagen aus und einige Männer und Halbwüchsige umringten die Besucher und stießen Verwünschungen aus. Meireles wusste, wie er in solchen Situationen zu reagieren hatte. „Wir werden diesen Abá jaguara finden, aber dafür brauche ich eure Hilfe! Wer kann ihn mir beschreiben?“
Die aufgekommene Aggression wendete sich gegen den unsichtbaren Feind und alle riefen durcheinander.
„Langsam, nicht alle auf einmal. Wer hat den Jaguarmann gesehen in jener Nacht?“
Der Häuptling deutete auf einen der jungen Männer. „Wilson hat ihn mit einem Speer vertrieben.“
Wilson stand etwas verunsichert vor dem Delegado und seiner Begleiterin. Schüchtern nuschelte er: “Es war dunkel. Ivana, Letícias Mutter, meine Tante, hat laut geschrien. Ich und ein paar andere sind aufgewacht und ich habe nach meinen Speeren gegriffen. Letzten Monat hat sich ein Puma einen unserer Hunde geholt und ich dachte, vielleicht ist er zurückgekommen. Dann sehe ich, dass es ein Mensch sein muss, denn für einen Puma ist die Gestalt zu groß. Ich hebe den Speer, aber ich will Letícia nicht verletzen. Der Kerl hockt auf ihr drauf wie ein Affe, aber er schreit wie ein Jaguar. Schließlich hebt er den Kopf und sieht mich an. Ich werfe den Speer nach ihm. Es ist dunkel und ich sehe nicht, ob ich ihn getroffen habe, aber er lässt ab von den Mädchen und ich werde noch eine Speer und dann Márcio hier auch. Und dann ist er im Wald verschwunden.“
„Wo war die Stelle? Kannst du sie mir zeigen?“
Wilson führte sie zu einer der vom Flussufer abgewandten Hütten und zeigte ins Dickicht. „Hier war es. Da ist der Jaguarmann reingesprungen. Wir haben gewartet bis es hell war und sind ihm nach. Kein Blut, nur abgeknickte Zweige. Ich und einige Männer sind den halben Tag der Spur gefolgt, aber irgendwann hörte sie auf und nach und nach sind wir alle zurückgekommen.“
Meireles wendete sich an den Häuptling: „Hat jemand Leticias Mutter nach Belém begleitet? Sind alle übrigen Bewohner hier?“
„Sie wollte allein fahren. Sie ist gut im Umgang mit dem Boot. Es ist sonst niemand weg. Werden jetzt Polizisten kommen?“
Gute Frage. Der Delegado fragte sich, wie wohl eine Suchaktion im dichten Wald aussehen mochte. Aber bevor er das Comando de Missões Especiais um Unterstützung bat, musste er sicher sein, dass hier nicht irgendein kollektiver spiritueller Ritus am Werk war. Er fragte den Häuptling: „Was war in jener Nacht? Hat es ein Fest gegeben? Ein Wiraohawo-i?“
Selva hatte ihm auf der Fahrt erläutert, dass es bei den Tembé komplexe Ernährungsregeln gab, die vor allem in der Zeit der Pubertät, der Schwangerschaft und der frühen Kindheit eingehalten werden mussten. Erst ab einem bestimmten Alter wurde Fleisch in den Speiseplan der Kinder aufgenommen. „Anlässlich eines Pubertätsritus ruft und bändigt der Schamane, die Vermittlerfigur zwischen den Menschen und dem Übernatürlichen, die Geister mit seinen langen Zigarren, Gesängen und Maracas“, hatte Selva erklärt. „Aber mir ist nicht bekannt, dass diese Riten ausufern und dass dabei jemand in Trance fällt oder ähnliches.“
Der Häuptling rief einen aufwändig tätowierten Mann mittleren Alters zu sich. „Unser Schamane kann Ihnen alle Fragen beantworten, Delegado“.
„Hat die kleine Letícia gegen die Ernährungsregeln verstoßen? Gab es eine Bestrafung?“
Der Schamane sah Meireles mit schiefgelegtem Kopf an, als belustige ihn, dass der Polizist versuchte, ihre komplexen Rituale und Traditionen zu verstehen.
„Sie sind auf dem Holzweg, Delegado. Es ist so, wie Wilson erklärt hat. Der Abá jaguara hat sie angegriffen und jetzt ist sie tot.“
„Wer oder was ist dieser Abá jaguara?“
Der Schamane breitete die Arme aus. „Die Geister der Tiere haben eine zentrale Bedeutung für uns. Manchmal geraten die Dinge in Unordnung. Der Geist eines Tiers, in diesem Fall eines Jaguars, hat sich in den Körper eines Menschen verirrt. Jetzt kämpfen der Mensch und das Tier und manchmal gewinnt das Tier.“
„So etwas wie ein Werwolf in der westlichen Mythologie?“
„Das kenne ich nicht, aber ich weiß, dass nach einiger Zeit nur noch das Tier übrig ist. Dann muss es getötet werden, weil es schlecht ist.“
„Was geschieht mit der Toten? Wird sie hier bestattet?“
„Selbstverständlich. Wir werden ihren Leichnam abholen und hierher bringen.“
„Nun, da gibt es ein Problem. Ihr Leichnam ist verschwunden.“
Der Schamane brach in ein irres Gelächter aus, sodass Meireles sicher war, dass die Vereinigung zwischen Mensch und Pica-Pau, dem Buntspecht, in ihm bereits vollzogen war. Der Häuptling und einige der Männer traten hinzu.
„Was ist so erheiternd?“
Der Schamane antwortete feixend in einer Sprache, die Meireles nicht verstand, woraufhin sich die Minen der Männer immer weiter verfinsterten. Einige machten drohende Gesten in Richtung der Besucher.
„Es wird Zeit, dass wir uns verabschieden“, sagte Selva und zog den Delegado mit sanften Druck zum Auto. Im Rückspiegel sahen sie, dass die Männer Speere und Messer schwenkten.
Auf der Rückfahrt fragte Meireles: „Haben Sie verstanden, was die Männer zuletzt geredet haben?“
Selva warf dem Delegado einen irritierten Blick zu. „Natürlich hat sich der Schamane darüber lustig gemacht, dass sie dem Mädchen in dem Krankenhaus nicht helfen konnten. Und dann lassen sie auch noch ihre Leiche davongehen. Er meint, dadurch, dass der Abá jaguara sie gebissen hat, wird sie jetzt selbst zu einem Jaguarmädchen.“
„Verdammter Aberglaube! Er will seinen Leuten weismachen, dass es sich bei dem Mädchen um eine Art Untote handelt, die einfach so aus dem Krankenhaus spaziert, nachdem die Ärzte ihren Totenschein ausgefüllt haben?“
„Haben Sie eine bessere Erklärung?“
Er hieb auf das Lenkrad und rief: „Nein, verdammt! Ich habe keine bessere Erklärung. Und das macht mich wütend. Ich bin jetzt seit fast dreißig Jahren bei der Polizei und habe weiß Gott viel gesehen. Vor ein paar Jahren wollten mir Kollegen aus São Paulo einreden, es gäbe eine Art Meerjungfrau, die ihre Opfer mit Spinnengift tötet. Und jetzt soll ich hinnehmen, dass es Jaguarmenschen gibt, die untot umher laufen und Leute beißen. Können Sie nachvollziehen, dass mir das ein wenig schwerfällt?“
Sie antwortete nicht.
Meireles versuchte sich vorzustellen, wie das Gespräch mit seinem Vorgesetzten laufen würde. Chef, ich muss zwei Abteilungen der Spezialkräfte anfordern. Eine muss am Rio Guamá die Wälder durchsuchen und eine hier in Belém jeden Hinterhof. Wir suchen ein paar Untote. Nein, sonst ist alles ruhig. Wie war Ihr Golfspiel am Wochenende?
- - -
Coronel Walter Souza Ramos, Kommandeur des Comando de Missões Especiais, zeichnete den Einsatzbefehl ab und übergab diesen seinem Adjutanten. Kopfschüttelnd wendete er sich wieder dem Stapel Papieren zu, die sich auf seinem Schreibtisch häuften. Die Anfragen der Staatsanwaltschaft wurden immer skurriler. Er war es gewohnt, dass man seine Spezialeinheit zur Bekämpfung von Drogenbanden oder in Geiselnahmen hinzuzog, aber in diesem Fall schien es sich um einen Verdachtsfall auf ein neuartiges Virus zu handeln, also setzte er seine Männer möglicherweise einer bedrohlichen Situation aus, die sie nicht mit der Waffe und ihrer Ausbildung allein lösen konnten. Die zweite Unterstützungsanfrage hatte er abgelehnt. Die Suche nach einem vermissten Kind im Stadtbereich war eindeutig Aufgabe der Policia Civil.
Der Jaguarmann
Tenente Luiz Antônio Gonçalves stellte seine Einheit zusammen. Es ging ins Gebiet der Tembé am Rio Guamá. Gonçalves war bewusst, dass dieser Auftrag heikel war, denn man hatte die Interessen der Índios zu berücksichtigen, daher nahm er neben Sargento Mendonça und fünf weiteren Männern auch Caique mit, einen Mischling, dessen Mutter eine Munduruku war und der neben Tupi einige weitere Dialekte beherrschte. Manchmal war es sinnvoll, wenn man den Indigenen in ihrer Sprache begegnete, außerdem war Caique der beste Fährtenleser des Zuges.
Tenente Gonçalves war ein drahtiger Mann Mitte Dreißig, zu dessen Hobbies Triathlon gehörte. Wie alle seine Männer war er körperlich austrainiert und einem Einsatz im Regenwald jederzeit gewachsen. Bárbaro war ein Veteran des Dschungelkrieges gegen die Drogenhändler, illegalen Goldsucher und gegen die Holzmafia und er hatte mehr Narben an seinem Körper als ein Fußballer Tattoos. Sie kontrollierten ein letztes Mal ihre Ausrüstung und saßen auf. Für die Fahrt zum Dorf der Tembé benutzten sie einen geländegängigen LKW.
Während der Fahrt über die Rodovaria Perna Leste entlang der teilweise sehr trockenen Mais- und Sojabohnen-Felder instruierte Tenente Gonçalves seinen Trupp über ihre Mission. Im einem Dorf der Tembé hatte es einen Überfall auf ein Mädchen gegeben. Möglicherweise handelte es sich bei dem Täter um eine Person, die an einem der Tollwut ähnlichen Virus erkrankt war. Jedenfalls war das Kind verstorben und ihr Auftrag war es, den Täter aufzuspüren und in Gewahrsam zu nehmen.
„Das klingt nach einer Jagd auf einen Muriqui. Ich denke, die Tembé würden den Kerl schneller finden als wir mit unserem ganzen Equipment“, meinte ein kleiner, zäher Kerl mit einer spitzen Nase, die ihm den Kosenamen Quati, Nasenbär, eingehandelt hatte, und erntete einen tadelnden Blick seines Vorgesetzten.
„Sie haben ihn gesucht, mussten aber aufgeben. Der Kerl ist wie vom Erdboden verschwunden. Außerdem wollen wir doch nicht, dass er womöglich einen von ihnen mit seinem Virus ansteckt.“
„Stimmt es, dass er das Mädchen gebissen hat?“, fragte Caique.
„Warum fragst du? Hast du Angst, dass er dich auch beißen könnte?“, höhnte Quati.
„Vielleicht will er ja dich beißen. Schließlich siehst du aus wie ein Beutetier und nicht der Mestiço“, warf Bárbaro ein und alle lachten. Von den Jungs hatte keiner ein Problem damit, dass es etwas rauer zuging, deshalb hatten sie sich alle freiwillig gemeldet zu der Spezialeinheit. Der aktuelle Auftrag kam einigen unter ihnen vor wie ein netter Ausflug ins Grüne. Hätten sie allerdings gewusst, dass nicht alle von ihnen lebend nach Belém zurückkehren würden, wären sie weniger ausgelassen zu Scherzen aufgelegt gewesen wie ein paar Schüler auf Klassenfahrt.
Nach einer dreistündigen Fahrt erreichten sie das Flussufer des Rio Guamá. Das Dorf der Tembé lag abseits der Straße inmitten von Maisfeldern. Etwa zweihundert Meter vom Flussufer entfernt begann der Wald, wobei sie von ihren Einsätzen tief im Innern des Regenwaldes Schlimmeres gewohnt waren.
„Absitzen! Und benehmt euch! Wir wollen die Leute nicht erschrecken“, befahl Tenente Gonçalves. „Caique begleitet mich, ihr anderen wartet hier am LKW!“
Gemeinsam mit dem Mischling schritt Gonçalves zu den Hütten hinüber, die ein kleines Dorf formten. Ihre Schnellfeuergewehre hingen mit dem Lauf nach unten locker über ihre Schultern.
Sie wurden erwartet.
Einige Männer, halbwüchsige Jungen und Mädchen, sowie ein paar Frauen standen zusammen vor den ersten Hütten und sahen die Männer schweigend an.
„Seid gegrüßt. Meine Name ist Tenente Luiz Antônio Gonçalves und gemeinsam meinen Männern da drüben werde ich den Mann suchen und finden, der das Kind angefallen hat. Kann jemand die Person beschreiben, nach der wir suchen?“
Ein junger Mann löste sich aus der Gruppe und trat auf sie zu. „Ich bin Wilson. Ich habe ihn gesehen. Es war dunkel. Er ist vielleicht so groß wie ich. Seine Augen sind gelb wie bei einem Teufel.“
Gonçalves hütete sich, gleich zu Beginn eine Grundsatzdiskussion zu beginnen. Diese Leute waren sehr einfach und wenn sie meinten, der Mann habe gelbe Augen gehabt, dann musste er ein Teufel sein oder ein Geist. Möglicherweise litt der Mann an einer Lebererkrankung oder er hatte Malaria oder sie hatten sich schlicht im Dunkel der Nacht getäuscht.
Der Junge, der sich als Wilson bezeichnet hatte, deutete auf den gegenüberliegenden Waldrand. „Dort hinein ist er geflüchtet. Es gab einige Spuren, dann nicht mehr. Er ist verschwunden.“
„Wie lange ist das jetzt her?“
„Der Angriff auf Letícia war vor vier Nächten.“
Nach fast fünf Tagen konnte der Mann inzwischen an jedem Ort in diesem Bundesstaat sein. Was, wenn er sich im Wald versteckt hatte und dann mit einem Boot geflohen war?
Gonçalves hatte seine Befehle, also ging er positiv an den Auftrag heran.
Er stieß einen gellenden Pfiff aus und signalisierte seinen Männern, sich mit ihm zu treffen. Dann brachen sie auf in Richtung Osten.
- - -
Auf den ersten paar hundert Metern konnte Caique der Spur noch so leicht folgen, als hätte jemand mit Sprühfarbe die Bäume markiert. Es gab zahlreiche Hinweise auf die Anwesenheit menschlicher Wesen, aber er meinte, das seien die Tembé, die hier gejagt hatten. An einem riesigen Kapokbaum hing ein Bienennest. Er deutete auf Kratzspuren an dem Baum. Offenbar waren sie hier hinaufgestiegen, um von dem köstlichen Honig zu nehmen. Dann fiel ihm wieder ein abgeknickter Ast auf oder er meinte, auf dem Boden seien ganz deutlich Fußabdrücke zu sehen, auch wenn der Tenente nur Blätter und Wurzeln erkennen konnte.
Nachdem sie nach zwei Stunden eine Strecke zurückgelegt hatten, die man in der Ebene in dreißig Minuten hätte bewältigen können, hörten die Hinweise auf. Es gab nur noch den dichter werdenden Dschungel mit seinen natürlichen Bewohnern. Sie sahen Fledermäuse, Nagetiere und Affen. Sie entdeckten das goldene Löwenäffchen, das Caxinguelê-Eichhörnchen, den Paca und den Muriqui. Und es gab Spuren von einer großen Raubkatze, wahrscheinlich von einem Jaguar. Caique deutete stumm auf die typischen Trittsigel, fast wie eine Menschenhand mit vier Fingern. Bárbaro nickte und flüsterte: „Maximal ein paar Stunden alt. Das Kätzchen kann hier noch irgendwo auf einem Baum liegen und uns beobachten. Seht auch ab und zu mal nach oben und nicht nur auf den Arsch eures Vordermannes!“
Sie gingen weiter. Mittlerweile trugen alle ihre Handtücher um den Hals, um den Schweiß aufzufangen, der unter ihren breitkrempigen Hüten hervortrat. Ein Marsch durch den Regenwald war immer wie ein Besuch in der Sauna, nur vollständig angezogen. Die Männer tranken viel und versuchten ein gleichmäßiges Tempo beizubehalten. Bárbaro merkte, dass der Mestiço sie in einem großen Bogen wieder in Richtung Fluss führte. Er schloss zu ihm auf und fragte leise: „Du scheinst nicht daran zu glauben, dass wir den Kerl aufstöbern, wenn wir einfach nur stundenlang durch den verdammten Wald stolpern?“
„Müsste ich mich hier verstecken, wärt ihr bereits ein paar Mal an mir vorbeigelaufen. Wenn er noch hier ist, muss er in der Nähe vom Wasser bleiben. Weiter drin lauert der Tod.“
„Was hältst du von den Geschwätz der Tembé, der ‚Abá jaguara‘ habe das Mädchen angefallen?“
Caique sah ihn ernst an, dann fragte er zurück: „Du glaubst doch an den saci-pererê?“
„Ich habe ihn gesehen, oben am Moju, darauf kannst du deine Eier verwetten.“
„Wenn es den saci gibt, warum sollte es dann den Abá jaguara nicht geben?“
„Aber ist er wirklich ein Gestaltenwandler, ich meine, kann er sich in einen Jaguar verwandeln oder was?“
„Ich kann es dir nicht sagen. Ich weiß nur, dass es in diesen Wäldern Wesen gibt, von denen wir uns wünschen würden, dass sie tief in ihren Höhlen bleiben.“
Bárbaro tastete nach seinem Kampfmesser, das an seiner Weste befestigt war. Sollte sie eines dieser Wesen angreifen, würde er ihm den Bauch aufschlitzen und sich aus seinen Gedärmen ein Seil drehen.
Nach einer weiteren Stunde konnte Bárbaro den Fluss wittern. Plötzlich gab es Aufregung am Ende des Zuges. Jemand rief: „Oh mein Gott, geh weg! Lass mich!“ Schüsse fielen. Dann schrie jemand, als sei er auf einem Haufen Treiberameisen aufgewacht.
Bárbaro hetzte zurück. „Was ist los?“, fragte er den Tenente.
„Quati. Etwas hat ihn angegriffen. Er ging direkt hinter mir.“
Der Mann lag auf dem Rücken und atmete schwer. Aus seinem Hals trat eine Menge Blut aus. Mit weit aufgerissenen Augen versuchte er etwas zu sagen, aber seine Worte gingen in einem Gurgeln auf. Sein Beine zuckten unkontrolliert.
„Puta! Das Verbandszeug!“, rief Bárbaro sich selbst zu. Quati war ihr Sanitäter und nun musste er selbst versorgt werden. Der Sargento riss ein steriles Verbandspäckchen auf und drückte es auf die Wunde. Dann suchte er nach einem Fläschchen mit Desinfektionslösung und schüttete etwas davon über die offene Wunde, die nicht aufhörte zu bluten. Es sah fast aus, als habe etwas ihm die Kehle aufgerissen. Bárbaro sah hoch zu dem Tenente, der blass um die Nase war.
„Haben Sie geschossen? Auf was?“
„Es ging verflucht schnell. Etwas kam aus dem Dickicht auf uns zugeschossen und ich sah noch, wie Quati zu Boden gerissen wurde. Ich habe zuerst in die Luft geschossen, aber das Biest hat sich nicht abhalten lassen. Weil ich nicht ihn treffen wollte, habe ich sorgfältig gezielt und dann hat es mich angesehen. Ich glaube, es war ein Mensch, aber…“
„Aber was?“
„Aber es sah nicht mehr aus wie ein Mensch. Ich habe einmal in den Straßen von Manaus einen Obdachlosen gesehen, der sich wahrscheinlich seit Jahren nicht mehr gewaschen oder rasiert hatte. Ein erbärmlicher Anblick. Dieses Wesen hier, es hatte irgendwie menschliche Züge, aber es sah auch aus wie ein Raubtier. Die Augen waren gelb. Als ich ihm in den Kopf schießen wollte, sprang es mit einem Satz in die Büsche und war so schnell verschwunden wie es aufgetaucht war Ich bin mir nicht sicher, ob ich es getroffen habe.“
„Habt ihr das Biest auch gesehen?“, fragte Bárbaro in die Runde. Die Männer schüttelten die Köpfe. Einer traute sich zu sagen: „Es ging alles so schnell. Ich habe nur den Rücken von dem Tenente gesehen, ich war ja direkt hinter ihm“.
„Du und Caique, ihr sucht die Umgebung ab. Und ihr anderen bildet einen Halbkreis, Gewehre im Anschlag!“
Der Tenente schien ihm gerade nicht in der Verfassung, um eindeutige Befehle zu erteilen und sein Vorgesetzter nahm es ihm nicht übel, dass er hier Kommandos brüllte.
„Wird er wieder? Wir müssen ihn so schnell wie möglich zum Fluss bringen, wo ein Hubschrauber landen kann.“
Quati hatte aufgehört zu wimmern. Er hatte das Bewusstsein verloren.
„Wenn er weiter so viel Blut verliert, wird das nichts. Die Wunde sitzt direkt am Kehlkopf, da kann ich keinen Druckverband anlegen.“
„Geben wir Caique zehn Minuten, dann brechen wir auf zum Fluss.“
Der Mestiço und sein Begleiter kamen nach fünf Minuten bereits zurück. „Kein Blut. Ich könnte es finden, aber dann müsste ich allein losgehen.“
„Vergiss es. Wir bringen jetzt Quati zum Fluss, rufen einen Hubschrauber und dann kommen wir alle zurück hierher und jagen das Biest.“
Sie bauten eine Trage aus starken Lianen und einigen Uniformstücken, dann hoben zwei Mann den Bewusstlosen auf und der Trupp bewegte sich in Richtung Fluss. Wer nicht den Verletzten trug, hielt das Gewehr im Anschlag und sicherte nach allen Seiten. Manchmal meinte einer der Männer, einen verdächtigen Laut zu hören, dann machten sie Halt und lauschten. Aber da waren nur die üblichen Geräusche des Regenwaldes. Insekten summten und brummten durch die schwüle Luft, in den Bäumen lieferten sich die unterschiedlichsten Vögel ihre Wettkämpfe und ab und zu hörten sie die warnenden Rufe der Brüllaffen, deren Aufmerksamkeit ihnen, einem Fressfeind oder wem auch immer gelten konnte. Unbehelligt erreichten die Männer schließlich den Fluss, wo sie die Trage abstellten und der Tenente über Funk einen Hubschrauber zu ihren Koordinaten beorderte.
Bárbaro und Caique unterhielten sich leise über das, was geschehen war. „Was meinst du, was kann das gewesen sein?“, fragte der Mestiço. „Doch der Abá jaguara?“
„Schwer zu sagen. Auf jeden Fall hat es Quati angefallen wie ein Raubtier. Es ging ihm direkt an die Kehle. Hätte der Tenente nicht geschossen, hätte das Biest ihm den Kehlkopf herausgerissen und das wär’s dann. Auch so ist es fraglich, ob der Kleine es schafft. Ich will es jagen, was immer es sein mag.“
„Ich auch. Aber ich glaube, wenn wir mit einem halben Zug hier durch den Wald trampeln, werden wir es nicht kriegen. Am liebsten wäre es mir, ich könnte allein losgehen oder mit dir.“
Bárbaro blies den Rauch von seiner Selbstgedrehten durch die Nasenlöcher. Wenn er im Einsatz war, musste er ab und zu eine rauchen, um die Nerven zu stimulieren.
„Du hast den Tenente gehört. Er kann nicht zugeben, dass er sich vor Angst fast in die Hosen gemacht hat. Sollte er zulassen, dass nicht der gesamte Trupp den Auftrag weiterverfolgt, bekommt er Ärger mit Leão. Wir werden alle gehen und wir beiden müssen auf die Frischlinge aufpassen.“
Caique spuckte den Kern einer Laranja de macaco aus, die er sich von einem Baum am Ufer gepflückt hatte. „Ich weiß. Das wird eine schlechte Sache werden.“
„Bárbaro, komm schnell her! Quati geht es schlechter!“, rief einer der Männer. Der Sargento warf seine Kippe weg und eilte ans Ufer, wo der Verletzte sich aufgerichtet hatte und röchelnd versuchte, Luft zu bekommen, doch das Blut verschloss ihm die Atemwege.
„Maldito! Ich weiß nicht, was wir mit ihm tun sollen, er verliert zu viel Blut. Dreht ihn auf die Seite!“ ordnete Bárbaro an und half dabei, Quati in eine stabile Seitenlage zu bringen, aber der Verletzte wehrte sich und versuchte sich in seiner Todesangst aufzurichten. Mit vereinten Kräften hielten die Männer ihn am Boden und schließlich verdrehte er die Augen und sein Körper erschlaffte.
„Puta! Wir verlieren ihn!“ Bárbaro begann mit einer Herzmassage und zählte dabei laut mit: „Eins, zwei, drei, eins, zwei, drei…“ Er hatte im Erste-Hilfe-Kurs gelernt, dass man kräftig drücken sollte, auch wenn ein paar Rippen dabei draufgingen, also legte er all seine Kraft in die Pumpbewegungen, bis ihm der Schweiß in die Augen lief.
Nach eine Weile spürte er eine Hand auf seine Schulter. „Was ist?“, rief er außer Atem.
„Lass ihn, er ist tot. Du kannst nichts mehr für ihn tun.“
Bárbaro hielt inne und versuchte einen Puls zu erfühlen. Dann legte er Quati das Ohr auf die Brust. Nichts. Der junge Mann war tot. Der Sargento richtete sich auf und bemühte sich, seinen eigenen Herzschlag unter Kontrolle zu bekommen. Dabei drehte er sich mit zittrigen Fingern eine Zigarette und wartete darauf, dass das Schwindelgefühl vorüberging, nachdem er den ersten Zug genommen hatte.
Die Männer standen mit gesenkten Köpfen um den Toten herum und schwiegen. Nach einer halben Ewigkeit hörten sie das Geräusch der Hubschrauberrotoren.
- - -
Ihre Nachtsichtgeräte hüllten die Umgebung in giftgrünes Licht. Die dichte Vegetation zwang ihnen auf, hintereinander zu gehen, was aus taktischen Gründen eigentlich nicht optimal war. Die Männer hielten ihre Schnellfeuergewehre fest umklammert und insbesondere bei dem ersten und letzten Mann in der Reihe waren die Nerven angespannt wie Drahtseile. Mehr als einmal fixierte jemand ein vermeintliches Ziel, aber einmal stellte es sich als Pekari heraus, das mit seinem Rüssel im Waldboden nach Würmern und Insekten grub, ein anderes Mal hätte einer der Frischlinge fast auf einen umgefallenen Baumstamm geschossen, dessen Umrisse er für einen am Boden kauernden Jaguar hielt. Nach nunmehr drei Stunden Marsch durch den dichten Wald unter höchster Anspannung, seit der Hubschrauber Quatis Leichnam abgeholt hatte, waren die Männer müde. Die Dämmerung war wie üblich in diesen Breitengraden schlagartig einer tiefen Dunkelheit gewichen und die Geschöpfe der Nacht beherrschten das Geschehen.
Caique führte die Einheit in Halbkreisen vom Flussufer weg und wieder zurück, da er der Ansicht war, dass man so die Chance erhöhte, das Vieh aufzuspüren, das Quati getötet hatte.
Tenente Gonçalves löste den Mann am Ende ab und er sicherte jetzt zur Seite und nach hinten. Sie hatten vielleicht einen weiteren Kilometer zurückgelegt, als der Tenente das Gefühl nicht loswurde, dass ihn etwas beobachtete. Er spürte, wie sich seine Nackenhaare aufstellten und unter seinem Hemd bekam er eine leichte Gänsehaut. In immer kürzeren Abständen drehte er sich um und spähte auf den Pfad zurück, der eigentlich nur ein schmaler Wildwechsel war. Jetzt war er sich sicher, dass er etwas gesehen hatte. Hinter einem Baum vernahm er eine Bewegung. Er klopfte seinem Vordermann auf die Schulter, hob die Hand und blieb stehen. Das Zeichen wurde weitergegeben, bis die Einheit stand. Durch das Zielfernrohr seines Gewehres zoomte Gonçalves näher an den Baum heran, bis er die stachelige Rinde im Detail erkennen konnte. Und hinter dem Baum lauerte eine Gestalt. Der Tenente ließ vor Schreck fast das Gewehr fallen, als er erkannte, was ihn da anstarrte. Sein Herz schlug bis zum Hals und er rief sich selbst zu, sich zusammenzureißen, Seine Männer sollten nicht sehen, wie viel Angst er hatte. Kurz spielte er seine Optionen durch, dann atmete er tief ein und betätigte den Abzug.
In den Bäumen erhob sich ein infernalisches Kreischen und Affen und Vögel sprangen und flatterten aufgeregt durcheinander. Gonçalves sah, wie sein Ziel zu Boden ging. Er rief: „Feind sechs Uhr getroffen am Boden, Ausschwärmen, nach allen Seiten sichern!“