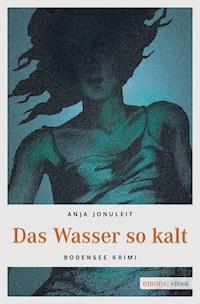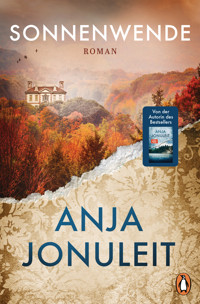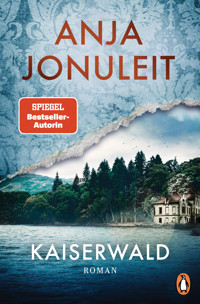
12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Penguin Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Die Kaiserwald-Reihe
- Sprache: Deutsch
Eine Suche. Eine Liebe. Ein Verbrechen.
»Deine Mutter ist verschwunden.« Eine Abfolge von Gefühlen zog über sein Gesicht: Ungläubigkeit, Entsetzen und schließlich diese Angst, die nun in der Welt war wie ein Geist, den man aus der Flasche gelassen hat.
Riga, Ostern 1998. Rebecca Maywald verschwindet spurlos. Sie hinterlässt eine achtjährige Tochter. Viele Jahre später setzt ein anonymer Brief Ereignisse in Gang, die das Leben zweier Familien für immer verändern sollen.
Berlin, 2023. Mathilda, Ex-Gebirgsjägerin, provoziert einen Autounfall, um mit Falk von Prokhoff, dem Sohn einer angesehenen Diplomatenfamilie, in Kontakt zu kommen. Der Grund bleibt zunächst unklar. Womit sie nicht gerechnet hat: Dass sie sich in ihn verliebt. Ein gefährliches Spiel um falsche Identitäten, unentdeckte Verbrechen und dubiose Machenschaften der Familienstiftung »Drei Linden« beginnt …
www.anjajonuleit.de
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 652
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
»Deine Mutter ist verschwunden.« Nur dieser eine kurze Satz, und eine Abfolge von Gefühlen zog über sein Gesicht: Ungläubigkeit, Entsetzen und schließlich diese Angst. An sie vor allem erinnere ich mich. Die Angst, die nun in der Welt war wie ein Geist, den man aus der Flasche gelassen hat.
Riga, Ostern 1998. Rebecca Maywald, Lehrerin am Deutschen Gymnasium in Riga, verschwindet spurlos. Ihre achtjährige Tochter Penelope wächst auf bei ihren liebevollen Großeltern im Allgäu. Die Sehnsucht nach der Mutter bleibt. Viele Jahre später setzt ein anonymer Brief Ereignisse in Gang, die das Leben zweier Familien für immer verändern sollen.
Berlin, 2023. Mathilda, junge Ex-Soldatin der Gebirgsjäger, provoziert einen Autounfall, um mit den von Prokhoffs, einer einflussreichen Diplomatenfamilie, in Kontakt zu kommen. Der Grund dafür bleibt zunächst unklar. Womit sie nicht gerechnet hat: Dass sie sich ausgerechnet in deren Sohn Falk verliebt. Ein gefährliches Spiel um falsche Identitäten, unentdeckte Verbrechen und dubiose Machenschaften der Familienstiftung »Drei Linden« beginnt. Die Spuren führen nach Riga, in den Kaiserwald …
Der neue große Roman von SPIEGEL-Bestseller-Autorin Anja Jonuleit: einfühlsam, fesselnd und klug recherchiert.
»Wie immer ist ein Roman von Anja Jonuleit ein Garant für gute Recherche, exzellente Erzählkunst und große Unterhaltung.«
Kieler Magazin über ›Das letzte Bild‹
Anja Jonuleit, 1965 in Bonn geboren und am Bodensee aufgewachsen, arbeitete einige Jahre für die Deutsche Botschaft in Rom. Nach einer Abordnung an die Botschaft Damaskus studierte sie am Sprachen- und Dolmetscherinstitut in München Italienisch und Englisch. Zurück am Bodensee machte sie sich als Übersetzerin und Gerichtsdolmetscherin selbstständig, bevor sie sich ganz dem Schreiben widmete.
Behutsam und kenntnisreich nimmt sie sich der großen Stoffe unserer Zeit an. Ihren Romanen – darunter »Herbstvergessene«, »Der Apfelsammler«, »Rabenfrauen« und »Das letzte Bild« – folgt mit »Kaiserwald« der erste Teil eines breit angelegten Familiendramas. Der zweite Teil »Sonnenwende« erscheint im Herbst 2024.
ANJA JONULEIT
KAISERWALD
ROMAN
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Copyright © 2024 by Penguin Verlag
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Straße 28, 81673 München
Umschlaggestaltung: FAVORITBÜRO, München
Umschlagmotive: Artwork unter Verwendung von © Arcangel, © shutterstock.com
Umsetzung eBook: Greiner & Reichel, Köln
ISBN 978-3-641-31396-8V002
www.penguin-verlag.de
Für meine Cousine Andrea Sandmann
»Die Zukunft ist gesichert.«
Prolog
Riga, im Frühjahr 1997
Mir brennen die Augen, als wir durch die Passkontrolle gehen. Eigentlich wollte Mama uns vom Flughafen abholen. Aber da wir so viel Krempel dabeihaben und das alles gar nicht in den Mercedes passt, mietet Waltraud einen VW-Bus. Vom Rücksitz kommt mal wieder nur Gemaule. Falk, der herumtrompetet, er habe keinen Bock auf die Scheiße und was die denn überhaupt im Scheiß-Ostblock wollen, woraufhin Waltraud ihm erklärt, dass wir 1997 haben und der Ostblock seit dem Zerfall der Sowjetunion Ende 1991 nicht mehr existiert. Klar, dass Tristan sie jetzt noch ein bisschen mehr foppen will, indem er sie nach Kippen fragt. Aber Waltraud lässt sich nicht provozieren. Das tut sie nie. »Ich kenne meine Pappenheimer«. Das sagt sie manchmal, und es hört sich für mich echt schräg an, weil Waltraud diesen britischen Akzent hat – auch wenn bei dem Vornamen keiner draufkäme, ist sie schließlich in England aufgewachsen, und nur ihre Mutter ist deutsch. Außerdem ist Waltraud viel zu hübsch für so ein beknacktes Wort wie Pappenheimer. Allerdings gibt sie sich ziemlich viel Mühe, das zu verstecken, und trägt immer so praktische Klamotten. Wahrscheinlich haben die ihr das bei ihrer Ausbildung zur Nanny eingebläut. Bloß nicht die Aufmerksamkeit des Hausherrn auf sich ziehen, sonst gibt es Ärger mit der Hausherrin. Wieso bist du nicht Ärztin geworden oder Anwältin, statt dich um so kleine Arschlöcher wie uns zu kümmern?, hat Tristan in einem seiner lichteren Momente mal gefragt. Aber Waltraud hat bloß gelacht und gesagt, der Job bei uns sei gar nicht so schlecht. Was ja wohl stimmen muss, sonst wäre sie nicht geblieben, als Tristan und Falk und später dann auch ich ins Internat gekommen sind. Seitdem ist sie so eine Art Hausdame, die alles macht, auf das meine Eltern keinen Bock haben. Und jetzt, wo Tristan und Falk – nach dreimal umtopfen – auch noch von meinem Internat, der Luisenhöhe, geflogen sind, ist sie wieder für uns kleine Arschlöcher zuständig.
Ohne das mit Tristan und Falk wäre ich jetzt noch auf der Luisenhöhe statt hier in dieser komischen Gegend. Das Mädchen mit den Asi-Brüdern zu sein war ein beschissenes Gefühl. Aber dann ist alles ganz schnell gegangen. An einem Tag habe ich noch einen Aufsatz im Internat geschrieben, am nächsten schon im Flugzeug nach Delhi gesessen, wo Waltraud gerade den Hausstand aufgelöst hat, weil mein Vater nach Riga versetzt wurde. Und jetzt sind wir hier, und ich weiß auch nicht, wieso ich immer noch die Hoffnung habe, dass wir am Ende doch so was wie eine normale Familie sein könnten.
Ich erinnere mich noch gut an den Tag, an dem wir im Kaiserwald ankamen. Es war, als würde man in die Vergangenheit reisen, an einen Ort, den es eigentlich gar nicht mehr gab.
Kaiserwald I
Penelope. Alles begann – oder endete – an jenem Ostersonntag 1998. Du kennst mich mittlerweile gut genug, um zu wissen, dass ich das genaue Datum abrufbereit habe. Aber es gibt immer noch zu viel in meinem Leben, von dem du keine Ahnung hast. Höchste Zeit, die Geheimnisse endlich aus der Dunkelkammer ans Tageslicht zu holen, Stück für Stück, damit du begreifst, warum ich dich so lange belogen habe.
Es war also am Ostersonntag, dem 12. April, ich war bei meinen Großeltern im Allgäu zu Besuch, als mein Vater anrief und meine Mutter sprechen wollte. Ich lachte, denn ich glaubte, er wollte mich auf den Arm nehmen, so wie er das manchmal tat. Doch da raunzte er mich an, ich solle ihm verdammt noch mal meine Mutter ans Telefon holen, was mich verwirrte, denn meine Mutter war doch bei ihm zu Hause. Ich ließ den Hörer sinken, schob den Dackel weg, der wie ein Verrückter meine Beine umschwänzelte, und ging in die Küche zu meiner Oma, die am Herd stand und Knödel machte.
»Hier, der Papa«, sagte ich und streckte ihr das Telefon entgegen. Ich weiß noch genau, wie sie verwundert die Augenbrauen hob, zur Spüle ging, sich die vom Knödelteig glitschigen Hände wusch und das Telefon ans Ohr hob, mit dem rot-weiß karierten Küchenhandtuch daran.
»Ja, hallo?«, fragte sie ungläubig, vielleicht weil mein Papa sonst nie hier anrief, auch nicht an Feiertagen. Dann sagte sie: »Nein, nein, warum sollte sie denn hier sein?«
Während sie meinem Vater zuhörte, schwieg sie, er hatte ihr allerhand zu erzählen. Nichts Gutes anscheinend, denn während sie dastand, veränderte sich ihr Gesichtsausdruck, und ihr sonst so freundlicher Mund war nur noch ein gerader Strich, ihr Blick nach unten gerichtet, so als müsste sie eine unleserliche Handschrift auf dem Küchenboden entziffern. Es kam mir vor wie eine Ewigkeit.
Irgendwann fragte sie: »Und der Land Rover ist auch weg?« Dann schwieg sie wieder, während die Stimme meines Vaters aus dem Hörer drang, blechern und weit entfernt, wie vom anderen Ende der Welt.
Plötzlich richtete sie sich kerzengerade auf. »Was?«, rief sie. »Und da meldest du dich erst jetzt?«
Meine Oma stellte meinem Vater eine Menge Fragen: ob er und meine Mutter sich mal wieder gestritten hätten, ob meine Mutter ihm nicht vielleicht eins auswischen wolle – oder nicht einfach für ein paar Tage ans Meer gefahren sein könnte, es seien ja schließlich Ferien.
Am Ende drückte sie die Taste und legte den Hörer mit dem Küchenhandtuch beiseite. Sie sah mich an, als würde sie mich zum ersten Mal sehen, und dann sagte sie mit furchtbar ernster Stimme: »Lauf schnell und hol den Opa.«
Ich weiß noch, wie ich nach draußen gerannt bin und meine Beine sich auf einmal mürbe angefühlt haben, als ob sie etwas wüssten, dass mein Verstand noch nicht begriff. Der Opa, der gerade beim Holzhacken war, ließ sofort die Axt sinken und eilte hinter mir her ins Haus, und als meine Großmutter ihm sagte: »Die Becky ist verschwunden«, nur diesen einen kurzen Satz, zog eine Abfolge von Gefühlen über sein Gesicht, die sich mir für alle Zeit eingebrannt hat: erst Ungläubigkeit, dann Entsetzen und schließlich Angst.
Die Angst. An sie vor allem erinnere ich mich. Die Angst, die nun in der Welt war wie ein Geist, den man aus der Flasche gelassen hat. Da nutzte es nichts, dass sich die beiden bemühten, mich mit Erwachsenenerklärungen zu beruhigen. Denn ich hatte sie auf dem Gesicht des Opas gesehen und in der Stimme der Oma gehört. Das ist es, was wir beide gemeinsam haben, du und ich. Die Angst. Wobei deine scharfkantiger ist, dich in deinen Träumen verletzt und dir die Seele aufreißt.
Kann ich dir begreiflich machen, wie sich das damals für mich angefühlt hat? Kannst du etwas damit anfangen, wenn ich dir sage, wie sehr ich meine Mutter liebte und dass mein Vater mir nie besonders nahestand? Jedenfalls blieb ich nach diesem Anruf bei meinen Großeltern in Röthenberg, weil mein Vater ja wieder arbeiten musste und sich nicht richtig um mich kümmern konnte. Anfangs war mein Aufenthalt bei den Großeltern nur für die Übergangszeit gedacht. Sie dachten wohl, dass es das Beste für mich wäre, dass ich so den geringsten Schaden erleiden würde. Doch selbst jetzt, nach so vielen Jahren, fällt es mir immer noch schwer, über diese erste Zeit zu sprechen. Wie ich mich durch die Tage tastete, wie bei jedem Klingeln des Telefons ein Stromstoß durch meinen Körper fuhr. Und dann gab es diese seltsamen Minuten, oder waren es Stunden?, in denen ich in einem Spiel versank, wie Kinder es eben tun. Dann fühlte es sich so an, als wäre sie gar nicht richtig weg, sondern immer noch in unserer Wohnung in Riga, wo sie jeden Tag zur Arbeit fuhr und wieder zurück, wo sie die Wäsche wusch und den Küchentisch abwischte, bis ich nach Hause zurückkehrte. Doch wenn ich irgendwann mit einem jähen Schrecken in die Wirklichkeit zurückstürzte, war die Angst wieder da und scheuchte mich durch den Garten. Aber nie so weit fort, dass ich das Telefon nicht hätte hören können.
Berlin, im Sommer 2023
Mathilda. Die Sonne am Abend des 31. Juli stand tief, als Mathilda in Prokhoffs Wagen raste. Und obwohl sie es ja mit Absicht tat, verkrampfte sich ihr Magen, während sie Gas gab, verdichtete sich zu einem dicken harten Klumpen wie manchmal im Halbschlaf, wenn sie das Gefühl hatte, in einen Abgrund zu fallen. Dann der Aufprall. Kreischendes Blech, splitterndes Glas, Bilder, die im Zeitraffer vorüberzogen. Selbst in diesem Moment ließ ihr Hirn sie nicht in Ruhe.
Als der Augenblick vorüber war und sie ihn aus seinem Wagen steigen sah, diesem fetten schwarzen Mercedes-S-Klasse-Ding, dessen Kühlergrill gerade mal eine leichte Delle zeigte, während ihre Schrottschleuder jetzt um ein Drittel kürzer war und wirklich Schrott, schloss sie die Augen und ließ ihren dröhnenden Schädel gegen die Kopfstütze sinken. Sie spürte, wie etwas Warmes über ihr Gesicht lief.
Die nächsten Minuten waren ohne Bild. Das Knirschen von Schritten im zersplitterten Glas. Jemand, wahrscheinlich Prokhoff, der ihre Autotür aufriss, sie an der Schulter berührte, erschrocken die Luft einsog, panisch auf sie einsprach. »Hallo? Hallo? Können Sie mich hören?« Es klang, als befände er sich in einem Funkloch. Dann wieder das Knirschen und Prokhoffs Stimme. »Einen Notarzt bitte, schnell!« Sie hörte ihn die Adresse durchgeben, kurz darauf andere Stimmen, ein Mann: »Was ist passiert?« Er: »Sie ist einfach rausgefahren.« Eine Frau: »O Gott, das viele Blut … und sie hängt so komisch da …« Irgendwann kam der Notarzt, der ihr Augenlid anhob, ihr in die Pupillen leuchtete, erst in die eine, dann in die andere. Ein starker Druck am Arm. Jemand, der sagte: »Blutdruck total im Keller.«
»Wo bringen Sie sie hin?«, hörte sie Prokhoff kurz darauf sagen, wie durch Watte. Aber da hatte sie schon eine Sauerstoffmaske auf. Sie blinzelte, öffnete die Augen, und alles, was sie sah, war Weiß, sein Hemd, und darüber sein Gesicht. Er sah besorgt aus. Als er merkte, dass sie wach war, dass sie nicht sterben würde, zumindest nicht in diesem Moment, glaubte sie, so etwas wie Erleichterung in seinem Blick zu erkennen. Als Mathilda das sah, wurde ihr klar, dass sie es geschafft hatte. Nach Monaten der Ereignislosigkeit hatte sie es endlich geschafft – von nun an würde sie für ihn zu existieren beginnen. Das Gefühl, das jetzt in ihr hochstieg, war eine seltsame Mischung aus Panik und Triumph.
»Ins Martin-Luther-Krankenhaus«, sagte der Sanitäter, ein arabisch aussehender Typ mit Bart.
Sie machte Anstalten, sich aufzurichten, wollte sich die Maske vom Gesicht ziehen, sagen, dass es ihr gut ginge, dass sie nirgends hingebracht werden müsste, doch sie besann sich. Für das, was sie vorhatte, war es viel besser, wenn sie weiter die Schwerverletzte gab, auch wenn sie sicher war, dass ihr nichts Schlimmes passiert war. Und so murmelte sie etwas und tat, als könnte sie keinen geraden Satz mehr herausbringen. Ein Mann, der aussah wie Harry Potter, wahrscheinlich der Notarzt, beugte sich über sie und berührte ihre Schulter. Und da tauchte auch Prokhoff wieder in ihrem Gesichtsfeld auf.
»Kann ich jemanden für Sie anrufen? Der zu Ihnen ins Krankenhaus kommt?«, fragte er überdeutlich und starrte sie an, als wollte er sie hypnotisieren.
»Da ist niemand«, flüsterte sie durch die Maske und machte mit dem Kopf eine ungeschickte, abwehrende Bewegung. Aber er ließ nicht locker, und so hob Mathilda leicht die Maske ab, ihre Stimme hatte tatsächlich wenig Kraft, als sie sagte: »Ich habe niemanden hier … komme aus Namibia … bin nur Gaststudentin.« Das Letzte, was sie sah, war sein erstaunter Blick, bevor die Sanitäter sie in den Krankenwagen schoben. Sie schloss die Augen, froh, diesem Blick erst mal zu entkommen. Für den Anfang hatte sie genug gelogen.
Riga, im Frühjahr 1997
Rebecca. Die Geschichte mit Georg begann vier Wochen nach Xenias fünfzehntem Geburtstag, sieben Monate, nachdem ich die Stelle als Lehrerin am Deutschen Gymnasium in Riga angetreten hatte. Xenia war ein waches Mädchen, intelligent und schüchtern, aber auf keinen Fall verwöhnt, wie man angesichts des märchenhaften Reichtums ihrer Familie hätte vermuten können. Wie reich ihre Familie wirklich war, wusste ich da allerdings noch nicht.
Ihre Mutter habe ich kennengelernt, als Xenia das erste Mal Bauchschmerzen hatte und im Krankenzimmer lag. Ich weiß noch, wie mir fast der Mund offen stehen blieb, als sie die Tür des Klassenzimmers öffnete – eine Eiskönigin aus einem Modemagazin, im lindgrünen Kostüm mit beige-rotem Seidentuch. Natürlich hatte ich sie schon bei der Einschulung gesehen, ich musste sie gesehen haben, aber an diesem ersten Tag war ich so aufgeregt gewesen, dass mir die Eltern nur unscharf in Erinnerung geblieben waren, ein Meer von Gesichtern im Klassenzimmer, Augen, die mich musterten und auf meine Tauglichkeit hin prüften. Ich konnte die Gedanken der Eltern förmlich hören: Ist sie nicht zu jung? Und ihr Rock nicht zu kurz? Als Xenias Mutter an diesem Vorfrühlingstag hereinkam, um ihre Tochter abzuholen und sich die Hausaufgaben geben zu lassen, war ich jedenfalls erst mal sprachlos, denn sie sah aus, als käme sie direkt von einem Nachmittagstee in Monaco.
Ich gab meiner Klasse einen Arbeitsauftrag und begleitete Xenias Mutter ins Krankenzimmer, wo ihre Tochter, eine Brechschüssel auf dem Schoß, vornübergebeugt auf der Liege hockte, kalkweiß im Gesicht, und ich weiß noch, was ich dachte, als ich die beiden zusammen sah: die blonde Eiskönigin und das scheue Mädchen, das angeblich ihre Tochter sein sollte. Sicher, auch Xenia war hübsch, mit ihrem energischen Kinn und den tiefbraunen Augen, aber sie war mir von Anfang an spröde und verletzlich vorgekommen. Schon im Krankenzimmer habe ich kurz an ihren Vater gedacht und mich gefragt, ob sie wohl nach ihm käme. Die weltläufige Eleganz ihrer Mutter dagegen mochte eindrucksvoll sein, befremdete mich aber auch, daher verabschiedete ich mich recht zügig und kehrte in mein Klassenzimmer zurück.
Xenia war das jüngste von drei Geschwistern und hatte, so kann man das wohl sagen, einen Narren an mir gefressen. Jedenfalls wollte sie mich, auch wenn das für eine schüchterne Fünfzehnjährige reichlich seltsam war, unbedingt zu ihrem Geburtstagsfest einladen, das direkt im Anschluss an die Frühjahrsferien stattfinden sollte. Zuerst wollte ich nicht, aber dann kam ihre Mutter kurz vor Ferienbeginn deshalb extra noch mal in die Schule. Sie wisse, dass so etwas ungewöhnlich sei, und natürlich solle nicht der Eindruck entstehen, dass sie im Gegenzug dafür etwas erwarten würden, gute Noten oder eine besondere Behandlung. »Xenia würde sich sehr freuen, das ist alles«, sagte ihre Mutter kühl, und so nahm ich die Einladung an.
Die Adresse, die sie mir gab, lag im vornehmen Stadtteil Mežaparks, der mit seinen Villen und parkartigen Grundstücken als eines der schönsten Viertel Rigas galt. Als Kunsthistorikerin wusste ich, dass das Viertel Anfang des zwanzigsten Jahrhunderts als erste Gartenstadt Europas von der deutschen Elite hier in Riga erbaut worden war, doch als ich nun das erste Mal überhaupt seit meiner Ankunft in der Stadt durch die stillen Straßen fuhr, war ich doch verblüfft über die Stimmung, die hier herrschte. Es war gerade so, als wäre ich aus der Gegenwart in eine geheimnisvolle Vergangenheit gefahren, zurück in eine Welt, in der weit entfernte Traumhäuser zwischen Büschen und Kiefernstämmen hindurchschimmerten. Ich verlangsamte das Tempo und hielt Ausschau nach der Hausnummer, die auf der Einladung gestanden hatte, konnte aber kein Schild entdecken, das mir die gesuchte Adresse verraten hätte. Auch war weit und breit kein Mensch zu sehen, den ich hätte fragen können. Doch dann bog ich in eine Straße ein, in der dicht an dicht teure Wagen geparkt waren, viele von ihnen mit Diplomatenkennzeichen, und so wusste ich, dass ich richtig war. Ich parkte den Wagen hinter dem letzten Fahrzeug in der Reihe, einem wie aufgepumpt wirkenden dunkelgrünen Jaguar, und stieg aus.
Ich weiß nicht mehr genau, was ich eigentlich erwartet hatte, stampfende Bässe, ausgelassenes Gejohle von Jugendlichen. Jedenfalls keine Kammermusik von Mozart und haufenweise fein gekleidete Erwachsene, die in Grüppchen zusammenstanden, in einem eleganten Salon, mit Sektgläsern und Canapés in der Hand. Kurz blieb ich an der Tür stehen und hielt nach Xenia Ausschau, doch als ich sie nirgends entdeckte, nahm ich mir ein Glas Sekt, schlenderte zwischen den Grüppchen umher und unterhielt mich mit ein paar Leuten, die Englisch miteinander sprachen. Ich war an solche Veranstaltungen gewöhnt, hatte zuvor schon am Goethe-Institut in Windhoek und an der Deutschen Schule in Montevideo unterrichtet, wo die Mitglieder der ausländischen Communities sich ständig auf irgendwelchen Empfängen trafen. Ich war gerade dabei, mir ein paar Snacks von einem vorbeigleitenden Tablett zu angeln, als ich hinter mir Xenias Stimme hörte.
»Sie sind zu spät!«, sagte sie und klang irgendwie enttäuscht, als hätte ich sie im Stich gelassen.
Ich ließ die Snacks sausen und antwortete ihr, dass ich gerade vom Flughafen käme, direkt aus dem Urlaub, und extra für sie einen Tag früher zurückgekommen sei, was sie zu besänftigen schien. Sie nahm mich bei der Hand und dirigierte mich aus dem Salon, um mir ihr Zimmer zu zeigen. Ich war ein wenig überrascht über ihre Direktheit, vor allem aber darüber, dass sie auf mich gewartet zu haben schien, was mir angesichts der vielen Gäste nicht einleuchtete. Sie zog mich quer durch die Eingangshalle und über eine Marmortreppe nach oben, vorbei an einer Flut von Zimmertüren, was beeindruckend war für jemanden wie mich, die in einem kleinen Forsthaus im Allgäu groß geworden war. In ihrem Zimmer angekommen, gab ich ihr mein Geschenk, ein Zeichenfeder-Set, weil sie, wie ich wusste, vor Kurzem mit dem Comiczeichnen begonnen hatte. Sie schien sich ehrlich zu freuen, was wiederum mich freute, denn ich war mir bis zum letzten Moment nicht sicher gewesen, was ich einem Mädchen, das schon alles hatte, schenken sollte. Und während sie so dastand, in ihrem blauen Samtkleid, und strahlend die Federn aus dem Etui zog, wirkte sie auf einmal wie ein Kind, viel jünger, als sie eigentlich war. Ich drehte mich um, und das Zimmer schien meine Gedanken zu spiegeln, denn alles hier war irgendwie zu mädchenhaft, zu kindlich, und passte nicht recht zu einem Teenager.
»Wo sind denn deine Freundinnen?«
»Wen meinen Sie?«
»Ella und Alise.«
»Ella ist irgendwo unten … Alise durfte ich nicht einladen. Obwohl die ja nur drei Häuser weiter wohnt.« Sie sagte es resigniert, ohne Vorwurf in der Stimme, wie eine Feststellung.
»Ach? Aber warum denn nicht?«, fragte ich verblüfft und musste an all die Erwachsenen denken, die da unten herumstanden und Small Talk betrieben. Eine eigenartige Geburtstagsgesellschaft für ein fünfzehnjähriges Mädchen.
Xenia wich meinem Blick aus. »Meine Mutter findet, dass Alise …«, sie malte Gänsefüßchen in die Luft, »… frühreif ist.«
Ich sah Alise vor mir. Wie viele andere in ihrer Klasse trug auch Alise am liebsten zerrissene Jeans und knappe Oberteile. Ein ganz normaler Teenager also, dachte ich und betrachtete Xenia mit ihrem Samtkleid und der perfekten Zopffrisur.
»Mir kommt sie eigentlich ziemlich …«, ich suchte nach einem unverfänglichen Wort, aber mir fiel nichts Passendes ein, deshalb beendete ich den Satz etwas einfallslos mit: »… ziemlich normal vor.«
Xenia sah mich immer noch nicht an. Da platzte es aus ihr heraus: »Meine Mutter hat Angst, sie könnte zu früh Großmutter werden.«
Ich muss ziemlich dumm aus der Wäsche geschaut haben, denn jetzt kicherte sie. »Sie denkt, Alise steht auf Tristan.«
»Deinen älteren Bruder?«
»Ja.«
Ich unterdrückte ein Seufzen und überlegte, was ich dazu sagen sollte oder ob es nicht besser war, einfach darüber hinwegzugehen. Doch dann wechselte sie unvermittelt selbst das Thema.
»Schauen Sie mal, was ich von meiner Patentante Patrizia bekommen habe. Meine Mutter ist total sauer. Weil sie mir so eine sauteure Digitalkamera geschenkt hat, die ich eigentlich gar nicht wollte. Ich wollte die hier.« Sie griff nach etwas Pinkfarbenem, das auf ihrem Schreibtisch lag, und hielt es mir hin.
»Du musst mir auf die Sprünge helfen. Ist das auch eine Kamera?«
»Eine Spice Cam. Die hab ich mir so sehr gewünscht.«
Auf meinen verständnislosen Blick hin lachte sie und erklärte: »Eine Polaroidkamera … die Spice Girls haben ein cooles Video dazu gedreht.«
Während sie mir ein paar Fotos zeigte, die sie damit gemacht hatte, fiel mein Blick auf eine Zeichnung, die halb verborgen unter ein paar Schulheften auf ihrem Schreibtisch lag. Sie folgte meinem Blick und sagte: »Ich hab noch einen Comic gemalt … wollen Sie ihn mal sehen?«
Als ich nickte, zog sie ein paar Blätter hervor und hielt sie mir hin.
Ein Gesicht in Schwarz-Weiß sah mich an, riesige Augen, ein aufgerissener Mund. Ich griff danach, trat ans Fenster und begann die Zeichnungen durchzublättern.
»Wow«, sagte ich, und ich weiß noch, dass ich wirklich beeindruckt war, einerseits. Andererseits kroch beim Anblick der düsteren Szenen ein ungutes Gefühl in mir hoch. Zu sehen war eine Art Bildergeschichte: ein Mädchen mit langen blonden Haaren in einer Art Pfadfinderuniform, die mit Pfeil und Bogen bewaffnet durch einen Wald rannte und auf irgendwelche dunklen Gestalten Jagd machte. »Die sind … wahnsinnig gut. Du hast wirklich großes Talent«, murmelte ich und war fasziniert von der Eindringlichkeit der Darstellungen.
Sie senkte verlegen den Blick, aber ich sah, wie sehr mein Lob sie freute. Und ich hatte es ja auch ernst gemeint. Sie war gut, gehörte zu den begabtesten Schülerinnen, die ich je unterrichtet hatte. Und doch verstörten die Bilder mich auf eine Weise, die ich selbst nicht recht verstand. Es war schließlich nur ein Comic.
»Wie bist du denn auf diese Geschichte gekommen?«, fragte ich und betrachtete eine Zeichnung, auf der das blonde Mädchen sich im Gebüsch versteckte, am Rande eines Platzes, auf dem ein riesiges Feuer brannte, eine Art Scheiterhaufen, in dessen Mitte eine Puppe an einen Pfahl gebunden war.
»Ach«, antwortete sie, »das ist mir halt so eingefallen.«
»Das ist … ziemlich außergewöhnlich«, sagte ich, schob die Blätter vorsichtig übereinander und reichte sie ihr. »Irgendetwas muss dich doch inspiriert haben?«
»Ich weiß es echt nicht mehr«, murmelte sie und wich meinem Blick aus. Während sie die Zeichnungen umständlich zurück unter die Hefte schob, sah ich, wie sie rot wurde, und fragte mich verwundert, warum sie log.
Ich dachte, im Kaiserwald würde alles wieder gut werden, würden wir wieder zusammenfinden.
Kaiserwald I
Penelope. Wie das mit meiner Erinnerung ist? Diese Frage ist nicht leicht und schon gar nicht schnell zu beantworten. Wenn du nicht unendlich viel Zeit hast, solltest du sie lieber nicht stellen. Die Wahrheit ist: Ich erinnere mich an alles, an jede Kleinigkeit. Und das ist ein Fluch, mit dem ich lebe, seit ich denken kann. Dass nichts vergeht, dass ich nichts vergessen kann, dass alles immer noch da ist, in mir, in meinem Kopf, jederzeit abrufbereit, jederzeit bereit, hochzuploppen wie ein Springteufel aus einer Kiste.
Und weißt du, was mich im Rückblick am meisten bestürzt? Dass alles in dieser Zeit ja irgendwie auch mit uns zu tun hat, auch wenn das damals niemand ahnen konnte. Aber lass mich vom ersten Tag in der neuen Schule erzählen – einem Tag, der mir schon morgens fast die Luft abschnürte, denn eine neue Schule hieß, dass sich die Erwachsenen einig waren: Meine Mutter würde so bald nicht zurückkommen.
Es war der 24. April, ein Freitag, und meine Oma und Tante Hannelore, die früher einmal Lehrerin gewesen war, begleiteten mich in die neue Grundschule, wo wir einen Termin beim Schulleiter hatten.
»Sie kommt zu Frau Wildenrein, das ist eine unserer erfahrensten Lehrkräfte«, sagte der Rektor und deutete auf ein Foto, auf dem eine sauertöpfische Frau zu sehen war, wobei er die ganze Zeit nur die Oma und Tante Hannelore ansah, so als wäre ich gar nicht im Raum, weshalb ich genug Zeit hatte, ihn anzusehen und darüber nachzudenken, an wen er mich erinnerte. Als er die Noten in meinem Zeugnis sah, hefteten sich seine Glubschaugen direkt auf mich, und da fiel es mir wieder ein. Er hatte große Ähnlichkeit mit der Kröte aus Der Wind in den Weiden, dem Buch, aus dem meine Mutter mir immer vorgelesen hatte. Ich wollte nicht weinen, deshalb rutschte ich von meinem Stuhl, und um mich abzulenken, betrachtete ich das große Foto an der Wand, wo alle Lehrerinnen der Schule und der Direktor abgebildet waren. Aber gleich als ich das Foto sah, musste ich schon wieder an meine Mutter denken. Sie hätte das nämlich ungerecht gefunden, dass da ein Mann war und ganz viele Frauen, und der Mann war natürlich der Chef. »Ihr werdet das alles mal besser machen!«, hatte sie oft zu mir gesagt, wenn sie die Wäsche aufhängte oder am Herd stand und kochte, nachdem sie den ganzen Tag gearbeitet hatte, während mein Vater in seinem Kabuff saß und Pfeife rauchte und noch etwas Dringendes für die Arbeit erledigen musste.
Am Ende gab der Direktor Tante Hannelore die Telefonnummer einer Lena Wolicek, die in unserer Gegend wohnte und mit der ich zusammen den Schulweg gehen könnte. Als wir kurz darauf den Pausenhof überquerten, sprachen meine Oma und Tante Hannelore mit dieser Lena, und ich weiß noch, wie sie dastand, mit ihrem Pferdeschwanz und der Tattoo-Kette, und zwischen der Oma und Tante Hannelore hin und her lächelte. Und wie die Neugier in ihren Augen aufblitzte.
Aber ich will dich nicht mit alten Schulhofgeschichten langweilen. Auch wenn du einmal zu mir gesagt hast (am 12. Oktober im letzten Jahr war das), dass du alles über mich erfahren willst. Aber da wusstest du natürlich noch nicht, was alles bedeutet.
Jedenfalls unterhielten sich die Oma und Tante Hannelore mit Lena und ihren Freundinnen, während ich dabeistand und die ganze Zeit nur daran denken konnte, dass sie alle eine Mutter hatten, die daheim auf sie wartete. Ich weiß, vieles von dem, was du durchgemacht hast, war auf eine andere Art viel krasser. Meine Großeltern müssen dir wohl wie ein Traum vorkommen, mit ihrer Wärme und Fürsorge. Aber das ändert nichts daran, wie fremd und wie einsam ich mich auf dem Heimweg fühlte, und das aufmunternde Geplapper von Tante Hannelore und der Oma machte alles nur noch schlimmer. Dabei wusste ich da noch nicht einmal, was für eine Nachricht mich gleich erwarten würde.
Als mein Opa uns zehn Minuten später die Haustür öffnete, gerade als die Oma den Schlüssel ins Schloss stecken wollte, schoss Wurzel, der Rauhaardackel meiner Großeltern, zur Tür heraus und tat wie immer, wenn er uns begrüßte, wie ein Ertrinkender. Ich war ganz damit beschäftigt, ihm den Kopf zu tätscheln, deshalb erkannte ich nicht sofort, dass etwas passiert sein musste. Erst im zweiten Moment bemerkte ich, dass der Opa ganz grau aussah, irgendwie viel älter. So richtig klar wurde es mir dann aber erst, als ich den erschrockenen Blick sah, den Tante Hannelore und die Oma wechselten. Und dann sagte die Oma mit einer Stimme, die ganz verrutscht klang: »Aber du bist ja schon daheim, Joseph, was ist denn los?«
Mein Opa sah von meiner Oma zu Tante Hannelore und wieder zu meiner Oma. »Was soll scho’ sein«, brummte er. »Ich hatte halt einen Termin, der nicht so lang gedauert hat.« Doch ich wusste gleich, dass er log. Zwar kam er fast immer zum Mittagessen nach Hause, doch sein Blick huschte umher wie eine ängstliche Maus, die auf der Suche nach einem Schlupfloch von einer Zimmerecke zur nächsten rast. Auch meine Oma merkte es, denn kaum, dass sie sich die guten Schuhe ausgezogen und die Pantoffeln angezogen hatte, sagte sie zu mir: »Geh doch noch ein bisschen in den Garten, bis das Essen fertig ist. Ich ruf dich dann.«
Ich nickte, sah von ihr zu Tante Hannelore und dann zum Opa, schnappte mir den Wurzel und machte auf dem Absatz kehrt. Ich lief ums Haus herum, stieg die paar Stufen zur Kellertür hinunter, drückte mit dem Ellbogen die Klinke herunter und schlich durch den Keller bis hinauf vor die Küchentür. Dort blieb ich stehen, mit dem Hund auf dem Arm.
»Nun sag es doch endlich, worauf wartest du denn noch?« Die Stimme meiner Oma klang schrill, und mit einem Mal spürte ich, wie etwas in mir sich zusammenballte, wie ein Fausthieb von innen. So stand ich da, mit angehaltenem Atem und dem Wurzel, der andauernd versuchte, mir das Gesicht abzuschlecken, und lauschte auf die Stille und auf das Schreckliche, das gleich kommen würde.
»Sie haben den Land Rover gefunden«, sagte mein Opa. »Auf einem Autobahnrastplatz an der A9, zwischen Bayreuth und Nürnberg.«
Berlin, im Sommer 2023
Mathilda. In der Notaufnahme war die Hölle los. Leute im Wartebereich und auf dem Korridor. Während Mathilda durch die Gänge geschoben wurde, bekam sie mit, dass es in der Nähe eine Feier in einem Seniorenheim gegeben hatte und der Kartoffelsalat wohl nicht mehr der frischeste gewesen war. Ihr wurde es ganz anders, als sie hörte, dass die Alten dort reihenweise umgekippt waren, Verdacht auf Salmonellenvergiftung. Am liebsten wollte sie auf der Stelle aufstehen und das Bett frei machen, damit der Typ, der sie herumschob, sich um die Alten kümmern konnte, ihr fehlte ja im Grunde nichts. Doch als sie Anstalten machte, sich aufzurichten, pflaumte der Pfleger, der aussah wie der Häuptling der Hells Angels, sie an, sie solle jetzt mal Ruhe geben. »Sie sehen doch, was hier los ist.« Wahrscheinlich war es dem ganzen Trubel geschuldet, dass die Ärztin Mathilda dann auch nur kurz durchcheckte. Nachdem sie noch mal den Blutdruck gemessen und sich die Wunde angeschaut hatte, meinte sie, Mathilda habe noch mal Glück gehabt, es sei nur eine Platzwunde. Trotzdem müsse sie zur Beobachtung dableiben, mindestens für vierundzwanzig Stunden. Reine Vorsichtsmaßnahme, aber bei einem Schädel-Hirn-Trauma müsse man aufpassen. Dann hetzte sie auch schon wieder weiter. Der Pfleger wischte Mathilda das Gesicht sauber, so vorsichtig, dass sie ihn nur verwundert ansehen konnte. Einen winzigen Moment lang fühlte sie sich wie ein Kind. Sie schloss die Augen, spürte der Erinnerung nach, versuchte sie zu greifen. Und tatsächlich bekam sie etwas zu fassen, und einen Moment lang sah sie ihre Mutter vor sich, so deutlich, als stünde sie hier vor ihr.
»Dat müsste halten«, sagte der Hells Angel in ihre Erinnerungen hinein. Sie öffnete die Augen, tastete ihre Stirn ab, auf der jetzt ein dickes Pflaster klebte.
»Danke«, sagte Mathilda. Er nickte und brachte sie auf ein Zimmer in der obersten Etage, am Ende des Korridors.
»So«, sagte er, »dat is’ unsre Luxussuite. Wenn wat is, Ihn’ schlecht wird oder so, klingeln Se.« Er deutete auf das Bedienpanel, das an dem Bettgalgen baumelte, und war schon wieder im Begriff, das Zimmer zu verlassen, als er sich an der Tür noch einmal umdrehte und mit strengem Blick sagte: »Und bleib’n Se verdammt noch ma’ im Bett!«
Mit einem Mal war es still. An der Wand gegenüber hing ein Flachbildschirm, zwei blassblaue Bilder einer Wüstenlandschaft, auf der Kamele zogen, irgendwo in der Ferne. Durch ein Fenster zur Linken sah sie in grüne Bäume. Gegenüber ein Tisch mit zwei Stühlen, darauf ein Obstteller mit Trauben, Melonenstücken, einer Birne, zwei kleine Saftflaschen, Wasser. Die Vorhänge zartblau und grau. Wenn Mathilda es nicht besser gewusst hätte, würde sie denken, sie wäre im Urlaub, in einem »besseren« Hotel. Das Einzige, was hier Krankenhausatmosphäre verbreitete, war dieser Galgen mit dem Bedienpanel.
Sie sah aus dem Fenster, ins sommermüde Grün der Bäume. Die Abendsonne ließ die Buchen am Straßenrand aufleuchten. Und obwohl es fast windstill war, schien es, als raschelten die Blätter ganz leise. Wie eine Unterwasserlandschaft, dachte Mathilda und wunderte sich ein bisschen über die Ruhe und die Abgeschiedenheit dieses Ortes inmitten der Stadt. Sie fragte sich, wo die Alten aus dem Seniorenheim waren. Und musste plötzlich an zu Hause denken. Wenn ihr tatsächlich mal was passieren sollte, würde niemand ihre Familie benachrichtigen. Niemand würde die Verbindung herstellen können. Es war ja alles falsch: ihr Führerschein, ihr Pass, ihr Name. Nichts davon gehörte zu ihr. Es gab nur zwei Menschen auf der Welt, die wussten, was sie vorhatte. Der eine war Baldrich, ein ehemaliger Kamerad, der früher bei den ITlern in Murnau stationiert gewesen war und ihr – natürlich undercover und nicht gerade legal – die notwendigen Informationen über die Prokhoffs beschafft hatte. Die andere Person lebte über achttausend Kilometer Luftlinie von Berlin entfernt. Mathilda atmete tief ein und wieder aus. Wenn all das hier vorüber war, würde sie nach Hause fahren und endlich reinen Tisch machen.
In dem Moment klopfte es, sie sagte: »Ja, bitte?«, und Prokhoff kam herein. Und obwohl sie ja genau das gewollt und sogar herausgefordert hatte, verschlug es ihr bei seinem Anblick jetzt den Atem. Nicht weil er noch immer das blutbefleckte Hemd trug und irgendwie dramatisch aussah, fast wie der Held in einem amerikanischen Actionfilm. Es war vielmehr die Tatsache, dass er hier tatsächlich vor ihr stand, der Mann, um den in den letzten Monaten ihr ganzes Denken gekreist hatte und den sie um jeden Preis hatte kennenlernen wollen. So sahen sie sich einen Moment lang an, Prokhoff, der in der geöffneten Tür stand, und Mathilda, die im Bett lag und sich ertappt fühlte, als könnte er die Gedanken hinter ihrer Stirn lesen.
Er schloss die Tür so behutsam, als hätte er es mit einer Sterbenden zu tun, und kam ganz leise auf Mathilda zu, ohne sie aus den Augen zu lassen. Einen Moment lang fühlte sie sich mies unter diesem Blick, der echte Sorge ausdrückte – mehr Sorge, als einem Menschen gebührte, der mit Absicht in ein anderes Auto gebrettert war. Doch das Gefühl verschwand so schnell, wie es aufgeblitzt war.
»Wie geht es Ihnen?«, fragte er schließlich und deutete auf ihren Kopf. Sie überlegte kurz. In die Bewusstlosigkeit konnte sie jetzt nicht mehr sinken, also sagte sie möglichst schwach, aber mit einem tapferen Lächeln: »Es geht schon.«
Prokhoff zog sich einen Stuhl heran und setzte sich. »Ich konnte noch keinen Arzt sprechen. Die sind hier vollauf beschäftigt. Ein Pfleger sagte mir, dass man Sie auf jeden Fall zur Beobachtung hierbehalten will.«
»Morgen werde ich heimgehen, auf jeden Fall.« Sie sagte das bestimmt, zu bestimmt, sie konnte nicht anders. Die Rolle des zarten Opfers lag ihr nicht.
Er zog eine Augenbraue hoch und warf ihr einen Blick zu, halb amüsiert, aber auch ein bisschen streng. Auf einmal hatte sie das Gefühl, sich hier wie ein trotziges Kleinkind aufzuführen. »Sie sollten auf das hören, was man Ihnen empfiehlt.«
Mathilda machte eine abwehrende Handbewegung, schüttelte den Kopf, was sie besser gelassen hätte, denn sofort begann das Zimmer zu wandern. Ihre Hand sank zurück aufs Bett, ihr Kopf auch. So verharrte sie eine ganze Weile, wartete, bis alles wieder stillstand. Erst jetzt kam ihr der Gedanke, dass ihr Manöver auch ganz anders hätte ausgehen können.
Als sie die Augen wieder öffnete, sah er sie noch immer an. Sie wusste nicht recht, wie sie diesen Blick interpretieren sollte. Sie wollte nicht, dass er sie für einen Pflegefall hielt, seinen Pflegefall. Andererseits war sie jetzt dort, wo sie hingewollt hatte, schließlich saß er hier neben ihrem Bett und sprach mit ihr. Und so besann sie sich auf die Rolle, die sie zu spielen hatte, und sagte: »Das ist sehr nett, dass Sie nach mir sehen. Obwohl ich es ja war, die …«
»Nun machen Sie sich mal keine Gedanken. Autos kann man reparieren.« Er stutzte, verzog das Gesicht erneut und sagte: »Obwohl Ihr Wagen ehrlich gesagt eher nicht so aussah.«
Mathilda verkniff sich den Impuls zu nicken und sagte möglichst reglos: »Das war zum Glück nur ein Mietwagen. Meiner ist zurzeit in der Werkstatt.«
»Ich wusste gar nicht, dass es solche Schrottkarren als Mietwagen gibt.«
Sie fragte sich kurz, ob er sie auf den Arm nahm, was durchaus sein könnte angesichts des überlegenen Grinsens auf seinem Gesicht. Und dann sagte er: »Aber was die Hauptsache ist: Sie erinnern sich an alles.«
Einen Moment lang sah sie ihn irritiert an. Wie hatte er das gemeint? Wusste er etwas, wusste er womöglich, wer sie war? Aber das konnte ja nicht sein. Er kannte sie doch nicht, und wie hätte er es denn herausfinden sollen, in der Kürze der Zeit? Da erst begriff sie, dass er sich auf den Unfall bezog, auf die Erinnerungslücken, die nach einem Schädel-Hirn-Trauma auftreten konnten.
Erleichtert lächelte sie. »Ja … klar. Das ist natürlich gut. Dass ich mich an alles erinnere.«
Riga, im Frühjahr 1997
Rebecca. Am frühen Abend, vielleicht gegen sechs, habe ich ihn zum ersten Mal gesehen. Zwei Stunden lang hatte ich mich mit verschiedenen Leuten unterhalten, mich am Büfett bedient, für einen Gesellschaftsfotografen posiert, zusammen mit Xenia und anderen Gästen, deren Namen ich vergessen habe. Jetzt war ich auf dem Weg nach draußen, um frische Luft zu schnappen. Ich überlegte, ob es unhöflich wäre, jetzt schon zu gehen, denn mein Mann und meine Tochter warteten zu Hause auf mich, zusammen mit den unausgepackten Reisetaschen und einem Haufen schmutziger Wäsche, den ich vor Schulbeginn am Montag noch waschen wollte.
Ich weiß noch genau, wie ich über die Terrasse nach unten geschlendert bin, in Richtung See, und da stand dieser Mann, direkt am Ufer, mit dem Rücken zu mir, und rauchte. Im ersten Moment habe ich noch überlegt, ob ich kehrtmachen und wieder hineingehen soll. Aber die kühle Luft fühlte sich gut an auf meinem erhitzten Gesicht, also blieb ich einfach stehen. In dem Moment drehte er sich um, und etwas Seltsames geschah. Einen Augenblick lang musterte er mich, wortlos und mit einem Blick, der mich dort festhielt, wo ich stand. Dann lächelte er, es war ein leicht ironisches Lächeln, hob die Hand mit der Zigarette und sagte: »Sie sehen aus, als könnten Sie auch eine vertragen.« Seine Stimme klang dunkel, sanft und bestimmt zugleich. Sie hatte etwas Hypnotisches, was mich einen kurzen Moment lang irritierte, ich weiß auch nicht, warum. Vielleicht weil ich das Gefühl hatte, ertappt worden zu sein. Es gefiel mir nicht, dass man mir mein Bedürfnis nach einer Pause so deutlich ansah. Und so zögerte ich, als er mir ein Etui hinhielt, obwohl eine Zigarette genau das war, worauf ich Lust hatte.
»Ich rauche eigentlich nicht mehr«, sagte ich und dachte an Robert, der es abstoßend fand, wenn ich nach Zigarette roch. Doch etwas an dieser Situation, das Dämmerlicht, die Frische dieses Frühlingsabends und sein unverwandter Blick ließen mich die letzten Schritte auf ihn zugehen und die Hand ausstrecken.
Die Zigarette zwischen den Lippen sah ich auf das Feuerzeug, das er mir hinhielt, ein schweres silbernes Ding, das zu dem Etui passte und auf dem ein paar Buchstaben eingraviert waren, wahrscheinlich seine Initialen. Erst sehr viel später begriff ich, dass dieser Einstieg symptomatisch war für alles, was dann kam: das berauschende Gefühl, dass er mich kannte, dass er wusste, was ich eigentlich wollte, noch bevor es mir selbst klar war.
Eine Weile rauchten wir schweigend, sahen in Richtung des Wassers, auf den See, wo zwei Männer in einem Boot vorüberglitten, lautlos, und sich mit neugierigem Blick nach uns umwandten. Ein leiser Wind fuhr durch die blattlosen Zweige der Birke, als er eine vage Handbewegung in Richtung Haus machte und mich fragte: »Und? Wie finden Sie das alles hier?«
Ich stutzte, fragte mich, was genau er meinte, die Villa, das Geburtstagsfest?
»Sehr schön«, antwortete ich höflich und sah, wie sein Mund sich zu einem schiefen Lächeln verzog, als er sagte: »Es ist wie in einem Zirkus.«
Ich runzelte die Stirn, wusste nicht, was ich darauf erwidern sollte, und so erschien mir Schweigen das Diplomatischste. Ich würde mich nicht dazu verleiten lassen, mich negativ über die Gastgeber zu äußern.
Da sagte er: »Sie haben recht. Lassen Sie uns über etwas … Spannenderes sprechen. Über Sie zum Beispiel.« Und wieder sah er mich mit so viel Aufmerksamkeit an, als wäre meine Antwort das Einzige, was für ihn in diesem Augenblick zählte.
Ich zog an meiner Zigarette, sog den Rauch tief in meine Lungen und überlegte, was ich darauf sagen sollte. Ich bin eine zweiunddreißigjährige Lehrerin, die ihren Kleiderschrank nach Farben sortiert und deren Ehe ein einziger Sauhaufen ist, eine Farce, die aber weder mein Mann noch ich beenden wollen, wegen unserer Tochter und vielleicht auch aus Bequemlichkeit, aus einem Mangel an Vorstellungskraft, wie es danach weitergehen könnte. Doch das sagte ich natürlich nicht, sondern wählte eine neutrale Version.
»Ich arbeite am Deutschen Gymnasium in der Āgenskalna iela.«
Er zog an seiner Zigarette, stieß den Rauch aus. »Sie sind Frau Maywald. Und unterrichten Deutsch und Kunst.«
Ich bemühte mich, nicht allzu erstaunt auszusehen. »Oh? Na, dann …«
»Ja. Der Elternabend im letzten Jahr. Sie haben sich vorgestellt. Eine kleine Ansprache gehalten. Sie trugen einen grünen Rock und braune Stiefel.«
Ich blinzelte verblüfft. »Also geht Ihr Kind auch auf diese Schule?«
Er kam nicht mehr dazu zu antworten. Im Augenwinkel sah ich eine Bewegung. Ich wandte mich um und sah Xenias Mutter auf uns zukommen, mit federnden Schritten, ein kamelhaarfarbenes Cape über den Schultern.
Als sie uns erreicht hatte, lächelte sie mich an und sagte: »Ich sehe, Sie haben sich schon kennengelernt.«
Sie muss mir meine Verwirrung angesehen haben, denn plötzlich lachte sie: »Hat er sich Ihnen nicht vorgestellt? Das ist mal wieder typisch.« Sie drehte sich dem Mann zu, machte eine ausladende Geste und erklärte: »Das ist mein Mann, Xenias Vater.« Und dann legte sie ihren Arm um seine Schultern. Erst später, als ich schon im Wagen saß, fiel mir ein, dass sie ihn mir nicht mit Namen vorgestellt hatte. Offenbar wollte sie, dass er für mich in erster Linie ein Vater war, Xenias Vater. Und ein Ehemann, ihr Ehemann, das vor allem. Ob sie mich da schon als Gefahr betrachtet hat? Jedenfalls habe ich betont harmlos gelächelt, »Sehr erfreut« gemurmelt und bin den Blicken der beiden ausgewichen, als hätte ich etwas Unrechtes getan. Was zu dem Zeitpunkt nicht der Fall war. Das alles ist dann ja erst später gekommen.
Xenia. Unser nächstes Thema: das Porträt im Expressionismus. Was mir daran gefällt: der Bruch mit alten Regeln und Wertvorstellungen. Bruch hört sich für mich sowieso gut an. Nach Freiheit. Weniger gut ist, dass das eine Partnerarbeit werden soll. Und obwohl Frau Maywald meine absolute Lieblingslehrerin ist, rammt sie mit diesem Wort einen rostigen Pfahl durch meine Mitte. Jeweils zwei Leute sollen sich gegenseitig malen. Natürlich werde ich übrig bleiben. Ich bin ja die Neue, die man auffällig unauffällig begafft. Über die man auffällig unauffällig flüstert. Doch da sagt Frau Maywald was von Auslosen. Alle sollen ihren Namen auf einen Zettel schreiben und ihn falten. Frau Maywald geht rum und sammelt die Zettel ein. Ein paar von uns ziehen jeweils zwei Zettel. Wenig später habe ich eine Partnerin. Es ist Alise. Ich sehe, wie sie die Augen verdreht, und möchte ihr am liebsten die Fresse polieren. Oder weit fortfliegen, zurück in mein früheres Leben. In die Höhle, die ich aus Decken und Kissen gebaut habe, als ich fünf oder sechs war. Nach dem Unterricht kommt sie auf mich zu. »Also-wie-machen-wir-das-jetzt«, sagt sie leiernd und schräg an mir vorbei. Ich weiß, dass sie bei uns in der Nähe wohnt. Aber ich antworte im selben Ton: »Keine Ahnung. Ich hab auch keinen Bock auf dich.« Und gehe aus dem Klassenzimmer.
Im Kaiserwald war es auch, wo unsere Familie endgültig zerfiel. Sicher waren die Risse schon vorher dagewesen, unsichtbar, haarfein, wie Adern.
Kaiserwald I
Penelope. Röthenberg also. Jetzt weißt du, wie ich in dieses Nest im Allgäu kam. Du würdest die Nase rümpfen, da bin ich mir sicher: 1700 Einwohner. Ein Landmaschinenmechaniker. Ein Wirtshaus. Eine Raiffeisenbank. Eine BayWa. Eine Molkerei, der größte Arbeitgeber in der Gegend. Sogar einen Bahnhof gab es, nicht mehr als eine Haltestation in der Pampa, und damit er noch eine Daseinsberechtigung hatte, war auf der einen Seite eine Getränkehandlung untergebracht, mit Bierkästen, die sich bis zur Regenrinne stapelten. Von einem Ende des Dorfes bis zum anderen waren es damals drei Kilometer. Auf der Landkarte sah Röthenberg aus wie ein zerfledderter Lappen oder wie ein Rorschachtest, in alle Richtungen zerflossen.
Meine neuen Mitschüler in der Röthenberger Grundschule begegneten mir mit Ehrfurcht. Sie beäugten mich wie ein exotisches Tier, immer aus einer sicheren Distanz heraus, aber doch nah genug, dass sie jeden meiner Blicke, jede Regung genau erkennen konnten.
Du lachst? Vielleicht glaubst du, dass ich übertreibe? Dann solltest du abwarten, bis du die ganze Story gehört hast. Denn ich kann dir ohne jede Übertreibung sagen, dass sie von mir fasziniert waren, von mir und der Aura der Tragödie, die mich umgab. Für sie war ich das große blonde Mädchen, dessen Mutter sich entweder aus dem Staub gemacht hatte (was asozial genug war, um Aufsehen zu erregen) oder entführt und ermordet worden war (die weitaus aufregendere Variante). Sie alle fühlten sich von mir angezogen, wie man von einem Tierkadaver auf der Straße angezogen wird oder von einem Unfall, an dem man vorbeikommt und so langsam wie möglich fährt, damit man auch noch die grausigen Details zu Gesicht bekommt, um dann entsetzt und erleichtert weiterzufahren, zurück ins eigene, unzerbrochene Leben. Und so wie es bei Unfällen immer wieder Typen gibt, die filmen, und im Zoo Besucher, die ein Steinchen ins Löwengehege werfen und »Buh« rufen, gab es auch unter meinen neuen Mitschülern ein Mädchen, das mich zu einer Reaktion bringen wollte, und das war Lena. Durch sie lernte ich, unnahbar auszusehen, frei von Gefühlen. Und was hätte ich auch fühlen sollen? Meine Mutter war weg, wie ausradiert, der Mensch, den ich für unsterblich gehalten hatte, war fort, hatte sich buchstäblich in Luft aufgelöst. Nichts war von ihr geblieben außer einem Wagen auf einem Autobahnrastplatz.
Hast du dich schon mal gefragt, was passiert, wenn ein geliebter Mensch einfach verschwindet? Wahrscheinlich nicht, du hast deine eigenen Dämonen, die du in Schach halten musst, wenn die Dunkelheit kommt und sie ihre Finger nach dir ausstrecken. Weißt du, was ich gedacht habe, als du neulich nachts im Wald plötzlich vor mir standest? Dass wir ein bisschen wie aus einem Märchen sind, du und ich, wie Hänsel und Gretel, die sich endlich auf dem Heimweg befinden. Aber ich schweife ab. Jedenfalls habe ich wohl kaum über etwas so häufig und so intensiv nachgedacht wie über das Verschwinden, allerdings ohne je zu einer zufriedenstellenden Antwort zu kommen. Auch ist mir nicht klar, wie ich das überlebt habe. Bis heute frage ich mich, wieso mein Leben damals nicht einfach aufgehört hat. Ich wollte mich auflösen in jenen Nächten, in denen ich wach lag, an meinen Nägeln kaute und in die Vergangenheit reiste, in jeden einzelnen Tag, in jede einzelne Minute, als es sie noch gab, mit ihrem weichen, hellen Haar, dem Duft nach Pfirsichen und ihrem breiten, lustigen Lachen, das immer ein wenig rau klang, ein wenig heiser, als müsste sie sich eigentlich räuspern. Und dann das Lauschen in die Stille hinein, tagsüber. Das Unterbrechen jeder Tätigkeit, die Geräusche verursachte, auch wenn es nur das Blättern im Heft bei den Hausaufgaben war. Das Innehalten beim Kauen eines Apfels. War da nicht das Motorengeräusch des Land Rovers, dieses Dieselbrummen, wenn sie angefahren kam? Und jedes Mal wieder dieses Herzklopfen, wenn ich nach draußen raste, mit fliegenden Beinen quer durch den Garten lief, raus auf die Straße, nur um zu sehen, dass es irgendjemand war, irgendjemand in irgendeinem Wagen.
Und dann kam der Tag, an dem ich sie an unserer Schule vorbeifahren sah.
Jetzt siehst du ziemlich irritiert aus. Irritiert und ungläubig, genau wie ich mich an jenem Freitag fühlte. Es war der 29. Mai1998, der letzte Schultag vor den Pfingstferien. Ich brauche noch nicht mal die Augen zu schließen, um wieder dort zu sein, in jenem Moment, als eine Schockwelle durch meinen Körper fuhr und eine so überwältigende Hoffnung in mir auslöste, dass mir ganz schlecht wurde.
Es war neun Uhr dreißig. Wir standen auf dem Pausenhof herum, ein kleiner Pulk von Mädchen, ich mit meinem unbewegten Gesichtsausdruck zwischen zwei Mitschülerinnen, die sich gerade darüber stritten, wer nach den Ferien neben Lena sitzen durfte. Ich hörte kaum zu, sondern dachte darüber nach, wie ich gleich nach der Schule auf die Weide hinter unserem Haus laufen und ein paar besondere Kräuter für die Kühe pflücken würde. Ich stand halb mit dem Rücken zu den anderen und stellte mir vor, einen Steg über den Grottenbach zu bauen, um an den Rotklee auf der anderen Bachseite zu kommen, als ich den Wagen sah. Ich weiß noch genau, wie es sich anfühlte, es war, als hätte man mir einen Stromstoß versetzt. Da fuhr sie vorbei, in ihrem graugrünen Land Rover Defender mit den rot-weiß karierten Vorhängen, der Dachreling und dem Ersatzrad obendrauf.
Als der Pausengong ertönte, setzte ich mich in Bewegung. Ich lief quer über den Schulhof, zum Tor hinaus, die Rufe der anderen sehr weit entfernt, auch die Stimme der jungen Lehrerin. Ich lief auf die Straße, wo ich den Land Rover fahren sah, die Hauptstraße entlang, die durch das zerfledderte Dorf führte. Ich lief die ganzen drei Kilometer bis zum Bahnhof und weiter, bis zum Parkplatz der Seilbahn, die zum Hörnleberg führt. Ich lief die ganzen fünfzehn Kilometer, und als ich müde wurde, setzte ich mich auf eine Bank, in der Erwartung, dass sie umkehren und hier vorbeikommen würde. Aber sie kam nicht.
Berlin, im Sommer 2023
Mathilda. Sie sank zurück auf die schräg gestellte Rückenlehne des Krankenhausbetts und dachte an die letzten Monate, die sie quasi vor dem Tor der Prokhoff‘schen Villa in Zehlendorf verbracht hatte – von der ganzen Familie unbemerkt hatte sie das Muster ihrer Tage kartografiert. In wechselnden Mietwagen parkte sie an einer Stelle unter den Bäumen, die nicht von den Kameras erfasst wurde, und beobachtete das Kommen und Gehen der Mutter, des Vaters und der beiden Söhne, auch die Frau des Bruders mit ihren Kindern auf dem Rücksitz hatte sie immer wieder gesehen. Dabei war mit der Zeit der Gedanke entstanden, sich auf ihn zu konzentrieren, den bisher unverheirateten Sohn. Nach ein paar Wochen hatte sie festgestellt, dass der Mann zwischen der Zehlendorfer Villa, einem Penthouse in der City, seiner Arbeit im ROD-Tower und sporadischen Besuchen im Ruderclub pendelte, weshalb sie schließlich auch noch das Rudern angefangen hatte, zusätzlich zu ihren Laufrunden, den Workouts und dem Krav-Maga-Training, das sie zweimal die Woche absolvierte. Wochenlang hatte sie diesen elitären Club besucht und Mühe gehabt, sich die Trainerin vom Leib zu halten, die ihre Fitness bemerkt hatte und sie gleich ins Förderprogramm des Clubs hatte aufnehmen wollen. Mathilda war die Ruderei herzlich egal, es ging ihr einzig und allein darum, Prokhoff kennenzulernen. Mehrmals hatte sie versucht, sich ihm unauffällig zu nähern, doch immer ohne Erfolg. Bis zu dem Tag, an dem sie ihn mit einer Frau hatte streiten sehen. Sie hatte die Frau wiedererkannt, von einem Bild im Internet. Es war Charlotte Brandt. Auf dem Foto stand sie bei einer Spendengala neben Prokhoffs Verlobter, dem bekannten It-Girl Josephine von Wittgenstein. Da hatte sie ihre Chance gewittert und sich mit der Brandt angefreundet.
Bei der Brandt probierte sie auch das erste Mal die Lügen aus, die sie sich in den Wochen zuvor zurechtgelegt hatte, angefangen mit ihrer Kindheit in Namibia und wie es für sie gewesen war, auf einer Farm namens Klein Grasbrook aufzuwachsen. Am Anfang kamen ihr die Worte wie dicke Brocken im Mund vor, doch nachdem sie sich ein wenig warmgeredet hatte, fühlte sich alles ganz natürlich an. Fast hätte sie angefangen, selbst daran zu glauben: wie ihre Eltern sie ins Internat geschickt hatten und sie nur alle paar Monate nach Hause kommen durfte. Wie erhofft schien das Wort Internat so eine Art Passwort für die Brandt zu sein. Denn kaum hatte Mathilda es ausgesprochen, wurde sie offener, zugänglicher, vergaß sogar für eine Weile ihre affige Angewohnheit, die Haare herumzuwerfen, und begann ihrerseits zu erzählen. Und so hatte Mathilda schließlich einen genauen Einblick in Falk von Prokhoffs Beziehung mit Josephine von Wittgenstein bekommen und allerlei Wissenswertes über die beiden in Erfahrung gebracht, zum Beispiel, dass Prokhoff und die Wittgenstein sich aus Internatszeiten kannten.
»Du musst dir vorstellen: Die Einladungen zur Hochzeit waren schon verschickt«, hatte die Brandt ihr erzählt, eine Zigarette zwischen den manikürten Fingern. »Und dann kommt er mit Ehevertrag und Verschwiegenheitsklausel daher. Er dachte allen Ernstes, sie unterschreibt das. Klar, dass sie da Schluss machen musste.«
Dann hatte die Brandt zu einem Vortrag über Josephine von Wittgenstein und ihren »Lifestyle« angehoben, darüber, dass »Jo« als Influencerin Privates und Berufliches nicht so leicht trennen könne. »Natürlich postet sie keine Adressen oder so was, ist doch klar«, hatte sie gesagt und die Asche ihrer Zigarette weggeschnippt. »Aber die wollten von ihr, dass sie nichts mehr postet, keine Urlaubsfotos mehr, keine Freizeitfotos mehr, nada! Angeblich aus Sicherheitsgründen.«
Mathilda hatte versucht, verständnisvoll zu klingen, aber da sprach die Brandt schon weiter, davon, wie fix und fertig ihre Freundin sei, total im Eimer. Dass sie nur noch rumhing, nichts mehr aß und kaum mehr redete. Mathilda hatte das nicht zusammenbekommen, die strahlend schöne und siegesgewisse »Jo« aus dem Internet und das Bild, das die Brandt hier von ihr malte. Deshalb hatte sie noch einmal nachgefragt: »Aber … hast du nicht gesagt, dass sie Schluss gemacht hat?«
»Ja, schon«, hatte die Brandt zugegeben, und Mathilda war in dem Moment klar geworden, dass die Wittgenstein sich einfach verzockt hatte. Offenbar hatte sie fest damit gerechnet, dass Prokhoff nachgeben würde.
Nach diesem Gespräch hatte Mathilda die Wittgenstein auf Instagramgestalkt und festgestellt, dass sie ständig allen möglichen Quatsch postete, woraufhin Mathilda Prokhoff insgeheim zur gelösten Verlobung gratulierte.
Im Verlauf des Monats sprach Mathilda noch weitere dreimal mit der Brandt. Doch Prokhoff tauchte im Ruderclub nicht mehr auf. Mit der Zeit erschien ihr die Mitgliedschaft dort immer sinnloser und ihre Mission immer aussichtsloser. Bis sie am Abend des 31. Juli den spontanen Entschluss fasste, Prokhoff auf eine andere Art kennenzulernen.
Riga, im Frühjahr 1997
Rebecca. Unsere Ehe war schon lange am Ende, zumindest wenn es um die Art von Intimität ging, die man nur als Paar miteinander teilt, und ich bin mir sicher, dass auch Robert nichts mehr für mich empfand. Oder zumindest nicht mehr exklusiv für mich. Den Beweis dafür hatte ich, ohne es zu wollen, vor etwas über zwei Jahren in unserem Schlafzimmer in Windhoek gefunden. Der Grund für diese Hausdurchsuchung war eine Kollegin gewesen, deren Mann Bettwanzen von einer Geschäftsreise mitgebracht hatte, was sie mir am ersten Schultag nach den Sommerferien erzählte, sodass ich nach dem Unterricht in einem Anflug von Panik und Reinigungswut unser Schlafzimmer auf den Kopf stellte. Zwar fand ich keine Bettwanzen. Was mir stattdessen beim Abrücken von Roberts Kommode von der Wand in die Hände fiel, war ein Brief. Ich weiß noch, wie ich eine Weile einfach so herumstand, auf das Ding starrte und mit mir kämpfte, ob ich der Sache auf den Grund gehen sollte. Ich schnupperte sogar daran, was ziemlich naheliegend war, weil der Brief nach den Überresten eines penetranten Parfüms roch – ich glaube, es war Poison von Dior. Da konnte ich mich einfach nicht mehr beherrschen und las den Brief. Danach gab es nicht mehr den geringsten Zweifel, was mein Mann mit der Absenderin »M« so alles angestellt hatte.
Danach war ich eine Weile hin und her gerissen, wie ich mich Robert gegenüber verhalten sollte. Schließlich entschied ich mich dafür, erst einmal abzuwarten und herauszufinden, wer diese M eigentlich war. Im Kollegenkreis gab es niemanden mit einem M-Namen, also konzentrierte ich mich auf die Schülerinnen der Abiturklasse, wo ich dann auch bald fündig wurde: M stand für eine reizende rothaarige Madeleine. Wahrscheinlich hätte ich mich nach meiner Entdeckung einfach von ihm trennen sollen. Aber da wir ein Kind miteinander großzogen, gab ich ihm nach einer Aussprache noch eine Chance, unter der Voraussetzung, dass wir den Ort wechselten, um irgendwo anders einen Neuanfang zu machen. Doch unser Verhältnis wurde nie wieder so wie vorher und fühlte sich seitdem wie notdürftig gekittet an.
Nach außen hin waren Robert und ich jedoch weiterhin das perfekte Ehepaar: Ich die Künstlertype, die junge Lehrerin, die von ihren Schülerinnen und Schülern angehimmelt wurde. Er der Naturwissenschaftler, gütig, gerecht, gut aussehend, ein charismatischer Mann, der allen Ernstes behauptete, dass es immer die Schuld des Lehrers war, wenn Mathematik nicht zum Lieblingsfach wurde. An seiner letzten Schule war er zweimal hintereinander zum beliebtesten Lehrer gewählt worden. Und dann hatte das perfekte Ehepaar, also Robert und ich, diese wunderbare Tochter, die der eigentliche Kitt war, der unsere Beziehung zusammenhielt: Penelope, kleiner Wildfang mit ständig aufgeschlagenen Knien, die auf jeden Baum kletterte, jedes Wettrennen gewann und Rosa verabscheute. Und im Grunde war sie mittlerweile wohl der einzige Grund, warum wir immer noch zusammenlebten, auf sämtlichen Schulveranstaltungen Arm in Arm zusammenstanden und um die Wette strahlten. Wir nahmen dieses falsche Strahlen sogar mit an den Frühstücks- und den Abendbrottisch, kurzum überallhin, wo Penelope uns sah. Und wenn wir nicht strahlten, so redeten wir zumindest die meiste Zeit höflich miteinander, so kultiviert, wie Akademiker das eben tun, wenn ein achtjähriges Mädchen ihnen zuhört.
Als ich an jenem Sonntagabend nach Hause fuhr, durch eine Stadt, die sich innerlich auf den Frühling vorbereitete, hatte ich noch immer Mozart im Ohr und ging im Geiste die Gespräche durch, die Leute, mit denen ich mich unterhalten hatte. Ich dachte an Xenia, wie sie in ihrem Zimmer stand, in diesem für ein Mädchen an der Schwelle des Erwachsenwerdens allzu reizenden Zimmer, mit ihrer Zopffrisur, im blauen Samtkleid. Wie lange es wohl dauern würde, bis dieses Mädchen erste Anzeichen einer Rebellion zu erkennen geben würde? Oder würde es diese Anzeichen vielleicht doch nie geben? Es war ja nicht ausgeschlossen, dass sie sich eines Tages doch nahtlos in die Schablone einfügen würde, die ihre Mutter für sie bereithielt. Und dann sah ich unvermittelt ihren Vater vor mir, den Mann, von dem ich zuerst gar nicht gewusst hatte, dass er ihr Vater war. Wie finden Sie das alles hier? Das waren seine Worte gewesen, ein seltsamer Gesprächsauftakt für einen Gastgeber.
Wie immer parkte ich direkt vor unserem Haus in der Antonijas iela. Für mich, die ich mich im letzten Jahr noch mit der permanenten Parkplatznot in Windhoek herumgeschlagen hatte, war es immer noch ein kleines Wunder, dass man in dieser Stadt, wo immer man hinkam, mühelos einen Parkplatz fand, egal in welchem Viertel.