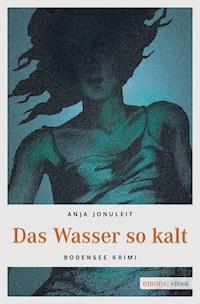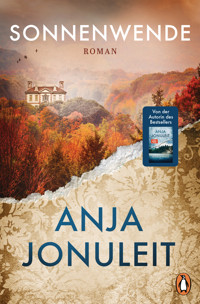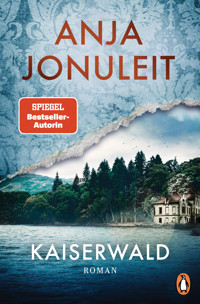9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dtv Verlagsgesellschaft
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Drei Frauen, drei Leben Für eine Versöhnung ist es zu spät: Zehn Jahre lang hat Maja Sternberg keinen Kontakt mehr zu ihrer Mutter Lilli gehabt – jetzt ist Lilli tot. Die Polizei in Wien spricht von Selbstmord. Doch daran mag Maja nicht glauben. In der Wohnung ihrer Mutter findet sie deren Geburtsurkunde: Der Name des Vaters fehlt. Als Geburtsort ist Hohehorst eingetragen. Ein Foto zeigt Großmutter Charlotte mit einem Baby, doch dieses dunkle Baby hat keinerlei Ähnlichkeit mit der hellblonden, blauäugigen Lilli. Von Schuldgefühlen und Neugier getrieben, begibt Maja sich auf die Spurensuche und stößt auf ein dunkles Familiengeheimnis, das alle Gewissheiten in ihrem Leben mit einem Schlag zunichtemacht ... Kennen Sie bereits die weiteren Romane von Anja Jonuleit bei dtv? »Der Apfelsammler« »Das Nachtfräuleinspiel« »Novemberasche« »Rabenfrauen« »Die fremde Tochter« »Das letzte Bild«
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 581
Veröffentlichungsjahr: 2010
Ähnliche
Für eine Versöhnung ist es zu spät: Zehn Jahre lang hat Maja Sternberg keinen Kontakt mehr zu ihrer Mutter Lilli gehabt – jetzt ist Lilli tot. Die Polizei in Wien spricht von Selbstmord, doch daran mag Maja nicht glauben. Von Schuldgefühlen gequält, beginnt sie, die Angelegenheiten zu ordnen. In der Wohnung ihrer Mutter findet sie deren Geburtsurkunde. Der Name des Vaters, der angeblich im Krieg gefallen war, fehlt. Als Geburtsort ist Hohehorst eingetragen. Ein Foto zeigt Großmutter Charlotte mit einem Baby, doch dieses Baby hat keinerlei Ähnlichkeit mit der hellblonden, blauäugigen Lilli. Und so begibt Maja sich auf die Suche nach den blinden Flecken in ihrer Familiengeschichte. Die ersten Spuren führen sie nach Hohehorst bei Bremen, das eine unrühmliche Vergangenheit als »Lebensborn«-Heim hat …
Anja Jonuleit
Herbstvergessene
Roman
Für meine Kinder
Marlene, Astrid, Laura und Peter
Für meine Großmutter
Hedwig Hein,
die zwei Weltkriege erlebt hat
Heute sah ich wieder dich am Strand
Schaum der Wellen dir zu Füßen trieb
Mit dem Fingergrubst du in den Sand
Zeichen ein, von denen keines blieb.
Ganz versunken warst du in dein Spiel
Mit der ewigen Vergänglichkeit
Welle kam und Stern und Kreis zerfiel
Welle ging und du warst neu bereit.
Lachend hast du dich zu mir gewandt
Ahntest nicht den Schmerz, den ich erfuhr
Denn die schönste Welle zog zum Strand
Und sie löschte deiner Füße Spur.
Marie Luise Kaschnitz
Prolog
Das alles liegt nun so fern von mir, und an manchen Tagen, den handfesten, tatkräftigen Tagen, an denen die Sonne bis in alle Winkel vordringt, an denen sich Aufgabe an Aufgabe reiht, verscheucht das wirkliche Leben die Gespenster der Vergangenheit. Und dann machen meine Hände mich glauben, mit ihren unendlich langsamen Bewegungen, dass ich schuldlos bin, dass das hier mein Leben ist und immer war: eine Aneinanderreihung harmloser und alltäglicher Verrichtungen. Und dass mein Leben allein daraus besteht, einen Teller, eine Tasse auf den Tisch zu stellen, das Messer danebenzulegen, zu warten, bis das Wasser brodelt, um dann das Kaffeepulver zu bebrühen und mir ein Brot mit Butter zu bestreichen.
Früher hatten die Tage viele Stunden, heute haben die Nächte zu viele und die Tage zu wenige. Staubpartikel tanzen in der Luft, schwirren, flirren und erinnern mich daran, dass sich auf alles Gewesene der Staub der Zeit legt. Und wenn man nicht daran rührt, wenn man ihn nicht aufwirbelt, so bleibt er liegen und bedeckt die Geheimnisse der Vergangenheit unter einem grauen Tuch. Und an hellen Tagen wiege ich mich so in der Illusion, dass ich alles nur geträumt habe. Dass ich alte Frau mich in nichts unterscheide von anderen alten Frauen. Dass ich bin wie sie, gelebtes Leben, der Anfang, der zurückkehrt, und die Stunden des Tages, die gerade ausreichen, mich an- und wieder auszuziehen, langsam und bedächtig.
In einem Silberrahmen über meinem Sekretär hängt ein gemaltes Liebespaar. Eng umschlungen sitzt es da, in einen weiten, weiten Mantel gehüllt, sternenübersät. Um die Liebenden züngeln Flammen, Hände wie Klauen greifen nach ihnen und Dämonenfratzen grinsen hämisch. Doch die beiden scheinen nichts von alldem zu bemerken, sie halten sich. Die Gesichter einander zugewandt, sind sie versunken in ihrem Mantel aus Liebe.
Im Sternenmantel
Jahrelang habe ich mir gewünscht, ich könnte aufhören zu rauchen. Ich wollte frei sein von diesem Zwang, frei von dem Drang, nach einer bestimmten Zeit, spätestens nach zwei Stunden, wieder in die Packung zu greifen und mit spitzen Fingern eine Zigarette herauszuangeln. Der erste Zug war das eigentliche Antriebsmoment, schließlich ist nichts so gut wie das erste Mal. Und dabei meine ich nicht die ungeschickten Versuche zweier junger Menschen, sich körperlich näher zu kommen. Nein, ich spreche vom ersten Zug, vom ersten Schluck, egal, ob Kaffee, egal, ob Wein oder, wenn es sein musste, Grappa. Und manchmal musste es einfach sein.
Auf jeden Fall war das Nikotin ihr, Mutters, Erbe an mich, und wenn es eines gab, was wir gemeinsam hatten, dann war es unsere Leidenschaft fürs Rauchen im Allgemeinen und für den »ersten Zug« im Besonderen. Ich erinnere mich noch gut an ihren Gesichtsausdruck, wenn sie neben mir am Fenster stand, die Hand in den Ärmel geschoben, und ich hin und wieder ihr Profil betrachtete, unbemerkt zusah, wie sie die Augen schloss und inhalierte. Sie hatte dann für eine Weile – die Zeit, die es dauert, eine Zigarette zu rauchen – etwas Mildes und Ruhiges an sich, eine Kompromissbereitschaft, die kurz darauf, wenn sie mit ihren knochigen Fingern die Zigarette in den Aschenbecher aus Kristallglas drückte, verschwunden war. Und mit der Zigarette verglomm auch die fast schwesterliche Sympathie, die ich in diesen Augenblicken für sie empfand. Mutter.
Es hätte anders sein können, das Verhältnis zu meiner Mutter, und dass ich sie so viele Jahre nicht mehr gesehen hatte, war allein meine Schuld. Ich hatte ihre Erwartungen nicht erfüllt. Sie hat es nie verwunden, dass ich kurz vor den Abschlussprüfungen zum Konferenzdolmetscher das Handtuch geworfen habe, ohne triftigen Grund, in ihren Augen. Trotz hervorragender Leistungen und der Aussicht auf einen Job bei den Vereinten Nationen. Ich hätte viel Geld verdient, regelmäßig noch dazu, doch was das Ausschlaggebende gewesen wäre: Sie hätte stolz auf mich sein können. Auf ihr Mädel, das es, wie sie, geschafft hatte. Aber leider oder Gott sei’s gedankt war es beim Konjunktiv geblieben: Sie hätte stolz sein können! Ein Lehrsatz wie aus einem Standardwerk Deutsch für Ausländer. Stattdessen habe ich der Welt des geschliffenen Wortes und damit auch Mutter den Rücken gekehrt und das gemacht, was schon immer mein Traum gewesen war: Ich hatte bei einem Freund in England eine Ausbildung als Interior Decorator und Upholsterer gemacht. Was für eine brotlose Kunst!
Und als an diesem Sonntagvormittag das Telefon klingelte und Wolf mir den Hörer reichte und mit hochgezogenen Augenbrauen stumm die Worte »Lilli Sternberg« formte, wusste ich, dass etwas Schlimmes passiert sein musste.
Das Schweigen zwischen meiner Mutter und mir dauerte nun schon zehn Jahre und unser Verhältnis, wenn man es denn noch als ein solches bezeichnen konnte, war auf je zwei Postkarten pro Jahr geschrumpft: eine zu unseren Geburtstagen und eine zu Weihnachten. Wir tauschten diese Karten jedes Jahr und in stummer Sturheit aus, und da wir beide demselben Sternzeichen angehören, das für seine Ausdauer bekannt ist, hatte ich manchmal die Vorstellung, wir würden auch nach unserem Tod noch Grußkarten austauschen.
Wolf hielt mir immer noch gestikulierend den Hörer hin und rollte mit den Augen, bis ich mich überwand, danach zu greifen.
»Hallo? Wer spricht denn da?«, hörte ich mich selbst sagen, absurderweise. Ich hielt den Hörer fest umklammert, und als mir ein barsches »Nun tu doch nicht so gschamig« entgegenbellte, wusste ich, dass sie es wirklich war. Ich hielt den Atem an, trotz allem ungläubig, ihre Stimme zu hören, die noch rauer, noch krächzender geworden war, eine richtige Raucherstimme, ein weiblicher Joe Cocker. Einen kurzen Augenblick lang lauschten wir beide dem summenden Schweigen in der Leitung, und als täte ihr der harsche Auftakt plötzlich leid, fragte sie: »Wie geht’s dir?«
Ich straffte die Schultern und wandte mich abrupt um, weg von Wolfs forschendem Blick, von der Besorgnis, die er ausstrahlte. Ich räusperte mich und antwortete mit fester Stimme: »Es geht uns gut. Danke.« Und eine Weile später, als ich die Stille nicht mehr aushielt, fragte ich: »Und dir? Bist du krank?«
Ich hörte sie schnauben, doch ihre Antwort klang überraschend milde, was mir mehr Sorgen machte, als wenn sie mich angeherrscht hätte.
»Es ist so: Ich muss mit dir über etwas sprechen.«
Ich zögerte. Mutter war nicht der Typ, der um den heißen Brei herumredete. Was ich oft bedauert hatte, denn ihre Direktheit war verletzend und ein bisschen mehr Diplomatie hätte ihr gut zu Gesicht gestanden. Was also konnte so wichtig sein, dass meine starrköpfige Mutter ihr über Jahre gehegtes Schweigen nun brach?
Sie sagte: »Es ist wichtig.«
»Na … dann … Ich hab Zeit. Du kannst sprechen.«
Sie schnaubte wieder und fuhr mich an: »Nicht am Telefon! Es gibt da etwas, was ich dir sagen muss … und zeigen.«
Ich überlegte. Was sollte das denn bedeuten? Wollte sie mich besuchen kommen? Mich mit Wolf unter die Lupe nehmen und womöglich feststellen, dass …
»Es wäre das Beste, wenn du kämst«, schnitt sie meine Überlegungen ab.
»Na ja …« Ich versuchte Zeit zu gewinnen. Im Moment war es schwer, hier alles stehen und liegen zu lassen. In der kommenden Woche konnte ich auf keinen Fall hier weg, denn ich musste den Fliesenlegern, die im Haus eines meiner Kunden arbeiteten, hin und wieder eine Stippvisite abstatten. Also sagte ich: »In einer Woche. Vorher geht’s auf keinen Fall.«
Sie zögerte einen Moment, ehe sie mit etwas zittriger Stimme antwortete: »Also gut. Dann in einer Woche.«
Der Flieger kreiste über Schwechat, drehte nach Osten hin ab und landete in der Warteschleife. So hatte ich noch ein wenig Zeit nachzudenken. Durch den Nieselregen erkannte ich ein sumpfiges Gewässer, das ich früher nie gesehen hatte. Groß und grau und stumpf lag es da, umgeben von einem braunen Schilfgürtel, seltsam unberührt und wie herausgelöst aus der übrigen Landschaft, die aus Feldern und Siedlungen bestand. Als habe nie ein Mensch die Einsamkeit zu stören gewagt. Ich war nervös, ich hatte Lust zu rauchen, mich an etwas festzuhalten. Grübeleien kamen und gingen und irgendwann, vielleicht nach der dritten Schleife, nahm der Flieger wieder Kurs auf den Flughafen und wenig später, viel zu früh, spürte ich das Vibrieren der Räder auf Beton. Bald würde ich ihr gegenüberstehen.
Nach Oma Charlottes Tod war Mutter »ganz« nach Wien gegangen. Ganz bedeutete, dass sie Omas Haus in Lindau, in dem sie hin und wieder während ihrer Einsatzpausen gewohnt und Oma Gesellschaft geleistet hatte, an eine siebenköpfige Familie vermietet hatte. Das Ferienhaus an der ligurischen Küste hatte sie für ihren Gebrauch behalten. Ich dachte bedauernd daran, denn ich wäre gerne wieder einmal hingefahren.
Mutter war Dolmetscherin bei den Vereinten Nationen, ein mnemotechnisches Wunderkind, und ich wusste, dass man sie sogar jetzt noch, mit Mitte sechzig, hin und wieder holte. Denn das hatte neben dem obligatorischen wünscht dir Mutter auf der letzten Weihnachtskarte gestanden. Natürlich hatte sie es sich nicht verkneifen können, mir diese Nachricht zukommen zu lassen – und damit die Botschaft, dass sie immer noch »auf höchster Ebene« mitmischte.
Am Volkstheater verließ ich die U-Bahn und wartete oberirdisch auf die Straßenbahn. Wenn ich es recht in Erinnerung hatte, brauchte ich die Linie 19. Ich war die Einzige, die hier herumstand, und daraus schloss ich, dass ich sie gerade verpasst hatte. »Wie du die größte Chance deines Lebens verpasst hast«, hätte Mutter in ihrer pathetischen Art dazu sicher gesagt. Und hinzugefügt, dass ich ein schwieriges Kind gewesen sei.
Mir war kalt, aber vielleicht lag das an der Wiedersehensangst. Im Volkstheater waren schon die Lichter an. Eine Weile lang stand ich mit hochgezogenen Schultern herum und träumte mich in die Wärme. Und in die Sicherheit. Jetzt einfach so dasitzen und zwischen Unbekannten auf eine Bühne sehen dürfen.
»Du willst dein Leben damit verbringen, den Leuten zu sagen, wo sie ihre Sessel hinstellen sollen?«, hatte Mutter bleich, die Lippen ein Strich, herausgepresst, als ich ihr verkündete, was ich in Zukunft tun wollte. Und das war für Jahre der letzte Satz gewesen, den ich mir angehört hatte. In der Zeit, die darauf folgte, war es meine Großmutter Charlotte, die hin und wieder ein Wort über Mutter verlor, sodass ich zumindest wusste, dass sie noch lebte. In diesen Jahren schafften meine Mutter und ich es manchmal, uns nur ein paar Stunden voneinander getrennt die Klinke in Charlottes Haus in die Hand zu geben. Nachdem das Schweigen fünf Jahre gedauert hatte, war es Charlotte zu bunt geworden und sie hatte diese Stunden herausgeschnitten und uns, Mutter und mich, zeitgleich in ihr Haus gelockt. Dort war es dann zu einer Art zähneknirschenden Versöhnung gekommen, bei der keine von uns echte Einsicht zeigte und sich entschuldigte (wofür auch!). Und auf die Phase des verbissenen Schweigens war dann eine Phase der verbissenen Weihnachtsgrüße gefolgt, die irgendwann auch Geburtstagskarten einschloss. Das einzige Mal, das ich Mutter nach diesem unfreiwilligen Treffen in Oma Charlottes Haus wiedersah, war bei deren Beerdigung.
Meine Mutter hat mir nie verziehen, dass ich nicht die gleichen Träume habe, die gleichen Vorstellungen davon, was im Leben erstrebenswert ist. Sie hat mir nie verziehen, dass ich nicht wie sie bin. Das klingt hart, aber es trifft den Nagel auf den Kopf. Sie war schon immer stark und sicher, extrem selbstbewusst. Mutter hatte Gewissheiten. Sie konnte charmant sein, hatte Humor und zeigte ihn auch (wenn sie wollte und wenn sie jemanden mochte). Aber sie konnte genauso gut beißend und zynisch sein (wenn sie jemanden nicht mochte). Vor allem aber glänzte sie auf gesellschaftlichem Parkett und betrieb Konversation par excellence. Eine Kunst, die mir immer fremd gewesen ist.
Durch den eisigen Nieselregen sah ich in die Richtung, aus der die Straßenbahn kommen sollte. Am Sonntag war der erste Advent und die Straßen und Schaufenster waren schon geschmückt. Ich liebte all die Lichter und den festlichen Glanz, auch wenn das natürlich nur dazu diente, das Vorweihnachtsgeschäft anzukurbeln. Als die Tram nach zehn Minuten noch immer nicht kam, nahm meine Ungeduld überhand. Ich trat aus dem Wartehäuschen in den Regen, zurrte mir den Schal zurecht, stellte den Kragen auf und lief los. Das hatte nichts damit zu tun, dass ich Mutter nun doch so schnell wie möglich sehen wollte. Ich war nur generell unfähig, längere Zeit auf etwas zu warten.
Der Nieselregen ließ mein Gesicht prickeln, Nässe kroch unter meinen Kragen und ich fluchte darüber, dass ich keinen Schirm dabeihatte. Wolf rührte jetzt wahrscheinlich gerade in den Töpfen und kochte sich ein feines Abendessen, wobei er sich ab und zu einen Schluck Rioja genehmigte. Mir wurde warm ums Herz und die Ressentiments gegen ihn, die ich in den letzten Monaten immer öfter gehabt hatte, waren plötzlich wie weggewischt. Meine verkrampften Gesichtsmuskeln entspannten sich und unwillkürlich lächelte ich: Morgen wäre ich wieder zurück, Wolf würde mich vom Flughafen abholen, nach Hause fahren und etwas Leckeres für mich kochen. Alles Unangenehme läge hinter mir und er und ich würden wieder neu beginnen.
Als ich eine halbe Stunde später vor der Haustür stand, lag die Feuchtigkeit wie ein Gewicht auf meinen Schultern. Ich schloss kurz die Augen und klingelte. Das Herz schlug mir bis zum Hals, meine Handflächen schwitzten, die Finger waren steif vor Kälte. Gleich würde sie den Summer betätigen, die Tür würde aufgehen, ich würde die vier Stockwerke zu Fuß hinaufgehen, nicht weil ich so sportlich war, sondern weil ich es im Moment nicht ertragen könnte, irgendwo herumzustehen – auch nicht in einem ratternden Jugendstilaufzug, dessen skurrile Eleganz ich sonst gerne bewundert hätte. Ich klingelte noch einmal. Vielleicht hatte sie es nicht gehört. Ich starrte die Tür an, ratlos, abwartend. Hinter mir rauschte der Regen, ich drehte mich um und sah zu, wie die Tropfen auf den Bürgersteig fielen und zerplatzten. Meine Fußspitzen in den Lederstiefeln waren kalt und feucht, das Braun des Leders war dunkel, fast schwarz. Als nach wiederholtem Klingeln immer noch nichts geschah, regte sich Unmut in mir. Wo war sie? Abrupt wandte ich mich ab. Dann eben nicht! Dachte sie, ich würde hier auf sie warten wie ein entlaufenes Hündchen? Nein, nicht mit mir. Ich würde jetzt gemütlich ins Hotel gehen, duschen, mir trockene Sachen anziehen und dann weitersehen.
Das Hotel Kugel lag ebenfalls in der Siebensterngasse, nur ein paar Häuser weiter. Ich öffnete die Tür und ein überheizter Vorraum empfing mich. Der Mann an der Rezeption war groß und dürr. Er schaute mich mit geschäftsmäßiger Freundlichkeit an, ich nannte meinen Namen, schob ihm meinen Pass zu, woraufhin er ein Formular vor mich hinlegte. Hinter ihm an der Wand hing ein altmodisches Schild, auf dem die verehrten Gäste darauf hingewiesen wurden, dass man hier nur bar bezahlen konnte. Und im Voraus. Am liebsten hätte ich auf dem Absatz kehrtgemacht, doch der Wunsch nach heißem Wasser und trockenen Kleidern war übermächtig. Also bezahlte ich für eine Nacht und nahm den Zimmerschlüssel für die 101 entgegen. Zwischen Fahrstuhl und Rezeption stand ein altmodischer Schuhputzapparat, mit Bürsten in Schwarz und Braun und einer Trittfläche aus schwarzem Profilgummi. Ich trat darauf und sah zu, wie die Bürsten losratterten und meine wasserfleckigen Stiefel polierten. Ich stieg die roten Teppichstufen hinauf, die beiden Taschen über der rechten Schulter. Ich hatte für die eine Nacht nicht viel mitgenommen. Morgen säße ich schon wieder im Flieger Richtung Deutschland und das Gespräch mit meiner Mutter wäre Vergangenheit.
Die zurückliegende Woche hatte ich damit zugebracht, mir unser Wiedersehen in den verschiedensten Farben auszumalen. Da gab es die tränenreiche und pathetische Reunited-Version, bei der sie mich für ihre Versäumnisse um Verzeihung bat und mir reumütig versicherte, sie habe Unrecht gehabt und endlich eingesehen, dass jeder Mensch »seinen eigenen Weg« gehen müsste. Eine andere Version, die wie ein Super-8-Film vor mir ablief, war die Enterbungsszene: Mutter, die wie ein Scherenschnitt vor mir stand und mir eröffnete, dass ich von ihr keinen Cent erhielte und dass Omas und Mutters Vermögen karitativen Zwecken zur Verfügung gestellt werden würde. Und dann gab es noch die »Mir bleibt nur wenig Zeit«-Version, in der sie mir gefasst, aber mit tränenfeuchten Augen von einer unheilbaren Krankheit berichten würde. Und noch eine letzte Möglichkeit war mir eingefallen – »die Chronik einer angekündigten Hochzeit«: Mutter, die (nach dem Pech mit meinem Vater – auch etwas, was sie mich hatte spüren lassen) verkündete: »Ich habe einen Menschen gefunden, mit dem ich alt werden möchte. Ich werde heiraten.« Ich würde eine etwas ältliche, aber elegante Brautjungfer abgeben und in einem schlichten eierschalenfarbenen Kostüm Blumen werfen.
Als ich in meinem feuchten Mantel in dem überhitzten Gang vor der Nummer 101 stand, fühlte ich mich wie eine Dampfkartoffel. Grimmig stellte ich fest, dass die Zimmertür genau gegenüber vom Fahrstuhl lag.
Immerhin war es im Zimmer nicht ganz so heiß wie auf dem Korridor. Ich stellte meine Tasche auf die Gepäckablage, zog Mantel und Stiefel aus und öffnete das Fenster. Das Zischen von Autoreifen auf Asphalt und das Summen einer anfahrenden Tram drangen herein. Ich kramte in meiner Tasche und stellte mich rauchend ans Fenster. Einen Moment lang schloss ich die Augen, inhalierte tief und fühlte, wie ich mich entspannte. Auf der gegenüberliegenden Straßenseite hingen vor einem Geschäft indische Seidenschals in allen erdenklichen Farben; daneben war eine Bäckerei, deren Lichter hell und freundlich in die hereinbrechende Dämmerung schimmerten. An der Tramhaltestelle war jetzt nur noch ein Mann mit einem altmodischen Hut, wie ihn Männer in amerikanischen Filmen aus den Vierzigern und Fünfzigern trugen. Er hatte keinen Schirm und stand einfach so da, im Regen. Sein Gesicht lag im Schatten des Hutes, doch aus irgendeinem Grund hatte ich das Gefühl, dass er zu mir heraufblickte und mich ansah.
Eine Stunde später trat ich, den Schirm des Portiers in der Hand, erneut auf die Straße. Inzwischen war es dunkel geworden, die Bäckerei und der indische Laden hatten geschlossen. Wieder wartete ich vergeblich, trat von einem Bein auf das andere und wusste nicht, wie ich mich verhalten sollte. Ich hatte Hunger, denn seit dem trockenen Sandwich im Flieger waren Stunden vergangen. Ich überlegte, ins Siebensternbräu zu gehen, etwas zu essen und von dort aus immer mal wieder anzurufen. Die Gastwirtschaft lag nur ein paar Häuser von der Wohnung meiner Mutter entfernt. Ich könnte auch im Café Kairo warten, das direkt gegenüber lag und von dem aus man die Haustür im Blick hatte. Ich wandte mich ab, als eine Frau, etwa im Alter meiner Mutter, an mir vorbeiging, zwei Einkaufstüten von Billa abstellte und den Schlüssel ins Türschloss steckte. Ich zögerte einen kurzen Moment, dann sagte ich seltsam stockend: »Verzeihen Sie, ich … wollte zu Frau Sternberg. Aber sie ist nicht da.«
Die Frau, die gerade dabei war, die Tür aufzustemmen, ließ diese wieder zufallen. Sie war klein und mit einem Gesicht voller Misstrauen gesegnet, und als ich nichts weiter sagte, baute sie sich vor mir auf, so gut das eben ging bei einer Körpergröße von 1,50 Meter, und fuhr mich an: »Habt’s ihr denn nichts Bessres zu tun, als euch am Unglück andrer zu ergötzen!«
Wovon sprach sie? Ich räusperte mich und wollte nachfragen, doch sie hatte sich schon wieder umgedreht und die Haustür erneut aufgeschlossen. Als sie nach den Tüten griff, glaubte ich die Worte »Journalistengeschwerl von der Kronenzeitung« zu verstehen. Bevor sie mir die Tür vor der Nase zudrückte, rief ich: »Ich bin doch nicht von der Zeitung. Ich bin die Tochter. Frau Sternberg ist meine Mutter.«
Bei diesen Worten hielt sie inne und grinste hämisch: »So, so, die Tochter! Aus welcher Versenkung ist die denn plötzlich aufgetaucht!« Ihr Lachen klang bitter, offenbar glaubte sie mir nicht.
Ich rief ihr hinterher: »Aber ich bin Frau Sternbergs Tochter. Ich bin heute aus Deutschland gekommen. Meine Mutter hat mich angerufen. Vor einer Woche. Sie wollte mich …« Ich verstummte. Was tat ich da eigentlich? Wieso legte ich einer fremden Frau Rechenschaft darüber ab, wer ich war? Etwas in meinem Schweigen schien die Frau zu berühren, denn sie war stehen geblieben und sah mich nun mit einem forschenden Blick an. Mit einem Mal wirkte sie unsicher. Sie öffnete den Mund, wie um etwas zu sagen, schien jedoch nicht recht zu wissen, was oder wie. Als sie dann doch sprach, klang ihre Stimme auf einmal leise und ich hatte Mühe, sie zu verstehen: »Ja, dann können Sie es freilich noch gar nicht wissen …« Ihr Blick ging mir durch Mark und Bein, und noch bevor sie weitersprach, wusste ich, dass etwas Entsetzliches passiert sein musste.
Sie hielt mir die Wohnungstür auf und führte mich zu einem Stuhl, auf den ich mich jedoch nicht setzte.
»Die Tochter san S’?«
Meine Finger umfassten die Stuhllehne. Ich nickte und sah sie an. Sie erwiderte meinen Blick.
»Sie hat von Ihnen erzählt, manchmal. Sie wohnen am Bodensee, nicht?« Und schließlich, als es nichts anderes mehr zu fragen und zu sagen gab, hörte ich die Worte, die später noch lange in mir nachhallen sollten, so unbegreiflich und furchtbar waren sie:
»Sie ist tot. Ihre Mutter ist tot.«
Gestern Nacht träumte ich wieder von Hohehorst. Es war das erste Mal nach all den Jahren, und selbst im Traum spürte ich das Erstaunen, das mit dieser unvermittelt auftauchenden Erinnerung einherging. Wie am Tag meiner Ankunft saß ich im Wagen vor den beiden Pförtnerhäusern und links und rechts des Tores ragten die Laternen wie grausame Kronen in die Dämmerung. Wie damals öffnete sich das Tor wie von Geisterhand und der Wagen setzte sich lautlos in Bewegung, glitt vorüber an den wehrhaften Kronen und in den Wald hinein. Der Weg vor uns verlor sich im Dunst, er schien ins Nichts hineinzuführen. Die Bäume nahmen Gestalt an und verschwanden wieder, Zweige schienen wie Hände nach mir zu greifen. Und plötzlich – zu plötzlich – stand ich vor dem Haus, auf einem leeren Platz, ganz allein. Der Wagen mit dem Chauffeur war verschwunden und rings um mich her war nichts zu hören als das leise Prickeln der Feuchtigkeit auf den Blättern. Ich sah empor an den grauen Mauern, ließ meinen Blick über die unzähligen Fenster gleiten, die alle seltsam leblos wirkten, wie erloschene Augen. Und während ich noch zögerte und mich fragte, was nun zu tun sei, erschien ein Gesicht hinter einer Scheibe, hoch oben, im zweiten Stock, ganz am Ende des Hauses. Ein Mann stand dort und sah zu mir herunter, bewegungslos. Und noch während ich hinaufstarrte und sein Gesicht zu erkennen suchte, hielt ich plötzlich ein Kind im Arm, in eine Decke gewickelt, wie ein Bündel. Das Kind begann zu wimmern und ich murmelte sinnlose Worte des Trostes vor mich hin. Als ich aufblickte und wieder nach oben sah, war der Mann verschwunden. Und plötzlich wusste ich, dass ich fortlaufen musste, jetzt, sofort, so schnell ich konnte. Der Mann würde versuchen, mir das Kind wegzunehmen. Da tauchte auch schon eine Gestalt aus dem Dunst hinter mir auf, und noch bevor ich ihn erkannte, wusste ich, dass er es war.
Es war dieser Traum, der mich bewog, meine Geschichte niederzuschreiben. Natürlich frage ich mich, wem es nutzt, wenn all das, was ich erlebt, all das, was ich getan habe, ans Tageslicht kommt. Letztendlich ist es nicht mehr als der Versuch eines Menschen, schreibend eine Art Absolution zu erfahren.
Ich weiß nicht recht, wo ich beginnen soll. Lange habe ich wach gelegen, die Nacht malte ihre Schatten an meine Zimmerwand, und manchmal, wenn ein Auto vorüberfuhr, fingen die Schatten an zu wandern, über Wand und Decke. Ich bin schließlich aufgestanden und habe das Fenster geöffnet. Nun stehe ich da und schau hinaus in den Regen. Vorher habe ich nur einzelne Tropfen gehört, die wie winzige Finger an die Scheibe geklopft haben, auf den Fenstersims, ein tickendes, zärtliches Geräusch. Mit dem Öffnen des Fensters ist der Regen präsenter geworden, drängt sich in das Zimmer und in mein Bewusstsein. Ich höre sein gleichmäßiges Rauschen und spüre, wie die kühle Luft, die er mitbringt, den Raum erfüllt. Ich schließe die Augen und höre ihn, sein Rauschen aus der Unendlichkeit, wie er schon vor tausend Jahren rauschte. Und jetzt weiß ich auch, wo ich beginnen werde. Denn der Regen trägt mich zurück. Zurück zu jenem Tag, an dem ich Paul das erste Mal sah.
Heute Morgen ist es … passiert. Sie ist von ihrer Dachterrasse gefallen. Oder gesprungen. Das weiß man nicht genau.« Ihre Worte klangen wie fremdartige Laute, denen man nachträglich einen Sinn zuzuordnen versucht. Ich sah die Frau auf mich zukommen, sie sprach weiter, bewegte die Lippen, ohne Ton, und fasste mich am Arm und führte mich zu einem Sofa, in das sie mich hineindrückte, ich weiß noch, dass es ein Kirschholzsofa mit einem Biedermeierstoff war, offensichtlich frisch aufgepolstert, denn die Sprungfedern waren hart und der Stoff jungfräulich, wie unberührt. Und dann dachte ich, dass jetzt alles anders war, alles. Dass es ab jetzt nie mehr so sein würde wie bisher. Dass ich etwas versäumt hatte, etwas Entscheidendes, das in seiner furchtbaren Endgültigkeit für immer mein Begleiter sein würde: Ich war zu spät gekommen.
Die Frau verschwand und kehrte wenig später mit einem Tablett und einer Karaffe mit einer braunroten Flüssigkeit zurück. Glas klirrte an Glas und sie hielt mir etwas an die Lippen, das nur Cognac sein konnte. Ich reagierte nicht, sie sagte: »Trinken S’, Sie sind ja weiß wie ein Leintuch.«
Und dann trank ich und wieder hörte ich die Frau sprechen, in Satzfetzen, die kamen und gingen, mit Wörtern, die wie Treibgut im Raum herumirrten. »… so furchtbar … nicht glauben … auch nicht der Typ … hin und wieder ein Glaserl miteinander… sooo viel Interessantes … Arbeit …« Der Alkohol breitete sich in meinem Körper aus, in meinen Gliedern, meine Kehle brannte und in meinem Nacken spürte ich ein weiches Kribbeln, das mich nachgiebig machte und irgendwie eine Distanz zu mir selbst erzeugte.
»Bitte erzählen Sie noch einmal. Von Anfang an. Alles«, sagte ich zu der Frau, deren Namen ich, wie mir jetzt auffiel, immer noch nicht kannte. Ich hielt ihr mein leeres Glas hin, und als sie die Karaffe zum Nachschenken anhob, fragte ich: »Wie heißen Sie?«
»Erna Buchholtz«, antwortete sie und strich sich über das kurze graue Haar, das wie ein Helm um ihren Schädel lag, »Mit tz.«
Die Frau, die Erna Buchholtz hieß, verschwand und kam mit einem zweiten Glas zurück, schenkte es voll und leerte es in einem Zug. Dann setzte sie es leise ab, ganz vorsichtig, als wollte sie die Geister, die den Raum bevölkerten, nicht verscheuchen. Ich betrachtete sie, es war alles so unwirklich, und wartete darauf, dass sie wieder zu sprechen begann:
»Heute Morgen. Es war noch ganz früh. Sieben oder so. Da hat’s plötzlich bei mir geläutet und da stand die Polizei und fragte nach Ihrer Mutter.« Ob Frau Sternberg allein lebe und ob sie, Erna Buchholtz, von Angehörigen wisse. Bei dem Wort »Angehörige« sei ihr ganz seltsam zumute geworden und sie habe gleich gewusst, dass etwas passiert sein musste. Und dann sagten die Beamten, dass es einen »Vorfall« – ja, dieses Wort hätten sie verwendet – dass es also einen Vorfall gegeben habe. »Dass sie – o Gott, ich darf mir das gar nicht vorstellen – irgendwann in der Nacht von ihrer Terrasse hinuntergesprungen ist. Ich wollte … konnte das nicht glauben, denn das hätte ja bedeutet, dass ich in aller Seelenruh geschlafen habe, während sie …«
Noch bevor ich näher darüber nachdenken konnte, sagte ich: »Meine Mutter hätte sich niemals umgebracht.«
Erna Buchholtz sah an mir vorbei, ich konnte nicht recht einschätzen, was sie dachte, aber aus ihrem Blick sprachen Mitgefühl und etwas, das mich vermuten ließ, sie wüsste Dinge, die mir verborgen waren.
Erna Buchholtz setzte sich auf ihrem Stuhl zurecht; das Knarzen des Geflechts klang überlaut in der Stille. Dann sagte sie, und ihr Blick war auf einen Punkt hinter mir an der Wand gerichtet: »Warum haben Sie sie nie besucht?« Die Worte trafen mich wie ein Peitschenhieb, ich konnte und wollte nicht darauf antworten, weil jede Erklärung wie eine lahme Ausrede geklungen hätte. Jetzt, wo alles anders war.
Da sagte Frau Buchholtz unvermittelt: »Wo sie doch so krank war, der Krebs …«
Mein Atem zitterte und das Gefühl, in einem Albtraum zu stecken, wurde übermächtig. Ich wollte aufstehen, davonlaufen, ich wollte aufwachen und alles sollte sich in Wohlgefallen aufgelöst haben: die Angst und der Schmerz, die Ohnmacht. Und die Erkenntnis, versagt zu haben. So endgültig, dass es nie mehr gut werden würde.
Das Gespräch endete zu später Stunde und damit, dass ich zu viel geraucht und noch mehr getrunken hatte. Ich erinnere mich, dass ich beim Aufstehen fast das Gleichgewicht verloren hätte und all meine Konzentration bündeln musste, um den Weg aus der Wohnung und ins Hotel zu finden. Ich tat dies mit ruhiger Anstrengung und bewusst würdevollem Gang und bildete mir wie alle Betrunkenen ein, dass ich mich gut im Griff hatte und niemand etwas bemerken konnte. Einzig das etwas verrutschte Lächeln des Nachtportiers im Hotel Kugel zeigte mir, dass mein Zustand doch nicht unbemerkt blieb. Mit dem Zimmerschlüssel in der Hand fragte ich ihn, bevor ich nach oben verschwand: »Sagen Sie, mein Bester, wie oft besuchen Sie eigentlich Ihre Mutter?«
Er antwortete nicht sofort, vielleicht fand er die Frage indiskret, vielleicht hatte er keine Mutter mehr, nie eine gehabt. Doch dann hörte ich ihn mit weichem Wiener Singsang sagen: »Ich brauch Sie nicht zu besuchen, Sie wohnt bei mir.«
Das gab mir den Rest und ich stolperte wortlos davon, bekam einen Stock höher die Zimmertür nicht gleich auf, und als es mir doch noch gelang, riss ich die Fenster auf, schmiss mich im Dunkeln aufs Bett und blieb so bis zum Morgen liegen, unbeweglich, bis das erste Morgenlicht die Schwärze der Nacht vertrieb.
Es war die Kälte, die mich weckte. Ich erhob mich mühsam, mit steifen Gliedern und Schluckbeschwerden, schloss die Fenster und drehte beide Heizkörper nach rechts bis zum Anschlag. Zitternd schleppte ich mich unter die Dusche und blieb dort zehn Minuten unter einem Strahl stehen, der so heiß war, dass ich es kaum aushielt. Dann schöpfte ich mit beiden Händen reichlich kaltes Wasser und klatschte es auf meine Augen, um die Verwüstungen des Alkohols abzumildern, was natürlich vergebens war.
In der frischen Unterwäsche, der einzigen, die ich mitgebracht hatte, saß ich dann eine Weile auf dem Bett herum. Ich würde mir ein paar Sachen kaufen müssen. Auch etwas Schwarzes. Wegen der Halsschmerzen hatte ich noch nicht einmal Lust auf eine Zigarette, also ging ich gleich in den Frühstücksraum hinunter, der aussah wie eine abgehalfterte Vorort-Stammtischkneipe, aus der man die Flipperautomaten entfernt hatte. Der Raum war gut besucht und ich verzog mich in die hinterste Ecke. Mit dem Rücken zu den anderen Gästen dachte ich daran, dass meine Mutter ein paar Häuser weiter mit zerschmetterten Knochen auf dem Boden gelegen hatte. Eine Frau mit Kleinmädchenstimme, etwa in meinem Alter, kam an den Tisch. Ich bestellte Kaffee und Früchtetee und hatte Mühe, die Tränen wegzublinzeln.
Bis vor wenigen Stunden hätte ich den Gedanken, meine Mutter könnte sich etwas antun, weit von mir gewiesen. Worte wie Verzweiflung oder Todessehnsucht brachte ich mit ihr nicht in Verbindung. Ich habe nie liebevoll an sie gedacht, aber ich war mir sicher gewesen, dass sie immer irgendwie da wäre. Ich hatte fest damit gerechnet, dass sie genug Disziplin aufbringen würde, um mich, die labile Tochter, um mindestens zwanzig Jahre zu überleben. Als ihr letzter Triumph über mich.
Aber so war es nicht gewesen. Mutter war alt und krank gewesen, todkrank, und wahrscheinlich war sie auch einsam gewesen. Sie hatte Kämpfe mit sich ausgefochten und einen letzten, endgültigen Kampf verloren. Gegen den Tod kam man nicht an. Noch nicht einmal sie. Aber dem Tod gewissermaßen in die Arme zu springen, das war so gar nicht ihre Art gewesen, früher. War Selbstmord nicht eine Form der Kapitulation? Die Segel streichen, die weiße Fahne hissen, das Schiff kampflos dem Feind überlassen? War das die Mutter, die ich gekannt, unter der ich ein halbes Leben lang gelitten hatte? Auf jeden Fall hatte die Mutter, die ich gekannt hatte, jede Schwierigkeit als Herausforderung betrachtet, die es zu bestehen galt. Zu überlisten, niederzuringen, zu beseitigen. Wie sehr musste sie sich verändert haben. Wie sehr musste die Krankheit sie verändert haben!
Schon im Gang hörte ich das Zimmertelefon schrillen und beeilte mich, die Tür aufzuschließen.
Es war Wolf und ich hörte seiner Stimme an, dass er sich Sorgen machte.
»Warum kannst du dieses verdammte Ding nicht anlassen?«, fragte er statt eines Grußes. Mit dem »Ding« meinte er das Mobiltelefon, das er mir letztes Weihnachten geschenkt hatte und das ich meist zu Hause in der Schublade aufbewahrte.
»Wolf, mein Lieber, Lieber«, flüsterte ich zittrig und brach in Tränen aus. Ich berichtete, was es zu berichten gab, in wenigen Sätzen. In der Leitung blieb es still. Wolf war kein Mann überflüssiger Worte. Er war riesengroß und wirkte tatsächlich wie ein Seewolf, breitschultrig und mit einer tiefen Stimme. Er war Maler, Stukkateur und Restaurator. Wir hatten uns bei der Arbeit kennengelernt, als ich für einen Auftrag in Südtirol »den Besten« suchte. Wolf hatte zu dem Zeitpunkt eine kleine Wohnung in Bozen, doch führte er schon damals ein recht nomadenhaftes Leben, immer unterwegs von einem Einsatzort zum nächsten.
»Maja … das ist ja entsetzlich.« Und dann fügte er hinzu: »Komm nach Hause, Maja.«
Wie immer hatte er sofort erfasst, wie es um mich stand. Ich nickte, und als mir einfiel, dass er mich ja nicht sehen konnte, setzte ich ein »Ja« hinzu. Und dann weinte ich wieder. Als ich nicht mehr konnte, fiel mir ein, dass ich ja die nächste Angehörige meiner Mutter war und vielleicht nicht einfach so wegfahren konnte. »Ich muss wohl heute noch zur Polizei. Und dann … jemand muss sich um die … Beerdigung kümmern, und das werde wohl ich sein.«
»Dann komme ich zu dir. Ich nehm den nächsten Flieger.«
Ich schluchzte noch einmal. Es wäre zu schön, Wolf da zu haben, mich von seinen riesigen Armen umschlingen zu lassen wie von einem weiten, warmen, weichen Mantel. Doch dann fiel mir ein, dass er an einem Auftrag arbeitete, der in zwei Tagen fertiggestellt sein sollte, und ich sagte so fest und entschieden, wie ich konnte: »Nein. Du machst deinen Auftrag fertig. Ich muss hier ja auch erst einmal alles sehen …« Was genau ich hier zu »sehen« hatte, wusste ich selbst nicht. Wir redeten noch eine Weile hin und her, draußen vor der Zimmertür rauschte ein Staubsauger. Schließlich konnte ich Wolf davon überzeugen, dass es so das Beste wäre und dass ich mich auf jeden Fall abends wieder melden würde. »Schalt das Telefon ein«, sagte er zum Abschied. Und: »Ich denk an dich«, was mich wieder zum Weinen brachte, aber erst nachdem ich aufgelegt hatte.
Immer schon habe ich mir gewünscht, tough zu sein. Ein Pokerface zu haben, in dem nicht alle gleich lesen, wie es um mich bestellt ist. Nicht gleich bei jeder rührseligen Szene im Kino zu spüren, wie einem die Tränen in die Augen treten. Außerdem gibt es Lieder, die kann und darf ich nur hören, wenn ich alleine bin.
Jedenfalls schmiss ich mich, nachdem Wolfs Stimme am Telefon verklungen war, bäuchlings aufs Bett und schrie und schluchzte in das Kissen. Irgendwann verging der Krampf, ich kramte eine Zigarette und ein chinesisches Notizbüchlein aus der Tasche, rauchte und versuchte eine Liste der Dinge zusammenzustellen, die jetzt zu erledigen wären. Polizei, Haustürschlüssel?, Beerdigung, wo? Ein paar Leute, wahrscheinlich waren es eher viele, mussten benachrichtigt werden, ich musste also Karten drucken lassen und sie verschicken. Die Adressen würde ich bei Mutter in der Wohnung finden. Ich musste mit Erna Buchholtz sprechen und sie fragen, ob Mutter irgendwann einmal etwas erwähnt hatte hinsichtlich, äh, der Bestattungsart. Ogottogott, dachte ich, was ist das alles fürchterlich! Ob Mutter sich etwa eine Feuerbestattung gewünscht hatte? Die Grabpflege fiel mir ein, noch etwas, um das sich Angehörige zu kümmern hatten. Kurz blitzte der Wunsch in mir auf, Oma Charlotte würde noch leben, sie hätte mir sagen können, was zu tun wäre. Doch dann fand ich mich egoistisch und überlegte, dass alles anders gekommen wäre, wenn Oma Charlotte noch gelebt hätte. Dann hätte sich Mutter wahrscheinlich gar nicht erst umgebracht. Ein Haufen Konjunktive, ein Haufen Fragen. Und musste nicht auch ihr Hausstand aufgelöst werden? Ich stellte mir vor, wie ich in Mutters Sachen kramte, wie ich einen Container bestellen würde. Aber nein, halt, eine Firma, die Haushaltsauflösungen organisiert, müsste das erledigen. Erst ganz am Schluss fiel mir das wohl Wichtigste ein: Ob ich Mutter etwa, wie man das im Fernsehen sah, »identifizieren« musste?
Erna Buchholtz war sich sicher: »So war das auch bei meinem Erwin. Der hat sich totgesoffen und man hat ihn gefunden, auf einer Bank im Prater. Da hat er gesessen und ist einfach gestorben.«
Sie nahm einen Schluck Kaffee und verzog das Gesicht und das Bedauern grub noch tiefere Furchen auf ihre Wangen. Dann schnitt sie eine Grimasse und fügte hinzu: »Als er nicht nach Hause gekommen ist, hab ich schon gewusst, dass was Schlimmes passiert sein musste. Bis irgendwann die Polizei vor der Tür gestanden hat, und dann hab ich ihn halt anschauen müssen, im AKH, in der Pathologie ist er gelegen. Und ich hab ihn erst gar nicht erkannt, weil er so schwarz ausgeschaut hat, um den Mund herum, mein Gott, Kind, ich kann Ihnen sagen, das war das Schwerste, was ich je hab tun müssen im Leben.« Ihr Blick verlor sich in der Ferne, in einer Vergangenheit, die nur sie sehen konnte, die mir aber deshalb nicht weniger leidvoll erschien. Jetzt, wo mir Ähnliches bevorstand. Ich atmete tief durch, stellte die Tasse ab und sagte: »Na, dann werd ich mal.«
Erna Buchholtz kehrte in die Gegenwart zurück, sie sah jetzt irgendwie erschrocken aus. Dann sagte sie: »Ach, Kind, das hab ich Ihnen gar nicht erzählen wollen, jetzt, wo Sie …« Sie brach ab. Ich nickte und sagte: »Schon gut. Vom drüber Schweigen oder Schönreden wird’s auch nicht besser.« Ich griff nach meinem Mantel. »Da muss ich halt jetzt durch.«
Erna betrachtete mich und das Mitleid machte ihr runzliges Gesicht ganz weich, sie sah aus wie eine etwas verknautschte Eule. Ich seufzte und meine Stimme zitterte, als ich fortfuhr: »Sie könnten mich begleiten und draußen warten. Das … wäre wirklich eine große Hilfe.«
In der Metro die üblichen U-Bahn-Gesichter: bleich, großstädtisch, ungesund. Sie zeugten von zu viel Zeit in geschlossenen Räumen, zu wenig Sonne und Luft und von Vitamin-D-Mangel. Ich fiel also kaum auf. Erna und ich saßen nebeneinander und sprachen kein einziges Wort. Dieses Schweigen hatte nichts Peinliches oder Fremdes an sich. Es war das Schweigen zweier Menschen, die wussten, dass es im Moment nichts zu sagen gab, was irgendetwas geändert hätte.
Der Polizist wartete bereits. Ein gemütlicher Mitfünfziger mit schütterem Haar namens Cincek. Erna und ich folgten ihm in einen riesigen Fahrstuhl und dann Korridore entlang. Wir wechselten einen beklommenen Blick und Ernas Gummikreppsohlen quietschten, was mich in einer anderen Situation sicher zu unangemessenen Heiterkeitsausbrüchen inspiriert hätte.
Und dann war es so weit. Erna war vor der Tür stehen geblieben. Ich trat ein, ich zitterte, wegen der Kälte oder aus Furcht. Auf einem Stahltisch lag eine Gestalt, von einem weißen Tuch bedeckt. Der Pathologieangestellte warf Cincek einen kurzen Blick zu, dieser antwortete mit einem knappen Nicken, einem Nicken, das davon sprach, dass der Polizist Cincek das hier schon viele Male getan hatte. Der Pathologiemann hob das Tuch und da sah ich sie. Mutter. Ich hatte Angst gehabt, Angst vor dem Anblick, vor den Verletzungen und Entstellungen. Aber da war nichts. Einzig der Kopf war in einem etwas unnatürlichen Winkel zurückgebogen, wie abgeknickt. Ihr Gesicht war nahezu unversehrt, und dennoch war es so anders. Sie war mager geworden und ihre Gesichtshaut war wächsern und gelblich. Ich konnte nicht sagen, ob sie friedlich aussah oder entspannt, ich wusste gar nichts mehr. Nur dass ich zu spät gekommen war. Und dass ich dieses Bild bis an mein Lebensende mit mir herumtragen würde. Mit den Jahren würde es verblassen wie eine alte Fotografie, aber ich würde es immer bei mir tragen.
Ich öffnete den Mund, um etwas zu fragen, aber es kam nur ein klägliches, bedauernswertes Krächzen heraus. Der Polizist Cincek sagte, als habe er meine Gedanken gelesen: »Sie ist mit dem Rücken nach unten aufgekommen. Ihr Genick …« Er brach ab und sah mich an. Ich nickte. Und das war das Letzte, woran ich mich erinnere.
Ich erwachte auf einer Liege in einem Raum, dessen Decke und Wände weiß waren. Im ersten Moment kam mir der Verdacht, ich selbst sei vielleicht auch gestorben, einfach so, doch dann hörte ich ein Geräusch, ein Rascheln und quietschende Schritte, jemand nahm meine Hand und ich erkannte Ernas Kirschäuglein, die sich auf mich hefteten. Sie blinzelte mir zu, ich blinzelte zurück, schloss die Augen, öffnete sie wieder. Erna war immer noch da, jetzt lächelte sie leicht.
»Das war alles ein bisserl viel«, sagte sie. Und als ich nichts erwiderte, redete sie weiter und ihre Stimme bekam dabei einen gerührten Unterton: »Sie schaut doch recht friedlich aus, man könnt grad meinen, sie schliefe.«
Ich blinzelte erneut und versuchte mich an alles zu erinnern, und dann wunderte ich mich: »Haben Sie sie denn auch gesehen?«
»Ja, als Sie umgefallen sind und die Herren die Tür geöffnet haben, um einen Arzt zu holen, da bin ich halt doch zu Ihnen rein. Da musst ich sie ja anschauen.«
»Wo ist …?«
»… der Polizist?«
Ich nickte.
»Er hat mir«, sie zog etwas aus ihrer braunen Kunstledertasche, »das hier gegeben. Sie sollen sich bei ihm melden. Wegen der Formalitäten.«
Der Begriff hallte in meinem Kopf wider und mit ihm kam das dumpfe Gefühl, möglicherweise etwas zu übersehen. Als Erstes musste ich Wolf anrufen, nein, halt, als Erstes musste ich ein Hotel finden oder eher im Hotel Kugel noch ein paar Nächte reservieren. Da hörte ich Ernas Stimme und sah Ernas Mund, der über mir auftauchte: »Wenn ich Ihnen helfen kann, bei den Erledigungen … und«, sie druckste herum, »wollen Sie nicht bei mir Quartier nehmen die Tage? In der Wohnung Ihrer Mutter möchten Sie vielleicht erst mal nicht …« Sie verstummte. Ich nickte lahm oder glaubte es vielleicht auch nur zu tun; jedenfalls fuhr sie fort, mich zu überreden.»Und in so einem Hotel, da kann man sich doch nicht mal einen Kaffee kochen. Außerdem fänd ich’s schön, ein bisserl Gesellschaft zu haben, gerade jetzt.«
Auf einmal wurde mir die Müdigkeit, die schier übermächtige Mattigkeit, die meinen ganzen Körper lähmte, bewusst. Warum konnte ich nicht einfach hier liegen bleiben? Ich erinnerte mich an die Male, als ich im Krankenhaus gewesen war, das eine Mal wegen einer Angina, das andere Mal wegen eines gebrochenen Beins, und es waren nicht unbedingt schlechte Erinnerungen, die da aufstiegen. Hier konnte ich schlafen, einfach immer schlafen, im Bett essen, wieder schlafen, man würde sich um mich kümmern. Und vielleicht würde dann alles vergehen, von selbst vergehen. Kurze Zeit überließ ich mich ganz dieser süßen Vorstellung, dann drang wieder eine Stimme von extern in mein Bewusstsein, eine Stimme, die eine hauptberufliche und routinierte Munterkeit ausstrahlte. Ich spürte Finger an meinem Handgelenk, die Finger zur Stimme fühlten meinen Puls. Ich hoffte, er möge recht schwach und besorgniserregend sein, dann hörte ich Erna Buchholtz in meine Hoffnung hineinsprechen.
»Wie ist es?«, fragte sie und die Munterkeitsstimme antwortete: »Na, ein bisserl wacklig ist sie schon noch. Am besten, Sie stecken sie für den Rest des Tages ins Bett. Ruhe ist jetzt gut für sie.«
Und so fand ich mich ein paar Stunden später in Erna Buchholtz’ Gästebett wieder, trank starken und süßen Tee mit Sahne und aß Butterbrote. Erna saß auf einem Stuhl neben mir und sah mir beim Kauen zu. Ich wunderte mich über nichts mehr, weder über Erna Buchholtz’ Fürsorglichkeit noch über meine Fügsamkeit oder den Heißhunger, der mich überfallen hatte, sondern betrachtete die Katzensammlung, die das Zimmer füllte. Da gab es Katzen aus Stoff, Ton, Porzellan, mit Perlen beklebte und hölzerne, sogar eine Gießkanne, deren Schwanz sich zu einem Haltegriff rollte und aus deren Mund das Wasser kam.
»Haben Sie eine Katze?«, fragte ich.
Erna Buchholtz lachte. »Reichen die nicht?«
»Na ja, ich meine halt eine richtige.«
»Früher hatte ich einen, den Katerl, aber er ist von heut auf morgen nicht mehr gekommen. Und jetzt füttere ich hin und wieder die Nachbarskatze. Die Wohnung hier wäre eigentlich ideal für ein Haustier. Für eine Großstadtwohnung, meine ich. Wer hat schon so einen Garten wie ich? Morgen zeig ich Ihnen den mal.«
Ich nickte und kaute, trank Tee und dann fiel mir ein, dass meine Mutter in diesem Garten oder jedenfalls direkt daneben den Tod gefunden hatte. Das Butterbrot wurde zu einem harten Kloß in meinem Hals, ich drängte die Tränen zurück, aber es half nichts, sie begannen zu laufen, meine Wangen hinunter, und der trockene Kloß steckte in meiner Kehle fest. Ich schluckte. Erna reichte mir ein Taschentuch, das sie aus ihrer Schürze zog, und plötzlich brach es aus mir heraus: »Ich glaube es nicht. Ich glaube nicht, dass sie da runtergesprungen ist. Das glaube ich niemals.«
Erna nickte, ernst und langsam, doch sie schien meine Überzeugung nicht zu teilen. »Nein. Unter normalen Umständen hätte ich das auch weit von mir gewiesen. Lilli war so … energisch. Sie verachtete Schwächlinge oder Leute, die sich hängen ließen. Aber …«
Ich wischte mir übers Gesicht. Erna stand auf, strich meine Bettdecke glatt und zurrte das Kissen zurecht, das in meinem Rücken steckte.
»Ja?«, fragte ich.
»Andererseits erfordert gerade so ein Akt großen Mut.«
»Mut oder eine tiefe Verzweiflung.« Ich trank den letzten Schluck Tee.
»Wann haben Sie denn zuletzt mit Ihrer Mutter gesprochen?«, wollte Erna wissen.
»Am 8. August vor drei Jahren. Um 16.45 Uhr. Nach der Beerdigung meiner Oma.«
Erna hielt in ihren Bewegungen inne, und als sie mir Tee nachschenkte und Zucker hineinschaufelte, tat sie dies gründlich, zu gründlich. Dann seufzte sie und ich fühlte mich zu der Erläuterung genötigt: »Wir, meine Mutter und ich, fanden es ausreichend, nichtssagende Karten zum Geburtstag und zu Weihnachten auszutauschen.«
Erna Buchholtz ging nicht auf meinen bitteren Tonfall ein. »Ich glaube, sie hatte große Angst …« Sie verstummte wieder und ich lauschte ihren Worten nach, erschrocken und schuldig.
»Ja, aber … da kann man doch was machen, gegen die Schmerzen.« Auch in meinen eigenen Ohren klangen mein Tonfall und meine Worte lahm und abgedroschen. Rechtfertigungen für das Versagen der eigenen Person. Aber, verdammt noch mal, wofür sollte ich mich eigentlich rechtfertigen? Schließlich war sie es gewesen, die immer etwas an mir auszusetzen gehabt hatte. Selbst am Tag von Großmutters Beerdigung hatte sie es nicht lassen können. Bitterkeit stieg in mir auf bei der Erinnerung. Ich hatte mir die Haare kurz schneiden und blondieren lassen, einen wilden Schnitt, der in alle Richtungen abstand. Und nach Jahren der Funkstille waren ihre ersten Worte an mich gewesen: »Es gibt Frauen, die sich so eine Frisur leisten können. Andere sehen damit aus wie eine Witzfigur. Man sollte wissen, zu welcher Gruppe man gehört.«
»Ich meine eher die Angst vor der Hilflosigkeit«, sagte Erna in meine Gedanken hinein. Und da musste ich wieder an das hagere Gesicht auf dem Stahltisch denken. An die eingefallenen Wangen, die gelbliche Färbung ihrer Haut. Mutter war immer schlank gewesen. Als junges Mädchen, auf alten Fotos, wirkte sie biegsam und elegant, zierlich trotz ihrer Größe von 1,75 Meter. Die Biegsamkeit war später, mit zunehmendem Alter, zu Zähigkeit mutiert, aber dürr war sie nie gewesen. Und selbst an Großmutters Beerdigung hatte ich noch gedacht, was für eine schöne Frau sie doch war. Ich starrte auf das Katzenmuster auf der Bettwäsche. Pastellene Katzen, die mit pastellenen Wollknäueln spielten, ein Albtraum in Biberqualität.
»Bei welchem Arzt war sie denn?«, fragte ich, vielleicht etwas zu unvermittelt, denn Erna blickte mich irgendwie seltsam an– war sie überrascht oder unangenehm berührt?
»Bei Dr.Prohacek. Seine Praxis ist nicht weit von hier. Aber da gibt es …«
In dem Moment klingelte es an der Haustür. Erna stand auf, ihre Schritte quietschten, sie trug immer noch die Gummisohlenschuhe, und dann hörte ich sie an der Haustür mit jemandem sprechen, einem Mann. Wenig später hörte ich, wie etwas klimperte, dann schloss sie die Tür und stand kurz darauf wieder vor mir, zwei Schlüssel in der Hand: »Unser Hausmeister hat mir die Zweitschlüssel für Lillis Wohnung gegeben. Er ist ein paar Tage nicht da und er dachte, falls man hineinmüsse …«
Ich nahm sie entgegen, sie fühlten sich warm an. Ich sah Erna an, die meinen Blick erwiderte, bedrückt, wie es schien. »Na ja«, sagte sie dann zu mir und ich antwortete: »Na ja.«
Eine Stunde später stand ich vor Mutters Wohnungstür im dritten Stock, den Schlüssel in der Hand. Ich sah mich um, blickte in das altehrwürdige Treppenhaus mit dem klapprigen schmiedeeisernen Fahrstuhl, den ich bei mir »die Eisenfalle« nannte; dem Terrazzoboden und der Jugendstilbordüre, die sich grün und schwarz durchs Treppenhaus rankte. Dann hob ich den Schlüssel und steckte ihn ins Schloss. Ich öffnete die Tür einen Spalt breit, ein schleifendes Geräusch war zu hören, das verstummte, als ich die Tür halb geöffnet hatte. Beim Eintreten fiel mein Blick auf einen braunen DIN-A5-Umschlag, der auf dem Boden lag und den jemand offensichtlich durch den Briefschlitz in der Tür gesteckt hatte. Ich hob ihn auf und las zu meiner Überraschung die in einer schwungvollen Handschrift geschriebenen Worte: An Frau Maja, Tochter von Lilli Sternberg, persönlich. Als Absender war eine Lore Klopstock in der Herrengasse in Wien angegeben. War das nicht eine Freundin meiner Mutter? Aber woher wusste sie, dass ich hier war? Und was war in dem Umschlag?
Nun bist du also wieder hier«, sagte Leni und sah mich mit einem Lächeln an, den Kopf leicht schief gelegt. Ich antwortete nicht gleich und ich erinnere mich, wie sie sich vorbeugte und mich anblinzelte. Sie sah schön aus, das rote Kleid stand ihr gut, in der rechten Hand hielt sie die grüne Tasse mit dem Maruschka-Bild. Sie sah mich direkt an, die Wangenknochen hoch und betont, ihr Ausdruck weniger fragend als belustigt. Ich blinzelte an ihr vorbei durch das Fenster, ihrem Blick ausweichend, und sagte: »Ja.«
Es war Ostern 1943, ich hatte die Schule beendet, war zurückgekehrt, nach zwei Jahren in einem Internat in Danzig. Ich war siebzehn und nach Ostern würde ich die Königsberger Handelsschule besuchen. So hatten meine Mutter und mein Stiefvater es für mich entschieden. Und nun saß ich mit Leni am Fenster und sie erzählte von Paul, während ich beobachtete, wie die Spatzen im Regen umherflatterten. Lenis Augen glänzten vor Besitzerstolz.
»Seine Augen sind dunkel, er hat eine Brille, so eine kleine, runde. Und manchmal spiegelt sich das Licht darin und du weißt nicht, ob er dich ansieht …« Sie hatte Paul bei ihrer Freundin Dora kennengelernt, vor einem knappen Jahr, an einem Nachmittag nach Pfingsten. Er war Apotheker, Ende zwanzig und hatte gerade die Apotheke seines Vaters übernommen. Sie hatte ihn gesehen, sich sofort in ihn verliebt (»unsterblich!«) und beschlossen, ihn haben zu wollen. Drei Monate später hatte sie ihn in einer kleinen Kirche an der Ostsee geheiratet. Immer schon hatte Leni, die große Schwester, bekommen, was sie wollte, ob es nun um einen Hund ging, den sie sich sehnlichst wünschte, oder um eine Bluse, die sie im Schaufenster bei Hermanns gesehen hatte und um die sie Mutter so lange anbettelte, bis sie sie ihr nachschneidern ließ. Der Hund war Leni dann bald lästig geworden und die Bluse zu langweilig. Und so war ich zu einem Hund gekommen und Ingeborg zu einer Bluse.
Ich denke an damals zurück und sehe mich vor mir. Auf einem Bild, das mich mit Leni, meiner ältesten Schwester, und Ingeborg, der mittleren, zeigt, stehe ich zwischen den beiden, groß und schlaksig (obwohl ich doch die jüngste war!), die Handgelenke ragen aus den Ärmeln hervor, der Saum meines Rockes bedeckt gerade noch die Knie, ich bin schon wieder gewachsen, habe die eins siebzig hinter mir gelassen. Ich sehe unelegant aus, irgendwie zu groß geraten und selbst für damalige Verhältnisse altmodisch mit meinen langen Zöpfen, neben Ingeborg mit ihrem flotten Hut und der Handtasche. Und neben Leni, die schon früh ihren Willen durchgesetzt hatte und das blonde Haar, ganz wie es die Mode gebot, zu einer Wasserwelle gelegt trug, obwohl unsere Eltern strikt dagegen gewesen waren. Ich war fünf Jahre jünger als Ingeborg und acht Jahre jünger als Leni und war die letzte Hoffnung meiner Eltern auf einen Jungen gewesen. Ich trug schwer an der Last dieser zerschellten Hoffnung. Noch Jahre nach dem Tod meines Vaters tat ich alles, um der Sohn zu sein, den er sich immer gewünscht hatte.
In der Schule war ich nicht gut und nicht schlecht gewesen. Die meisten Lehrer hatten mich nur dadurch wahrgenommen, dass ich immer mit den Jungen über den Schulhof rannte – eines meiner beiden Knie war ständig aufgeschlagen –, dass ich Murmeln spielte und im Sport am schnellsten rennen konnte. Schön gehörte damals nicht zu den Attributen, die ich erstrebenswert fand, ich machte mir wenig Gedanken darüber, wie ich aussah. Meine Kleider waren mir egal, ich nahm meinungslos alles entgegen, was Leni oder Ingeborg nicht mehr gefiel. Nur wenn die Schneiderin kam und von mir verlangt wurde, so lange still zu stehen, bis sie alle Nadeln, die zwischen ihren Lippen klemmten, untergebracht hatte, revoltierte ich und sagte:»Ich hab doch das Karierte.«
Das alles änderte sich schlagartig an dem Tag, an dem Paul in mein Leben trat.
Mit dem Umschlag in der Hand machte ich kehrt, lief die Treppe hinunter und aus dem Haus. Meinen Mantel hatte ich vorsorglich angezogen, gegen die Kälte im Treppenhaus und wegen meiner angeschlagenen Gesundheit, und so empfand ich die kalte Nachtluft, die mir entgegenschlug, als wohltuend und erfrischend. Ein paar Straßen weiter steuerte ich eine Kneipe an, die nach Alkohol und Anonymität aussah. Am Automaten zog ich mir eine Packung Camel, verdrückte mich in eine schlecht beleuchtete Ecke und bestellte, Erkältung hin oder her, einen Gin Tonic. Dann fingerte ich mir eine Zigarette aus der Packung und öffnete den Umschlag. Er enthielt eine Nachricht von Lore Klopstock sowie einen zweiten, kleineren und versiegelten Umschlag, auf dem Großmutters Siegel, CB, Charlotte Benthin, prangte.
Liebes Fräulein Maja, ich hätte Ihnen den Umschlag gerne persönlich überreicht, aber ich bin zurzeit im Krankenhaus, wegen meiner Diabetes, sodass ich einen Boten damit beauftragt habe. Diesen Umschlag gab mir Ihre Frau Mutter vor circa zwei Wochen. Ich weiß nicht, was er enthält, aber ich denke, dass es in Lillis Sinne ist, wenn ich ihn an Sie weiterreiche. Ich bin zutiefst bestürzt über den Tod Ihrer Mutter, Sie war mir eine gute Freundin und ich versichere Sie meiner tief empfundenen Anteilnahme. In Trauer, Ihre Lore Klopstock.
Ich berührte das Siegelwachs, es fühlte sich hart an und glatt, ich schluckte, schloss die Augen. Als ich sie wieder öffnete, stand der Wirt vor mir, stellte den Gin Tonic auf einen Bierdeckel und kritzelte eine Zahl darauf. Ich nickte ihm zu und drehte dann den Umschlag in meinen Händen. Ich betastete ihn behutsam und fühlte etwas Kleines, Hartes. Ich schob den Finger hinein und riss ihn vorsichtig auf, dann kippte ich ihn um. Heraus fielen ein Schlüssel und ein Foto. Es fiel mit der Vorderseite nach unten, und auf der Rückseite stand: Wir beide in Hohehorst, März 1944. Langsam drehte ich das Bild um. Das war Oma, Oma Charlotte, als ganz junge Frau. Und das Kind musste meine Mutter sein. Was war sie für ein rosiges und rundgesichtiges Baby gewesen! Das runde Gesichtchen lugte lachend aus einer Kappe heraus, die unter dem Kinn gebunden war, und die dicken Backen zeugten von Wohlsein und Gesundheit. Oma Charlotte lachte auch. Die Sonne beschien die beiden von der Seite und Charlottes Zöpfe, die sie zu einer Art Kranz um den Kopf gewunden hatte, leuchteten wie eine Aureole; das Haar meiner »Babymutter«, das vorne unter der Mütze hervorsah, war dunkel.
Aber das eigentlich Ergreifende war der Ausdruck auf Charlottes Gesicht, das Strahlen ihrer Augen, die Glückseligkeit und die unbedingte Liebe, mit der sie ihr Kind betrachtete. So als hielte sie den kostbarsten Schatz der Welt in ihren Armen. Und so war es wohl in der Regel auch: Für eine Mutter war der kostbarste Schatz ihr Kind. Ob meine Mutter mich je so betrachtet hatte? Wenn ja, so musste das vor meiner Zeit gewesen sein, dachte ich bitter und kämpfte mit den Tränen– diesmal waren es Tränen des Selbstmitleids.
Ich stopfte beides, den Schlüssel und das Bild, in den Umschlag zurück. Ich trank das Glas mit einem Zug leer, stand auf, legte einen Schein auf den Tisch und verließ die Kneipe. So hatte sie mich niemals angesehen, da war ich mir sicher. Und während ich durch die nächtlichen Straßen zurück zu Ernas Wohnung lief, rätselte ich, was es mit dem Schlüssel auf sich hatte. Und warum Mutter es für nötig gehalten hatte, den Schlüssel und auch das Foto bei Lore Klopstock in Verwahrung zu geben.
Ich erwachte von Ernas vorsichtigen Bemühungen, mir das Foto aus den Fingern zu ziehen. Ich zuckte zusammen, sie ebenfalls, doch dann murmelte sie begütigend.
Nach meiner Rückkehr in Erna Buchholtz’ Wohnung hatte ich mich auf direktem Wege ins Gästezimmer begeben, schweigsam und in mich gekehrt, Ernas Fragen ausweichend. Ich hatte die Tür hinter mir geschlossen, mich ins Bett gesetzt, die Decke um mich herum festgestopft und noch einmal das Foto aus dem Umschlag genommen. Dann war ich eingeschlafen.
Jetzt ließ ich Erna gewähren, die das Foto auf den Nachttisch legte, eine Tasse Tee danebenstellte und sich dann leise wieder entfernte. Ich setzte mich auf, trank den Tee in kleinen Schlucken. Etwas drängte in mein vernebeltes Gehirn, etwas Wichtiges, das es zu erledigen galt, doch ich war zu müde, und sosehr ich auch grübelte, ich kam nicht darauf.
Ich erwachte mit bohrenden Kopfschmerzen und zerschlagenen Gliedern. Ich hatte jegliches Zeitgefühl verloren und fühlte mich so, wie ich mich früher manchmal gefühlt hatte, nach durchzechten Nächten, wenn ich um drei aus der Disco gekommen war und mir die plötzliche Stille draußen in den Ohren rauschte. Alles erschien mir seltsam unwirklich, wie eine Welt aus Watte.
Unter dem Blick von mindestens hundert Katzenaugen schälte ich mich aus den Decken, auf der Suche nach einer Uhr, die mir verraten würde, ob es Morgen oder Abend wäre. Wolf fiel mir ein und damit mein schlummerndes Handy und ich beeilte mich, es aus der Tasche zu fischen. Ich öffnete das Fenster weit, zündete mir eine Zigarette an und hielt den Hörer an mein Ohr. Der Empfang war hier schlecht und ich fürchtete schon, ich müsste mich anziehen und in verzweifelter Suche nach einem »Pegel« durch Wiens Straßen irren, doch kurz darauf tutete es und ich hörte Wolfs Stimme, die entgegen seiner sonstigen Art atemlos und gehetzt klang.
»Na endlich«, sagte er als Erstes und ich erwiderte, dass es mir leidtue, wegen des Handys, und dass ich das Gefühl hätte, in einem Albtraum erwacht zu sein. Ich erzählte ihm von der Pathologie und auch von dem Umschlag.
»Ist denn kein Brief dabei oder sonst etwas, das die … Angelegenheit näher erläutert?«, fragte Wolf mit seiner Bassstimme, in seiner feinen Art.
»Kein Brief, kein Zettel, nichts. Und ich glaube auch nicht, dass sie den Umschlag als Botschaft für mich gedacht hatte.«
Wolf sagte leise: »Bist du dir da ganz sicher? Immerhin hat sie sich … nun, sie hat selbst Hand an sich gelegt.«