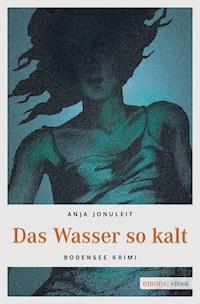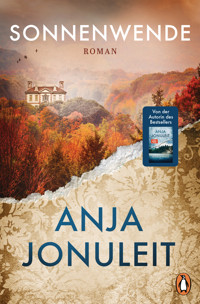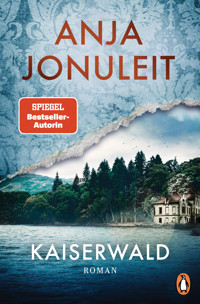Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ohrenschmauss Verlag
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Mord am Bodensee November in Friedrichshafen: Auf dem Friedhof wird die Leiche eines jungen Mannes gefunden. Er wurde betäubt und erstickt. Zur gleichen Zeit erhält die Malerin Marie Glücklich eine furchtbare Nachricht: Erik, der Mann ihrer besten Freundin, ist bei einem Fallschirmsprung ums Leben gekommen. Gibt es einen Zusammenhang zwischen den beiden rätselhaften Todesfällen? Marie Glücklich und Kommissar Andreas Sommerkorn ermitteln. Kennen Sie bereits die weiteren Romane von Anja Jonuleit bei dtv? »Der Apfelsammler« »Das Nachtfräuleinspiel« »Rabenfrauen« »Herbstvergessene« »Die fremde Tochter« »Das letzte Bild«
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Anja Jonuleit
Novemberasche
Kriminalroman
Für meine Freundin Constanze Funke, Conny
Der stumme Reiter
Er ist wieder unterwegs
Ich höre ihn kommen
Wie Donnerschläge
die Hufe seines schwarzen Rosses
Der stumme Reiter
Schwarz ist sein Gewand
Und wenn er kommt bebt die Erde
und die Luft brüllt
Und wenn er geht
bleibt einzig
Stille
Er nimmt ihn mit sich
den Schmerz – die Fratzen – ihr Lachen
den Dornendraht
trägt sie fort
in eine gnädige Finsternis
ohne Echo
in der die Welt aufhört
sich zu drehen
Er bringt mich fort
in eine Welt ohne Menschen
12. September, am Tag danach,
Nur die Ruinen
Asche im Wind
die Wolken ziehen noch
als wäre nichts geschehen
Der stumme Reiter
breitet den schwarzen Mantel aus
und gnädig vergeht
was er berührt
löst sich auf
in nichts
Löse mich auf
in nichts
Novembertod
Fallschirmspringen gilt höchstrichterlich als nicht gefährliche Sportart.
(div. Urteile, z.B. LArbGer Berlin
vom 3.7.69, AZ 5 Sa 57/68)
Es regnete, als Marie um kurz nach acht die Straße entlang zu ihrem Haus ging. Sie schritt rasch aus und sog die frische Abendluft ein, um ihre Aufregung, die hoffnungsfrohe Erwartung, die das heutige Gespräch ausgelöst hatte, im Zaum zu halten. Noch nie war sie so nah dran gewesen! Wenn das mit der Ausstellung klappte, bedeutete das ihren Durchbruch. In ein paar Tagen würde sie sich noch einmal mit Marlene Kattus, der Galeristin, treffen, und die Entscheidung würde fallen. Weil Marie so sehr mit dem Gedanken an die Konstanzer Galerie und ihren eigenen kometenhaften Aufstieg am deutschen und – ja – vielleicht am internationalen Kunsthimmel beschäftigt war, bemerkte sie den Wagen gegenüber erst im allerletzten Moment.
Das alte Haus am See, in dem sie seit nunmehr gut einem halben Jahr wieder wohnte, lag am Stadtrand von Friedrichshafen, es war das letzte Haus vor dem Eriskircher Ried, das letzte Haus vor der Einsamkeit, und es hatte Nächte – und auch Tage – gegeben, an denen Marie einen belebteren Ort dieser Einsamkeit vorgezogen hätte. Gerade wenn sie an die Ereignisse – ein Wort, das einen gnadenlosen Euphemismus darstellte – im vergangenen Herbst dachte.
Sie erschrak zutiefst, als sie vor ihrer Gartenpforte den Wagen am anderen Straßenrand entdeckte: Jemand saß dort hinter dem Steuer und regte sich nicht. Marie hielt in ihrer Bewegung inne und starrte hinüber. Ja, der helle Fleck hinter der beschlagenen Windschutzscheibe war ein Gesicht. Da saß jemand in der Dunkelheit, reglos. Marie fühlte, wie eine eisige Angst in ihr hochstieg. Sie hatten ihn doch gefasst, er saß im Gefängnis! Das tat er doch – oder? Langsam, wie in jenen Träumen, in denen die Glieder zu Blei wurden und die sie während vieler Wochen gequält hatten, legte sie ihre Hand auf den Griff der Pforte, drückte ihn hinunter und das Tor schwang mit einem Quietschen auf, überlaut in der Stille des Abends. Aus dem Augenwinkel sah sie, dass die Person im Wagen sich immer noch nicht bewegte. Sie saß da, völlig still, das Gesicht ein Schemen hinter der Scheibe.
Marie schob die rechte Hand in die Manteltasche, und ihre Finger ertasteten neben dem Schlüsselbund das Pfefferspray. Seit jenem Tag, der noch nicht allzu lange der Vergangenheit angehörte, trug sie es bei sich, wo immer sie hinging. Auf der Schwelle vor ihrer Haustür wandte sie sich um und sah nun direkt zu dem Wagen hinüber. Dann holte sie tief Luft. Das wollen wir doch mal sehen, sagte sie zu sich und ging die Stufen wieder hinunter, zur Pforte hinaus. Sie umklammerte das Pfefferspray so fest sie konnte. Als sie die Straße überquerte, hatte sie den Blick unverwandt auf den weißen Fleck gerichtet. Ich werde mich nie wieder ins Bockshorn jagen lassen, nie wieder, murmelte sie mit zusammengebissenen Zähnen.
In den unzähligen Tropfen auf der Scheibe brach sich das Licht und schillerte orangerot, so dass Marie das Gesicht immer noch nicht erkennen konnte. Sie zwang sich dazu, ruhig ein- und auszuatmen, ein und wieder aus … Erst als sie direkt neben der Fahrertür stand, erkannte sie sie. Die Person hinter der Scheibe war Paula, ihre gute Freundin Paula, die blicklos, mit weit aufgerissenen Augen im Wagen saß und in den Regen starrte.
Marie klopfte an die Scheibe, und als Paula nicht reagierte, riss sie die Fahrertür auf. »Paula«, rief sie aus, doch diese starrte weiter reglos in die Nacht. Marie beugte sich hinunter und fasste sie an der Schulter. »Was ist passiert?«
Die Kinder, schoss es Marie in diesem Moment durch den Kopf, etwas ist mit den Kindern, ein Unfall. Als Paula immer noch keine Reaktion zeigte, schrie sie die Freundin an, schüttelte sie: »Ist was mit den Kindern, nun sag schon!« Sie sah Paula an, die fast unmerklich den Kopf schüttelte. In dem Moment fuhr Marie die Erkenntnis mit aller Wucht in die Glieder: Sommerkorn, es hatte mit Sommerkorn zu tun. Sie schwankte und musste sich am Wagendach festhalten. Mit tonloser Stimme flüsterte sie: »Dein Bruder.« Sie sah, wie Paula den Kopf zurücklehnte, gegen die Nackenstütze, wie sie plötzlich aufseufzte, ein zitternder Seufzer, wie nach einem Weinkrampf oder unmittelbar davor. Ihre Lippen bebten, als sie fast unhörbar flüsterte: »Erik ist tot.«
Marie sah sie an. Erik, Paulas Mann, an ihn hatte sie gar nicht gedacht.
*
Der Tote saß an einen Grabstein gelehnt, und seine Augen starrten in den Regen, der stetig fiel und für die Ewigkeit gedacht schien. Sommerkorn ging einmal um das Grab herum, den Blick beständig auf die reglose Gestalt geheftet. Der Mann, der fast noch ein Junge war, sah so aus, als habe er sich hier niedergelassen, um einen Augenblick der Ruhe, ja, der Weltabgeschiedenheit zu zelebrieren. Ein anachronistischer Byron, dachte Sommerkorn und korrigierte seinen Gedanken. Nein, kein Byron, dazu hat er die falsche Frisur. Wenn die Frau, die ihn gefunden hatte, etwas genauer hingesehen hätte, so wäre ihr aufgefallen, dass der junge Mann nicht, wie von ihr angenommen, unter Drogen stand, sondern dass der Regen in blicklose Augen fiel, über ein Gesicht rann, als wollte er es reinwaschen.
Die Spurensicherung hatte ihre Arbeit bereits getan. Der Erste Kriminalhauptkommissar Andreas Sommerkorn war spät erreicht worden, da er in einem anderen Fall, einer Serie von Bränden in diversen Dönerbuden, unterwegs gewesen war. Nun stand er hier auf dem Friedhof, in der Dunkelheit und bei Regen, und blickte auf das vom Scheinwerferlicht beleuchtete Bild, das an die Gemälde von Goya erinnern mochte. Die Grabsteine und Kreuze warfen bizarre Schatten, und der Tote schien für eine unheimliche Szene in einem Film ausgerichtet zu sein.
Sommerkorn betrachtete ihn. Er war noch jung, keine zwanzig, und sein Gesicht war makellos und wächsern, wie das einer Schaufensterpuppe. Sommerkorn war es, als steckte er in einem hartnäckigen Traum fest; die Situation war völlig surreal. Es war ein absonderlicher Anblick, der Regen, die Schatten, die Leiche waren wie für ein Kunstwerk arrangiert, für eine – wie nannte man dieses moderne Zeug noch gleich –, ja, für eine Installation.
Es war der Arzt, Dr.Bender, der in Sommerkorns Traum hineinsprach. Er hatte etwas abseits gestanden und mit Hasenberger von der Spurensicherung, seines Zeichens mürrischster Mitarbeiter der Polizeidirektion Friedrichshafen, und dem Fotografen gesprochen.
»Guten Abend, Hauptkommissar – auch wenn die Umstände, unter denen wir uns wiedersehen, nicht die besten sind.« Dr.Bender, einer der Ärzte, die von der Polizei bei Todesfällen ohne Fremdverschulden gerufen wurden, lächelte zurückhaltend, wie es seine Art war. Wenn Hasenberger der Mürrischste von allen war, dann war Bender der Feinsinnigste.
»Guten Abend, Dr.Bender«, entgegnete Sommerkorn und deutete mit dem Kinn auf den Toten. »Drogen?«
»Sieht ganz so aus. Zumindest stand er vor seinem Tod unter dem Einfluss von Drogen. Man braucht sich nur die Pupillen anzuschauen. Allerdings …« Bender bewegte sich ein paar Schritte auf den Leichnam zu, beugte sich hinunter und schob die Hemdsärmel des Jungen ein Stück hoch.
Sommerkorn betrachtete die nackten Handgelenke, die eigenartige Schnitte und Kratzer aufwiesen. »Machen so was auch Jungen?«
»Wenn Sie damit meinen, ob auch Jungen sich selbst Verletzungen beibringen bzw. sich ritzen, wie das im Jargon heißt, dann kann ich Ihnen sagen, dass diese Domäne weitgehend weibliche Anhänger hat. Allerdings sehen diese Verletzungen hier nicht danach aus. Zu gleichmäßig. Sehen Sie.« Er nahm die Handgelenke des Toten und hielt sie nebeneinander hoch.
»Das ist merkwürdig. Sieht fast aus wie ein …«
»Muster?«
Die beiden Männer sahen einander an. Der Arzt zuckte die Achseln.
»Was glauben Sie, wie alt er ist?«, fragte Sommerkorn.
»Noch keine zwanzig. Aber ein paar Jahre auf oder ab … Das ist bei manchen schwer zu sagen.«
»Und wie lange ist er schon tot?«
»Eine vorläufige Schätzung? Mindestens vierundzwanzig Stunden, der Rigor Mortis löst sich bereits.«
»Also ist er möglicherweise in der letzten Nacht gestorben?«
»Möglicherweise.«
In dem Moment trat Hasenberger zu ihnen. Sommerkorn nickte ihm knapp zu, der Techniker nickte knapp zurück.
»Irgendwelche Ausweispapiere?«, fragte Sommerkorn ihn.
»Nein. Dieser hier hat zur Abwechslung mal keine um den Hals hängen.«
Auf diese bissige Bemerkung sagte Bender nur: »Ich werde dann mal«, und verschwand im Regen.
»Ja, bis dann«, sagte Sommerkorn über die Schulter hinweg und wandte sich wieder dem missmutigen Kollegen zu.
»Das hier steckte in seiner Jackentasche.« Hasenberger hielt Sommerkorn die eingetüteten Fundstücke hin. Sommerkorn nahm die beiden Tüten; in der einen steckten ein paar Geldscheine, in der anderen ein Messer mit einem schwarzen Griff – ein Springmesser.
»Habt ihr sonst noch was?« Sommerkorn gab Hasenberger die Tüten zurück.
»Nichts. Außer einer durchweichten Zigarettenkippe, die wir auf dem Nachbargrab gefunden haben.« Hasenberger brummte noch etwas Unverständliches und sagte dann: »Wir sind hier fertig. Ist ja nicht viel zu holen, bei diesem Sauwetter.« Dann ging er zu den beiden Männern, die neben einer Zinkwanne darauf warteten, den Toten abzutransportieren.
Sommerkorn nickte geistesabwesend und wandte sich noch einmal dem jungen Mann zu. Er stand da und ließ seinen Blick langsam über den Toten wandern. Ja, die ganze Szene hatte etwas Künstliches, etwas Arrangiertes. Sein erster Eindruck, dass der Junge etwas Statuenhaftes an sich hatte, vertiefte sich noch. Doch das lag nicht allein an der Reglosigkeit der Gestalt. Der Junge hatte hellbraunes, vielleicht auch blondes Haar, das ihm in Strähnen am Kopf klebte. Seine Wangenknochen und sein Kinn waren ausgeprägt, die Nase schmal und gerade. Das Bemerkenswerte an ihm aber waren die Augen, die von heller, ja fast leuchtender Farbe waren, Grün oder Braun, er konnte es nicht genau bestimmen.
Ich werde das nie verstehen, dass man sich so mit Drogen vollpumpt. Dass man sein Leben einfach so wegwirft, dachte Sommerkorn. Ob vorsätzlich oder nicht. Die seltsame sitzende Haltung deutete jedenfalls darauf hin, dass es sich um einen dramatischen Akt des Abschiednehmens handelte. Ein als Stillleben inszenierter Selbstmord?, fragte sich Sommerkorn. Vielleicht waren die Verletzungen an den Handgelenken der diesem Akt vorauseilende Hilferuf. Jedenfalls war das bereits der vierte Drogentote im Bodenseekreis in diesem Jahr. Was per se und verglichen mit anderen Regionen Deutschlands eine geringe Zahl war. Wenngleich das für die Angehörigen auch kein Trost war.
Sommerkorn schlug seinen Mantelkragen hoch, nickte den beiden Trägern zu und wandte sich ab. Irgendetwas war an dem Jungen, das Sommerkorn seltsam berührte. Das ihn an etwas oder jemanden erinnerte. Und während er durch die Dunkelheit zu seinem Wagen zurückging und der Kies unter seinen Schritten knirschte, grübelte er darüber nach, was das sein konnte.
☺
Wieder hat Walser mich zum Vorrechnen an die Tafel geholt und mich dabei feixend angesehen. Ich glaube, der Typ hasst mich. Es kann doch nicht sein, dass der immer noch daran denkt, dass ich ihm mal einen Fehler nachgewiesen habe. Na ja, genauer gesagt, war’s ja nicht nur ein, sondern drei Mal. Auf jeden Fall hat er mich bei der schwierigsten Aufgabe vorgeholt, einer Integralrechnung, die es in sich hatte. Natürlich hat er gehofft, dass er mich diesmal kleinkriegt, dieser Sack. Aber wie immer hat er sich getäuscht. Ich hab sie gelöst, und dann musste er mich wohl oder übel loben. Als ich zum Platz zurückging, hab ich gesehen, dass sie enttäuscht waren, dass sie mich gerne stotternd und mit roter Birne da vorne gesehen hätten. Die übliche Verarsche konnten sie sich trotzdem nicht verkneifen. Nur der Neue hat mich angesehen und mir zugenickt.
*
Später wusste Marie nicht mehr, wie sie es geschafft hatte, die Freundin aus dem Wagen zu befördern, sie über die Straße zu führen, durch den Regen, der inzwischen bis auf ihre Kopfhaut und unter ihren Schal gedrungen war.
Im Wohnzimmer war es kalt, also führte sie Paula in die Küche, setzte sie an den Tisch und begann mit wenigen geübten Handgriffen den alten Holzherd anzufeuern. Bald knisterte und zischte das Feuer im Herd. Sie füllte Wasser in den Kessel, sie stellte ihn auf die Metallringe und setzte sich Paula gegenüber. Sie ergriff ihre Hände – sie waren eiskalt – und fragte: »Was ist passiert?«
»Er ist … gesprungen. Heute … Es sollte sein letzter Sprung in dieser Saison sein …« Sie bedeckte ihr Gesicht mit beiden Händen.
»Gesprungen? Du meinst, mit dem Fallschirm?«
Paula nickte. Sie hatte die Hände immer noch vor dem Gesicht. Dann ließ sie sie langsam sinken und blickte an Marie vorbei auf etwas, das nur sie sehen konnte. Der Regen klopfte an die Scheibe, das Holzfeuer knackte im Herd, und hin und wieder rüttelte der Wind an den alten Fenstern.
»Und wenn er es überhaupt nicht ist? Ich meine, wer hat ihn identifiziert, Paula? Eine Verwechslung vielleicht …«
Paula schüttelte den Kopf. »Nein, keine Verwechslung«, flüsterte sie.
»Oh Gott, oh Gott«, war alles, was Marie sagen konnte, und dann noch einmal »oh Gott«. Nach einer Weile, als das Unfassbare in ihrem Kopf langsam begann Gestalt anzunehmen, sagte sie: »Wie kann denn so etwas passieren? Ich meine, ich erinnere mich, wie Erik sagte …«
»… dass Fallschirmspringen sicherer ist als Reiten.« Paulas Stimme war kaum noch zu hören.
Marie kehrte in Gedanken zurück zu einem Tag im Oktober. Sie sah Erik vor sich, groß und schlaksig, wie er in seinem Haus an der Dielentür stand, den Springeroverall unter dem Arm, zum Aufbruch bereit. Um seine Lippen spielte sein typisches Lächeln – ein Ausdruck von Ironie und Verschmitztheit. Auch Sommerkorn war an jenem Tag dabei gewesen, und sie erinnerte sich, dass die beiden Männer noch eine Weile übers Fallschirmspringen gesprochen hatten. Es war auch die Rede von einem Reserveschirm gewesen, das fiel ihr nun wieder ein. Mit gerunzelter Stirn sah sie Paula an, die blicklos und blass auf ihrem Stuhl kauerte. Schon hörte sie sich selbst reden, und noch während sie ihre Frage formulierte, kam sie sich töricht und hilflos vor.
»Aber … was war mit dem Reserveschirm?«
Und da begann Paula zu weinen, lautlos zuerst, die Tränen rannen über das Gesicht in einem steten Strom, und aus ihrer Kehle drang bald ein seltsamer Laut, den Marie im ersten Moment gar nicht mit Paula in Verbindung brachte, denn es klang wie das Wimmern eines verendenden Tieres. Sie schluchzte auf, und das Schluchzen steigerte sich zu einem Ringen nach Luft. Marie legte die Arme um Paula, und so blieben sie eine Weile: Marie, die von Krämpfen geschüttelte Paula haltend. Als das Schluchzen ein wenig abebbte, führte sie Paula ins Wohnzimmer, wo sie sie aufs Sofa bettete und zwei Decken über sie breitete. Einen Moment lang stand Marie da und betrachtete Paula. Sie fühlte sich unglaublich hilflos. Was sollte sie tun, was konnte sie tun? Wärme, dachte sie, zunächst braucht sie Wärme, und so lief Marie in die Küche und brühte Tee auf und holte die rote Wärmflasche. Als sie zurück ins Wohnzimmer kam, klapperte Paula mit den Zähnen und atmete schwer. Hyperventilierte sie etwa? Marie fühlte Panik in sich aufsteigen. Konnte man an einem Schock sterben? Eines nach dem anderen, eines nach dem anderen, betete sie sich selbst vor. Zuerst die Wärmflasche. Sie legte sie Paula an die Füße und setzte sich neben die Freundin, nahm sie in den Arm und hielt den bebenden Körper, der immer dramatischer nach Luft schnappte. Konnte man auf diese Weise ersticken? Marie wurde immer deutlicher, wie hilflos sie war, und nur mit größter Mühe gelang es ihr, ihre Angst zu unterdrücken. Da fielen ihr die Tropfen ein, die sie vor kurzem, als sie selbst knapp dem Tod entronnen war, von einer Polizistin verabreicht bekommen hatte. Irgendwann hatte sie das braune Fläschchen doch in ihren Rucksack gesteckt; es musste noch dort sein. Sie lief in die Diele, holte den Rucksack hervor, kramte darin herum, und tatsächlich, da war es. Sie ließ Wasser in ein Glas laufen, tat einige Tropfen hinein und setzte sich wieder zu Paula.
»So, das trinkst du jetzt.« Mit einer Hand stützte sie die Freundin, mit der anderen Hand hielt sie das Glas an ihre Lippen. Das Wasser schwappte über, doch schließlich gelang es Marie, Paula dazu zu bewegen, einen Schluck zu trinken. Dann noch einen. Und langsam, ganz langsam – es war fast ein Wunder – ließ das Beben und Zähneklappern nach, und Paula wurde ganz schlaff und sackte aufs Kissen. Marie stellte das Glas ab und zog die Decke enger um Paula. Sie musste jetzt einen klaren Gedanken fassen, tun, was in so einem Fall zu tun war. Die Kinder, richtig, was war mit ihnen?
»Wo sind Anna und Leni?«
»Bei einer Freundin. Ich bin sofort hierhergefahren. In Frau Traubingers Wagen … Meiner ist in der Werkstatt.« Die Stimme versagte ihr.
»Das heißt, sie wissen es noch nicht.« Oh Gott, dachte Marie, was war das alles entsetzlich, und sie fühlte wieder Panik in sich aufsteigen. Sie durfte gar nicht daran denken, wie die Kinder reagieren würden, wenn sie erführen, dass ihr Papa … Marie schluckte. Sie betrachtete Paula, die mit weit aufgerissenen Augen ins Leere starrte.
»Wann hast du es erfahren?«
»Ich … Als ich nach Hause kam. Ein Zettel klebte an der Tür. Von der Kripo. Ich sollte anrufen. Zuerst dachte ich, es sei was mit den Kindern. Aber die Nummer … Es war die der Polizei Ravensburg …« Paula drehte den Kopf ein wenig zur Seite, ihre Lider flatterten. Sie sieht so müde aus, dachte Marie, so müde und so schutzlos.
»Weiß es Andreas schon?«
Paula schüttelte fast unmerklich den Kopf, ihre Augen waren geschlossen. Ihre Atemzüge wurden langsamer, ruhiger. Marie erhob sich vorsichtig und sagte leise: »Ich ruf ihn an.«
Aber Paula reagierte nicht, und Marie wusste nicht, ob sie ihre Worte überhaupt gehört hatte.
☺
Seit ER da ist, ist alles besser. Wenn ich früher eine richtige Antwort auf eine schwierige Frage gab, haben alle gestöhnt, fick dich, Klugscheißer, der schon wieder, kann der nicht einmal seine verdammte Schnauze halten! Sie haben gefeixt und dumme Geräusche gemacht. So dass ich mich irgendwann nicht mehr gemeldet habe. Selbst wenn die Lehrer mich aufrufen und die Antwort richtig ist – und das ist sie immer –, grunzen sie oder machen sonst was Dämliches. Doch seit ER da ist, ist alles anders. Denn ER ist selbst klug. Und ER sagt, die Besten müssen sich zusammentun und diesen Augiasstall ausmisten, in den die Welt sich verwandelt hat. ER liebt die griechische Mythologie. Da herrschte noch Klarheit, sagt ER. Und wenn nicht, dann hat man sie kurzerhand wiederhergestellt.
*
Es war kurz nach halb elf, als sie Sommerkorns Wagen vor dem Haus vorfahren hörte. Er war blass, und an Wangen und Kinn hatten sich dunkle Schatten gebildet. Wie anziehend er ist, dachte Marie wie immer, wenn sie ihn sah, ein wahrer Heathcliff, es stand ihm, sich nicht zu rasieren. Gleich darauf schämte sie sich für diesen Gedanken, der in diesem Moment so unpassend war.
Paula war inzwischen eingeschlafen, und so gingen sie in die Küche, schlossen die Tür und setzten sich einander gegenüber, gerade so, wie Marie und Paula einander zuvor gegenübergesessen hatten. Sommerkorns Blick lag auf seinen Händen, die vor ihm auf der Tischplatte ruhten.
»Ich konnte nicht früher, ich komme direkt vom Friedhof. Sie haben dort einen toten Jungen gefunden.«
Er sah sie an, mit dem Blick, der sie schon auf dem Schulhof gefesselt hatte. All die Jahre, schoss es ihr durch den Kopf, all diese Jahre, die ich fort war. Und nun bin ich wieder da. Sie atmete tief durch und hörte ihn weitersprechen.
»Ich habe mit dem Kollegen aus Ravensburg gesprochen. Erik ist gegen sechzehn Uhr mit ein paar anderen Springern ins Flugzeug gestiegen und wie immer als Letzter gesprungen. Aus irgendeinem Grund ist weder der Haupt- noch der Reserveschirm aufgegangen. Er ist praktisch ungebremst nach unten gerast.«
Sommerkorn verstummte abrupt und rieb sich das Gesicht mit den Händen. Stille machte sich breit, die Küchenuhr tickte überlaut, das Feuer knackte. Und wie schon zuvor rüttelte der Wind an den Fenstern, als forderte er Einlass.
Marie starrte ins Leere. Plötzlich erschien ihr alles unwirklich. Sie hier in der Küche mit Sommerkorn, Paula im Wohnzimmer. Und Erik tot. Zerschmettert. Erik, der in den Tod gerast war. Es war wie in einem fürchterlichen Film, einem Actionthriller, einem von der Sorte, die von Effekten lebten. So etwas geschah doch nicht wirklich! Bald würden sie aufwachen, ein Regisseur käme herein und würde »Schnitt« sagen.
»Ich kann es nicht fassen«, sagte Sommerkorn und riss Marie aus ihren Gedanken. Er schüttelte stumm den Kopf und blickte ausdruckslos auf die Tischplatte.
»Möchtest du etwas trinken?«, fragte Marie. »Tee?«
Sie betrachtete ihn, und für einen flüchtigen Moment schauten sie einander direkt an. Marie dachte daran, welcher Albtraum für sie gerade erst zu Ende gegangen war. Ein Psychopath hatte sie in seine Gewalt gebracht, und es war ihr wie durch ein Wunder gelungen, ihn zu überwältigen. Paula und deren Bruder Andreas Sommerkorn, den sie bei sich nur Sommerkorn nannte, hatten ihr unermüdlich beigestanden in den schlimmsten Wochen ihres Lebens. War das wirklich erst kürzlich geschehen? Ihr kam es vor, als begleite dieser Albtraum sie schon ein halbes Leben. Und jetzt das. Paulas Welt in Scherben. An die beiden kleinen Mädchen, die nun ohne Vater aufwachsen würden, durfte sie gar nicht denken! Ganz egal, wie viel Zeit vergehen würde, es würde nie wieder gut werden. Nie wieder.
»… nicht ausgelöst hat, aber das werden die Untersuchungen klären.«
Marie sah auf. »Wie bitte? Entschuldige, ich habe gerade … Was sagtest du?«
»Jeder Fallschirm ist mit einem Öffnungsautomaten ausgestattet, der in Notfällen in einer bestimmten Höhe, gewöhnlich bei 225 Metern, automatisch den Reserveschirm öffnet.«
»Du meinst, wenn etwas mit dem Hauptschirm nicht stimmt, gibt es immer noch einen Reserveschirm, und der öffnet sich automatisch, wenn der Springer ihn nicht manuell öffnet?«
»Ja. Aber bei Erik hat dieser Sicherungsautomat aus irgendeinem Grund versagt.«
*
Sommerkorns Frühstück bestand aus einem Becher Kaffee, der nicht besonders gut schmeckte und den er auf der Autobahn nach Leutkirch trank. Er hatte eine kurze und unruhige Nacht hinter sich und würde heute etwas später zur Direktion fahren, denn zunächst war er mit einem von Eriks Fallschirmspringerkollegen auf dem Flugplatz verabredet. Der Mann würde ihm hoffentlich ein paar Fragen beantworten können.
Das monotone Geräusch der Scheibenwischer, die alle paar Sekunden den Nieselregen von der Windschutzscheibe wischten, wirkte beruhigend, beinahe einschläfernd. Während die Reifen über den Asphalt zischten und die spätherbstliche Landschaft wie hinter einem Schleier an ihm vorüberzog, wanderten Sommerkorns Gedanken wieder zu Paula. Seine Schwester. Nie zuvor hatte er sie so gesehen. So matt und – apathisch. Selbst im schwachen Schimmer, den der Lichtschein aus der Küche auf ihr schlafendes Gesicht geworfen hatte, war Sommerkorn die wächserne Blässe aufgefallen. Als sei sie selbst schon tot. Wie gut, dass Marie jetzt da war, dass jemand außer ihm da war, der sich um sie und die Kinder kümmern konnte.
Über die Ausfahrt Leutkirch verließ Sommerkorn die Autobahn. Der Parkplatz des nahen Flugplatzgeländes war leer. Nur der Regen war zu hören, der auf den Asphalt prasselte, stetig und traurig, wie auch das ganze Gelände einen traurigen Eindruck machte. Sommerkorn stellte den Motor ab und stieg aus. Er tat ein paar Schritte um die Halle herum. Das Tor war geschlossen, kein Mensch war zu sehen. Wie ein verlassener Jahrmarkt, dachte er und setzte sich wieder in den Landrover. Nach wenigen Minuten war die Scheibe komplett beschlagen, und so hörte er den anderen Wagen, bevor er ihn sah. Sommerkorn kurbelte das Fenster hinunter und entdeckte einen Jeep, aus dem ein Mann ausstieg. Das musste er sein – Jojo.
Die beiden Männer gaben sich schweigend die Hand, Jojo bedeutete Sommerkorn mit einer Geste, ihm zu folgen. Er sperrte die Halle auf und steuerte auf einen separaten Raum zu.
»Kaffee?«
Sommerkorn nickte. »Gern.«
Der Mann stellte zwei Tassen in einen Automaten, ein Sirren war zu hören und kurz darauf reichte er Sommerkorn eine Brühe, die kaum besser schmecken würde als der Coffee-to-go von heute Morgen. Jojo tat zwei Stück Zucker in seine Tasse und lehnte sich an die Wand. Er blickte ausdruckslos zu Boden.
»Wir können das alle nicht fassen. Erik war ein Profi, er hatte mehr als zweitausend Sprünge.«
Sommerkorn nickte.
»Ich habe keine Ahnung vom Fallschirmspringen. Über eine Sache habe ich allerdings nachgedacht: Ich weiß, dass jeder Springer einen Haupt- und einen Reserveschirm hat, und dass der Reserveschirm, wenn der Hauptschirm nicht gezogen wird, in einer bestimmten Höhe automatisch geöffnet wird.«
»Korrekt. Das Cypres hat nicht ausgelöst.« Der Mann verzog keine Miene.
»Das Cypres?«
»Der Sicherungsautomat.«
»Und wie kommt das?«
»Das ist eine gute Frage, die einerseits leicht, andererseits schwer zu beantworten ist. Passen Sie auf: Jeder erfahrene Springer ist für seinen Sicherungsautomaten selbst verantwortlich. Bevor man springt, muss man a) kontrollieren, ob er aktiviert ist, und b), auf welche Höhe er eingestellt ist.«
»Das Cypres richtet sich also nach der geografischen Höhe der Landschaft, in der gesprungen wird?«
»Jep. – Ich kann es mir nur so erklären, dass Erik vergessen hat, das Cypres umzustellen. Denn sehen Sie: Zwei Wochen vor dem Sprung waren wir in Cagliari, das liegt auf nur vier Metern über dem Meeresspiegel. Wenn Erik dort gesprungen wäre, hätte das Cypres sicher korrekt ausgelöst.«
»Sie glauben also, dass Erik vergessen hat, diesen Öffnungsautomaten auf die aktuelle Höhe hier in Leutkirch einzustellen?«
Jojo nahm einen Schluck von seinem Kaffee, sah Sommerkorn kurz an und senkte wieder den Blick.
»Kann’s mir nur so erklären. Allerdings …«
»Allerdings?«
»Das ist bei einem so erfahrenen Springer etwas seltsam.«
»So seltsam, dass es nie vorkommt?«
»Nein, nein, solche Sachen passieren. Routine kann ja auch zu Schlamperei führen. Und wenn einer beim Fallschirmspringen etwas falsch macht, dann sind die Folgen eben gravierend. Insgesamt gesehen passiert dennoch ziemlich wenig.«
»Also kommt es sozusagen fast nie vor, dass ein erfahrener Springer vergisst, den Sicherungsautomaten auf die richtige Höhe einzustellen?«
»Doch, doch. Vor ein paar Jahren in Höxter zum Beispiel. Dann dieser Politiker, Möllemann, der ist beim Cypres-Check nochmal rausgegangen – angeblich, um ein Glas Wasser zu holen. Er wollte wohl die gegenseitige Kontrolle umgehen.«
»Wollen Sie damit sagen …«
»… irgendwie erinnert sich niemand richtig. Aber alle, die mitgeflogen sind, sind sich ganz sicher, dass sie Eriks Cypres nicht kontrolliert haben. Wissen Sie, ich habe die ganze Nacht darüber nachgedacht …«
»Ja?«
»Es ist schon möglich, dass Erik das Cypres absichtlich nicht umgestellt hat.«
»Aber warum hätte er denn so etwas tun sollen?«
Jojo zuckte die Achseln, schüttelte stumm den Kopf und trank den letzten Schluck aus seiner Tasse. Sommerkorn betrachtete den Mann. Aus ihm würde er nicht mehr herausbekommen. Warum hätte Erik so etwas tun sollen? Er hatte doch keinen Grund. Oder etwa doch?
☺
Ich war bei IHM zuhause! ER hat ein echt cooles Zimmer, so eines habe ich noch nie gesehen. Keine Rockbands oder Sportler an den Wänden, kein Chaos, keine leeren Büchsen, kein Müll. ER sagt: Die Ordnung der Welt fängt bei jedem Einzelnen an. Das ganze Haus ist super und riesig. Die haben einen Riesenpool, einen Riesengarten. ER sagt, so etwas kann jeder haben. Man muss es nur zulassen. Wir müssen daran arbeiten, die Welt zu dem Ort zu machen, den wir haben wollen.
Und ER hat Mut. Neulich am Bahnhof hat er so einem Typen, der doppelt so breit war wie ER – aber alles Muskeln –, seine weggeworfene Kippe wiedergegeben. »Du hast was verloren!« Ihn kotzen die ganzen Chaoten an, hat er gesagt. Und die Erde wäre ohne sie besser dran.
*
Am späten Vormittag ging bei der Polizeidirektion Friedrichshafen eine Vermisstenanzeige ein, die ein wenig Licht ins Dunkel bringen und die Identität des Toten vom Friedhof klären sollte. Seltsamerweise wurde die Anzeige nicht von Angehörigen des Verschwundenen aufgegeben, sondern von einer Lehrerin des Karl-Maybach-Gymnasiums in Friedrichshafen. Tatsächlich stellte sich wenig später heraus, dass es sich bei dem Toten um den siebzehnjährigen Leander Martìn handelte, der die zwölfte Klasse des Karl-Maybach-Gymnasiums besucht und der mit seinen Eltern in Kressbronn-Berg gewohnt hatte. Die Klassenlehrerin, Studienrätin Rosemarie Bärlach, die Leander Martìn in Deutsch und Geschichte unterrichtet hatte, war verwundert gewesen über die unentschuldigte Abwesenheit des Schülers. Sie hatte Leanders Freunde befragt, die allesamt keine Auskunft geben konnten und ebenso verwundert waren wie Bärlach selbst. Nach Rücksprache mit zwei weiteren Lehrern und dem erfolglosen Versuch, die Eltern zu kontaktieren, entschied sie, die Angelegenheit der Polizei zu melden.
Als die Identifizierung des Toten durch die Lehrerin seine Identität bestätigte, gelang es der Polizei auch, die Eltern ausfindig zu machen. Der Vater, der einen Posten in einer der oberen Etagen bei Tognum innehatte, befand sich gerade auf einer Geschäftsreise in den USA, die Mutter auf einem dreiwöchigen Wellnessurlaub auf Gran Canaria. Die darauffolgende Inaugenscheinnahme des Leichnams durch den Vater, der mit dem nächsten Flug nach Hause kam, brachte die endgültige Bestätigung. Was bei der Rückkehr des Vaters für einige Verwirrung sorgte, war die Tatsache, dass sich eines der Fahrzeuge der Martìns nicht wie erwartet in der Garage des Anwesens in Kressbronn-Berg befand. Der schwarze Porsche Cayenne wurde daraufhin zur Fahndung ausgeschrieben und noch in derselben Nacht auf dem Betriebsparkplatz der ZF in der Nähe des Bodenseecenters sichergestellt.
Der Anruf des Gerichtsmediziners erreichte Sommerkorn kurz nach der Morgenbesprechung, als er – den Kopf voll mit imaginären Stichpunkten einer To-do-Liste in Sachen Dönerbudenbrände – auf dem Weg in sein Büro war. Dr.Fassbinder war ein Mann, den Sommerkorn noch während des Studiums an der Polizeihochschule in Villingen-Schwennigen fürchten gelernt hatte und den er inzwischen, nach vielen Jahren, mit einem Gefühl der Belustigung, aber auch des Befremdens betrachtete. Unbestritten war, dass Dr.Fassbinder nicht nur als kleiner König in seinem Reich regierte, sondern auch eine Koryphäe auf seinem Gebiet war. Dass seine Scherze oftmals auf Kosten anderer gingen und er Schwierigkeiten hatte, andere Meinungen neben seiner eigenen gelten zu lassen, war eine Begleiterscheinung, die man in Kauf nehmen musste und die ihm bei Sommerkorn den Beinamen »Richter über Gott und das Universum« eingebracht hatte. So war Sommerkorns Stimme gedämpft, als er Fassbinders Nummer auf seinem Display aufleuchten sah.
»Sommerkorn.«
»Warum hat man mich nicht gerufen?«
»Auch Ihnen einen schönen guten Morgen!«
Statt den Gruß zu erwidern, bellte der Professor in die Leitung: »Vielleicht hätte der Herr Kommissar die Güte, mir zu erklären, was ihn bewogen hat, einen gewöhnlichen praktischen Arzt die Leichenschau vornehmen zu lassen!«
Sommerkorn unterdrückte ein Seufzen.
»Wir sind davon ausgegangen, dass es sich um ein Drogenopfer handelt. Aus Ihren Worten schließe ich, dass dem nicht so ist?«
»Da haben Sie ja diesmal ins Schwarze getroffen!«
»Was haben Sie mir also mitzuteilen?«, fragte Sommerkorn betont förmlich, obwohl er atemlos auf Fassbinders Antwort wartete. Wenn der Professor persönlich sich herabließ, ihn anzurufen, dann konnte das nur eines heißen …
»Leander Martìn. Die Obduktion hat ein paar bemerkenswerte Details ergeben.« Es folgte eine Kunstpause, dann fügte er hinzu: »Die Arbeit für Sie bedeuten.«
Sommerkorn blies Luft aus. Er wusste, dass er jetzt nachfragen musste, sonst würde sich das Schweigen ewig hinziehen. Fassbinder konnte wie eine eigenwillige Primadonna sein, die jede Gelegenheit wahrnahm, die Spannung zu erhöhen.
»Na, dann lassen Sie mal hören«, sagte Sommerkorn und fühlte sich wie ein Schaf. Er hasste es, den Erwartungen anderer zu entsprechen. Gab es nicht anderswo eine Oper, in der Fassbinder auftreten konnte? Warum konnte der Mann nicht einfach seine Arbeit machen und ihnen dann das Ergebnis mitteilen!
»Wir haben es hier, wie gesagt, mit mehreren bemerkenswerten Details zu tun. Erstens: Der Junge war bis zum Rand abgefüllt mit Gamma-Hydroxy-Buttersäure.«
»K.-o.-Tropfen.«
»Richtig, junger Freund. Da wird man doch gleich wieder wach, nicht wahr?«
»Niemand bringt sich K.-o.-Tropfen selber bei. Also können wir davon ausgehen …«
»… dass es ein anderer war, der ihm das Mittel verabreicht hat.«
»Aber das ist noch nicht alles, nehme ich an?«
»Er ist nicht daran gestorben. In seinen Atemwegen haben wir Fasern gefunden, und nach eingehender Analyse kann ich sagen, dass der junge Mann mit einem Kissen erstickt wurde.«
Sommerkorn brauchte einige Sekunden, bis die Nachricht bei ihm angekommen war. Also hatten sie es nicht mit einem Drogentoten zu tun. Er hatte es geahnt. »Als wollte jemand ganz sichergehen«, murmelte er ins Telefon.
»Zweitens: Die Verletzungen an den Handgelenken haben wir genau untersucht, wenngleich mir ziemlich bald klar war, worum es sich handelt.«
Es folgte eine Definition, die gespickt war mit lateinischen Begriffen und die Sommerkorn wie eine lauwarme Brise an sich vorüberziehen ließ. Endlich hörte er den Mediziner das aussprechen, was relevant war.
»Stacheldraht. Seine Handgelenke wurden mit Stacheldraht gefesselt. Und das ist vor seinem Tod geschehen.«
Sommerkorn dachte nach. Der Junge war also vor seinem Tod gefoltert worden.
»Tja, der Fachmann staunt. Und der Laie wundert sich«, sagte Fassbinder.
Sommerkorn, der ahnte, wen Fassbinder in diesem Kontext für den Fachmann und wen für den Laien hielt, verzog gelangweilt das Gesicht.
»Eine Sache allerdings konnten wir nicht zu unserer Zufriedenheit lösen.« Bei wichtigen Entdeckungen verwendete Fassbinder stets den Singular, bei sich abzeichnenden Schwierigkeiten oder gar Problemen kannte er nur den Plural.
»Ja?«
»Im Mund des jungen Mannes fanden wir einen Zettel, ein Stück Papier. Es ist noch erkennbar, dass etwas von Hand darauf geschrieben wurde. Den Text konnten wir jedoch nicht mehr rekonstruieren. Wir haben ihn ans LKA weitergegeben. Vielleicht haben die mehr Erfolg. Im Moment wissen wir lediglich, dass es drei Wörter gewesen sein müssen.«
Ein toter Junge, der misshandelt worden war und in dessen Mund ein Zettel steckte. Mit was für einer Geschichte hatten sie es hier zu tun?
☺
ER sagt, wir müssen etwas tun, wir dürfen nicht zulassen, dass alles untergeht, dass unsere schöne Heimat im Dreck versinkt. Und irgendwie hat ER recht.
In Marmorsälen
Die Jugendlichen richten sich weder nach den sogenannten »traditionellen« Werten, wie Treue, Pflichtgefühl etc.; noch haben sie »modernere« Werte umfassend an deren Stelle gesetzt (…). Vielmehr mixen sich die Jugendlichen einen »Wertecocktail« aus unterschiedlichen Werten, welche am besten zu ihren individuellen Plänen zur Lebensgestaltung zu passen scheinen.
(Prof. Dr.Mathias Albert: Jugend ohne Perspektive? –
»Alte« Werte und »neuer« Generationenkonflikt.
Das Familienhandbuch des
Staatsinstituts für Frühpädagogik (IFP),
www.familienhandbuch.de, 4.9.2007)
Später konnte Paula sich nicht erinnern, wie sie die Zeit danach durchgestanden hatte. Die Tage nach dem Sprung. Irgendwie war sie nach Ulm gekommen, ach ja, Andreas hatte sie gefahren, um dort mit den Polizisten zu sprechen. Sie hatte Erik identifiziert. Nein, nicht daran denken, fort mit diesen Gedanken! Sie hatte es den Kindern gesagt, mit Hilfe von Andreas und Marie. Sie wusste nicht, was sie erwartet hatte, Schreien und Toben, Weinen, Schluchzen. Aber nichts von alledem hatte sich ereignet. Die Kinder hatten seltsam gefasst reagiert. Zwei blasse schmale Kindersoldaten, war es ihr durch den Kopf geschossen. Anna hatte sie angeschaut, aus großen kugelrunden Augen, aus denen keine Träne fiel, nur die Kleine, Leni, hatte ein wenig geweint, Marie hatte sie in den Arm genommen, sie gehalten und auf sie eingeredet, beruhigende Worte gemurmelt, sinnlose beruhigende Worte, die für sie, Paula, ohne Bedeutung geblieben waren. Etwas später hatten die Mädchen sich im Wohnzimmer vor dem Kamin niedergelassen, in ihren Kisten mit den Barbiesachen gewühlt, ein Haus für die Puppen eingerichtet und mit dem rosa Barbiemobil eine Runde durchs Zimmer gedreht. Paula hatte einfach nur dagesessen, auf dem geschmackvollen beigen Sofa in dem geschmackvoll eingerichteten Wohnzimmer mit dem Boden aus Carrara-Marmor und hatte abwechselnd von einem Kindergesicht zum anderen und durch die großen Fenstertüren in den parkähnlichen Garten geschaut, auf die sorgfältig zurechtgestutzten Besenbäumchen, an denen unzählige Lichtchen funkelten. Sie hatte den Totensonntag nicht abgewartet. Mit ihrer Adventsdekoration. Hatte es nicht erwarten können, die kleinen Lichter im Garten zu sehen. Und nun war Erik tot.
Sie erinnerte sich nicht mehr, wie sie an jenem Abend ins Bett gelangt war, was mit den Kindern geschehen war. Das Einzige, woran sie sich wirklich erinnerte, war das Nichts. Wie sie am nächsten Tag aufgewacht war und das dicke graue Licht durch den Spalt zwischen den Vorhängen in Maries Wohnzimmer gesickert war. Wo sie auf dem Sofa in einen von albtraumhaften Bildern zerrissenen Schlaf gesunken war. Sie hatte zugesehen, wie dieser Spalt heller geworden war, wie er angefangen hatte zu leuchten. Wie der Spalt zwischen den beiden Flügeln einer Tür, die in den Himmel führt, hatte sie gedacht, sich aber nicht mehr erinnern können, warum sie das so traurig machte, so unendlich traurig und müde. Irgendwann hatten sie und Marie die Kinder von der Freundin abgeholt, bei der sie übernachtet hatten. Die Mutter der Freundin hatte etwas zu ihr und zu den Kindern gesagt, das sie nicht verstanden hatte, weil es keine Bedeutung für sie gehabt hatte. Dann waren sie nach Hause gefahren, in ihr Haus, Marie und die Kinder und sie. In dieses Haus, in dem jetzt nur noch drei Menschen lebten. Da waren’s nur noch drei, hatte sie gedacht und nichts anderes mehr denken können. Frau Traubinger, ihre Perle seit nunmehr sechs Jahren, war gekommen und hatte versucht, sie aus ihrem Kokon herauszuholen, aber Paula hatte die Haushälterin nur stumm und ausdruckslos angesehen. Warum wollte diese Frau, dass sie aufstand? An der Schlafzimmertür hatten die Kinder gestanden, schmal und sehr gerade, und wieder hatten sie ihre kleinen Soldatengesichter aufgehabt. Aber gesprochen hatten sie nicht.
*
Das Haus der Martìns war ein Palast aus Eis. Wo er hinsah Stein, Stahl und Glas. Während Sommerkorn im Wohnzimmer auf die Eltern des Jungen wartete, fror er, obgleich es in dem Raum warm war. Er trat an die Fensterfront und sah hinaus. Von hier aus konnte man den halben See überblicken, so weit, bis sich der Blick in der Ferne verlor. Ganz links sah man den Pfänder, darunter Lindau, das im Nebel steckte wie eine Geisterstadt, und direkt unter ihm verschmolzen die Silhouette der alten Bäume und Häuser, die das Ufer wie eine Borte säumten, mit dem blaugrauen Dunst. Dort unten in Nonnenhorn wohnte Pfefferberg, ein wohlhabender Mann, der im Besitz diverser Häuser war. Er hatte ihn unlängst bei den Ermittlungen in Maries Fall kennengelernt und der Mann hatte Sommerkorn angeboten, ihm bei der Suche nach einer neuen Bleibe behilflich zu sein. Pfefferberg selbst bewohnte die altehrwürdige Villa neben dem Nonnenstein, und Sommerkorn hatte ihn einmal dort besucht. Was für ein friedlicher Anblick, die Welt eingesponnen in einen Dornröschenschlaf, ging es Sommerkorn durch den Kopf. Die Stille hier oben, hinter der überdimensionalen Glasfront schien grenzenlos.
Sommerkorn hörte ein Geräusch, die Tür wurde geöffnet, und Irene Martìn betrat den Raum. Es war auf den ersten Blick zu erkennen, dass sie es sein musste; die Ähnlichkeit zwischen dem Jungen und ihr war verblüffend. Das gleiche makellose Gesicht, die gleichen fein geschwungenen Lippen, die hellleuchtenden Augen. Und die Blässe. Sie ist fast so blass wie ihr toter Sohn, dachte Sommerkorn. Aber irgendetwas an ihr passte nicht ins Bild, ohne dass Sommerkorn wusste, was es war. Wortlos ging sie auf ihn zu und wortlos streckte sie ihm die Hand entgegen.
»Ich möchte Ihnen mein tiefes Beileid aussprechen«, sagte Sommerkorn und empfand seine Worte hilflos und hölzern, in der Gewissheit, dass nichts, was er hier sagte, in irgendeiner Form etwas ändern würde.
Irene Martìn nickte stumm. Einen Augenblick lang standen sie sich gegenüber, bis von der Tür her erneut ein Geräusch zu hören war und Roberto Martìn den Raum betrat. Auch er reichte Sommerkorn die Hand und stellte sich ans Fenster. Wie Darsteller in einem Bühnenstück, schoss es Sommerkorn durch den Kopf. Sie betreten die Bühne und jeder stellt sich an den für ihn vorgesehenen Platz.
»Haben Sie Neuigkeiten, Herr Kommissar?«
Sommerkorn und Roberto Martìn waren sich zum ersten Mal begegnet, als er und Barbara den Mann zur Identifizierung des Jungen begleitet hatten. Bereits bei dieser Gelegenheit war Sommerkorn die absolute Beherrschtheit des Mannes aufgefallen. Martìn war um die fünfzig. Der perfekte Senior Manager im maßgefertigten Anzug in Arbeitgeberblau, und mit einem Gesicht, das auch jetzt so neutral wirkte, dass Sommerkorn wirklich nichts von ihm ablesen konnte. Wenn er diesen Mann bei einer Geschäftsbesprechung getroffen hätte, wäre der Ausdruck kein anderer gewesen.
»Ja.« Sommerkorn nickte und beschloss, nicht lange drumherum zu reden. »Es gibt Erkenntnisse, über die ich mit Ihnen reden möchte.« Muss, dachte Sommerkorn. Ich möchte es eigentlich nicht.
»Ihr Sohn ist nicht, wie zunächst angenommen, an der Überdosis eines Rauschmittels gestorben. Bei der Obduktion wurde festgestellt, dass er K.-o.-Tropfen im Blut hatte, und zwar eine erhebliche Dosis. Allein diese Dosis hätte vielleicht ausgereicht, ihn zu töten. Dazu ist es jedoch nicht gekommen: In den Atemwegen Ihres Sohnes haben wir Fasern gefunden, die leider keinen anderen Schluss zulassen, als dass er erstickt wurde.«
Sommerkorn sah von Martìn zu dessen Frau, die beide regungslos verharrten. Wie von einem Zauber zu Stein verwandelt, dachte Sommerkorn. Dann sah er, wie Frau Martìn die Hände auf den Mund presste. Eine Weile lang sagte keiner ein Wort. Martìn schluckte hörbar, die Frau stand mit beiden Händen vor dem Mund da, als hätte ein grausamer Gott die Zeit angehalten. Die Stille wurde unwirklich.
Irene Martìn brach schließlich das Schweigen: »Jemand hat ihn getötet?« Ihre Stimme war kaum vernehmbar, nur ein Flüstern.
»Ja.«
»Wer?«
»Das versuchen wir herauszufinden.« Sommerkorn ließ einige Sekunden verstreichen, sah sich um. Die Villa der Martìns war, so konnte man wohl sagen, aus einem Guss und, wie Sommerkorn fand, übertrieben modern und ziemlich kahl eingerichtet. In dem großen luftigen Raum standen zwei ausladende graue Sofas im rechten Winkel zueinander, ein mit demselben Stoff bezogener Hocker brach die Symmetrie auf und stand schräg dazu vor einem Tisch aus Plexiglas. An einer Wand war ein Flachbildschirm von der Größe einer bescheideneren Kinoleinwand befestigt. An einer anderen Wand hing ein etwa zwei mal drei Meter großes Bild, das Paula sicher als avantgardistisch oder sonstwie bezeichnet hätte, bei dem Sommerkorn jedoch nur der Begriff »grau« einfiel. Das Auffälligste war, dass weit und breit kein persönlicher Gegenstand zu entdecken war. Keine Vase, kein Nippes, kein Buch. Nichts. Sommerkorn räusperte sich.
»Ich muss Ihnen einige Fragen stellen und würde mir auch gerne Leanders Zimmer ansehen.«
Die Frau nickte abwesend, Martìn erwiderte Sommerkorns Blick mit der ihm eigenen Undurchdringlichkeit.
»Hatte Ihr Sohn mit jemandem Schwierigkeiten, vielleicht Streit?«
Martìn zögerte. »Nein.«
»Vielleicht wäre es sinnvoll, wenn ich mir zuerst das Zimmer ansehe.«
Sommerkorn folgte Martìn auf eine verglaste, lichtdurchflutete Galerie, die zu einer Treppe nach unten führte. Vor einer Tür im unteren Stock blieb Martìn stehen. Offenbar wollte er etwas sagen, überlegte es sich jedoch anders und öffnete die Tür.
Sommerkorn wusste nicht, was er erwartet hatte, ob er überhaupt etwas erwartet hatte, und falls ja, dann am ehesten wahrscheinlich das übliche Chaos aus Postern, Verstärkern, elektronischem Schnickschnack und CDs, das männliche Pubertierende gewöhnlich um sich herumdrapierten. Auf jeden Fall nicht ein solches Zimmer. Nicht diese mustergültige Ordnung.
»Haben Sie das Zimmer in letzter Zeit verändert?«
Martìn zuckte mit den Achseln und sagte: »So sieht es … sah es immer aus.«
»Es ist ungewöhnlich ordentlich für das Zimmer eines Siebzehnjährigen.«
»Das mag sein.«
Sommerkorn ließ den Blick über die Möbel streifen. An der Fensterfront stand ein massiver Schreibtisch aus dunklem Holz, wie er vor fünfzig Jahren im Arbeitszimmer eines wohlhabenden Schuhfabrikanten gestanden haben mochte, darauf lagen ein Füller und ein Stapel weißes Papier. Irgendetwas fehlt hier, dachte Sommerkorn. Noch einmal ließ er den Blick schweifen.
»Hatte Ihr Sohn keinen Computer?«
»Doch, einen Laptop.« Martìn tat ein paar Schritte auf den Schreibtisch zu und zog die Schubladen eine nach der anderen auf.
»Eigentlich müsste das Notebook hier sein …«
»Wie sieht es aus, dieses Notebook?«
»Es ist ein Apple MacBook, ziemlich neu. Silbergrau, eines von diesen flachen Dingern, die kennen Sie sicher …«
Sommerkorn machte sich Notizen.
»Wissen Sie, ob sonst noch etwas fehlt?«, fragte er.
Martìn warf einen Blick in den Raum. Zum ersten Mal wirkte er ratlos, beinahe verloren.
»Nein. Sonst fehlt nichts.«
Gegenüber dem Bett befand sich eine Schrankwand mit Schiebetüren, die Sommerkorn aufschob; auch hier eine soldatische Ordnung. Das Einzige, was ein wenig Aufschluss über die Vorlieben des Bewohners geben konnte, waren die über dem Bett angebrachten, säuberlich gerahmten Fotos, viele von Panzern und Jagdflugzeugen aus dem Zweiten Weltkrieg. Auf einigen erkannte Sommerkorn Leander.
Das Zimmer war riesig für ein Jugendzimmer, es hatte etwa vierzig Quadratmeter. So hatte links des Eingangs eine altmodische Sitzgruppe aus dunklem Leder Platz. An der Wand über dem Sofa hing eine historische Deutschlandkarte.
In die Stille hinein sagte Martìn: »Leander hat sich sehr für Geschichte interessiert. Speziell für den Zweiten Weltkrieg.«
»War er ein guter Schüler?«
»Er war …«, Martìn hielt inne, und Sommerkorn hatte den Eindruck, dass ihm die Stimme versagte. Der Mann holte tief Luft. »Leander war ein ausgezeichneter