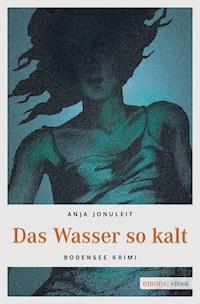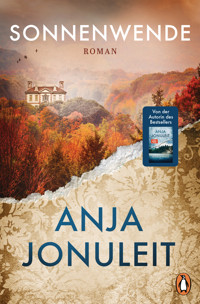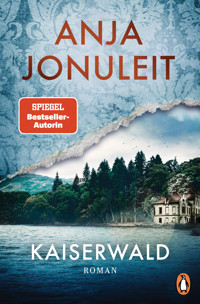9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dtv Verlagsgesellschaft
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
»Doch das Allerschlimmste war der Verrat.« Jahrhundertsommer 1959 in Grösitz: Die Freundinnen Ruth und Christa genießen die letzten Ferien vor dem Abitur. Eines Abends lernen sie beim Baden im nahe gelegenen Bach Erich kennen, der zu einer Gruppe freikirchlicher Christen gehört, die dort ihre Zelte aufgeschlagen hat. Eine willkommene Abwechslung für die Mädchen, die fortan viel Zeit im Zeltlager verbringen. Aber dann verlieben sich alle beide in Erich. Und das Schicksal der Freundinnen ändert sich für immer – auf dramatische Weise. Kennen Sie bereits die weiteren Romane von Anja Jonuleit bei dtv? »Der Apfelsammler« »Das Nachtfräuleinspiel« »Novemberasche« »Herbstvergessene« »Die fremde Tochter« »Das letzte Bild«
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 541
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Anja Jonuleit
Rabenfrauen
Roman
dtv Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG, München
Und der Rabe rührt’ sich nimmer,
sitzt noch immer, sitzt noch immer
auf der bleichen Pallas-Büste
überm Türsims wie vorher;
und in seinen Augenhöhlen
eines Dämons Träume schwelen,
und das Licht wirft seinen scheelen Schatten
auf den Estrich schwer;
und es hebt sich aus dem Schatten
auf dem Estrich dumpf und schwer
meine Seele – nimmermehr.
E.A. Poe, Der Rabe
»Man kann nicht einfach frei sein.«
Rita Albers, Villa Baviera, Chile
Für meine Tochter Marlene,
die mich auf der Reise
nach Chile begleitet hat
Die Handlung und die Personen dieses Romans sind frei erfunden. Dabei beruht das Geschilderte auf wahren Ereignissen, über die der historische Überblick und das Quellenverzeichnis im Anhang Aufschluss geben.
RUTH. Lange Zeit habe ich geglaubt, dass Erich an allem schuld war. Dass all das ohne ihn niemals geschehen wäre. Ich habe meinen Hass auf ihn genährt, und erst jetzt, da ich kurz vor meiner großen Reise stehe, frage ich mich manchmal, ob nicht auch er ein Opfer war. Wie Christa und all die anderen, die wie die Lemminge auf den Abgrund zusteuerten. Obwohl es mir schwerfällt, die mit den Knüppeln als Opfer zu sehen.
In diesen Nächten, wenn die Erinnerungen mich nicht schlafen lassen, schleicht sich noch ein anderer Gedanke in meinen Kopf, einer, der noch viel unangenehmer ist und den ich gern sofort wieder loswerden würde: dass es in Wirklichkeit meine Schuld war. Wenn ich in jenem Sommer nicht auf Erichs Einladung eingegangen wäre, wenn ich nicht zu den Freikirchlern gegangen wäre, wenn ich Christa gegenüber von Anfang an offen gewesen wäre, ja wenn … Doch das Allerschlimmste war der Verrat. Mein Verrat an ihr und die Tatsache, dass ich ihr einfach nicht die Wahrheit gesagt habe damals. Denn vielleicht hätte die Wahrheit ja alles verändert.
Und Anne weiß noch immer von nichts. Wenn ich sie ansehe, dann steht auf ihrem Gesicht ein großes Fragezeichen. Warum willst du dorthin, ans andere Ende der Welt? Warum musst du so dringend jemanden wiedersehen, den du vor fünfzig Jahren das letzte Mal gesehen hast? Noch dazu, wo dieser Mensch vielleicht sogar bald nach Deutschland kommen wird? Ich kann es ihr nicht verdenken, dass sie mich für eine starrköpfige alte Frau hält, eine von der Sorte, die sich plötzlich in einen völlig abwegigen Gedanken hineingebohrt hat, in eine Idee, die für niemanden nachvollziehbar ist. Aber Anne weiß ja von nichts. Und deswegen kann sie auch nicht begreifen, dass ich einfach nicht mehr warten kann. Ich muss dorthin, muss nach Südamerika, muss ihr zuvorkommen. Es ist mir unangenehm, dass Anne mich für starrköpfig hält. Aber ich lasse sie in dem Glauben. Soll sie ruhig denken, dass ich die Strapazen dieser Reise um einer alten Freundschaft willen auf mich nehme, oder meinetwegen auch, weil es mir um Aufarbeitung geht. Allein bei dem Wort werde ich schon rot. Dieser ganze Befindlichkeitskrempel. Und am Ende darf jeder ganz ehrlich sagen, was er dabei empfindet! Ja, das glauben heute alle: dass man die Vergangenheit nur hinter sich lassen kann, wenn sie ausgesprochen wurde. Ein für alle Mal der Welt präsentiert, am besten vor laufender Kamera. Als ob durch die Quatscherei irgendeine Art von Gerechtigkeit hergestellt oder eine Wiedergutmachung erfolgen kann! Wie soll das gehen? Was soll das helfen? Wo die Täter längst tot oder uralt sind. Und die Verletzten so tief verletzt, dass es nie wieder gut werden kann. Er hat ihnen ihr Leben gestohlen, es ist weg! Man kann es ihnen nicht zurückgeben. Warum also diese Jahre wieder herauszerren und die Scheinwerfer darauf richten? Ich glaube nicht, dass die Welt je wird begreifen können, was dort geschehen ist. Und so wird vielleicht Anne auch nie erfahren, warum es mich in Wirklichkeit dorthin treibt. Was ich getan habe.
TEIL I BREITAUSDIEFLÜGELBEIDE
Der Tag, an dem Anne sie das erste Mal sah, war ein Sonnabend und sollte später als der heißeste Tag des Jahres 2010 in die Wetterchronik eingehen. Was insofern eine Rolle spielte, als sie sich durch die Hitze überhaupt erst kennenlernten. Durch die Hitze und ihre gerade überstandene Malaria Tertiana. Jedenfalls war Anne an diesem Nachmittag »auf Totengang« unterwegs. Um Abschied zu nehmen von Maximilian, der in diesem Rekordsommer im Teufelsmoor an Unterkühlung gestorben war.
Als die Hiobsbotschaft sie erreicht hatte, war Anne gerade auf einer Forschungsstation im Kongo gewesen, und ob es nun mit dieser Nachricht zusammenhing oder nicht: Am Nachmittag desselben Tages hatte sie Schüttelfrost bekommen, sich dann die Seele aus dem Leib gewürgt und am Ende dermaßen geschwitzt, dass sie in ihrem eigenen Schweiß hätte davontreiben können. Was folgte, waren Tage im Vakuum, die auch im Nachhinein nicht gefüllt werden konnten. Die Zeit war für immer verloren in einem Fiebertraum, in dem die Nachricht von Maximilians Tod umherwaberte und verschmolz mit den Lauten des Urwalds, den Rufen der Bonobos und den Erinnerungen an die Raben, die nun, im Lichte der Ereignisse, etwas Dunkles, Unheilvolles an sich hatten. Später dann dachte sie, dass – so seltsam es auch klingen mochte – die Malaria sie davor bewahrt hatte zu sterben, einfach so, nach dem Anruf ihrer Mutter.
»Maximilian ist tot«, hatte Ruth ohne viel Federlesens gesagt. Er sei im Moor umgekommen, beim Beobachten der Raben. Ruth war schon immer der Meinung gewesen, die Dinge verbesserten sich nicht, nur weil man drum herumredete. Anne jedoch hatte in dem Moment nur denken können, dass das alles gar nicht sein konnte. Sie hatte doch noch mit ihm telefoniert, während er auf dem Weg zu seinem Unterstand war. Dann fiel ihr etwas anderes ein: Sie musste die Letzte gewesen sein, mit der er gesprochen hatte. Unmittelbar danach war die Malaria gekommen und hatte einen Kokon des Vergessens um sie gesponnen, in dem nichts mehr zählte als der Körper, der gebeutelt wurde von immer neuen Schüttelfrostattacken und Fieberschüben.
Wie im Fieber fühlte sie sich auch heute, was aber an der Hitze lag, die sich schon jetzt, am Vormittag, zwischen den Heidesträuchern festgesetzt hatte. Auch war sie insgesamt noch recht klapprig auf den Beinen, und weil der Weg weit war und man nicht anders an das Moor herankam, war sie mit dem Rad unterwegs. Von der Striezelbrücke aus warf sie einen sehnsüchtigen Blick ins Wasser, das, wie sie wusste, auch im heißesten Sommer so kalt blieb, dass man nach einer Weile das Gefühl hatte, in einer Gefriertruhe zu stehen. Eine Vorstellung, die ihr im Moment durchaus reizvoll erschien.
Auf der anderen Seite bog sie links ab und folgte dem Weg am Fluss entlang. Zu Beginn hatte sie noch recht flott in die Pedale getreten, doch als nun das Alte Gut auftauchte, endete die Fahrbahnbefestigung und Anne blieb mit den Reifen im feinen weißen Sand stecken. Möllersand, so hatte Annes Oma Käthe den immer genannt. Sie stieg vom Rad und blickte die Allee entlang, die direkt auf das Backsteingebäude zuführte. Schön, dachte sie, und konzentrierte sich ganz auf das Grün der Linden vor der roten Ziegelfassade. Jeder Gedanke, der nichts mit Maximilian zu tun hatte, war ihr willkommen. Sie zwang sich, das Haus genau anzusehen: die weißen Sprossenfenster, die Freitreppe, die zu der schweren schwarzen Eingangstür führte, das Rosenspalier. Seit sie als Kind hier am Flussufer entlanggestrichen war, hatte das Haus so ausgesehen, hatte still und unberührt dort gestanden, wie immun gegen den Fortgang der Zeit. Einmal, vor Jahren, hatte Ruth etwas von Erbstreitigkeiten erzählt, ein Familienzwist, der den Verkauf des Anwesens unmöglich machte. Wie lange konnte sich so etwas hinziehen?
In dem Moment hörte Anne ein Kind rufen. Sie drehte sich um, sah den Weg auf und ab, konnte aber niemanden entdecken und begriff, dass die Stimme von dem Grundstück kommen musste. Hatten Kinder das Gelände als Abenteuerspielplatz für sich entdeckt, so wie sie früher, wenn sie in den Ferien bei ihrer Großmutter zu Besuch gewesen war? Sie ging weiter, vorüber am Gutshaus, und warf einen Blick auf das Verwalterhäuschen, das ein Stück vom Haupthaus entfernt nach hinten versetzt lag.
Da erst bemerkte sie die Veränderung.
Wo früher nichts als Wiese gewesen war, blühten nun Phlox und Fingerhut und gelbe Rosen, während im anderen Teil Tomaten und Stangenbohnen ganz offensichtlich prächtig gediehen. Auch das Häuschen, das früher vernachlässigt gewirkt hatte, sah nun anders aus: Haustür und Fensterläden leuchteten in warmem Gelb und auf der Wäscheleine hing weiße Bettwäsche. Einen Augenblick lang glaubte Anne, sie sei ins Werbefernsehen geraten, so schön und makellos war das Bild, das sich ihr präsentierte. Und um alles noch ein bisschen unwirklicher zu machen, hörte sie plötzlich wieder die Kinderstimmen, ein Rufen: »Alma, Alma!«, und dann bogen zwei kleine Mädchen in geblümten Sommerkleidern um die Hausecke. Ihre dunklen Zöpfe flatterten im Lauf, die Größere von beiden reckte eine rote Plastikschaufel in die Höhe, die die andere wohl unbedingt haben wollte. Anne musste lächeln und einen kurzen Moment lang vergaß sie sogar, warum sie hier unterwegs war, und dachte daran, was das für ein wunderbarer Ort für eine Familie war. Gebannt sah Anne den beiden Mädchen nach, wie sie über die Wiese rasten, bis die Ältere, offenbar Alma, in den Sandkasten sprang und die Schaufel fallen ließ. Triumphierend stürzte sich die Kleine darauf und umklammerte die Schaufel mit beiden Händen, als befürchte sie, dass die andere ihr die wertvolle Beute gleich wieder wegschnappen würde.
Anne blieb noch eine Weile stehen und sah ihnen zu, wie sie im hellgelben Sand saßen. Die Kleine begann sofort mit Kuchenbacken, die Ältere ließ Sand durch ihre Finger rieseln. Anne konnte den Blick nicht von ihnen nehmen, bis die Flügeltür zur Terrasse aufschwang und eine blond gelockte Frau in einem wadenlangen Rock herauskam, einen Wäschekorb im Arm. Sie stutzte, als sie Anne entdeckte. Anne lächelte ihr zu und rief einen Gruß. Peinlich, dachte sie, wie muss das aussehen? Eine neugierige Tante, die sich vor lauter Gucken nicht einkriegt. Die Frau erwiderte Annes Nicken knapp und begann die Laken von der Leine zu nehmen.
Erst später verstand Anne, was sie am Anblick dieser Kinder und auch der Frau so berührt hatte: Es war geradeso gewesen, als hätte sie durch ein Fenster in die Vergangenheit geschaut, in eine Zeit, in der sie selbst auf Fotos mit gezacktem Rand zu sehen war, im Album ihrer Großmutter.
Während Anne weiter durch den Sand pflügte, zweifelte sie daran, ob es so clever gewesen war, das Rad mitzunehmen. Sie hatte vergessen gehabt, wie diese Heidewege waren. Am Ende stellte sie das Rad einfach am Wegrand ab und ging zu Fuß weiter, die Rose für Maximilian in der schwitzigen Hand.
Nach einer halben Stunde verfluchte sie ihren Eigensinn. Warum hatte sie das unbedingt heute machen müssen, bei vierzig Grad im Schatten! Eine Schnapsidee, aber so war sie nun mal. Schon immer hatte sie die Beschränkungen, die der Körper ihr auferlegte, nicht akzeptieren wollen. Wenn sie nur an die Nächte dachte, in denen sie ihre Doktorarbeit geschrieben hatte: literweise Kaffee, den sie am Ende hatte runterwürgen müssen. Oder an ihre Forschungsreisen in den Kongo, wo sie sich noch jedes einzelne Mal mit Malaria infiziert hatte, was sie jedoch nie davon abgehalten hatte, wieder und wieder dorthin zu reisen, um ihr Bonobo-Projekt durchzuführen. Und das war auch etwas gewesen, das Maximilian und sie gemeinsam hatten: das Hinausschieben der eigenen Grenzen, der Versuch, sie zu sprengen. Und nun war Maximilian tot, letztlich gerade aus diesem Grund.
Die Stille auf dem Moor war bedrückend und die Hitze der in einem Backofen nicht unähnlich. Irgendwann lichtete sich der Bewuchs, die Bäume wurden spärlicher und Anne schleppte sich von Schatteninsel zu Schatteninsel, wo sie jedoch nie länger stehen bleiben konnte, weil die Gnitzen im Schatten deutlich angriffslustiger waren als in der prallen Sonne. Sie konnte es sich also aussuchen: entweder von einem Hitzschlag niedergestreckt zu werden oder als quaddelübersätes Monster zurückzukehren. Wobei sie da in der letzten Nacht ja auch schon einiges abbekommen hatte. Sie musste an Hermann Löns denken, der als Dichter und wegen seiner politischen Einstellung zwar umstritten, als Naturkenner aber herausragend gewesen war. Löns war vor nichts zurückgeschreckt, auch nicht davor, sich bei seinen Beobachtungen bis zum Hals im Schlamm zu versenken.
Es dauerte etwa zwei Stunden, bis Anne sich eingestehen musste, dass sie die Stelle nicht finden würde. Die Rose in ihrer Hand ließ den Kopf hängen und auch sie selbst fühlte sich inzwischen ziemlich dehydriert. Noch einmal holte sie die topografische Karte aus der Tasche. Ihrer Meinung nach war sie in der richtigen Richtung unterwegs, wobei die Informationen, die sie von der Feuerwehr bekommen hatte, nicht allzu präzise gewesen waren. Schließlich war man hier nicht erpicht darauf, noch eine Leiche aus dem Moor zu bergen.
Am Ende gab sie auf. »So scheitert der Kongoforscher an der Heide«, fluchte sie mit zusammengebissenen Zähnen vor sich hin und nahm den letzten Schluck aus ihrer Wasserflasche. Sie hatte das Teufelsmoor unterschätzt. Außerdem hatte sie angenommen, deutlichere Spuren der Rettungsaktion zu entdecken. Wahrscheinlich war der Leichnam per Helikopter geborgen worden. Wie sonst hätte das gehen sollen, wo kein befahrbarer Weg näher als ein paar Kilometer an das Moor heranführte?
Der Gang zurück wurde zur Tortur. Sie hatte nun wieder Kopfschmerzen, und als sie das Moor endlich hinter sich gelassen und ihr Rad erreicht hatte, kam auch diese fiebrige Zittrigkeit zurück, die sie längst überwunden geglaubt hatte.
Glücklicherweise war da schon der Zufahrtsweg zum Alten Gut. Ab dort würde sie wieder radeln können. Schwerer und schwerer wurden ihre Schritte. Auf einmal hatte sie das Gefühl, sich hinlegen zu müssen, hier und jetzt. Sie ließ das Rad an eine Birke sinken, holte ein Stofftaschentuch aus ihrer Hosentasche und wischte sich den Schweiß vom Gesicht. Sie brauchte ganz dringend frische Luft. Sie atmete ein und wieder aus. Ein und aus. Aber die Luft war nicht frisch, ganz und gar nicht, sie war stickig und heiß. Auf einmal fühlte Anne, wie ein Taumel sie erfasste, sie sah nur noch weiße Watte, griff nach dem Zaun und sank langsam zu Boden.
RUTH. Er hieß also Erich, und als ich ihn das erste Mal sah, hantierte er mit irgendwelchen Stangen und einer Zeltplane. Ich bemerkte ihn von Weitem, über den Fluss hinweg, und er fiel mir wohl deshalb auf, weil er fast einen ganzen Kopf größer war als die anderen und als Einziger kein Hemd trug. Die Striezel war nicht besonders breit, an manchen Stellen wirkte sie wie ein zu groß geratener Bach, aber für uns Dorfkinder war sie die einzige Abkühlung inmitten einer Landschaft aus Heide und Moor.
Auf jeden Fall war der 16. Juli 1959 ein Donnerstag. Ich weiß das deshalb so genau, weil die Sommerferien immer an einem Donnerstag begannen, was diesen Tag zu etwas Besonderem machte. Nie raschelte der Sommerwind in den Birken geheimnisvoller, nie duftete das Geißblatt süßer als am ersten Tag der großen Ferien. Und obgleich schon dieser erste Tag mit Kartoffelkäfersammeln begonnen hatte, fühlte ich das Versprechen der unbeschriebenen Tage, die vor uns lagen.
Ostern hatte für Christa und mich das letzte Schuljahr im Auguste-Viktoria-Gymnasium begonnen. Doch anders als Christa hatte ich seit April nichts getan, als zu pauken, wohingegen sie sich wie ein typischer Backfisch verhielt – sich in Tagträumen verfing und im Zug scheue Blicke mit den Jungen tauschte. Allerdings hatte auch ich langsam die Nase voll vom Lernen, und so würde ich nach dem Abitur nicht studieren, obwohl meine Mutter alles dafür getan hätte, um mir ein Studium zu ermöglichen. Auch wenn sich das im Rückblick als ein kurzsichtiger Wunsch herausstellte, damals erschien mir nichts attraktiver, als so schnell wie möglich eigenes Geld zu verdienen und von hier fortzukommen, fort aus dem winzigen Heidedorf, aus der Beschränkung und Engstirnigkeit, die so ein kleiner Ort zwangsläufig mit sich bringt. Im nächsten Frühjahr würde ich weggehen, in den Harz, und dort eine Ausbildung zur Biologisch-technischen Assistentin machen. Christa wollte mich begleiten, was aber weniger ihrem Interesse für diesen Beruf entsprang als dem Wunsch, in meiner Nähe zu sein. Mir zuliebe hatte sie in diesem Jahr sogar auf ihren alljährlich anstehenden Ferienbesuch bei ihrer Berliner Cousine verzichtet.
Noch heute erinnere ich mich an diesen Sommer in einer fast scharfkantigen Klarheit: An die gebeugten Rücken, die sengende Sonne, die von einem erbarmungslos blauen Himmel knallte und uns den Schweiß aus allen Poren trieb. An den Strohhut, unter dem sich die Hitze staute wie in einem Treibhaus. An die Kartoffelkäfer mit ihren harten Panzern und Beinen, die träge über meine Fingerkuppen kratzten. Und an die Larven, die sich glibberig anfühlten und unsere Hände gelb färbten.
Seit Wochen lastete die Hitze wie eine bleierne Glocke über der Landschaft, und als das Licht gegen Mittag einen schmutzig gelben Ton annahm, dachte ich für einen kurzen Moment, dass diese Glocke sich nun auf uns herabsenken und uns alle ersticken würde. Dann aber verzogen sich die Schwefelwolken und die Sonne kam wieder hervor, heißer und gnadenloser als zuvor. Als wenig später der kleine Hans einfach so umkippte, entließ Bauer Schlüpke uns an diesem Tag zwei Stunden früher als sonst.
Auf direktem Wege liefen Christa und ich nun zu unserer Badestelle an der Striezelbrücke, und wie immer trottete Hans uns in einiger Entfernung hinterher. »Der lütte Hans« war der Nachbarsjunge, der in der Baracke neben unserer wohnte. Er war wie ein kleiner Bruder für mich und sah das selbst wohl auch so. Und wie das mit kleinen Brüdern so ist, wollte ich ihn nicht überall dabeihaben, doch meist klebte er wie eine Klette an mir. An mir und an Christa.
Unsere Schritte fühlten sich schwer an, als wir die Brücke erreichten, eine verwitterte Holzbrücke, die wir zu unserem Sprungturm auserkoren hatten. Doch als wir kurz darauf ins Wasser sprangen – wie immer ohne uns vorher abzukühlen – und prustend wieder auftauchten, war all unsere Müdigkeit mit einem Schlag verflogen. Nach einer Weile hatte ich genug, kletterte wieder auf die Brücke und legte mich auf das sonnendurchwärmte Holz, das nach Sommer und Sonne und Freiheit duftete. Ich blinzelte und unter meinen halb geschlossenen Lidern sah ich Hänschen, der auf der anderen Seite der Brücke saß und eine selbst gebastelte Angel ins Wasser hielt. Ich grinste matt. Hänschen hatte sein Lebtag lang noch keinen Fisch gefangen. Aber darauf kam es ihm wohl auch gar nicht an. Unter mir plantschte Christa im Wasser und ich wusste, dass sie gleich versuchen würde, mich nass zu spritzen. Wie immer wunderte ich mich über sie. Wie konnte meine Freundin, die doch um vieles zarter schien als ich, so völlig unempfindlich sein gegenüber der Kälte, die der Fluss auch jetzt, im Hochsommer, noch speicherte. Eine Weile lang döste ich vor mich hin und lauschte den vereinzelten Rufen der Männer, die drüben am anderen Ufer mit den Zeltstangen hantierten. Als ich das leise Vibrieren von Christas Schritten auf der Brücke spürte, murmelte ich: »Was die da drüben wohl für Zelte hinstellen?«, und betrachtete träge das orangerote Muster, das die Sonne auf meine geschlossenen Lider malte.
»Die sind für unsere Kirchenfreizeit«, antwortete eine mir unbekannte Stimme. Ich fuhr hoch, verschränkte die Arme vor der Brust und sah in die Augen des blonden Hünen, den ich eben noch auf der anderen Seite beobachtet hatte. Inzwischen hatte er sich allerdings ein Hemd übergezogen.
»So …«, sagte ich gedehnt und versuchte mir meine Überraschung nicht allzu sehr anmerken zu lassen. Stattdessen meinte ich betont keck: »Und von welcher Kirche, wenn ich fragen darf?«
»Von verschiedenen Freikirchen«, antwortete er. Ich muss ihn daraufhin verständnislos angeglotzt haben, denn er lächelte auf einmal ziemlich breit und fügte erklärend hinzu: »Adventisten, Pfingstler, Baptisten und andere … dorthin kommen Christen, die Gott begegnen wollen. Menschen, die nach dem rechten Weg suchen.«
»Und Sie suchen mit?«
»Jetzt nicht mehr«, antwortete er, ohne auf meinen scherzhaften Tonfall einzugehen.
In dem Moment betrat Christa die Brücke und ich löste meinen Blick aus dem des Fremden. Ich sah Christa näher kommen, eine Silhouette im Nachmittagslicht, und auch der Fremde drehte sich zu ihr um. Kurz darauf stand sie direkt vor uns und ich bemerkte das Wasser, das wie Glas gewordenes Licht von Christas Schultern perlte. Ein kurzes Schweigen entstand, und um es zu brechen, sagte ich: »Ich heiße Ruth.«
Der Mann lächelte wieder. »Ruth … die Freundin. Die, die in Tagen des Verfalls gottesfürchtig bleibt …«
Aus dem Konfirmandenunterricht erinnerte ich mich vage daran, dass es so etwas wie ein Buch Ruth gab, darauf musste er wohl anspielen. Ich nickte möglichst allwissend, und um das Bibelthema schnell wieder loszuwerden, deutete ich vage in Christas Richtung und sagte: »Und das ist …«
»Christa Bellstedt«, fiel Christa mir ins Wort und ich sah, wie sie den Mann regelrecht anstarrte. Sie schien überhaupt nichts anderes mehr wahrzunehmen als ihn. Er reichte uns die Hand, zunächst Christa und dann mir. »Ich bin Erich«, sagte er, und erst da, während er seine Hand eine Spur zu lange in meiner liegen ließ, erst in diesem Moment verstand ich, was Christa gesehen hatte: Ich bemerkte sein dichtes, blondes Haar, das ihm in einem kühnen Schwung in die Stirn fiel. Sah das kantige Kinn und wie das blasse Blau seines Hemdkragens sich an seinen braunen Hals schmiegte.
Im Augenwinkel registrierte ich, wie Christa sich abrupt bückte und nach ihrem Handtuch griff. Der Mann, der Erich hieß, löste seine Hand aus meiner.
»Tja …«, sagte er, »dann will ich auch mal ins Wasser … diese Hitze!«
»Ja«, antwortete ich und versuchte Christas Blick einzufangen, doch sie hatte sich abgewandt. Mit energischen Bewegungen rubbelte sie sich die Arme trocken und zog rasch ihr Kleid über den nassen Badeanzug. Sie schien es auf einmal sehr eilig zu haben.
Der Mann hatte sich schon ein paar Schritte entfernt, als er sich noch einmal umdrehte.
»Ach, Ruth und Christa …«
Ich sah, wie Christa in ihrer Bewegung innehielt.
»Wenn ihr am Samstag Zeit habt, dann kommt doch vorbei. Wir beten zusammen, machen Musik und Spiele … und verhungern sollt ihr auch nicht!«
Wieder suchte ich den Blick von Christa, die mir immer noch auswich. Ich dachte daran, dass ich vormittags wieder Kartoffelkäfer sammeln und später die Wäsche machen und fürs Abitur büffeln musste. Und doch antwortete ich, ohne zu zögern: »Vielen Dank für die Einladung. Wir kommen gerne.«
Februar 1961. Amerigo Vespucci, wenn das nicht nach weiter Welt klingt! Da steh ich an Deck, eingequetscht zwischen den anderen Passagieren. Ein bisschen Angst hab ich, dass das Schiff umkippen könnte, wo doch alle auf der einen Seite herumstehen. Aber jetzt legt es ab und es ist, als würden sie davongleiten, die Winker am Kai. Ein Gewimmel aus Händen ist das, auf der Stelle flatternde Vögel! Für mich winkt keiner. Aber wer hätte das auch sein sollen, schließlich ist das Genua und niemand kennt mich hier. Andererseits hätte es auch nichts geändert, wenn ich von Hamburg abgefahren wäre. Denn es wäre doch niemand gekommen, um mich zu verabschieden. Wenn du das tust, wenn du mit denen gehst, bist du die längste Zeit meine Tochter gewesen.
Der Wind zerrt an meinem Haar und ich trete hinter das Rettungsboot, wo ich mir das Kopftuch zurechtbinde. Dann geh ich wieder an die Reling, halte mein Gesicht in den Wind und schau nach vorn. So wie ich das von nun an immer tun werde! Ich beuge mich vor, um das Gefühl noch ein bisschen stärker werden zu lassen. Das alte Leben liegt hinter mir. Ich habe mit allem gebrochen. Einen Moment lang verschlägt mir dieser Gedanke den Atem. Doch gleich darauf steigt eine überschäumende Freude in mir auf und ich möchte die Arme nach oben reißen und es allen zurufen: dass ich die Liebe meines Lebens gefunden habe! Dort, am Ende der Welt, werde ich recht bald meinen geliebten Mann wiedersehen und wir werden endlich wieder alle zusammen sein. Wie ist es möglich, dass das Leben auf einmal so viel Glück für mich bereithält, nach dieser schweren Zeit? Und so muss und will ich nun alles dafür tun, es Gott zu danken und ihm ein Wohlgefallen zu sein.
Nein, leicht haben wir es nicht immer gehabt, in diesen letzten eineinhalb Jahren. Es gab Momente der Prüfung. Aber es ist, wie Onkel Paul sagt: Der Weg, der zum Leben führt, ist schmal und die Pforte eng. Drum werde ich auch alles dafür tun, den armen Menschen dort unten zu helfen, und mich ganz in die Gemeinschaft einbringen. Wenn ich nur an das Zeitungsfoto denke, das Magda mir gezeigt hat, von dem Erdbeben in Valdivia! Wer soll dort helfen, wenn nicht wir? Die vielen Toten. Tausende von Menschen sind bei dem Erdbeben umgekommen und so viele Überlebende haben noch immer kein Dach über dem Kopf. Vor allem um die Kinder will ich mich kümmern. Darum lerne ich, wann immer es geht, Spanisch. Außerdem bin ich ja nicht allein. Hier neben mir steht Magda und dort ist Resi mit den Kindern.
Gut, ja, Elfriede und Else sind auch dabei. Aber ich lass mir die Freude nicht verderben. Zumal Else, kaum dass sie das Schiff betreten hat, über der Kloschüssel hängt und sich die Seele aus dem Leib kotzt. Wie ich ihr das gönne! Mir ist bewusst, dass ich diesen sündigen Gedanken sofort nach der Schiffstour werde beichten müssen.
Aus weiter Ferne hörte Anne ein Tuscheln und Wispern und einen Moment lang fühlte sie sich wie im Elfenland. Dann öffnete sie die Augen und sah sie: Über ihr schwebten die Gesichter der beiden dunkel bezopften Mädchen und das Gesicht der blond gelockten Frau, die sie vorhin beim Wäscheabnehmen gesehen hatte. Alle drei sahen auf Anne herab und die Frau fühlte ihr den Puls.
»Was …«, nuschelte Anne, verstummte aber sofort, weil der Schwindel wieder stärker wurde.
»Kannst du aufstehen, wenn ich dich stütze?«
Anne nickte schwach. Sie rollte sich zur Seite und schaffte es irgendwie, sich mit Hilfe der Frau hochzustemmen. Wie ein schwankendes Schiff stand sie da und versuchte sich zu stabilisieren, während sie sich auf die Frau stützte. Langsam setzten sie sich in Bewegung, Schrittchen für Schrittchen.
Als sie ins Haus kamen, bugsierte die Frau sie auf ein Sofa, legte ihre Füße hoch und steckte ihr ein Kissen unter den Kopf. Anne blieb mit geschlossenen Augen liegen und verfluchte ihre Blödheit. Wie hatte sie bei dieser Hitze einen Zweistundenmarsch hinlegen können, so kurz nach einer auskurierten Malaria! Sie war noch ganz bei diesem Gedanken, als die Frau ihr ein großes Glas Wasser vor die Nase hielt.
»Trink das mal.«
Anne richtete sich halb auf und trank.
»Danke. Aber ich mach Ihnen Umstände.«
Die Frau entgegnete nichts, sondern betrachtete sie nur. Anne hatte nicht die leiseste Vorstellung, was die Frau wohl denken mochte. Auf ihrem Gesicht lag ein Ausdruck vollkommener Entspannung. Oder war es Reglosigkeit? Anne fiel in dem Moment absurderweise auf, dass das Gesicht dieser Frau aussah wie das einer Florentiner Madonna. Und dass es beinahe faltenfrei war. Noch nicht einmal Lachfältchen um die Augen hatte sie. Und doch schien die Frau nicht besonders jung zu sein. Aber vielleicht kam dieser Eindruck auch nur von den altbackenen Kleidern, in denen sie steckte.
»Bei dieser Hitze sollte man keine Fahrt ins Blaue unternehmen«, sagte die Frau jetzt und Anne ließ sich zurücksinken.
»Eine Fahrt ins Blaue … Das hatte ich nun wirklich nicht vorgehabt«, entgegnete sie matt. Sie glaubt also, ich hätte eine kleine Heidetour unternommen, bei gefühlten hundert Grad, dachte Anne und sah sich plötzlich mit den Augen der Frau: ihr erhitztes, sicher hochrotes Gesicht, das schweißverklebte Haar. Sollte Anne ihr sagen, was sie wirklich auf dem Moor gesucht hatte? Die Tatsache, dass sie hier auf diesem fremden Sofa lag und aus dem Glas dieser fremden Frau trank, gab Anne das Gefühl, irgendetwas erklären zu müssen. Und so sagte sie stockend: »Sie haben doch sicher von dem Mann gehört, der vor ein paar Wochen im Teufelsmoor umgekommen ist.«
Die Frau nickte, antwortete aber nicht darauf, sondern wandte sich stattdessen den Kindern zu und sagte: »Es ist Zeit für eure Musikstunde.«
»Dürfen wir nicht noch ein bisschen hierbleiben?«
»Es ist schon gleich sechs. Geht nach hinten und übt.«
Ohne ein weiteres Wort trabten die Kinder davon. Als wenig später Tonleitergefiedel durch die offene Tür klang, sagte Anne: »Er war mein Lebensgefährte. Ich wollte die Stelle suchen, wo er gestorben ist.«
Die Frau hielt Anne noch einmal das Glas hin. Als Anne schon nicht mehr damit rechnete, dass die Frau etwas darauf antworten würde, sagte die unvermittelt: »Der Rabenmann.«
Überrascht sah Anne zu ihr auf. »Sie kannten ihn?«
»Ja«, sagte sie schlicht. Und dann fügte sie völlig übergangslos hinzu: »Du musst etwas essen.« Sie drehte sich abrupt um und verschwand in der Küche. Anne sah ihr hinterher und trank das restliche Wasser aus. Dann nahm sie die Gelegenheit wahr, sich im Raum umzusehen. Die Möbel waren schlicht, nichts Überflüssiges stand herum. Ein Esstisch und vier Stühle aus Kiefer, eine Anrichte. Das Sofa, auf dem sie saß. Ein Röhrenfernseher, nicht besonders groß. Ein Bücherregal. An den Wänden hing ein einziges Bild, irgendwelche rötlichen Berge, Genaueres konnte Anne aus der Entfernung nicht erkennen. Der Raum war völlig gesichtslos, man hätte denken können, es handele sich um eine Ferienwohnung.
Das Gefiedel, das nun aus dem Hinterzimmer kam, hatte sich verändert. Die Aufwärmübungen hatten die Mädchen offensichtlich hinter sich gebracht und spielten jetzt erstaunlich gewandt. Geigenspiel – zumindest die Überei – hatte für Anne immer den Stempel der gequälten Seele. Zu gut erinnerte sie sich noch an die Jahre, in denen sie sich vergeblich abgemüht hatte, auch nur annähernd eine Melodie zustande zu bringen. Und so staunte sie nicht schlecht über diese Kinder, die vielleicht fünf und acht Jahre sein mochten. Sie lauschte noch immer ihrem leichten Spiel, als die Frau mit einem Tablett zurückkam. Als Anne sah, was darauf stand, rief sie überrascht: »Obstsuppe mit Grießklößchen? Ich wusste gar nicht, dass die noch einer kennt!«
Es war das erste Mal, dass Anne die Frau lächeln sah. Sie reichte ihr den Teller und Anne konnte nicht anders, als fasziniert daraufzustarren: auf die roten Backpflaumen und die Äpfel- und Birnenschnitze und die säuberlich arrangierten runden Klößchen.
»Sicher haben Sie das Rezept von Ihrer Oma!«
Plötzlich war das Lächeln verschwunden. Die Frau richtete sich auf, kerzengerade jetzt, und sagte nur: »Essen und Trinken hält Leib und Seele zusammen.«
Verwirrt wandte Anne den Blick ab und tauchte den Löffel in die Suppe. Und dann fiel ihr nichts anderes ein, als zu sagen: »Ich heiße übrigens Annemarie Westhoff. Aber alle nennen mich Anne.«
»Mein Name ist Renate«, entgegnete die Frau ein wenig steif und verschwand kurz darauf wieder in der Küche.
Während Anne die köstliche kalte Suppe in sich hineinlöffelte, verstärkte sich das verwirrende Gefühl von vorhin: die Frau im wadenlangen Rock mit der Lockenfrisur ihrer Großmutter, ihre seltsame Art zu sprechen, die nahezu perfekten Geigenklänge, die aus dem Nebenraum hereinwehten. Und die Obstsuppe, die Anne zuletzt vor über dreißig Jahren gegessen hatte.
Etwa um halb fünf kam der Mann. Anne hatte jemanden erwartet, der eine gewisse Ähnlichkeit mit den Mädchen aufweisen würde, die beide dunkelbraunes, fast schwarzes Haar hatten. Doch wie Renate war auch ihr Mann blond und genau wie Renate haftete auch ihm etwas Fremdartiges an, das Anne nicht recht begriff.
Er kam näher und Anne bemerkte, dass auf seinem Gesicht ein mildes Lächeln lag. »Na, das ist ja eine Überraschung: Da ist Besuch in der guten Stube!« Seine Stimme klang gut gelaunt und wie die seiner Frau auf eine altmodische Weise aufgeräumt. Und plötzlich wusste Anne, woran die beiden sie erinnerten, nicht nur vom Aussehen her, nein, vom ganzen Habitus her: an die Heinz-Rühmann-Filme, die sie als Kind bei ihrer Oma hatte gucken dürfen. Jetzt streckte ihr der Mann mit einer zackigen Geste die Hand entgegen und sagte: »Ich bin Horst. Und wer bist du?«
Wieder dieses Du. Anne drückte kurz seine Hand, murmelte: »Anne heiß ich«, während sie darüber nachdachte, wie das alles hier zusammenpasste. Die Fünfziger-Jahre-Pfadfinderstimmung und das offenherzige Du, mit dem die beiden sie ganz zwanglos ansprachen.
Als Renate das Zimmer betrat, wälzte sich Anne vom Sofa. »So«, ächzte sie. »Jetzt bin ich Ihnen aber lange genug auf den Wecker gegangen. Ich werd dann mal.«
Renates große blaue Augen hefteten sich auf Anne.
»Horst fährt dich.«
»Das ist wirklich nicht nötig. Ich hab’s nicht weit. Muss nur bis zur Sandstraße. Außerdem hab ich ja das Rad hier.«
Aber am Ende stieg Anne doch in den klapprigen Toyota, der in der Einfahrt parkte. Im Rückspiegel sah sie Renate, die mit wehendem Rock auf Annes Fahrrad saß und ihnen folgte. Als sich Anne am Ende der Sandstraße aus dem Wagen stemmte und Renate das Fahrrad an den Jägerzaun lehnte, bemerkte Anne, wie im Haus schräg gegenüber die Küchengardine ein Stück zur Seite geschoben wurde.
Etwas unbeholfen standen sie kurz darauf vor dem Jägerzaun, und als Anne erst Horst und dann Renate die Hand reichte, um sich noch einmal zu bedanken, sagte Renate unvermittelt: »Wenn du willst, zeig ich dir die Stelle im Moor.«
Anne winkte dem Toyota nach, wie er rückwärts aus der Sackgasse fuhr. Dann öffnete sie die Pforte, schob das Rad aufs Grundstück und betrachtete das kleine Haus. Die Baracke bei Tageslicht, dachte sie. Gestern bei ihrer Ankunft war es schon dunkel gewesen, sie hatte nach der achtstündigen Fahrt nur ihre Tasche und den Schlafsack aus dem Auto genommen und sich, nach einem flüchtigen Blick ins Schlafzimmer, wo sich Maximilians Bücher und allerlei Ausrüstungsgegenstände türmten, gleich aufs Sofa gebettet. Sie hatte unruhig geschlafen und war spät aufgewacht, mit einem zerschlagenen Gefühl. Mit dem Kaffeepott in der Hand war sie dann ins Schlafzimmer gegangen und hatte sich aufs Bett gesetzt und die Sachen betrachtet, die Maximilian mitgebracht hatte: Gaskartuschen, Isomatten, Heringe, zwei Schlafsäcke. Als sie später das Haus verlassen hatte, war sie so auf ihr Vorhaben fixiert gewesen, dass sie nichts weiter wahrgenommen hatte als den Rosenbusch, von dem sie die einzelne Blüte für Maximilian geschnitten hatte.
Nun aber blickte sie sich um. Das Häuschen sah aus wie immer, wenn sie nach längerer Abwesenheit hierherkam: Im Vorgarten wuchsen Gras und Girsch um die Wette und zwischen den Steinplatten, die zum Haus führten, hatte sich Löwenzahn angesiedelt. Sie wusste nicht, was sie erwartet hatte, säckeweise Tierfutter? Oder einen Berg vergammeltes Freibankfleisch? Jedenfalls nicht diese träge Sonntagsidylle, die sie an ihre Großmutter und Kindheitstage denken ließen. Sie ließ den Blick über die dunkelbraune Holzwand schweifen, über die weißen Sprossenfenster und fragte sich wieder einmal, wer dem hübschen Häuschen eigentlich diesen absurden Namen verpasst haben mochte. Baracke? Anne fand, es erinnerte eher an ein Ferienidyll. Möglicherweise war es bei dem Ausdruck um eine Art Abgrenzung gegangen, dachte sie plötzlich. Weil das Häuschen nach dem Krieg für »die Flüchtlinge« gebaut worden war – und Flüchtlinge brachte man schließlich in Baracken unter.
Auch Maximilian war in gewissem Sinne ein Flüchtling gewesen. »In meinem Sabbatjahr werde ich all das tun, was ich schon immer habe tun wollen.« Einen Teil davon hatte er dann auch realisiert. Zum Beispiel die Raben in freier Wildbahn beobachtet, ganz in Ruhe, ohne den Druck irgendeines Projekts im Hintergrund. Eigentlich Luxus. Dabei hatte er ein verletztes Rabenkind gefunden, um das er sich dann gekümmert hatte. Und weil Raben gesellige Vögel sind und Maximilian nun mal so war, wie er war, hatte er gleich einen zweiten beschafft, eine Voliere für die Herrschaften gebaut und beide Vögel versorgt, denn Raben können, einmal an Menschen gewöhnt, in Freiheit nicht mehr ohne Weiteres überleben.
Sie stellte das Rad in den Schuppen und öffnete die Heckklappe ihres Landrover, hievte den Koffer von der Ladefläche und zog ihn hinter sich her über den holprigen Plattenweg. Und da entdeckte sie die Spur im Gras. Sie ließ den Koffer los. Maximilian war seit vier Wochen tot, aber diese Spur hier sah frisch aus, es war ein regelrechter Trampelpfad.
Langsam folgte sie der Bahn ums Haus herum. Still und verlassen lag die Voliere da, die eine Hälfte im Schatten unter der alten Kiefer. Wie zu erwarten gewesen war, standen die Käfigtüren weit offen. Auch innen schoss das Unkraut in die Höhe, war durch die Kiesschüttung gedrungen, die Maximilian aufgebracht hatte. Sie ging näher heran. Dort unter der Kiefer, um den Stamm herum aufgereiht, standen noch die Näpfe, es waren vier – zwei Wassernäpfe und zwei Fressnäpfe. In zwei von den Näpfen war tatsächlich Wasser. Wie merkwürdig, wo es doch wochenlang nicht mehr geregnet hatte.
RUTH. Wir waren beide Außenseiter: ich das Flüchtlingskind aus Ostpreußen, Christa die Tochter der Selbstmörderin. Und wenn ich an jenen heißen Samstag im Sommer 1959 zurückdenke, dann möchte ich nur eines: die Zeit zurückdrehen vor jenen Nachmittag, als Christa dort stand, in ihrem braunen Rock und der weißen Sonntagsbluse, am Rand der Wiese, auf Frau Bottkes Fahrrad gestützt, und ihren Blick suchend über den Platz schweifen ließ – über ein paar Frauen in Schürzenkleidern, die in riesigen Töpfen rührten; über ein Mädchen mit langen Zöpfen, das Handtücher von einer Leine nahm. Erich war nirgends zu sehen. So wie überhaupt kein einziger Mann zu sehen war. Dafür drang aus dem größten Zelt eine Stimme, die wohl zu einem Prediger gehörte. An meiner Hand zerrte Hans, den wir in letzter Minute hatten mitnehmen müssen und der nun sein Recht einforderte.
»Wir wollten doch zum Baden!«
Zu Hause hatte alles so weit funktioniert, wie ich mir das vorgestellt hatte. Vormittags hatte ich auf dem Feld gearbeitet, war dann schnurstracks nach Hause geradelt, hatte die Wäsche erledigt, so schnell ich konnte. Doch gerade als ich die Laken auf die Leine gehängt hatte, kam Erna Bottke, Hänschens Mutter, die inzwischen wieder schwanger war, aus dem Nachbarhaus gewatschelt, im Schlepptau Gisela und Jutta, Hänschens kleine Schwestern, die mich mit ihren Schwarzkirschenaugen ins Visier nahmen. Über den Zaun hinweg rief Frau Bottke: »Ach, nehmt doch das Hänschen mit zum Fluss!«
Christa und ich wechselten einen Blick und ich beeilte mich zu sagen: »Das ist doch ein bisschen weit für den Kleinen … bei der Hitze bis zum Fluss gehen.« Das Letzte, was wir an diesem Tag gebrauchen konnten, war ein kleiner Junge, der hinterher herumerzählte, wo wir gewesen waren.
Doch wie immer, wenn es darum ging, den Jungen aus dem Weg zu räumen, wusste Frau Bottke Rat: »Fahrt doch mit den Rädern! Ihr kriegt meinen Drahtesel dazu, dann könnt ihr Hans auf den Gepäckträger nehmen.«
Im Dorf galt Frau Bottke als nicht ganz hasenrein. Böse Zungen behaupteten, dass ihr Mann, Hänschens Vater, weder ihr Mann noch Hänschens Vater gewesen war. Sie hatte fünf Kinder, lebte von der Stütze und war neuerdings mit einem vierschrötigen Kerl namens Ernst Stuck zusammen, den ich im Verdacht hatte, dass er Hans und auch die anderen Kinder in mehr oder weniger regelmäßigen Abständen durchprügelte.
Eine ganze Weile standen wir unentschlossen am Rand des Zeltplatzes herum, und obwohl uns keiner beachtete, fühlte ich mich unwohl. Doch gerade als ich sagte: »Lass uns lieber gehen«, wurde die Plane des großen Zelts zur Seite geschlagen und die Gottesdienstgemeinde strömte heraus. Allen voran ging ein Mann, der, obwohl nicht besonders groß, irgendwie zupackend wirkte. Wie die anderen Männer trug auch er ein Hemd mit aufgekrempelten Ärmeln. Dicht hinter ihm ging Erich. Schnell schaute ich weg, schließlich wollte ich auf keinen Fall den Eindruck erwecken, als hätte ich hier nach ihm Ausschau gehalten. Stattdessen beugte ich mich zu Hänschen herunter und sagte irgendetwas Belangloses zu ihm. Als ich mich wieder aufrichtete, entdeckte ich zu meiner Überraschung noch zwei andere bekannte Gesichter: Berta Löwe, die wie meine Mutter im Grösitzer Sägewerk von Christas Vater arbeitete und auch aus Ostpreußen stammte, und ihre Tochter Magda. Gerade wollte ich den beiden zuwinken, da sagte jemand hinter mir: »Rote Haare, Sommersprossen sind des Teufels Volksgenossen.«
Ich fuhr herum. Da stand der zupackend aussehende Mann und grinste schief an mir vorbei. Das hatte mir gerade noch gefehlt, dass sich jemand – womöglich in Erichs Nähe – über mein Aussehen lustig machte! Verstohlen sah ich mich nach Erich um und fand ihn unmittelbar hinter uns, wie er Stühle an einen der langen Esstische rückte. Hatte er die Bemerkung über mein rotes Haar gehört? Christa kicherte, und als ich mich gerade über sie ärgern wollte, ging der Mann vor Hänschen in die Hocke, strubbelte ihm durch das Haar und ich begriff, dass gar nicht ich gemeint gewesen war, sondern Hans, der ganz nah an mich heranrückte.
»Na, na, das ist doch kein Grund, sich hinter der großen Schwester zu verkriechen«, sagte der Mann und lachte. »Ich bin Onkel Paul. Und wer bist du?«
»Hans«, piepste Hans und ich sah, dass Christa sich plötzlich sehr aufrecht hielt, so wie wir das bei ihr zu Hause immer geübt hatten, mit einem Buch auf dem Kopf. Und da bemerkte ich, dass jemand dicht an mich herangetreten war. Ich drehte mich um und da war Erich. Wie von ferne hörte ich Paul mit Hänschen sprechen, es ging ums Essen, ob er Hunger habe, etwas in der Art, doch alles rauschte an mir vorüber, und das Einzige, was ich in dem Moment wirklich wahrnahm, war Erichs blauer Blick und dass er wirklich ziemlich groß war. Dann war der Moment vorüber. Der Mann, der sich Onkel Paul nannte – mit vollem Namen hieß er Paul Schäfer, wie ich später erfuhr –, richtete sich wieder auf, sagte etwas, das ich nicht verstand, und als ich ihm einen Augenblick später direkt ins Gesicht sah, erschrak ich: Denn nur sein eines Auge blickte mich an, das andere sah an mir vorbei. Erst Sekunden später begriff ich, dass er ein Glasauge hatte.
Wieder an Hänschen gewandt, sagte er: »Na, dann komm mal mit. Wir wollen dir ja nicht beim Hungern zusehen.« Und dann ging der Mann an der Schlange vorbei, die sich vor der Essensausgabe gebildet hatte. Vorne angekommen, rief er den Frauen dort in scherzhaftem Ton zu: »He, ihr Essensweiber, gebt mal gleich ’ne doppelte Portion für meinen kleinen Freund hier«, und ich sah, wie Hänschen ganz rot wurde, diesmal vor Freude und Stolz.
»Wollt ihr auch was essen?«, fragte nun Erich und voller Genugtuung registrierte ich, dass ich es war, die er dabei länger anschaute.
»Wenn wir was kriegen?«, kam Christa mir mit der Antwort zuvor. Ihre Stimme klang ganz fremd.
»Eure Wünsche sind mir Befehl, edle Frolleins«, sagte Erich mit einer angedeuteten Verbeugung und stellte sich an der Essensausgabe an.
Ich sah ihm hinterher und auf einmal fiel mir ein, woran mich das Gesicht des Mannes, der Paul hieß, denken ließ. An dieses alte, unheimliche Kreuzigungsbild, das wir in Kunsterziehung durchgenommen hatten und das Christa »so scheußlich, pfui Teufel« gefunden hatte. Das Bild zeigte den dornengekrönten Jesus. Um ihn herum standen Männer. Und einer von ihnen sah aus wie Onkel Paul.
Wenn ich heute zurückdenke, glaube ich, dass es die Heimatlosigkeit war, die uns dort hineintrieb, in seine Arme. Wahrscheinlich hatte er einen siebten Sinn für die Gestrandeten, die Angstvollen und die Gottgefälligen, oder zumindest für die, die es sein wollten. Und so wurde er ihr Schäfer, im doppelten Sinne. Uns Ostpreußen jedenfalls saß die Flucht in den Knochen, Mutter und den Löwes und all den anderen. Noch immer, Jahre nach Kriegsende, waren wir »die Flüchtlinge«. Und auch wenn die Heidjer uns das nicht ständig spüren ließen, so fühlten wir es doch in jeder Zelle unseres Körpers. Für Christa galt das alles nicht, sie stammte aus einer der alten, angesehenen Heidjer Familien, aber wenn ich an ihre Mutter denke, schließt das Gefühl des Gestrandetseins auch sie mit ein.
Christas Mutter war in den Fluss gegangen. Das war jedenfalls der Satz, der jahrelang in meinem Kopf herumspukte, bevor Konstantin mir die ganze Wahrheit sagte. Als Kind hatte ich mir vorgestellt, wie sie im Wasser trieb, so ähnlich wie eine Nixe. Manchmal, wenn ich über die Striezelbrücke ging oder am Flussufer entlangstrich, starrte ich so lange ins Wasser, bis ich glaubte, zwischen dem Fischkraut ein Gesicht zu sehen, umrahmt von Haaren, die sich in der Strömung bewegten. Jedenfalls war Luise Bellstedt der Grund dafür, dass der Gutshof für mich von Anfang an mit einem Geheimnis umgeben war.
In Wirklichkeit hatte der Fluss nicht allzu viel mit ihrem Tod zu tun. In einer eisigen Winternacht ist sie hinausgegangen, mit einer Flasche Cognac und einer Schachtel Schlaftabletten. Sie hat sich ans Ufer gesetzt, die Flasche leer getrunken und die Tabletten geschluckt und ist dann eingeschlafen. Erst spät am nächsten Tag hat man sie vermisst. Christas Vater hatte die Nacht in Hamburg verbracht. Die Grösitzer erzählten, er sei bei seiner Geliebten gewesen, während seine Frau am Striezelufer langsam zu Eis gefror. Später dann, als ich im Gutshaus ein- und ausging, warf ich, wann immer ich Gelegenheit hatte, einen langen Blick auf das Gemälde über dem Wohnzimmerkamin. Und je älter Christa wurde, desto deutlicher trat die Ähnlichkeit zu ihrer Mutter hervor: das braune, leicht gewellte Haar, die klaren Züge, der umschattete Blick. Christa war drei Jahre alt gewesen, als ihre Mutter in die Winternacht hinausging, ihr Bruder Konstantin dreizehn.
Doch an diesem Nachmittag war Christa glücklich und auch Hänschen grinste zufrieden, während er den zweiten bis zum Rand gefüllten Teller Graupeneintopf verdrückte.
Nach dem Essen trat Onkel Paul an unseren Tisch, klopfte Hans auf den Rücken und zwinkerte ihm zu.
»Nach dem Essen sollst du ruhen oder …« Er zog die Augenbrauen hoch und sagte gedehnt: »… eine Runde Völkerball gefällig?«
Ich sah, dass Hans rot anlief, so viel freundliche Aufmerksamkeit von Erwachsenen war er nicht gewohnt. Zu Hause wurde er von seiner überforderten Mutter entweder nach draußen geschickt oder von seinem Stiefvater – wenn er denn einmal da war – mit einer Ohrfeige bedacht. Darum wunderte ich mich nicht, als er mir nun einen teils verunsicherten, teils hoffnungsvollen Blick zuwarf. Ich nickte ihm aufmunternd zu und sah den beiden hinterher: dem kleinen rothaarigen Jungen in seinen viel zu großen kurzen Hosen, die seine Mutter ihm aus einer alten Anzugshose zurechtgeschneidert hatte, und dem drahtigen Mann mit den hochgekrempelten Hemdsärmeln. Von Weitem beobachtete ich, wie sich eine ganze Schar Jungen um ihn herumdrängte und wie einer rief: »Onkel Paul, Onkel Paul!«, und ihm den Ball zuwarf. Ich weiß noch, wie sehr ich mich für Hänschen freute. In der Schule stand er immer ein bisschen am Rand und es war schon vorgekommen, dass ich mir den einen oder anderen Bengel vorgeknöpft hatte, der den Kleinen, meist wegen seines Rotschopfs, gar zu hartnäckig gefoppt hatte.
Ich war ganz in diesen Gedanken versunken, als ich Christa dicht neben mir lachen hörte. Verblüfft wandte ich mich um und sah gerade noch, wie Erich an ihrem Zopf zog. Irgendetwas war mir da wohl entgangen und ich konnte nicht umhin, mich über Christa zu ärgern: über ihre Kopfhaltung, die so anders war als sonst; über die zarte Röte, die auf ihren Wangen lag und sie geradezu bezaubernd aussehen ließ.
Die nächsten Stunden verbrachte ich mit Hoffen und Sehnen und kann heute nur den Kopf schütteln über so viel Dummheit. Auf jeden Fall sahen Christa und ich Erich an diesem Nachmittag nur noch aus der Ferne. Erich beim Ballspielen, die muskulösen Arme in die Höhe reckend. Erich beim Boxkampf. Erich mit nacktem Oberkörper im Fluss neben Onkel Paul, der Wasser auf die Köpfe der Bekehrten schöpfte. Auf einmal musste ich an die Bibel denken und an ein Bild, das Pastor Brehm uns einmal im Konfirmandenunterricht gezeigt hatte, von Johannes dem Täufer. Als ich eine der Frauen irgendwann nach der Uhrzeit fragte, erschrak ich, denn es war schon nach sieben und Punkt sieben gab es zu Hause Abendessen. Ich lief zu Hänschen, der ein Stück flussaufwärts mit den anderen Kindern am Ufer stand, bis zu den Knien im Wasser, und ein Borkenschiffchen fahren ließ.
»Hans! Wir müssen los!«
Er drehte sich um, nahm das Schiffchen aus dem Wasser und stapfte ans Ufer. Während er auf mich zukam, bemerkte ich, dass er ganz glücklich aussah. Auf seinem Gesicht lag ein Lächeln, das ich nur als selig bezeichnen kann, und die Erinnerung daran zerreißt mir noch heute das Herz.
»Hopp, lauf dir die Füße im Gras trocken!«, trieb ich ihn an und bückte mich nach seinen Socken und Schuhen. Als ich mich wieder aufrichtete, stand plötzlich Onkel Paul da und sagte: »Na, wie hat es euch nu bei uns gefallen, dir und deinem Bruder?«
Seitdem ich dabei zugesehen hatte, wie dieser Onkel Paul die Leute getauft hatte, erschien mir der Mann irgendwie größer, auch seine Stimme kam mir anders vor, gewichtiger. Hinter Pauls rechter Schulter, ein ganzes Stück entfernt, sah ich Christa, die am Zeltrand bei den Fahrrädern stand und auf mich wartete. Sie winkte, um mir zu bedeuten, ich solle mich beeilen. Daher war ich nicht ganz bei der Sache, während ich vor mich hin murmelte: »Er ist der Nachbarsjunge.«
»So? Und du kümmerst dich um ihn? Das ist ja löblich …«
Das Winken im Hintergrund hatte aufgehört. Zerstreut murmelte ich: »Wir nehmen ihn halt ab und zu mit«, und als ich nun wieder einen Blick an Paul vorbei tat, sah ich Erich bei Christa stehen.
»Na, wenn das so ist … Am Dienstag haben wir hier Bibelabend mit Lagerfeuer. Kommt doch auch, ihr beiden!«
Nun schaute ich Paul direkt an. »Das wird leider nicht gehen«, sagte ich und wusste nicht genau, in welches Auge ich blicken sollte. »Meine Mutter lässt mich nicht weg. Sie will nicht, dass ich abends spät unterwegs bin.«
Da lachte Paul laut auf. »Was ist wichtiger, dein Seelenheil oder die irrsinnigen Ängste deiner Mutter?«
Ich wollte ihm gerade sagen, dass meine Mutter eigentlich keine übertrieben besorgte Frau war, doch da zupfte Hänschen an den Sandalen in meiner Hand. Ich ließ sie los und Paul Schäfer fuhr fort: »Außerdem könnt ihr hier übernachten. In einem der Weiberzelte ist sicher noch ein Platz frei. Und für den Lütten findet sich auch ein Pöstchen.« An Hans gewandt sagte er: »Naa, du willst doch auch am Feuer sitzen und Kartoffelstöcke schnitzen?«
Und Hänschen nickte, eifrig und ehrfurchtsvoll, mit leuchtenden Augen.
»Na, dann abgemacht«, sagte Paul und klopfte Hans noch einmal auf die Schulter und ging davon.
Ich bückte mich und half Hans beim Einfädeln der Lasche, und als ich mich wieder aufrichtete, sah ich Christa immer noch mit Erich vor dem Zelt stehen.
»Wir müssen los«, rief ich ihr zu und bemühte mich, nicht allzu unfreundlich zu klingen.
Als wir wenig später nebeneinander in Richtung Dorf radelten, hörte ich Hänschen hinter mir auf dem Gepäckträger vor sich hin singen. »Wilde Gesellen, vom Sturmwind umweht«, so klang seine kleine Stimme durch den Abend. Ich freute mich, dass er so glücklich war, und wollte Christa gerade von dem bevorstehenden Bibelabend erzählen, als mich ihr Anblick verstummen ließ. Sie saß sehr aufrecht, trat ordentlich in die Pedale und der Wind wehte ihr die Strähnen, die sich aus ihrem Zopf gelöst hatten, aus dem Gesicht. Ihr Profil war wie gemeißelt, die klare Stirn, die vollen Lippen, das weiche Kinn – und in diesem Moment wurde mir klar, dass sie schön war. Nicht hübsch oder lieblich oder anziehend, wie die meisten Mädchen schon allein durch ihre Jugend sind, nein. Christa war schön, im klassischen Sinne. Und so wandte ich mich wieder dem Weg zu und schwieg.
Eine Woche ist vergangen und Else geht es immer noch nicht gut. Die Kotzeritis hat sie fest im Würgegriff. Wenn das nicht zum Lachen ist! Onkel Paul würde sie sicher fragen: »Naa, da scheint ja jemand ziemliche Macht über dich zu haben?« Jedenfalls habe nun ich die Aufsicht über die Kleinen. Weil Elfriedes Beine das nicht mitmachen. Ich glaube eher, sie meint ihre Nerven. Auf jeden Fall sind die Kinder froh darüber, dass weder Else noch Elfriede sie antreibt. Weil die so gar keinen Spaß mitmachen, sauertöpfisch, wie die sind. Auch frage ich mich manchmal, warum die Kinder eigentlich nicht bei ihren Müttern bleiben können, was für ein Schaden wäre das? Doch das behalte ich lieber für mich, schließlich will ich nicht wieder in Ungnade fallen. Wie bei der Sache mit dem Geld. Als ich unverrichteter Dinge aus Grösitz zurückkehrte, mit leeren Händen. Jedenfalls freut sich Resi, die Mutter von Traudel und Luise, bestimmt, wenn ich nun diejenige bin, die sich um die Lütten kümmert. Auch wenn sie das natürlich nicht laut sagt. Resi ist froh, wenn sie unauffällig mitmischen kann, ohne sich wieder mit Else herumschlagen zu müssen, da bin ich mir sicher.
Es fällt Resi so schwer, von ihren Kindern getrennt zu sein. Wer könnte das besser verstehen als ich! Manchmal denke ich, dass Resi auch deshalb meine Nähe sucht. Weil sie sich mit mir verbunden fühlt. Oder tröstet sie ganz einfach der Gedanke, dass da jemand ist, der es noch schwerer hat als sie? Aber genau wie ich wird auch Resi das einsehen. Schließlich geht es um den großen Plan, von dem wir ein Teil sind. Ab und zu denke ich sogar, dass es für die Kleinen ja nicht nur ein Nachteil sein muss. Denn vermisse ich etwa meine Mutter? Die Frau, die mich einfach im Stich gelassen hat? Früher vielleicht, als Kind, das schon. Da wusste ich es nicht besser und es hat mir auch keiner gesagt. Jetzt aber hat Onkel Paul mir die Augen geöffnet! Wie selbstsüchtig das von meiner Mutter war. Sich einfach so aus der Verantwortung zu stehlen! Und was sie dadurch für eine Schuld auf sich geladen hat. Wer Hand an sich legt, kann niemals ins Himmelreich gelangen. Ins Himmelreich gelangt nur der, der reinen Herzens ist. Und rein werden wir nur, indem wir alles Unreine rauslassen, sagt Onkel Paul. Und ich weiß, dass es so ist, hab ich es doch am eigenen Leib erfahren, damals im Wald. Als ich es das erste Mal spürte, wie es ist, ganz rein zu sein.
Leider ist Ruth diese Gnade nicht zuteilgeworden. Man kann wohl sagen, dass das der Anfang vom Ende war. Onkel Paul sagt, dass Ruth vom Satan sei und gesandt, mich vom rechten Wege abzubringen. Aber ich halte Ruth nicht wirklich für schlecht. Wie könnte ich auch! Zumal jetzt, wo ich so tief in ihrer Schuld stehe. Aber Onkel Paul weiß natürlich nicht, welches Opfer Ruth für mich gebracht hat. Das ist schon das Handeln eines rechten Christenmenschen. Drum tut mir der Gedanke auch weh, dass sie niemals ins Himmelreich kommen wird. Weil sie im Grunde doch trotzdem ein guter Mensch ist. Vielleicht hätte ich ihr in jener Nacht im Wald mehr beistehen müssen, das denke ich manchmal. Denn wenn es auch ihr gelungen wäre, in Seiner Sprache zu sprechen und so näher zu Ihm zu gelangen, dann wäre sie jetzt vielleicht hier an meiner Seite. Und so bete ich nun jeden Morgen und jeden Abend für sie. So wie ich auch für die anderen Seelen bete: für Vater und Konstantin, für meine Mutter. Und für Frau Bottke, mit ihrem schrecklichen Lebenswandel, in den sie den kleinen Hans schon fast hineingezogen hatte.
In der Baracke roch es stickig, nach Hitze und Staub. Während Anne alle Fenster aufriss, überlegte sie, wer hier wohl aufs Grundstück kam und Wasser in die Näpfe kippte und wozu er das tat. Denn die beiden Raben waren doch längst vom Tierschutzverein abgeholt worden, das hatte Anne in die Wege geleitet, am selben Tag, noch von Afrika aus, bevor sie in die Malaria-Versenkung gefallen war.
Maximilian war fasziniert gewesen von Rabenvögeln. Das war auch etwas, das sie gemeinsam gehabt hatten, das Interesse an diesen klugen Tieren. Wobei Maximilians Verbindung zu den Vögeln eigentümlich innig gewesen war und fast mystische Züge gehabt hatte. Es hatte nie auch nur einen einzigen Vogel gegeben, der Maximilian gegenüber feindlich gesinnt gewesen wäre. Sie selbst hatte da ganz andere Erfahrungen gemacht. Während ihres Praktikums in Schweden zum Beispiel hatte ein Rabe, unglücklicherweise der Chef der ganzen Bande, sie jedes Mal, wenn sie die Voliere betrat, angeflogen und sich mit seinen Krallen an ihrem Kopf abgestoßen. So etwas wäre Maximilian nie passiert. Und irgendwann hatte er dann diese – eigentlich ganz unwissenschaftliche – Idee mit der Baracke und den Raben gehabt. In letzter Zeit hatte sich der Eindruck in ihr verfestigt, dass er die ganze Sache vielleicht nur deshalb begonnen hatte, um für eine Weile irgendwo hinzugehören. Denn das war ihre andere Gemeinsamkeit gewesen, die Heimatlosigkeit. Sie führten beide dieses typische Nomadenleben von Ethologen, die sich der Forschung verschrieben haben. Maximilian war fünfundfünfzig Jahre alt geworden und dabei nie richtig sesshaft. Und seine letzte Behausung war die Baracke gewesen, die Anne und ihre Mutter ihm für sein Sabbatical zur Verfügung gestellt hatten.
Manchmal dachte Anne, dass für sie vielleicht alles anders geworden wäre, wenn sie Geschwister gehabt hätte. Aber das hatte eben nicht sein sollen. Sie erinnerte sich noch gut daran, wie sie und Ruth einmal auf dieses Thema gekommen waren – ein Gespräch, an das Anne noch oft zurückdachte, mit gemischten Gefühlen. Ihre Mutter hatte damals gesagt, sie habe eigentlich überhaupt nicht vorgehabt, Kinder zu bekommen. Als junge Frau habe sie in die Welt hinausziehen wollen, um zu sehen, was das Leben so bietet. »Aber dann bist auf einmal du da gewesen und alles war ganz wunderbar!«, hatte Ruth schnell hinterhergeschickt, wohl weil sie Annes ziemlich bedröppelten Gesichtsausdruck bemerkt hatte. Und Anne hatte gedacht, dass sie und Ruth sich offenbar ähnlicher waren, als sie bis dahin geglaubt hatte.
Später telefonierte Anne mit Lara, ihrer Assistentin in Seewiesen, wo sie eine Forschungsgruppe am Max-Planck-Institut für Ornithologie leitete. Während des Gesprächs hatte Anne Mühe, sich auf die Inhalte ihrer Arbeit zu konzentrieren. Sie ertappte sich immer wieder dabei, wie sie stattdessen an ihren vergeblichen Gang aufs Moor dachte. Als sie aufgelegt hatte und sich gerade eine Stulle schmieren wollte, klopfte es an der Haustür. Schnell legte sie das Messer weg und ging zur Tür. Wer mochte das sein? Sie hatte hier ja zu niemandem mehr Kontakt. Die Heidesommer ihrer Kindheit, als sie Oma Käthe in den Ferien besucht hatte, waren nur noch Erinnerung, die Alten von damals waren längst gestorben, die Häuser verkauft.
Vor der Tür stand eine ältere Frau mit schwarzen Knopfaugen, in der Anne Gisela Bottke von gegenüber erkannte. Wie lange hatte sie die schon nicht mehr gesehen? Die Nachbarin schien gerade vom Einkaufen gekommen zu sein, denn in der Hand hielt sie den Griff einer kunstledernen Einkaufstasche auf Rollen. Während Anne noch auf das verwegene Muster ihres Haushaltskittels blickte, sagte Frau Bottke: »Ich wollt mal Tach sagen kommen!«
Anne musste unwillkürlich grinsen. »Das ist nett. Kommen Sie doch rein.«
»Nee, nee«, sagte Frau Bottke. »Eigentlich wollte ich fragen, ob Sie das jetzt machen. Mit Hugin und Munin und der Fütterei.«
Anne war perplex. Gar nicht mal in erster Linie darüber, dass die Vögel offenbar doch noch da waren und die Nachbarin die Näpfe unter der Kiefer befüllte. Fast noch mehr wunderte sie sich über die Selbstverständlichkeit, mit der Frau Bottke diese albernen Namen benutzte. Wie typisch für Maximilian, bei der Namenswahl die nordische Mythologie zu bemühen! Hugin, der Gedanke. Und Munin, die Erinnerung. So hatten die Raben Odins geheißen – was Anne allerdings herzlich egal war.
Erst im zweiten Moment fiel ihr ein, dass sie doch dem Tierschutzverein Bescheid gegeben hatte. Auf einmal fühlte sie eine heiße, für sie völlig untypische Wut in sich aufsteigen. Wie hatte der Mitarbeiter das einfach vergessen können? Ohne Frau Bottke wären die beiden Raben in ihrem Käfig elend zugrunde gegangen!
»Eigentlich …«, hob Anne mit vor Empörung zusammengepressten Lippen an. Doch ehe sie weitersprechen konnte, sagte Frau Bottke: »Ich hab ihn übrigens als vermisst gemeldet.«
Anne sah sie direkt an. »Sie?«, fragte sie dann nur.
»Na ja, so war’s.« Mit wachen dunklen Äuglein musterte sie Anne: »Hab ihn ja jeden Morgen gesehen. Wie er aufs Moor raus is. Und wenn er wiederkam, dann war ich meistens grad im Unkraut.«
Anne wusste immer noch nicht, was sie sagen sollte, konnte die Frau ihr gegenüber nur anschauen. Was war bloß los mit ihr? Normalerweise war sie in der Lage, alles zu rationalisieren, und wusste immer, wie sie die Dinge einzuordnen hatte und was zu tun war. Doch jetzt fehlten ihr, der Wissenschaftlerin, auf einmal die Worte.
»Ja«, sagte Frau Bottke nun und nickte. »Is ja jeden Tag aufs Teufelsmoor raus … Hat da die wilden Raben beobachtet. Kam immer hier vorbei. Und wir haben ein bisschen geklönt. Nur an dem Tag kam er nicht zurück. Zuerst hab ich mir nichts dabei gedacht. Aber später dann, als die Vögel so gerufen haben, da kam es mir langsam komisch vor. Es war schon dunkel und ich habe nachgesehen, ob bei ihm Licht brennt. Aber da war keiner. Also bin ich hin, hab geklopft, und als er nich aufgemacht hat, bin ich nach hinten, um zu sehen, was mit den Raben los is.« Sie machte eine Pause und rieb sich die Backe. »Ja, und da hab ich sie gesehen, wie sie aufgeregt hin und her gehüpft sind und immer wieder so gerufen haben.«