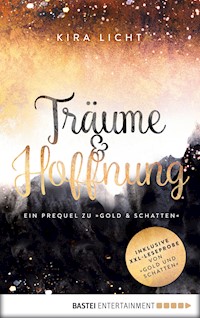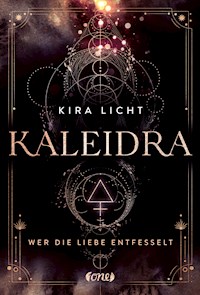
6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ONE
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Das packende Finale der Urban-Fantasy-Trilogie: Spannend bis zur letzten Seite
Nachdem Emilia und Ben aus Kaleidra zurück sind, ist nichts mehr so, wie es einmal war. Die Hohepriesterin Ishtar ist wie vom Erdboden verschluckt, und die Crux greifen unter der Herrschaft der Quecks die Menschen an. Städte werden ins Chaos gestürzt, und auch Rom bleibt nicht unversehrt. Emilia und ihre Freunde versuchen händeringend, einen Ausweg zu finden. Und dann ist da auch noch die Sache mit Emilias wahrer Herkunft, die sie nicht loslässt. Zusammen mit alten und neuen Verbündeten will sie der Sache auf den Grund gehen. Schließlich offenbart sich ihr ein gut gehütetes Geheimnis, das nicht nur das Schicksal aller Alchemisten, sondern auch die Zukunft der gesamten Menschheit verändern könnte ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Inhalt
Cover
Weitere Titel der Autorin:
Über die Autorin:
Titel
Impressum
Widmung
Motto
Playlist
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
EPILOG
DANKESCHÖN
Glossar
Weitere Titel der Autorin:
Gold & Schatten – Das erste Buch der Götter
Staub & Flammen – Das zweite Buch der Götter
Kaleidra – Wer das Dunkel ruftKaleidra – Wer die Seele berührt
Über die Autorin:
Kira Licht ist in Japan und Deutschland aufgewachsen. In Japan besuchte sie eine internationale Schule, überlebte ein Erdbeben und machte ein deutsches Abitur. Danach studierte sie Biologie und Humanmedizin. Sie lebt, liebt und schreibt in Bochum, reist aber gerne um die Welt und besucht Freunde. Für News zu Büchern, Gewinnspielen und Leserunden folgen Sie der Autorin auf Instagram (@kiralicht) und Facebook.
Originalausgabe
Copyright ® 2021 by Kira Licht
Copyright deutsche Originalausgabe ® 2021 by Bastei Lübbe AG, Köln
Dieses Werk wurde vermittelt durch die Michael Meller Literary Agency GmbH, München
Textredaktion: Annika Grave
Covergestaltung: Sandra Taufer, München unter Verwendung von Motiven von © IChaikova / shutterstock; IChaikova / shutterstock; run4it / shutterstock; Bokeh Blur Background / shutterstock; Phatthanit / shutterstock; elyomys / shutterstock
eBook-Erstellung: 3w+p GmbH, Rimpar (www.3wplusp.de)
ISBN 978-3-7517-0169-3
www.one-verlag.de
www.luebbe.de
Für meine Lektorin Annika.
#dreamteam
»Wenn ich alleine träume, ist es nur ein Traum. Wennwir gemeinsam träumen, ist es der Anfang der Wirklichkeit.«
– Johann Wolfgang von Goethe
Kapitel 1
»Wir müssen weg von hier, schnell!«
Bens Stimme ließ mich zusammenzucken. Dennoch konnte ich meine Augen nicht von dem Bild losreißen, das sich uns vom Dach des Pergamonmuseums hoch über Berlin bot. Die ganze Stadt schien von den Crux überrannt worden zu sein. Häuser brannten, Alarmsirenen heulten, und in der Ferne stieg eine Schuttwolke in den Himmel, nachdem nur Sekunden zuvor ein mehrstöckiges Gebäude eingestürzt war. Die graue Rauchsäule verdunkelte die Sonne und das umliegende Blau.
»Emilia.« Der Klang meines Namens ließ mich den Kopf drehen. Auch Ben wirkte schockiert und beunruhigt, doch im Gegensatz zu mir schien ihn diese apokalyptische Situation nicht zu lähmen. Im Gegenteil, er wirkte entschlossen und kampfbereit. Doch was sollten wir gegen so eine Übermacht ausrichten können? Allein dieses Gebäude zu verlassen, ohne in Gefahr zu geraten, schien mir in diesem Moment unmöglich. Doch dann breitete sich ein anderer Gedanke in meinem Bewusstsein aus, und Panik ergriff mich.
»Meine Mutter«, stieß ich hervor. Wenn dieses Horrorszenario die Lage der gesamten Welt widerspiegelte, dann musste ich sofort ...
Ben legte beide Hände um meine Oberarme. Ich keuchte überrascht. Er berührte mich, verstieß damit erneut gegen eine der härtesten Regeln der Orden.
»Zuerst müssen wir eine Loge erreichen«, unterbrach er meine Gedanken. »Dann sehen wir weiter. Ich habe keine Ahnung, warum das Ishtar-Tor uns nach Berlin und nicht nach London gebracht hat und ...« Er schien erst jetzt zu bemerken, wie groß meine Angst um Mamma war, denn seine Stimme wurde sanfter. »Ich bin mir sicher, deiner Mutter geht es gut.«
Doch ich hörte den aufgesetzten Optimismus in seinen Worten.
»Hast du mal nach unten gesehen?« Ich deutete mit dem Finger in die Straßenschlucht unter uns. »Die Zombie-Apokalypse ist in vollem Gange, und du willst erst in eine Loge und dann was? Einen Bericht über unsere Mission schreiben?« Ich war außer mir vor Sorge, und der Gedanke an meine Mutter, meine Angst um sie, war jetzt alles, an das ich denken konnte.
Ben ließ die Hände sinken und blieb immer noch ruhig. »Wir Fechtmeister trainieren für alle Katastrophenszenarien. Und du wirst vermutlich lachen, aber ja, auch für so etwas wie eine ›Zombie-Apokalypse‹. Wir leben seit Jahrhunderten mit den Crux und haben jeden noch so abstrusen Gedanken ernstgenommen und jede noch so unwahrscheinliche Situation durchdacht und dafür trainiert. Der erste Schritt in einer Situation wie dieser ist: Bringe dich in einer Loge in Sicherheit, informiere dich über die aktuelle Lage, und dann plane dein weiteres Handeln.«
So gerne ich weiter auf meinem Standpunkt beharrt hätte, seine Worte klangen vernünftig. Dennoch konnte ich mich nicht bremsen und riss Ben das Handy des Wachmanns aus der Hand. Ich würde Mamma anrufen. Jetzt sofort. Ich würde mich nur kurz erkundigen, ob es ihr gut ging. Ich musste einfach ihre Stimme hören. Wie selbstverständlich wollte ich die Nummer in das Zahlenfeld tippen, doch dann wurde mir klar, dass ich ihre Handynummer nicht auswendig wusste. Das Festnetz hatten wir schon vor Jahren abgeschafft.
»Emilia, sei vernünftig.« Jetzt klang Ben nicht mehr so beherrscht. »Auch ich habe Angst um meine Leute, aber wir sollten nicht überstürzt handeln.«
Ich hörte ihm kaum zu. Ich hatte zwar nicht Mammas Handynummer parat, aber ich würde einfach die Telefonnummer von Giovannis Pizzeria googeln. Die würde ja wohl im Internet zu finden sein. Wenn es hier Tag war, standen die Chancen gut, dass ich Mamma dort erreichte. Vielleicht hatte sie es nicht mehr nach Hause geschafft und sich dort verbarrikadiert. Mein Gott, hoffentlich geht es ihr gut. Mein Herz krampfte sich schmerzhaft zusammen, als ich darüber nachdachte, wie es sein musste, sich mitten im Geschehen zu befinden. Wie beängstigend es sein musste, wenn plötzlich überall die Welt in sich zusammenbrach. Schließlich konnten die Menschen die Crux nicht sehen. Es musste sich anfühlen, als würde die gewohnte Umgebung plötzlich auseinanderbrechen, wie Teile eines Puzzles, die nicht mehr zusammenpassten.
Ich hatte Glück, denn das Internet funktionierte einwandfrei. Ich hatte gerade die Nummer entdeckt und wollte auf den »Anrufen«-Button drücken, da wurde mir das Handy aus der Hand gerissen.
»Hey!« Wütend versuchte ich, Ben das Handy wieder aus der Hand zu schnappen.
»Denk nach«, waren die einzigen zwei Worte, die er knurrte. Wir sahen uns an wie zwei angriffslustige Tiere, die gleich aufeinander losgehen würden. Irgendwo über uns jagte ein Helikopter durch den Luftraum.
»Denk. Nach.« Ben betonte die Worte erneut, als wäre es ein Mantra.
»Ich verlasse dieses Dach nicht, bevor ich weiß, ob es meiner Mutter gut geht.«
»Du erinnerst dich aber schon, dass da immer noch ein Klon von dir herumläuft?«
Ich hatte wie selbstverständlich etwas erwidern wollen, doch dann verstummte ich abrupt. Daran hatte ich in meiner Panik gar nicht mehr gedacht. Ben hatte recht. Mal wieder.
Etwas kleinlaut und hilflos zugleich sah ich ihn an. Es musste doch eine Lösung geben.
Bens Blick wurde weich, bevor im nächsten Moment ein weiterer Helikopter über den Himmel jagte. So nah und tief, dass wir uns unwillkürlich duckten und unsere Haare vom Wind der Rotorblätter durcheinandergewirbelt wurden. Als der Lärm so weit abgeebbt war, dass wir uns wieder unterhalten konnten, straffte Ben die Schultern. »Ich kann ja unter einem Vorwand anrufen.«
Schon wieder krampfte sich mein Herz zusammen. »Danke«, sagte ich und lächelte ihn an, obwohl ich gleichzeitig Angst hatte vor den Nachrichten. Den guten oder den schlechten. Vor der Gewissheit, vor der Erkenntnis, dass ich vielleicht zu spät kam. Bitte nicht ...
Unter uns heulten Sirenen von Rettungswagen auf. Irgendwo schrie jemand laut. Ben hielt sich das Handy ans Ohr, während mir gleichzeitig schlecht wurde vor Angst. Häuser waren in sich zusammengestürzt und dutzende Menschen unter dem Schutt begraben. Straßenbahnen entgleist, Brände loderten ungehindert, und immer wieder hörte man verzweifelte Rufe. Ich betete voller Inbrunst, dass meiner Mutter nichts passiert war und auch niemand anderem, der mir etwas bedeutete. Tizi, Davine, den Mitgliedern der Loge ... Dennoch wusste ich, dass ich von Ben nur diese eine Freikarte bekommen würde. Er würde danach sicherlich nicht auch noch Tizis Nummer wählen.
»Buon Giorno«, sagte er endlich. »Hier ist Ben. Ich möchte etwas zum Abholen bestellen. Mit wem spreche ich bitte?«
Er nickte. »Hallo, Frau Pandolfini. Ich hätte gerne eine große Pizza mit Pilzen und Sardellen. Wann kann ich sie abholen?«
Er nickte, während er zu mir sah und gleichzeitig den Daumen hob. Mir fiel nicht nur ein Stein vom Herzen, es war eine ganze Edelsteinmine. Mamma ging es gut! Ich war so unendlich erleichtert.
»Ja dann, vielen Dank ...« Ben brach ab, und dann malte sich ein Lächeln auf seine Züge. »Richtig, ich bin ein Austauschstudent. Ja genau, England.« Er lachte kurz auf. »Danke schön. Das kann ich nur zurückgeben. Rom ist aber auch wirklich toll, besonders die Menschen dort. Alle sind so ...«
Wieder brach er ab, und sein Lächeln wurde noch breiter. »Stimmt. Charmant trifft es absolut ...«
Ich legte interessiert den Kopf schief. Was ging denn da gerade ab?
Ben lachte erneut, er war der perfekte Schauspieler. Um uns herum ging die Welt unter, und er tat so, als wäre alles in bester Ordnung.
»Perfekt, dann bis gleich.« Er legte auf, und das Lächeln auf seinen Lippen hielt an, erst dann nickte er mir kurz zu. »Da scheint alles in Ordnung zu sein. Sie klang völlig entspannt.«
»Hast du gerade mit meiner Mutter geflirtet?«
Ben, der soeben das Handy in die Tasche schieben wollte, erstarrte. »Was?«
Ich war immer noch so erleichtert, regelrecht euphorisch, dass es Mamma gut ging, dass ich mich nicht bremsen konnte, ihn ein wenig damit aufzuziehen. »Du hast gelacht. Am Telefon. Du hast noch nie am Telefon gelacht.«
»Ähem.« Ben schien etwas unschlüssig. Offensichtlich hatte er nicht bemerkt, dass ich das hier nicht ganz ernst meinte. »Sie sagte, ich hätte einen hübschen Akzent und ...« Erst da bemerkte er mein Grinsen. »Witzig.« Er schwang herum. »Verschwinden wir von hier.« Wie zur Bestätigung begann das Gebäude zu wackeln. »Wir sollten eine Loge erreicht haben, bevor die Nachwirkungen losgehen.«
»Die was?« Ich musste mich bemühen, zu ihm aufzuholen, weil er mal wieder mit Sieben-Meilen-Schritten vorausging.
Er sah nur kurz über die Schulter in meine Richtung, während das Handy einen warnenden Ton von sich gab. Es hörte sich an, als wäre der Akku gleich leer. Super. Und es war ganz allein meine Schuld.
»Wird der Twin beim Verlassen von Kaleidra so abrupt aus dem Geist entfernt, kommt es zu Nebenwirkungen, genau wie wenn man Kaleidra betritt. Die können etwas heftiger ausfallen, weil da plötzlich wieder eine Lücke ist in deinem Kopf. Es kann sein, dass man medizinische Betreuung benötigt. Und bei dir wissen wir noch nicht genau, was jetzt eigentlich los ist. Deshalb sollten wir nicht allein sein, wenn es losgeht.«
Richtig. Ich hatte ja meinen Twin gefunden. Oder besser gesagt: Er hatte mich gefunden. Ein uralter Twin voll mit Erinnerungen, die mich selbst in unzähligen Leben zuvor zeigten. Ein Twin, den Ishtar als ihre Tochter bezeichnet hatte. Das war immer noch so schwer zu glauben. Und die Sache mit den Nebenwirkungen klang auch nicht gerade beruhigend. Als wäre die Crux-Apokalypse nicht schon beängstigend genug.
Über uns begannen Gewitterwolken aufzuziehen, während das Handy erneut warnend piepte.
Ben verfiel in einen Laufschritt, um wieder zurück ins Treppenhaus zu gelangen. »Wie geht es jetzt weiter?« Meine Worte wurden von dem plötzlich umschwingenden Wetter fast verschluckt.
»Ich werde jetzt jemanden in London anrufen, damit sie uns abholen. Wenn ich dort niemanden erreiche, werden wir uns zur Berliner Goldloge durchkämpfen müssen.« Selbst über den plötzlich tosenden Wind konnte ich die Sorge in seiner Stimme hören, als er auf das Display des Handys sah.
Plötzlich fühlte ich mich unendlich egoistisch. Ich hatte darauf bestanden, dass wir uns nach Mamma erkundigten. Doch Ben hatte auch Angehörige, um die er sich Sorgen machte. Schließlich hatten wir keine Ahnung, wie die Situation in London war.
Ich hatte gerade zu Ben aufgeholt, der schon die Tür zum Hausflur erreicht hatte, als das Handy ein letztes Geräusch von sich gab. Der Akku hatte den Geist aufgegeben.
»Verdammt!«, knurrte Ben und schüttelte das Telefon, als würde das etwas bringen.
Ich schluckte. Wie sollten wir jetzt Hilfe rufen? Die Crux würden sicher bald unsere Gegenwart spüren, und gegen so viele von ihnen konnten wir uns unmöglich nur zu zweit behaupten. Zumal wir nicht mal geeignete Waffen aus Antimon dabeihatten. Das Atropium, mit dem sie die Katastrophen auslösten, war für uns, anders als für die Menschen, hochgiftig.
»Das wäre ja auch zu einfach gewesen.« Genervt schob Ben das Telefon in seine Tasche. Ich rechnete schon damit, dass er mir Vorwürfe machen würde, doch stattdessen zog er die Stirn kraus, als würde er intensiv über einen Plan B nachdenken. Ich wollte gerade etwas sagen, mich für meinen Egoismus entschuldigen, als die Tür zum Hausflur plötzlich aufschwang.
»Hat hier jemand ein Taxi bestellt?«
*
Eine Samurai-Hose, nackte Füße in Flip Flops, die kleine silberne Narbe am Auge.
»Larkin!« Da stand er, lässig gegen den Türrahmen gelehnt und mit seinem 1000-Watt-Lächeln auf dem unverschämt hübschen Gesicht.
Ben beugte sich zu mir. »Nur fürs Protokoll. Meinen Namen hast du noch nie so gerufen.«
Ich ignorierte ihn, ich ignorierte alle Regeln und warf mich in Larkins Arme. Einen ewigen Moment lang schien er überrumpelt, dann lachte er dunkel und drückte mich fest an sich. »Ich bin froh, dass es euch gut geht. Warum hat das so lange gedauert?«
Wir lösten uns voneinander. »Warum sind wir in Berlin gelandet? Wie geht es den anderen? Wie geht es Murphy? Und was ist hier eigentlich los? Ist das Ishtars Werk?«, feuerte ich meine Fragen auf ihn ab.
»Es geht allen den Umständen entsprechend gut, aber später mehr – wir haben nicht viel Zeit.« Er und Ben umarmten sich kurz. »Was sollte der Spruch gerade?« Larkin war Bens Retourkutsche also nicht entgangen.
Ich kam Ben zuvor. »Er hat mit meiner Mutter geflirtet.«
Larkin kicherte und hielt dann Ben die freie Hand zum High Five hin. »Korrekt, Fechtmeister.«
Ben besaß die Frechheit, einzuschlagen.
Ich machte eine »Bin ich im falschen Film?«-Geste, die Larkin dazu brachte, sich zu räuspern und eine goldene Schuppe aus seiner Tasche zu ziehen. »Verschwinden wir von hier.«
Das Pergamonmuseum schwankte leicht, und Putz bröckelte von den Wänden.
»Beeilung«, bat ich, als wir uns dicht nebeneinander drängten.
Und auf einmal ging alles ganz schnell. Ein Blitz schlug in das Nebengebäude ein. In den Straßen jaulten die Crux auf. Es krachte, und dann jagte ein Riss im Boden direkt auf uns zu. Ich schrie auf, als die Steine unter unseren Füßen wegbrachen.
»Larkin!«
»Bon voyage!«, rief Larkin, als die goldene Schuppe sich endlich aufblähte und uns im Hall eines weiteren Donners davontrug.
*
Mein Gehirn spielte mir einen Streich, denn ich rechnete damit, dass wir in der Goldloge von Rom landen würden. Als ich die Augen aufschlug, war ich mir sicher, dass auch dieser goldenen Schuppe ein Fehler unterlaufen war.
Doch dann erhaschte ich Meister Emmetts sorgenvollen Blick. Er schien auf unsere Rückkehr gewartet zu haben. Die letzten Tage hatten ihre Spuren auf seinem Gesicht hinterlassen. Er wirkte um Jahre gealtert.
»Home sweet home«, murmelte Larkin, während er die Schuppe zurück in seine Tasche schob.
»Es geht euch gut.« Meister Emmett kam auf uns zugeeilt. »Bei allen Göttern, ihr habt es geschafft.«
»Meister.« Ben senkte respektvoll den Kopf.
Ich tat es ihm gleich, obwohl er nicht mein Meister war, ich ja nicht mal zu seinem Orden gehörte. »Meister.« Doch als ich den Kopf hob und seine warmen braunen Augen mich voller Sympathie und Sorge musterten, wurde mir erneut klar, dass diese Menschen für immer meine alchemistische Familie sein würden. Wir mochten getrennt sein, durch Orden, Logen, das Element in unserem Blut. Doch Familie war keine Frage von Genetik. Für mich war es eine Herzensangelegenheit.
»Ihr habt es wirklich geschafft«, murmelte Meister Emmett erneut. Er klopfte Ben einmal kurz anerkennend auf die Schulter. »Gut gemacht.« Sein Blick glitt wieder zu mir. »Ihr beide wart ein tolles Team.« Dann sah er zu Larkin. »Die Idee, eine Kamera gegenüber des Ishtar Tors anzubringen, war großartig, Scriptor.«
Larkin wurde noch ein paar Zentimeter größer, bevor er genauso respektvoll den Kopf neigte. »Vielen Dank, Meister.«
Im nächsten Moment tauchte eine weitere Gestalt auf. Groß und schlank, mit dunkler Haut und auffallend hellblauen Augen.
»Willkommen zurück.« Oliver lächelte mich an, bevor er Ben in seine Arme zog. »Ich habe mir solche Sorgen gemacht. Wir dachten schon, wir würden euch nie wieder ...«
»Es ist ja alles gut gegangen«, unterbrach Meister Emmett ihn energisch.
Oliver löste sich von Ben und schien tatsächlich einen Moment lang um Fassung zu ringen. Ich war gerührt, dass der sonst so zurückhaltende Sekundant der Loge so emotional reagierte. Noch mal lächelte Oliver mir zu, und wieder fühlte es sich absolut falsch an, ihn nicht kurz zu umarmen. In solchen Momenten brauchte man doch einfach die Berührung des anderen. Nicht umsonst hieß es »sich an jemandem festhalten«, wenn man Trost suchte. Ich hatte mich den Regeln der Orden beugen wollen, doch je länger ich mit den Alchemisten zusammen war, desto sicherer wurde ich mir, dass diese Regeln nicht nur antiquiert, sondern regelrecht menschenfeindlich waren. Es musste doch eine Lösung geben, wie sich Alchemisten unterschiedlicher Orden nicht mehr gegenseitig schwächten. Auf so viel Zwischenmenschliches zu verzichten, freundschaftliche Berührungen, liebevolle Umarmungen, ein gemeinsames Leben. Konnte das wirklich die richtige und einzige Lösung sein? Oliver schien meinen Zwiespalt zu spüren, denn er lächelte mir wieder zu und seine Augen sagten: Du machst das gut.
»Wie geht es Murphy? Und was ist in Berlin los? Hat Ishtar sich gezeigt? Und ...« Ben klang aufgebracht.
Meister Emmett hob beschwichtigend die Hände, und Ben verstummte. »Setzt euch für den Moment und trinkt etwas. Ihr seid sicherlich erschöpft.« Er deutete auf eine kleine Sitzgruppe. Das dunkle Holz und der olivgrüne Bezug wirkten einladend. Eine Karaffe und ein paar Gläser standen auf der polierten Holzplatte.
Oliver goss uns allen ein, und ich nahm dankbar einen großen Schluck Wasser, als er mir mein Glas reichte.
»Zuerst möchte ich kurz wissen, wie es euch in Berlin ergangen ist«, fuhr Meister Emmett dann fort. »Habt ihr etwas Verdächtiges gesehen? Die Angriffe der Crux gingen vor einer Stunde in Berlin, Paris und Stockholm los, und noch wissen wir so gut wie gar nichts. Danach ...«, sagte er und hob die Stimme, als Ben schon zu reden beginnen wollte. »... möchte ich, dass ihr euch auf der Krankenstation einfindet. Außerdem wissen wir nicht, wie extrem die Symptome sein können, wenn man Kaleidra verlässt. Bei Larkin lief es bis jetzt relativ glimpflich ab, aber wir gehen kein Risiko ein. Ich habe bereits ein Team zusammengestellt, und das medizinische Personal wird sich sehr gut um euch kümmern. Gehe ich recht in der Annahme, dass ihr einen Versorgungschip bekommen habt? Der sollte zügig entfernt werden, nicht nur wegen des vermutlich integrierten GPS-Trackers.«
»Was für Symptome können denn auftreten?« Ich hatte mich gerade etwas unauffällig in der Loge von London umgesehen, aber jetzt bekam ich es doch langsam mit der Angst zu tun.
Larkin neben mir zuckte mit den Schultern. »Von einem leichten Kratzen im Hals bis zum Tod so ziemlich alles.«
»Larkin!«, sagten Ben, Oliver und Meister Emmett gleichzeitig. Offenbar war sein Taktgefühl auch noch nicht ganz zurückgekehrt.
»Entschuldige«, murmelte er.
Ben berichtete von unserem kurzen Aufenthalt in Berlin. Ich hingegen sah mich weiter um. Das hier war das eigentliche Zuhause von Ben und den anderen. Unweit der Sitzgruppe machte ich den Stein der Weisen aus. Er sah dem in Rom sehr ähnlich, auch wenn die Versuchsaufbauten nicht ganz so aufwendig verziert schienen. Ein wenig entfernt befand sich auch der »Schlüsselkasten«, in dem die Alchemisten die Objekte aufbewahrten, die sie in die Prima Materia gaben, damit der Stein der Weisen sie an einen bestimmten Ort transportierte. Diese Objekte aus allen Teilen der Welt waren quasi wie Fahrkarten, die darauf geprägt waren, einen ganz bestimmten Ort zu erreichen.
Mein Blick glitt weiter durch die Eingangshalle. Sie war nicht so hoch, nicht so imposant wie die Goldloge in Rom, aber dennoch ein Ort, der einen zugleich einschüchterte und faszinierte. Auch hier war der Boden aus dunklen Steinplatten gefertigt. Anders als in Rom waren diese hier jedoch schwarz und erinnerten mich an Onyx. Sie waren mit breiten goldenen Adern durchzogen, die ein wunderschönes Muster bildeten. An den Wänden hingen Gemälde, und ich sah sogar einige Personen mit Kronen oder anderen Attributen, die man eindeutig dem Adel zusprechen konnte. Wenn das hier ihre Vorfahren waren, konnten die Alchemisten auf einen beeindruckenden Stammbaum zurückblicken. Wie immer schmeckte ich einen Hauch von Gold in der Luft. Ich ließ den Blick nach oben wandern.
Eine Glaskuppel bildete die Decke, doch nach dem Abbild der großen Schlange suchte ich vergeblich. Ich ließ meine Augen tiefer gleiten, denn vielleicht fand ich Hinweise auf ihre Existenz irgendwo im Bereich der Wände. Vielleicht setzte sie sich aus Mosaiksteinen zusammen, wie in der Quecksilberloge in Washington. Doch auch an den Wänden fand ich keinerlei Hinweise. Es gab jede Menge Bilder, alle in aufwendig gestalteten goldenen Rahmen, hier und da eine kleine Lampe, in der Nähe der Türen die obligatorischen Lichtschalter, und an einer der Türen gab es sogar ein hochmodernes Bedienfeld, in das man einen Zahlencode eingeben musste. Aber ansonsten ... keine Hinweise auf eine Schlange. Ich spürte, wie Meister Emmetts Blick kurz auf mich fiel, als ich mich in meinem Sessel noch weiter um mich selbst drehte. Er würde sicherlich verstehen, dass ich neugierig war, wo ich gelandet war. Die Logen schienen sich architektonisch tatsächlich zu unterscheiden. Ob sie genauso einen garstigen Aufzug besaßen, der seine Fahrgäste tötete, sollten sie ihn ungebeten betreten?
Ben hatte gerade seinen Bericht beendet, und mein Blick fiel auf die Reaktionen der anderen. Oliver hatte von irgendwoher ein Tablet gezaubert, auf dem er nun einen Nachrichtensender einstellte. »Alle Logen haben bereits Einsatzteams aus der ganzen Welt vor Ort. Wir helfen beim Retten und Bergen, während das Töten der Crux tagsüber leider sehr diskret ablaufen muss. Das erschwert uns ein schnelles Eingreifen.« Die Berichte über die unerklärlichen Naturkatastrophen in den drei Hauptstädten klangen beängstigend und erschreckend.
Einen Moment lang schwiegen wir alle betroffen.
»Wir gehen davon aus, dass dies Professor Avalanches Werk ist. Die Crux sind nicht vollständig verwandelt und ...«
»... haben spitze Zähne«, ergänzte ich.
Er nickte angespannt. »Larkin hat bereits erzählt, dass der Professor seinen Sohn als Versuchskaninchen benutzt hat. Es ist eine Bedrohung der neuen Art, da die Crux jetzt Befehle befolgen.«
Mein Herz krampfte sich zusammen, als ich an Matti dachte. Ich konnte ihn manchmal über unseren Tria-Bund spüren. Ich wusste, dass er Schmerzen hatte und Angst, und es schürte meine Wut auf den Professor, seinen Vater, der ihm das angetan hatte, nur noch mehr.
»Gibt es Hinweise auf Ishtar?«, wollte Ben wissen. »Ich habe eindeutige Beweise gefunden, dass sie einen Wachmann getötet hat.«
Meister Emmett schüttelte den Kopf. »Wir vermuten, dass sie sich erst in dieser für sie neuen Zeit zurechtfinden muss. Sie wird sich irgendwo verkrochen haben.« Er strich sich sorgenvoll übers Kinn. »Wir suchen aktiv nach ihr. Andererseits gehe ich davon aus, dass es nicht allzu lange dauern wird, bis wir auf die ein oder andere Weise von ihr hören werden.«
Oliver presste die Lippen aufeinander, bis sie nur noch ein schmaler Strich waren. »Es wird schwer, das vor den Menschen geheim zu halten, sollte sie erst mal anfangen, die Welt zu ihrem persönlichen Spielplatz zu machen.« Er sah kurz zu Meister Emmett. »Wir Alchemisten sind nicht mehr das, was wir mal waren. Was, wenn wir sie nicht aufhalten können?«
Niemand hatte eine Antwort darauf.
Mein Bauch verkrampfte sich, als die Erinnerungen aus Kaleidra plötzlich vor meinem inneren Auge auftauchten. Zwei Dinge waren mir am deutlichsten im Gedächtnis geblieben. Das irre Lachen von Professor Avalanche, als er uns bewies, dass er die Crux kontrollieren konnte. Und Murphys Schrei, nachdem er sich bei dem Sturz durch die Decke so schwer verletzt hatte.
»Wie geht es Murphy? Darf ich ihn sehen?« Ich sprach so leise, dass Meister Emmett sich ein Stückchen zu mir beugte.
»Wie bitte, Emilia?«
Doch Ben hatte meine Worte wohl gehört. »Das würde ich auch gerne wissen«, sagte er und dann mit einem Blick zu Meister Emmett: »Wir sollen uns ja eh auf der Krankenstation einfinden. Darf Murphy Besuch empfangen?«
»Natürlich«, sagte Meister Emmett, und wir taten es ihm nach, als er sich erhob. Sein Blick blieb an mir hängen, als ich kurz über meine ramponierte Kleidung strich. Er legte den Kopf schief, und plötzlich war sein Blick geschärft.
»Meister?«, fragte Ben, als er den Blick bemerkte. Auch Larkin und Oliver sahen ihn neugierig an.
Meister Emmett blinzelte. »Du hast etwas an dir«, sagte er dann, klang aber so, als könne er seinen eigenen Worten nicht wirklich trauen.
Mir jagte eine Gänsehaut den Körper hinab.
Meister Emmett kam näher. Ben und Larkin wichen respektvoll zur Seite, als er mich einmal umrundete. Mein Puls beschleunigte sich, Anspannung mischte sich mit Angst, und wie immer in so einer Situation glitt mein Blick zu Ben.
»Alles gut«, formten seine Lippen lautlos.
Ich schluckte. »Was ist denn?«, platzte es aus mir heraus. Auch die anderen sahen ihn jetzt besorgt an.
»Bin ich krank? Fehlt mir etwas?«
»Nein«, erwiderte Meister Emmett mit sanfter Stimme. Sein Blick jedoch war ernst, als er mich umrundete und mir wieder direkt in die Augen sah. »Aber irgendetwas ist mit dir in Kaleidra geschehen, richtig?«
Kapitel 2
Einen Moment lang war ich sprachlos. Meister Emmett betrachtete mich weiterhin mit großem Interesse, als wäre ich ein Studienobjekt, dem er sich gerne den Rest des Tages widmen würde.
»Ja, ich habe meinen Twin wiederbekommen, so verrückt das klingt.«
Larkin wandte sich an Meister Emmett. »Und was bedeutet das jetzt für Emilia, Meister?«
»Emilia hat vorher wie die Menschen gelebt. Sie vereinen ihre guten und schlechten Eigenschaften in sich. Wir Alchemisten versuchen jedoch, sie zu trennen, da unsere schlechten Eigenschaften uns so viel mehr Macht verleihen und wir so immer mit der Gefahr leben, zum Crux zu werden.«
Ich sah ihn erschrocken an. Daran hatte ich noch gar nicht gedacht. »Könnte ich jetzt zum Crux werden, da mein Twin sich nicht mehr in Kaleidra befindet?«
Meister Emmett schien einen Moment lang nachzudenken. »Da es dieses Phänomen noch nie zuvor gegeben hat, kann ich dir nur raten, vorsichtig zu sein. Du solltest zukünftig ...«
Doch in diesem Moment stöhnte Ben leise auf. Plötzlich wurde er blass wie eine Wand, und dann krümmte er sich abrupt, als habe er starke Bauchschmerzen.
Während wir alle aufsprangen, gab Meister Emmett Oliver knapp per Handzeichen die Anweisung, Ben zu stützen.
»Das sind die Nachwirkungen.« Der Meister klang besorgt.
Ben krümmte sich erneut.
»Auf die Krankenstation mit euch, sofort«, befahl er nun.
»Es geht schon wieder«, protestierte Ben, doch er klang alles andere als okay. Gerne hätte ich mich bei ihm untergehakt, nur um ihm zu zeigen, dass ich da war. Doch vor Meister Emmett traute ich mich nicht, gegen die Regeln zu verstoßen. Er hatte bereits ein Auge zugedrückt, als Ben und ich in inniger Umarmung nach der Mission im Petersdom wieder in der Loge aufgetaucht waren. Schon da hätte er Ben mit weitaus härteren Konsequenzen bestrafen können als einer Ansprache in seinem Büro. Mich hatte er gar nicht erst auf den Vorfall angesprochen.
»Es geht schon«, sagte Ben erneut und machte sich von Oliver los. »Danke, Sekundant, aber das ist nicht nötig.«
Das war so typisch Ben. Er war für alle da, er stürzte sich mitten ins Kampfgetümmel, um seine Freunde zu verteidigen. Aber ihm selbst fiel es schwer, Hilfe anzunehmen.
»Auf die Krankenstation, sofort.« Meister Emmetts Stimme duldete keinen weiteren Protest mehr. Wir sahen ihn alle kurz an, weil wir damit rechneten, dass er weitere Befehle erteilen würde. Doch er blickte nur auf die goldene Uhr an seinem Handgelenk. »Ich habe jetzt ein Skype-Meeting, bin aber immer erreichbar. Die Logen werden sich über die Lage in Paris, Stockholm und Berlin beraten. Ich hoffe, dass es bereits erste konkrete Schadensberichte gibt. Danach wird die Allianz sicherlich versuchen, jemanden aus der Führungsriege des Quecksilberordens zu erreichen. Jemand muss die Verantwortung dafür übernehmen.« Die letzten Worte hatte er geradezu wütend hervorgestoßen. Doch sofort wurde sein Blick wieder weicher, als er Ben und mich kurz ansah. »Ruht euch aus. Wir sehen uns später.«
Mir fiel auf, dass weder Meister Emmett noch Oliver überrascht gewirkt hatten, als ich das mit meinem Twin angedeutet hatte. Vermutlich war Larkin mir zuvorgekommen.
Meister Emmett nickte uns noch einmal zu, dann schwang er herum und eilte aus der Halle. Kaum, dass er hinter einer der reich verzierten hohen Holztüren verschwunden war, krümmte Ben sich erneut vor Schmerzen. Ihn so zu sehen brach mir fast das Herz.
Oliver stützte ihn und gemeinsam gingen sie voraus. In meinem Kopf schwirrten noch so viele Gedanken, doch Larkin blieb an meiner Seite, als wolle er sichergehen, dass ich alleine laufen konnte. Ich wusste, er würde mich erst anfassen, wenn ich ernsthaft Hilfe brauchte. So waren die Regeln der Orden nun mal. Doch er war bereits zu so etwas wie einem Freund geworden, und gerne hätte ich mich einfach bei ihm untergehakt.
»Komm«, sagte er irgendwann leise und machte einen kleinen auffordernden Schritt hinter Ben und Oliver her. Ich seufzte, nickte und holte dann zu ihm auf.
»Du brauchst keine Angst zu haben.« Larkin sah mich kurz von der Seite an. »Egal was mit dir in Kaleidra geschehen ist, Meister Emmett wird einen Rat wissen. Du magst vielleicht in Meister Vincence einen eigenen Meister haben. Aber glaub mir, ich bin mir sicher, dass Meister Emmett sich in diesem Moment genauso verantwortlich für dich fühlt.« Seine Stimme wurde ernst. »Wenn nicht sogar noch mehr.«
Ich wandte den Blick ab, weil ich plötzlich einen dicken Kloß im Hals hatte. Larkin sprach mir aus der Seele. Und er deutete das an, was ich von Anfang an für diese Loge empfunden hatte: Die Goldloge war wie eine Familie für mich.
*
Ich suchte noch nach den passenden Worten, da riss Ben, der sich natürlich von Oliver losgemacht hatte, eine der großen hölzernen Türen auf. So kraftvoll, dass sie mit der Wand Bekanntschaft machte und der darauffolgende Knall wie ein Donner durch das Gebäude hallte. Wir folgten ihm, und neugierig sah ich mich um. Der schlicht gehaltene Gang führte zu einem Treppenhaus, und zu unserer Linken entdeckte ich auch endlich einen Aufzug.
»Autorisiert sie«, sagte Ben, kaum dass die Türen aufglitten. Er atmete schwer, so schlecht schien es ihm zu gehen. Dennoch schaffte er es, mit dem ausgestreckten Arm auf mich zu zeigen, als wäre ich ein Opfer und kein Gast.
Sobald er nicht mehr so grün im Gesicht war, würde ich ihm ganz schön was erzählen ...
Da ich das Spektakel schon kannte, zuckte ich kaum noch, als die Kammer in rotem Licht erstrahlte und der Aufzug »Silber, Silber, Silber!« zu quäken begann.
Dieses Mal übernahm Oliver die Prozedur mit dem Handscanner. Kaum, dass ich autorisiert war, erlosch das rote Licht, und der Aufzug setzte sich in Bewegung.
»Hat er schon mal jemanden gefressen?«, fragte ich möglichst beiläufig.
»Das möchtest du nicht wissen.« Oliver hatte die Arme vor der Brust verschränkt und stand neben Ben. Wieder mal war ich mir sicher, dass sie irgendwie Brüder sein mussten. Sie ähnelten einander in Mimik und Gestik auf so frappierende Art und Weise, dass es irgendeine Art von genetischer Verwandtschaft geben musste. Es konnte gar nicht anders sein.
Einen Moment lang war es ganz still, dann beugte Larkin sich ein Stückchen zu mir und sah mir prüfend ins Gesicht. »Hast du auch Bauchkrämpfe?«
Ich schüttelte den Kopf, und im nächsten Moment hatten wir zum Glück die dritte Etage erreicht. Der weiße Linoleumboden und der zarte und zugleich beißende Geruch nach Desinfektionsmittel ließ keinen Zweifel daran, dass wir auf der Krankenstation gelandet waren.
»Es ist die zweite Tür links«, erklärte Oliver, als just in diesem Moment ein Mädchen das Krankenzimmer verließ. Sie lächelte, als sie uns entdeckte. Ihr kurzer Schottenrock und ihr Pferdeschwanz wippten, als sie auf uns zuging. Mit den großen grünen Augen und dem weizenblonden Haar sah sie aus wie eine weibliche Kopie von Murphy. Sie musste, wenn überhaupt, ungefähr in meinem Alter sein. Sie hatte ein Tablet dabei, das in einer grellrosafarbenen Hülle steckte.
»Ihr seid wohlbehalten zurück!«, platzte es aus ihr hervor. Erst dann schien sie sich an irgendeine Ordensregel zu erinnern, denn sie räusperte sich. »Hallo Goldalchemisten, und willkommen zurück, Fechtmeister.« Sie sah zu mir. »Hallo Emilia aus dem Silberorden.«
»Hi Cynthia.« Oliver nickte ihr zu, als wir voreinander stehenblieben. »Darf ich vorstellen? Cynthia, das ist Emilia. Emilia, Cynthia ist unsere Pionierin.«
Die neue Pionierin. Ihr Name war bereits gefallen, aber ... Annmary ... sie fehlte mir so sehr. Der Gedanke an sie nahm mich für einen Moment so gefangen, dass ich es fast versäumte, Cynthias höfliches Kopfnicken zu erwidern.
»Hallo Cynthia. Freut mich.«
»Mich auch.« Sie tippte etwas auf ihrem Tablet, ohne hinzusehen.
Ich musterte sie unauffällig. Murphy sah schon aus wie etwas sehr Niedliches, das jemand aus Marzipan geformt hatte. Doch diese kleine Elfe toppte das noch mal.
»Bevor du fragst, ja«, sagte sie in diesem Moment mit heller Stimme. »Deine Vermutung ist richtig. Murphy ist mein Bruder.«
Konnte sie Gedanken lesen? Ich hätte gerne mit ein paar netten Floskeln geantwortet, vielleicht sogar nachgefragt, aber Murphy war jetzt wichtiger. »Wie geht es ihm?«, fragte ich stattdessen. »Ich mache mir solche Sorgen.«
»Ihr könnt ihn besuchen.« Cynthias freundliches Lächeln verrutschte, und sie bemühte sich merklich um Fassung. »Aber bleibt nicht so lange. Er braucht Ruhe.«
»Natürlich«, erwiderte ich sofort.
»Danke, Cynthia.« Ben klang schon wieder so, als würde er sich gleich übergeben müssen oder direkt ohnmächtig werden.
Sie musterte ihn kurz, doch dann verschwand sie mit gesenktem Kopf. »Wir sehen uns oben.«
Ben klopfte leise an die Tür, und wir folgten ihm in das Zimmer.
Als mein Blick auf Murphy fiel, presste ich unwillkürlich die Hand auf den Mund. Er war nicht mehr blass, er wirkte regelrecht durchsichtig, fast wie ein Geist. Die Ränder unter seinen Augen waren nicht mehr dunkel, sondern schwarz und die Lippen blutleer. Seine Lider flatterten, als er zu uns hochsah und sich an einem kleinen Lächeln versuchte. Es schien ihn alle Kraft zu kosten.
»Er hat eine Menge Blut verloren«, raunte Larkin mir zu. »Die Ärzte konnten die Wunde schließen, und er hat sofort Bluttransfusionen bekommen, aber ...« Seine Stimme brach. »Als wir hier ankamen, hatte er bereits einen Schock, und wären wir nur Minuten später ...«
»Mein Gott«, murmelte ich, während Ben und Oliver schon an Murphys Fußende Stellung bezogen hatten. Gleich zwei Infusionsbeutel hingen an einem Ständer, und an einem seiner Finger klemmte ein Pulsoximeter, das den Sauerstoffgehalt in seinem Blut überwachte.
»Hey ...« Murphys Stimme klang, als riebe Stein über Stein. Seine Lippen waren trocken und aufgerissen. Seine Stirn zierte ein riesiger Bluterguss. Die Wunde an seinem Oberschenkel konnte ich nicht sehen, denn eine leichte Decke verhüllte seine Beine.
»Wie geht es dir?«
»Was machst du denn für Sachen?«
Wir bestürmten ihn gleichzeitig mit Fragen.
Er lachte leise, hielt dann aber abrupt inne, als er sich fast verschluckte. »Tut mir leid«, murmelte er dann. »... dass ich euch so viele Umstände und Sorgen bereite. Sobald ich wieder gesund bin, werde ich das Fallen aus größerer Höhe trainieren.«
»Hör sofort auf, so einen Blödsinn zu reden«, erwiderte Larkin mit leicht zitternder Stimme. Seine Augen schimmerten feucht. »Hast du schon mal von einem Computergenie gehört, das einen Triathlon gewonnen hat? Oder von einem Profi-Gamer, der bei den Olympischen Spielen antritt? Das eine schließt das andere praktisch aus.«
Oliver wirkte zwar nicht, als würde er komplett Larkins Meinung sein, dennoch nickte er zustimmend. »Unfälle bei Einsätzen können passieren. Du bist jetzt zwar verletzt, aber es hätte viel schlimmer kommen können.«
»Das stimmt«, murmelten wir anderen fast wie im Chor.
Murphys Blick glitt zu Ben. »Ich habe mir die ganze Zeit Sorgen gemacht, ob ihr es schafft.«
»Wir sind kurz nach eurer Flucht erwischt worden, aber wir hatten Hilfe.« Bens Blick glitt kurz zu mir. »Und das war in der Tat etwas merkwürdig. Darüber werden wir noch mal in Ruhe sprechen müssen, wenn Meister Emmett auch anwesend ist. Jetzt ruh dich erst mal aus.«
»Nein.« Murphy verschränkte die Arme vor der Brust. »Ich habe doch nichts am Kopf, also erzählt schon. Ihr hattet Hilfe? In Kaleidra? In der geheimen Basis des Quecksilberordens? Seid ihr auf eine andere Loge getroffen? Mir ist nicht bekannt, dass noch jemand anderes in den letzten Jahrzehnten das Risiko eingegangen und nach Kaleidra gereist ist. Davon hätten wir sicherlich erfahren.«
Jetzt betrachteten uns auch Larkin und Oliver voller Neugier. Und mir fiel mal wieder auf, wie viel passiert war, von dem die anderen noch gar nichts wussten.
»Ihr Fechtmeister hat uns die Flucht ermöglicht.«
»Was?« Oliver schien plötzlich eine Art Sprungfeder im Rücken zu haben. Er straffte die Schultern, als rechnete er jeden Moment mit einem Angriff. »Wer?«
»Kyle Denham.« Larkin wirkte nachdenklich. »Er war auch bei der Führung in der Quecksilberloge in Washington anwesend. Im Gegensatz zu Tyson Avalanche scheint er kein testosterongesteuerter Volltrottel zu sein.«
»Sein Name lautet Kyle Aoki Denham.« Murphys Stimme klang beiläufig, als schien er mit seinen Gedanken ganz woanders. »Sein zweiter Vorname ist japanischen Ursprungs.«
Oliver musterte Murphy mit hochgezogenen Augenbrauen, schob es dann aber vermutlich auf die Wirkung irgendwelcher Medikamente. »Und er hat euch geholfen? Einfach so?«
»Dazu müssten wir vielleicht Emilia befragen.« Bens Blick schien unergründlich. »Sie hatte mit Kyle sehr viel mehr zu tun als ich.«
Ich wich einen halben Schritt zurück. »Glaubst du, ich habe ihn bestochen? Oder auf irgendeine Art und Weise dafür ... bezahlt?«
Ben schnaubte, doch seine Stimme klang versöhnlich. »So habe ich das nicht gemeint. So etwas würde ich dir niemals unterstellen.« Er sah mich an, und ich erkannte in seinen tiefblauen Augen, dass er es absolut ernst meinte. Er klang nur einfach viel zu oft wie ein störrischer Brummbär, und davon ließ ich mich verunsichern.
»Ihr beide hattet mehr Kontakt miteinander, und vielleicht habt ihr eine Art Draht zueinander entwickelt. Schließlich hat er auch zuletzt gesagt, dass jemand diesen Wahnsinnigen –und er meinte damit Professor Avalanche – stoppen muss.«
»Er hat was gesagt?« Oliver wirkte immer noch ungläubig. »Ich merke schon, ihr habt eine Menge zu erzählen. Hoffen wir mal, dass eure Nachwirkungen durch Kaleidra ähnlich glimpflich wie bei Larkin ausfallen. Wir müssen dringend ein Treffen einberufen. Hoffentlich wissen wir dann auch schon mehr zu den Angriffen auf die Großstädte.«
»Großstädte werden angegriffen?« Murphy sah entsetzt zwischen uns hin und her. »Kann mich mal jemand einweihen?«
Er bekam die Kurzfassung von Ben.
»Wow«, erwiderte er nur, als dieser geendet hatte. »Wie fürchterlich. Die armen Menschen. Das ist ja wie bei einer Zombie-Apokalypse.«
Oliver zog schon wieder die Augenbrauen hoch, sagte aber nichts. »Und Kyle hat euch wirklich einfach so gehen lassen?«
Ben zuckte mit den Schultern. »Er hat uns in einen Raum gebracht, von dem auch die Quecks aus reisen. Dort war das Energielevel absichtlich erniedrigt, sodass eine Flucht möglich war.«
»Und das hat niemand bemerkt?« Oliver schien skeptisch. »Ich kann mir gut vorstellen, dass diese ganze Anlage mit Kameras ausgestattet ist.«
»Doch, natürlich«, erwiderte Ben. »Er hat sogar extra Personal aus dem Raum geschickt, damit wir alleine sind. Wir konnten durch das Fenster in der Tür beobachten, wie er verhaftet wurde. Ich denke, wir können davon ausgehen, dass er mittlerweile tot ist. Avalanche wird so einen Verrat mit unerbittlicher Härte bestrafen.«
Murphys ohnehin schon große Augen weiteten sich erneut. Und er schien noch blasser geworden zu sein, wenn das denn überhaupt möglich war. Offensichtlich ging es ihm plötzlich wieder schlechter.
»Alles okay?« Ben beugte sich über ihn und berührte ihn leicht an der Schulter.
»Ich glaube, wir sollten ihm jetzt etwas Ruhe gönnen.« Oliver behielt mal wieder den Überblick. »Es ist viel passiert, aber die Gesundheit von euch allen steht jetzt im Vordergrund. Ruht euch einen Moment aus, lasst euch durchchecken und wir behalten die Lage der Welt so lange im Blick.«
Ben drückte vorsichtig Murphys Schulter. »Halt die Ohren steif, Kleiner.«
»Wir sind gleich alt«, gab Murphy etwas verschnupft zurück.
Bens schiefes Lächeln war voller Zuneigung. »Du weißt, wie ich das meine.«
Vielleicht hatte er sich einfach nur etwas zu schnell gedreht. Vielleicht überwältigte ihn aber auch die Überanstrengung gerade in diesem Moment. Denn nur Sekunden später stöhnte Ben auf und brach kraftlos auf dem Boden zusammen.
Kapitel 3
Oliver trug Ben aus dem Zimmer. Larkin hatte geistesgegenwärtig einen Knopf an der Wand gedrückt, und kaum, dass wir den Raum verließen, kam bereits medizinisches Personal auf uns zugeeilt. Eine Frau mittleren Alters mit einem Stethoskop um den Hals gab ruhig Anweisungen an ihre jüngeren Kollegen. Ich hatte Angst um Ben, doch ihre kühle Autorität und die Kompetenz, die sie ausstrahlte, vermittelten mir sofort das Gefühl, dass sie die Situation im Griff hatte. Das Zimmer nebenan schien bereits für uns vorbereitet gewesen zu sein. Zwei Betten standen an gegenüberliegenden Wänden und daneben reihten sich jede Menge medizinische Gerätschaften auf. Was mich jedoch beunruhigte, war der Defibrillator, den ich in einer Ecke entdeckte. Rechneten sie damit, dass sie uns wiederbeleben mussten?
»Ben.« Ich flüsterte verzweifelt seinen Namen, doch es war so voll um sein Bett, dass ich kaum einen Blick auf ihn erhaschen konnte. Außerdem wollte ich nicht im Weg stehen. Immerhin atmete er noch, doch das war alles, was ich wusste.
Ich wollte mich nach vorne drängen, doch Larkin umfasste meine Taille und hielt mich fest. »Lass die Ärzte ihre Arbeit machen«, raunte er mir zu. »Sie wissen, was sie tun.«
»Ich möchte bei ihm sein.«
Doch Larkin löste seinen Klammergriff keinen Zentimeter. Dafür, dass er seine Zeit hauptsächlich umringt von Büchern verbrachte, war er unglaublich stark. Ich spürte, wie mein Silber auf sein Gold traf, und unsere Elemente automatisch um die Oberhand rangen. Larkin keuchte auf, vermutlich, weil er es noch intensiver spürte als ich.
In diesem Moment trat ein junger Mann direkt vor mich, und auf seinem Kittel entdeckte ich einen eingestickten Schriftzug, der ihn als Doktor auswies. Er war ungefähr in Larkins Alter. »Signorina Pandolfini, bitte.« Der junge Arzt deutete auf das Bett auf der gegenüberliegenden Seite. »Ruhen Sie sich aus. Wir entfernen die Chips und müssen ein paar Tests machen, aber das meiste sind Formalitäten.«
Ich wollte gerade eine weitere Diskussion anfangen, da erklang Bens raue Stimme. »Leg dich in das verdammte Bett, Emilia.«
Ich war so erleichtert, dass er das Bewusstsein wiedererlangt hatte, dass ich mich nicht über seinen rüden Tonfall aufregte.
Auf dem Nachttisch an meinem Bett hatte jemand eine Jogginghose und ein Shirt bereitgelegt. Ich hätte gerne als Allererstes geduscht, doch das hier war wichtiger. Und sollten mich ähnliche Bauchkrämpfe überfallen wie Ben, war es sicherlich keine gute Idee, währenddessen nackt in der Dusche zu stehen.
»Da drüben ist das Badezimmer.« Larkin deutete auf eine schmale Tür.
Wieder nickte ich nur und schnappte mir die Klamotten. Hinter mir hörte ich die Ärzte leise sprechen, doch es klang routiniert, ja regelrecht entspannt. Ich war mir sicher, sollte es Ben schlecht gehen, würde ihr Tonfall anders klingen. Dann hörte ich, wie Ben auf eine Frage antwortete, und auch seine Stimme klang nun klar und fest. Innerlich atmete ich auf, bevor ich die Tür aufstieß und den Lichtschalter betätigte.
Das Badezimmer besaß kein Fenster, war aber mit drei kleinen Lampen erhellt. Wie die gesamte Krankenstation schien es hochmodern und neu. In der ebenerdigen Dusche stand ein Hocker aus Plastik. Haltegriffe befanden sich an den Wänden und zusätzlich rechts und links von der Toilette. All das deutete darauf hin, dass hier regelmäßig schwere Verletzungen kuriert wurden. Ich hatte schon von Ben mitbekommen, dass die Jagd auf die Crux lebensgefährlich war. Er hatte sogar schon von Verlusten berichtet. Aber irgendwie hatte ich das Ganze wieder verdrängt, und erst hier in diesem Badezimmer wurde mir bewusst, wie gefährlich das Leben eines Alchemisten sein konnte. Wie gefährlich die Bedrohung durch die Crux für die gesamte Welt, für Alchemisten und Menschen gleichermaßen, war.
Ich stützte beide Hände auf dem Waschbecken ab und betrachtete mein Spiegelbild. Die staubige, zum Teil zerrissene Kleidung, die ich noch vor wenigen Stunden in Kaleidra getragen hatte. Mein zerzaustes Haar, die Kratzer auf den Armen, der Schmutz in meinem Gesicht. Der Quecksilberorden war zu einer realen Gefahr geworden, und ich wusste nicht, welchen Plan Professor Avalanche verfolgte. Aber er hatte der Welt eindrucksvoll demonstriert, dass er in der Lage war, die Crux zu kontrollieren.
Ich wandte mich von dem Spiegel ab und betrachtete das Bündel aus grauer Kleidung. Wie konnte ich mich jetzt ins Bett legen? Da draußen gab es einen verrückten Professor, der seine eigenen Pläne mit der Welt hatte. Und so ganz nebenbei war noch eine der mächtigsten Alchemistinnen der Geschichte aus ihrem Gefängnis entkommen – und was sie mit unserer Welt plante, lag noch völlig im Dunkeln.
Ich seufzte leise und drehte mich wieder meinem Spiegelbild zu. Sicherlich hatten Meister Emmett und die anderen Orden längst eine Strategie entwickelt, wie wir weiter vorgehen würden. Dort gab es klügere Strategen, bessere Kämpfer und erfahrenere Diplomaten als mich. Ein paar Stunden Ruhe konnte ich mir sicherlich gönnen, aber dennoch ...
Mein Spiegelbild begann sich zu bewegen, als sei die Oberfläche des Glases plötzlich flüssig geworden. Wellen breiteten sich kreisförmig von einem Punkt aus, als habe jemand einen Stein hineingeworfen. Die Konturen meines Abbildes verschwammen wie in einer Aquarellzeichnung. Unwillkürlich krallte ich meine Finger um den Rand der Armatur des Waschbeckens. Das Metall fühlte sich glatt und kühl an. Ein Frösteln jagte meine Wirbelsäule hinab. Das ist mein Anker in der Wirklichkeit, dachte ich und versuchte, den Blick abzuwenden. Doch es funktionierte nicht. »Bleib hier«, flüsterte ich mir selber zu. »Es ist wieder nur eine dieser verrückten Erinnerungen.«
Doch dann schlugen die Wellen im Spiegel höher, formten eine Art Trichter, und als er hervorschoss und mich komplett einhüllte, konnte ich nicht mal mehr schreien.
Ich bewegte mich, oder nein, schaukelte es um mich herum? Mein Blick war leicht verschwommen, unklar, als würde ich durch eine Art Schleier sehen. Dann war es auf einmal unerträglich laut. Flugzeuge jagten tief über das Firmament, Gewehrsalven ratterten in der Ferne. Ich sah auf meine blutigen Hände, dann hinauf in einen milchig gewordenen Spiegel. Blondes Haar, erschöpfte Augen, ein fremdes Gesicht unter der altmodischen Haube einer Krankenschwester. Ich drehte mich um, weg von der Wand und dem medizinischen Gerät, das vor mir lag. Auf einer Liege lag ein junger Mann in einer Pilotenuniform aus dem Zweiten Weltkrieg. Er schrie auf vor Schmerz, und ich spürte meine eigene Verzweiflung, die Wut über das sinnlose Töten und ...
Wieder wechselte das Bild. Ich trug einen weiten Rock mit ausgefranstem Saum, und die Sohlen meiner Schuhe waren dünn und kalt. In meinen Händen hielt ich ein silbernes Tablett, auf dem ein gebratener Fasan angerichtet war. In einer Reflektion am Rand konnte ich mein Spiegelbild schemenhaft erkennen. Kaum älter als fünfzehn Jahre, eine kleine Nase, eine Narbe auf der Stirn. Ein fremdes Gesicht, und doch wusste ich wieder, dass ich es war. »Lorenzo Medici!«, rief ein Mann, der an dem Tisch saß, den ich nun erreichte. »Die Feiern in deinem Hause sind immer ein Fest für alle Sinne!« Ich stellte die Platte am Rande des Tisches ab und drehte mich mit gesenktem Blick um, und ... Von irgendwoher drang eine Stimme zu mir, doch sie klang dumpf. Um mich herum war es schemenhaft dunkel.
»Mein wunderschönes kleines Mädchen.« Ich kannte die Stimme.
»Du bist mein Augenstern. Du bist mein Ein und Alles.«
Ich wollte mich bewegen, wollte mich umsehen, doch ich lag auf etwas Weichem, das mich gleichzeitig sicher umschloss.
Jemand beugte sich über mich, doch das Gesicht lag im Dunkeln verborgen. Ein tiefes Gefühl von Zuneigung durchflutete mich. Ich hob eine Hand, und sie war ... winzig. Die Faust eines Kleinkindes.
Dann hörte ich die Stimmen. Die anderen Stimmen. Schreie, wütendes Gebrüll und ein hohes Kreischen. Das Gesicht über mir verschwand. Noch mehr Geschrei, ein Poltern, als etwas umfiel, ein scharfer Luftzug, als die Gestalten im Raum sich bewegten. Die Stimme, die ich kannte, schrie auf vor Panik und Wut.
»Ihr könnt sie mir nicht nehmen. Ihr werdet sie mir niemals nehmen können!« Die mir so vertraute Stimme war jetzt ganz nah. »Du gehörst mir. Du wirst immer mir gehören. Wir gehören zusammen.«
Aber ich war so unglaublich müde ...
»Nein ...« Jetzt war sie ganz nah. Sie berührte mich, nur ganz leicht. Und dann nahm sie etwas mit von mir. Den Teil von mir, der sie niemals vergessen würde. Den Teil, auf den es ankam.
Wieder durchströmte mich das Gefühl von Zuneigung, dann verblassten die Geräusche, die Schreie verstummten, und ich glitt in einen tiefen Schlaf.
*
Mein Kiefer schmerzte, und mein Mund war staubtrocken. Ich sah in die dunkelbraunen Augen der Ärztin, die sich ein gutes Stück zu mir hinabgebeugt hatte. Ihr Stethoskop berührte fast meinen Brustkorb.
»Hallo Emilia.« Sie hatte eine angenehme Stimme, das war mir vorhin schon aufgefallen. »Mein Name ist Thereza, und ich bin die leitende Oberärztin dieser Loge. Sie befinden sich in Ihrem Bett im Krankenflügel, nachdem Sie ohnmächtig zusammengebrochen sind. Wie fühlen Sie sich?«
Ich befeuchtete meine Lippen und bewegte prüfend meinen Kiefer. Es fühlte sich an, als hätte mir jemand mitten ins Gesicht geschlagen. Ich wollte etwas erwidern, doch mein Mund war zu trocken zum Sprechen.
Die Ärztin drehte nur kurz den Kopf, doch offenbar war ihr Team in der Lage, ihre wortlosen Aufforderungen zu verstehen. Der junge Arzt von vorhin beugte sich von der anderen Seite des Bettes über mich, richtete mich mühelos ein wenig auf und hielt mir mit der freien Hand ein Glas Wasser an die Lippen. Ich nahm zwei, drei tiefe Schlucke, und sofort schienen alle meine Sinne zurückzukehren. Ich nickte ihm zu, damit der Arzt wusste, dass ich genug getrunken hatte, und sofort ließ er mich zurück in die Kissen sinken.
»Danke«, flüsterte ich. Dann fiel mein Blick auf Larkin, der am Fußende stand. Er hatte sich mit beiden Händen auf dem metallenen Rand des Bettes abgestützt, und seine angespannte Miene verriet mir, dass ich vermutlich nicht auf eigenen Beinen in dieses Bett gelangt war.
»Erinnern Sie sich, was passiert ist?«, wollte Thereza jetzt wissen.
»Ich glaube, ich bin gestorben.« Meine Stimme klang, als hätte ich mehrere Stunden lang am Stück geschrien.
Thereza hatte von irgendwoher eine kleine Taschenlampe gezaubert und leuchtete mir nacheinander in beide Augen.
Ich blinzelte.
»Nicht ganz. Sie sind ohnmächtig geworden.« Sie deutete mit dem Kopf nach hinten. »Drüben im Badezimmer.«
Richtig. Das Badezimmer. Ich erinnerte mich plötzlich wieder deutlich an den Spiegel und an das, was danach geschehen war. Und auch wenn ich hier vielleicht ohnmächtig geworden war, so war ich mir doch relativ sicher, dass das, was ich gesehen hatte, das, was ich in meinem letzten Flashback miterlebt hatte, eine weitaus dramatischere Situation gewesen war.
Ich sah zurück in Therezas dunkelbraune Augen. Konnte ich ihr davon erzählen? Wollte ich ihr davon erzählen?
Mein Blick glitt weiter zu Larkin. Mit ihm würde ich darüber reden. Das alles musste eine Bedeutung haben, das alles konnte wichtig sein. Und ich vertraute Larkin.
»Ruhen Sie sich aus.« Thereza nickte mir aufmunternd zu. »Alles andere hat Zeit. Wir haben Ihren Chip bereits entfernt. Jetzt warten wir noch auf das Ergebnis der Blutuntersuchung, aber ansonsten scheinen Sie in bester körperlicher Verfassung. Es kann sein, dass Kaleidra sich auf das Erinnerungsvermögen auswirkt. Die Konzentration der Elemente dort ist sehr hoch. Es besteht die Möglichkeit, dass sie in Ihrem Kopf herumpfuschen. Das sollte aber vermutlich in zwei bis drei Tagen verschwunden sein, wenn Sie die Vergiftung, die Ihr Körper in Kaleidra erlebt hat, losgeworden ist. Sie waren fast bis zum errechneten Zeitlimit dort. Das heißt, Sie haben die maximale Dosis an giftigen Elementen in sich aufgenommen. Vergiftungserscheinungen können auch Halluzinationen beinhalten. In einigen Stunden wissen wir mehr.« Sie nickte mir noch mal höflich zu und neigte dann auch den Kopf in Larkins Richtung. »Die nächste Visite steht in vier Stunden an. Sollte die Blutuntersuchung Auffälligkeiten ergeben, leite ich das sofort weiter.«
»Danke, Thereza«, sagte Larkin, während er das Bett umrundete.
Wann bitte hatten sie mir Blut abgenommen? Davon hatte ich gar nichts mitbekommen. Ich schielte auf meine Arme. Und richtig: In der linken Armbeuge klebte ein kleines Pflaster und eins weiter oben, wo sie mir den Chip entfernt hatten.
Die Ärzte verschwanden, während Larkin seitlich auf meinem Bett Platz nahm. Doch mein Blick glitt wie automatisch sofort zu Ben. Ich sah den dunklen Haarschopf und nur einen Teil seiner Stirn. Er hatte die Decke bis hoch zur Nase gezogen und schien zu schlafen. Ein EKG-Monitor piepte in regelmäßigem Takt, während gleichzeitig die typische Herzstromkurve abgebildet wurde.
»Ihm geht es gut.« Larkin war meinem Blick gefolgt. »Aber was ist mit dir passiert, Emilia? Du hast geschrien, als hättest du fürchterliche Schmerzen.«
Daran erinnerte ich mich nicht. »Was?«
»Du bist im Badezimmer zusammengebrochen. Wir haben dich schreien gehört und sind dann sofort rein. Du hast hyperventiliert und die Augen verdreht.« Larkin verknotete die Hände ineinander. »Es sah sehr ...« Er brach ab. »Es sah sehr ernst aus.« Er schluckte und sah dann zurück in mein Gesicht. »Es wirkte, als wärst du zwar hier, aber irgendwie auch nicht. Als wärst du gefangen in einem Albtraum und ...« Er brach ab und straffte dann die Schultern. »Entschuldige, ich sollte dir keine Angst machen. Es geht dir gut, und Thereza ist wirklich eine sehr fähige Ärztin. Sie wird ...«
»Alles gut«, sagte ich schnell. »Ich will wissen, was passiert ist. Ab einem gewissen Punkt war einfach alles schwarz.«
»Ab einem gewissen Punkt?«
Ich sah zurück in sein Gesicht. Ich wusste, dass er vertrauenswürdig war. Wir hatten von Anfang an eine besondere Verbindung gehabt. Ich hatte Ben, Murphy und ihm schon von den Flashbacks, die in Kaleidra begonnen hatten, erzählt. Von den Erinnerungen, die wie aus einer anderen Zeit zu stammen schienen. Mal aus dem Mittelalter, mal aus einer Zeit, die noch weit davor lag.
»Zuletzt war ich noch ein Baby«, sagte ich leise. »Ich habe meine eigene kleine Faust gesehen. Wie kann das sein?«
Larkin schüttelte ganz leicht den Kopf, er wirkte ungläubig. »Und du bist gestorben? In diesem Moment?«
Ich nickte, obwohl mir erneut dieser kühle Schauer die Wirbelsäule hinab jagte. Das alles war so beängstigend.
»Ja. Ishtar war da, und sie hat etwas von mir ... mitgenommen.« Das klang so verrückt. »Bevor ich mein Bewusstsein verloren habe, spürte ich, wie sie diesen Teil von mir, der unsere Verbindung definiert, aus mir ... entfernt hat? Ich habe es ganz deutlich gespürt. Meinst du, das war mein Twin?«
Larkin holte tief Luft und atmete dann zischend wieder aus. »Okay, ich werde definitiv heute eine Nachtschicht einlegen müssen.« Sein Blick glitt zum Fenster, wo die Sonne noch hoch am Himmel stand. »Ishtar hatte Kinder, das ist bekannt. Zwei oder drei Söhne und eine Tochter. Sie war ihr jüngstes Kind. Es ist praktisch kaum vorstellbar, den bereits existierenden Twin aus dem Geist eines Alchemisten zu entfernen. Bisher wurde diese Möglichkeit für eine Legende gehalten. Wir dachten immer, die Geschichtsschreibung habe übertrieben, als es hieß, dass die Ur-Alchemisten Ishtars Twin getrennt von ihr aufbewahrt haben, um ihre Flucht zu verhindern. Schließlich befand sie sich bereits in einem Bannkreis. Aber wenn das tatsächlich möglich ist, dann kann es sein, dass sie das Gleiche bei ihrer Tochter gemacht hat. Wenn ich mich beeile, bekomme ich heute vielleicht noch ein paar Nachschlagewerke aus der Bibliothek in Oxford. Aber wenn der Kurier erst mal in den Nachmittagsverkehr gerät, na dann gute Nacht.«
Seine Worte klangen so harmlos und normal, so sehr nach Larkin, dass ich unwillkürlich lächelte. Doch dann erwachte ein anderer Gedanke in meinem Kopf.
»Wenn ich mit Ishtar tatsächlich verwandt bin, geht dann von mir auch eine Gefahr aus? Und wie ist das überhaupt möglich?«
Larkin zuckte mit den Schultern. »Das kann ich dir nicht sagen. Es gibt unterschiedliche Überlieferungen, was die ersten drei Alchemisten angeht. Ihre Namen waren ...«
»Ishtar, Trismegistos und Enmerkar.« Ich hatte gesprochen, ohne darüber nachzudenken.
Larkins Augen weiteten sich, und er sah mich an wie das achte Weltwunder.
»Ishtar machte die beiden verantwortlich für den Anschlag auf ihre Familie«, fuhr ich fort. »So wie es aussieht, haben die beiden anderen Ur-Alchemisten etwas mit deren Tod zu tun.«
Larkin nickte. »Hier sind die Quellen sich einig. Es war Vergeltung und Mord in einem. Ishtar hatte sich sehr verändert, und ihre Gier nach Macht war zu groß geworden. Sie hat eine Menge Leid verursacht, Kriege angefangen und viele Menschen auf dem Gewissen. Enmerkar und Trismegistos sahen irgendwann keine andere Möglichkeit mehr, um sie zu stoppen. Wir wissen, dass sie sie innerhalb von Kaleidra gebannt haben. Damals muss es ein noch wesentlich schrecklicherer Ort gewesen sein. Sie wollten sie zu ewigem Leiden verbannen.« Erst jetzt schien er sich wieder an etwas zu erinnern.
»Es gibt da diese andere Aufzeichnung.« Larkin schien mit seinen Gedanken abzuschweifen. »Warum ist es mir in Kaleidra nicht sofort eingefallen?« Jetzt schien er wieder ganz der Bibliothekar, der er war. Er rutschte vom Bett und stand auf. »Ist es okay, wenn ich Meister Emmett darüber in Kenntnis setze?«
»Na klar«, sagte ich schnell. »Du kannst ihm alles erzählen, was in Kaleidra passiert ist, wenn du möchtest. Vielleicht hilft es ja auch bei der Suche nach Ishtar.«
Larkin gab ein Brummen von sich. »Sie verhält sich ruhig, also ist sie jetzt erst mal nur das zweitrangige Problem.« Es war offensichtlich, dass er an die Angriffe der Crux in den drei Großstädten dachte.
»Wann kann ich wieder aufstehen?« Ich brannte darauf, den anderen zu helfen, sie bei ihrem Kampf gegen die Quecksilberalchemisten zu unterstützen. Außerdem wollte ich jederzeit bereit sein, wenn es darum ging, meine Familie und Freunde vor jeder Gefahr zu beschützen.
Es war immer noch abstrus, sich einen Klon von mir an der Seite meiner Mutter vorzustellen, aber im Moment konnte ich daran nichts ändern.
Larkin warf einen Blick in Richtung Ben. »Ihr habt euch etwas Ruhe verdient. Wir sind gut darin, Katastrophen abzuwenden. Ich halte dich auf dem Laufenden. Und bitte ...« Er schwang wieder herum und sah mich eindringlich an. »Bleib liegen. Wenn dich der nächste Flashback überfällt, ist vielleicht niemand im Zimmer, und wenn du dann wieder im Badezimmer herumstehst, kann das böse enden. Der Boden ist ziemlich hart.«
Ich nickte.
Larkin salutierte gespielt. »Wir sehen uns später.«
Kaum, dass er aus dem Zimmer war, ließ ich mich zurück in die Kissen sinken und schloss für einen Moment die Augen. Ich hatte echt Glück gehabt, dass ich mich bei meinem Sturz im Badezimmer nicht ernstlich verletzt hatte. Wieso überfielen mich immer wieder diese Flashbacks? Wer pfuschte da in meinem Verstand herum? Ich schnaubte und schloss kurz die Augen. Der Gedanke, dass ich mit einer der gefährlichsten Alchemistinnen der Erde verwandt war, ließ mich schaudern. Konnte das wirklich wahr sein? Ein uralter Twin? Erinnerungen an unzählige Leben?
Ich richtete mich hastig auf, als ein anderer Gedanke sich plötzlich in den Vordergrund drängte. Manipulierte sie uns vielleicht immer noch? Gehörte all das zu einem Plan von Ishtar, den wir bis jetzt nicht durchschaut hatten?
*
Ben gab leise Worte im Schlaf von sich und riss mich so aus meinen Gedanken. Ständig verwirrt zu sein schien zu einem Dauerzustand bei mir zu werden. Ständig kamen neue Fragen auf, ständig schien ich von Rätseln umgeben. Wie sollte ich all das in einen logischen Zusammenhang bringen? Wieso schien jeder hier ein Geheimnis zu haben?
Ben stöhnte auf, und ich streckte mich, um ihn besser sehen zu können. »Ben? Alles in Ordnung?«
Das Piepen des EKGs beschleunigte sich. Noch mal murmelte er unverständliche Worte. Ob er in einem Albtraum gefangen war? Sofort schlug ich die Decke beiseite und schwang die Beine über die Bettkante. Es hätte nicht viel gefehlt, und ich wäre direkt auf dem Linoleumboden gelandet. Mit einem Ächzen fiel ich zurück auf die Matratze, schaffte es aber soeben noch, meine Balance zu finden und sitzen zu bleiben. Ich hatte mir offenbar im Fallen vorhin das Knie angeschlagen, denn jetzt brannte meine rechte Kniescheibe wie Feuer. Egal. Langsam rutschte ich zum Rand der Matratze. Ich würde es noch mal versuchen.
»Bin gleich da«, rief ich zu Ben herüber. Dieser murmelte wieder etwas, doch jetzt klang es alarmiert, als würde er sich im Traum einer großen Gefahr stellen.